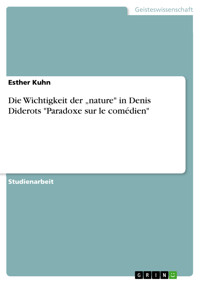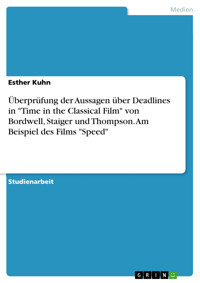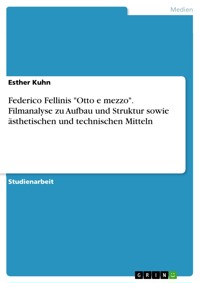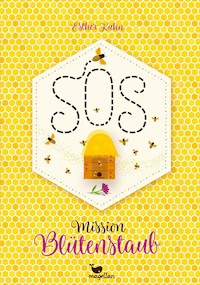11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Magic Kleinanzeigen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Magic Kleinanzeigen? Wo ist Tobi denn da hineingeraten? In der Theorie klingt das alles super: Alte Spielsachen in das Anzeigenportal hochladen, verkaufen und dann im Gegenzug echt magische Hilfsmittel einkaufen. Zaubercremes, unsichtbar machende Hüte und magische Schreibfedern würden einige von Tobis Problemen in Luft auflösen. Doch leider hat das Ganze einen Haken: Die Zaubergegenstände sind gebraucht und haben manchmal einen eigenen Willen. Schnell steckt Tobi mittendrin im Abenteuer …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Ähnliche
Magic Kleinanzeigen
Band 1: Gebrauchte Zauber sind gefährlichBand 2: Im Zauberspiegel
Für Leander
ESTHER KUHN
Inhalt
DER ANFANG VOM ENDE
MIT EINEM FUß AM ABGRUND
EIN KOFFERRAUM VOLLER KUSCHELTIERE
SELTSAME EREIGNISSE
EIN UNGEBETENER GAST
VIER TAGE BIS ZUM UNTERGANG
DIE CHAOS-CREW
DER JACKPOT
DIE PLÜSCHTIER-MAFIA
DAS TREFFEN IM GEHEIMVERSTECK
DIE PIRATEN
DER UNTERGANG
DAS IST DER HAMMER!
ZU VIEL GLAMMER
EISKALTES VERGNÜGEN
ZOOLOGIE
DER LIEBESTRUNK
JAKOB
DER BLATTLÄUSEPLAN
LEVEL ALPHA
DER FLUCH DES FÜNFTEN MANNES
STATUSVAKUUM
DER PLAN
DAS PIRATENNEST
GEFANGEN
DIE UHR TICKT
MITTERNACHTSTREFF IM MONDSCHEIN
FLÜSSIGE WAHRHEIT
DER NEUANFANG
DER ANFANG VOM ENDE
»Wir könnten ihn einfach explodieren lassen.«
Was?
Was sagt sie da?
Mich explodieren lassen?
Ich schreie.
Aber es kommt nur ein dumpfes »Nmpf« aus meiner Kehle, denn der Knebel in meinem Mund sitzt so fest, dass ich nicht mal richtig schlucken kann.
»Das entscheidet der Boss«, krächzt ein Junge hinter mir wie eine Krähe. Stimmbruch. Es klingt lustig. Ich würde gerne lachen, wenn ich nur könnte. Dann spüre ich Finger, die an meiner Augenbinde zupfen, um zu prüfen, ob sie auch gut sitzt. »Passt. Er sieht nix mehr und kann nicht weg. Es gibt keinen Grund auszuflippen.«
Ich kann nicht viel tun, um meine Zustimmung zu signalisieren. Also nicke ich verzweifelt, um zu bestätigen, dass ich völlig harmlos bin. Wenn ich doch nur das Tuch in meinem Mund einfach ausspucken könnte. Ich würde alles erzählen. Natürlich nicht die Wahrheit. Irgendeine gute Ausrede müsste mir noch einfallen.
»Wie wäre es, wenn wir ihn einfach in den Fluss werfen, und fertig«, schlägt die Verrückte vor.
Es dauert eine Sekunde, bis ich verstehe, was sie da sagt.
Das kann sie doch nicht ernst meinen? Erst explodieren lassen und jetzt ertränken? Meine Unterarme beginnen zu jucken, ich möchte sie kratzen, aber es geht nicht, denn ich bin mit beiden Armen an den wackligen Stuhl gefesselt, auf dem ich sitze.
»Meinst du, ihn umbringen?« Die Krähe ist genauso entsetzt wie ich.
»Nein. Du hast recht«, lenkt die Verrückte ein. »Eine Explosion fürs Gehirn. Das reicht auch.«
Sie meint es ernst, aber die Krähe lacht nur laut: »Du Angeberin, hast du das denn schon mal gemacht? Dabei kann man selbst draufgehen. Ich hab von einem gehört, der es versucht hat, und bang – war’s vorbei.«
»Ja, so ein Idiot. Ich kenn den. Angeblich kann er sich an nix mehr erinnern. Alles Banane im Schädel. Das wär die Endkatastrophe.«
»Also warten wir, bis der Boss kommt«, wiederholt die Krähe.
Warten, bis der Boss kommt? Gute Idee. Das bringt mir immerhin Zeit. Also nicke ich wieder.
»Okay«, erwidert die Verrückte: »Ich hol schon mal das Wahrheitsserum. Dann kann das Vögelchen erst noch singen, bevor wir es in die Luft jagen.«
In meinem Kopf scheint jetzt schon alles zu explodieren. Wo bin ich da nur reingeraten?
Plötzlich muss ich daran denken, wie alles angefangen hat, und ich frage mich, ob ich mich noch einmal dafür entscheiden würde. Also mit dem Wissen von jetzt.
Denn eins ist klar. Wenn der Boss kommt, dann endet mein Abenteuer auf die schrecklichste Weise, die man sich vorstellen kann. Sie werden mir das Wahrheitsserum verabreichen. Ich werde plappern wie ein Papagei. Und dann: BUMM. AUS. VORBEI.
Dabei hat alles ganz harmlos angefangen. Vor vier Wochen. Mit einem Kofferraum voller Kuscheltiere.
MIT EINEM FUß AM ABGRUND
Ich erinnere mich genau an den Urknall meines Abenteuers, an den einen Moment, ohne den diese Geschichte niemals passiert wäre. Es war der Tag, an dem ich die schlechteste Note ever in einem Biotest bekommen hatte. Ergebnis: einer von zwanzig Punkten. Thema? Was war es noch mal? Ach ja. Amphibien! Also, Frösche und Lurche und so. Den einen Punkt hatte ich gnädigerweise für meine Antwort auf die Frage nach den natürlichen Fressfeinden von Fröschen bekommen: »Franzosen«.
Auf jeden Fall waren überall auf meinem Test lilafarbene Anmerkungen und Striche gewesen. Herr Weber, den alle nur den Weberknecht nennen, findet nämlich für seine Korrekturen ein freundliches Lila netter als ein böses Rot. Vielleicht sollte ihm mal jemand sagen, dass diese Farbe ebenfalls in den Augen wehtut und es keinen Unterscheid macht, wenn man sich so oder so wie ein Totalversager fühlt.
Klar, ihr denkt jetzt: Was soll’s. Ist doch halb so wild. Man kann ja auch mal eine schlechte Note in Biologie haben.
An sich ja. Aber nicht, wenn man auf eine Schule wie meine geht. Bevor ich vor zwei Jahren in die fünfte Klasse eingeschult wurde, dachte ich ernsthaft, dass es im Karl-Koch-Gymnasium bestimmt leckeres Essen in der Cafeteria gibt. Ich wusste nicht, dass Karl gar kein Koch war, sondern ein Wissenschaftler. Spezialgebiete: Medizin und Botanik. Woher sollte ich ihn auch kennen? Der Typ ist seit über hundert Jahren tot.
Auf meiner Schule wird er aber immer noch sehr verehrt. Überall in den Fluren hängen alte Fotos von ihm. Es gibt Förderpreise mit seinem Namen, und in der Weihnachtsgala tritt er sogar höchstpersönlich auf, gespielt von unserer Direktorin, Frau Eisenbeis. Unter uns: Selbst das Mittagessen ist ihm gewidmet. Es besteht zu einem Großteil aus Pflanzen und schmeckt meistens nach Medizin.
»Das war nur ein Test«, sagte der Weberknecht an diesem denkwürdigen Montag. »Der sollte euch zeigen, wo ihr zurzeit steht.«
Mit einem Fuß am Abgrund, dachte ich aufgebracht.
»Ich möchte, dass ihr den Test unterschrieben wieder mitbringt«, fuhr er fort.
Never. Den Test konnte ich unmöglich zu Hause vorzeigen. Meine Eltern sind nämlich beide megastolz darauf, dass ich ihre Schule besuche. Die, auf der sie beide vor zwanzig Jahren ihr Spitzen-Abitur in Bio und Mathe gemacht haben. Dummerweise denken sie, dass bei zwei naturwissenschaftlich begabten Menschen automatisch auch ein naturwissenschaftlich begabtes Kind herauskommen muss. Aber ich bin der lebende Beweis, dass das nicht so ist.
»Und nächste Woche am Mittwoch steht dann noch der große Eignungstest auf dem Programm. Das Ergebnis entscheidet darüber, wer sich von euch für den naturwissenschaftlichen Zweig ab Klassenstufe sieben qualifizieren wird.«
Der Eignungstest?
Au Backe.
Meine Unterarme begannen zu jucken, wie immer, wenn es stressig wurde. Aber ich versuchte, mich zu beruhigen. Nächste Woche, hatte er gesagt. Das waren dann ja mit heute noch neun Tage zum Lernen. Easy! Da würde ich die Sache mit den Lurchen und Molchen schon irgendwie ins Gehirn bekommen.
Mit einem Räuspern versuchte der Weberknecht, gegen die aufbrandende Unruhe anzukommen: »Und denkt daran, ich werde euch einmal querbeet durch den Stoff des ganzen Jahres abfragen.«
Der Stoff des ganzen Jahres? Ich war am Arsch. Hatte der sie noch alle?
Es klingelte zur letzten kleinen Pause. Ich sah mich Hilfe suchend um und entdeckte viele zufriedene Gesichter. Eine Reihe vor mir erhaschte ich sogar einen deprimierenden Blick auf Filines Test. Lupenrein, ganz ohne Lila! Aber das war zu erwarten gewesen. Der Großteil in meiner Klasse war gut in Biologie, Filine jedoch war unsere Miss Brain. Ansonsten lief im Oberstübchen auch nicht alles korrekt, weshalb sie hinter ihrem Rücken auch die verrückte Filine genannt wurde. Seit Kurzem kam sie mit schrill bunten, meist gestreiften Wollmützen und Schals in die Schule. Hallo? Im Juni bei fünfundzwanzig Grad!
Aber ich hatte mir vorgenommen, mich nicht mit so einer zu messen. Anderes Level! Nein, anderes Universum! Also schubste ich meinen besten Freund und Banknachbarn Leon an. Dank ihm war ich nicht der Einzige, bei dem sich seine Eltern geirrt hatten. Für Leon wäre ein Picasso-Gymnasium das richtige gewesen, denn er konnte richtig gut malen und zeichnen. Trotzdem versuchte auch er verzweifelt, in die viel zu großen Fußstapfen von Karl Koch zu treten.
»Was?«, fragte Leon ein bisschen genervt.
»Alles lila. Und bei dir?«
Er zögerte. Wahrscheinlich schämte er sich genauso wie ich.
Widerwillig schob er mir seinen Test rüber.
Ich konnte erst gar nicht reagieren, so geschockt war ich.
Achtzehn von zwanzig Punkten? WAS?
»Wer bist du?«, fragte ich voller Misstrauen. »Und was hast du mit Leon gemacht?«
»Red keinen Quatsch.«
Warum war er nur so genervt, bei dem Ergebnis?
»Beweise mir, dass du es wirklich bist!«, stichelte ich und forderte ihn zu einem Wörterkettenduell heraus. Es war unser Lieblings-Pausenfüller-Spiel. Jeder musste mit einem Wort antworten, das ihm zu dem davor genannten Wort als Erstes in den Kopf kam. Ich fing an: »Blut.«
»Tot.«
»Grab.«
»Zombie.«
»Axt.«
»Aua.«
Na gut. Er war es doch. Eindeutig. Dieses Spiel endete bei Leon nämlich immer irgendwann mit einem »Aua«.
»Mensch, ToHo! Du solltest vielleicht auch mal über Nachhilfe nachdenken.«
ToHo. Das war ein weiterer Beweis. Denn nur Leon nannte mich so. Schon am ersten Schultag hatte er mir diesen Spitznamen verpasst: das To von Tobias und das Ho von meinem Nachnamen. Hoppe.
»Seit wann hast du Nachhilfe?«, fragte ich erstaunt. Kein Wort hatte er je darüber verloren.
»Seit drei Wochen oder so.«
»Wieso hast du mir nix davon erzählt?«
»Meine Eltern wollen nicht, dass es jemand weiß. Ist ihnen wohl peinlich, dass ich es nicht einfach so in den Nawi-Zweig schaffe. Also kein Wort zu niemandem.«
Ich musste sofort an meine Eltern denken. An das enttäuschte Gesicht von Frau Professorin Hoppe, Biologin an der Uni, und an das traurige Gesicht von Dr. Hoppe, seit Kurzem Abteilungsleiter bei der Linneberger Bank.
Automatisch kamen mir die »Taxioten« in den Sinn. So hießen hier die zehn Prozent, die den Sprachenzweig belegten: Idioten, die niemals wirklich Karriere machen, sondern als Taxifahrer enden würden. Ich kratzte mich heftig an der Innenseite meines linken Unterarms. Es fühlte sich an wie tausend kleine Insektenstiche.
Als hätte Leon meine Gedanken gelesen, sagte er: »Oder willst du so enden wie der unheimliche Schatten?«
Mike oder der unheimliche Schatten, wie er von vielen hinter vorgehaltener Hand genannt wurde, war ein ganz normaler Junge gewesen, bis er es im letzten Jahr nicht in den Nawi-Zweig geschafft hatte. Dann waren ihm irgendwie über den Sommer die Sicherungen durchgebrannt. Als er nach den Ferien zurückkam, trug er nur noch schwarze Klamotten, sprach mit niemandem mehr und schlich immer alleine wie ein Serienmörder über den Schulhof. Aber ich verstand ihn. Seine Mutter war Direx Eisenbeis. Zu Hause war bestimmt der Teufel los. Er tat mir leid. Nein. So wie Mike wollte ich nicht enden. Auf keinen Fall!
EIN KOFFERRAUM VOLLER KUSCHELTIERE
Nach der Schule schlappte ich gemütlich mit Leon über den Schulhof, als ich meine Mutter vor dem Schultor stehen sah. Was wollte die denn hier? Ich war ja keine sieben mehr und konnte sehr gut alleine mit der Straßenbahn nach Hause fahren.
Seitdem wir im Ostviertel wohnten, war mein Nachhauseweg so einfach, dass ich den auch schon im Kindergarten alleine hinbekommen hätte. Es gab also keinen Grund für sie, mich abzuholen. Wie peinlich, vor allem, weil sie auch noch mitten im Halteverbot geparkt hatte.
»Hey, Leon. Meine Mum ist da. Willst du mitfahren?«, fragte ich meinen Kumpel, denn in diesem Moment sah ich den Weberknecht aus dem Nebengebäude kommen und hörte innerlich seine Stimme: »Bitte den Test unterschrieben wieder abgeben.« Ich musste mir dringend eine Strategie überlegen, wie ich an die Unterschrift meiner Mutter kommen konnte, ohne ihr den Test zu zeigen. Ein Mitfahrer war eine gute Taktik. Zumindest solange Leon im Auto war, würde sie mir keine bohrenden Fragen über die Schule stellen, und ich hatte ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken.
»Sorry. Hanna nimmt mich mit«, sagte Leon, und da entdeckte ich auch schon seine große Schwester, die gerade auf den Schulhof gefahren kam, um Leon einzusammeln. Mit ihrem silbernen Helm über den kurzen rosa Haaren und auf dem pinkfarbenen Roller sah sie aus wie ein Knallbonbon.
»Wie wäre es mit Daddeln? Du könntest später vorbeikommen«, fragte ich noch schnell, als Leon hastig hinten aufstieg.
»Hey, Kleiner«, grüßte mich Hanna ganz cool, als würde sie den Weberknecht, der mit mürrischer Miene auf sie zustürmte, gar nicht bemerken. Sie ging schon in die elfte Klasse und wusste genau, dass das Fahren auf dem Schulhof streng verboten war.
»Was ist jetzt? Kommst du vorbei?«, fragte ich noch mal.
»Sorry. Vielleicht am Wochenende. Die Woche ist schon wieder ganz vollgepackt. Du weißt ja. Fußball, Malschule, Schwimmen und Nachhilfe eben.«
Dann zog er sich schnell den zweiten Helm über und die beiden knatterten vom Hof.
Als der Weberknecht das sah, wechselte er noch im Gehen die Richtung und hielt nun mit wedelnden Armen und wehenden Fusselhaaren Kurs auf meine Mutter. Er war ein großer, schlaksiger Mann und erinnerte jetzt wirklich an das Spinnentier mit den langen, dünnen Beinen. Hoffentlich ging es ihm nur um die Parksünde und nicht um meine schulischen Leistungen.
Jetzt mal ehrlich!
Lurche und Molche.
Ich hatte ja versucht, mir die Details zu merken. Einen Abend vor dem Test hatte ich mir alles einmal genau durchgelesen. Ich schwöre es. Aber die Infos waren irgendwie über Nacht von meiner Gehirnfestplatte gelöscht worden. Keine Ahnung, warum!
In Panik rannte ich los, um das Schlimmste zu verhindern. Aber sie redeten bereits miteinander. Ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten. Ich versuchte abzulesen, worum es ging. Doch das war unmöglich.
»Wie gesagt«, hörte ich den Weberknecht murren, als ich die beiden erreichte. »Das ist eine Feuerwehreinfahrt. Hier muss immer frei bleiben.«
»Natürlich. Das verstehe ich«, antwortete meine Mutter. »Ich bin auch sofort wieder weg.« Sie lächelte ihr schönstes Strahlelächeln. Herr Weber wünschte ihr »Einen schönen Tag«, kehrte auf dem Absatz um und stolzierte davon.
»Bis dann«, rief meine Mutter ihm hinterher, als wären sie die besten Kumpels.
Ob er etwas gesagt hatte? In den Sekunden vor meiner Ankunft? Ich forschte in ihrem Blick, aber sie sah nicht verärgert aus. Zum Glück.
Dann entdeckte ich die nächste Katastrophe.
Der ganze Wagen war voll mit Kartons und Säcken. Nur Fahrer- und Beifahrersitz waren noch frei. Da hätte Leon sowieso nicht mehr mit reingepasst.
»Ja, du wunderst dich sicher, dass ich hier bin«, begrüßte mich meine Mutter. »Also, ich dachte, ich hol dich heute ab und wir bringen gemeinsam die ganzen alten Sachen weg.«
Vor einer Woche waren wir ins Ostviertel gezogen. Erst zwei Tage bevor die Umzugsfirma gekommen war, um alles abzuholen, hatten wir unsere Sachen einfach Hals über Kopf in unzählige Kisten gepackt. Es war ein einziges Chaos gewesen.
»Ich hab mir heute extra freigenommen und ein bisschen was aussortiert.« Sie lächelte verlegen. »Sag nichts. Ich weiß, es wäre schlauer gewesen, das vor dem Umzug zu machen.«
Ich ahnte Böses. »Und was ist das alles?«
»Klamotten von mir und auch alter Krempel von dir, der jetzt echt mal wegkann.«
Das klang nicht gut, gar nicht gut.
»Was für alter Krempel?«, fragte ich daher misstrauisch.
»Na ja. Ich dachte, wir könnten andere damit glücklich machen. Deshalb wollte ich alles zum Kinderschutzbund bringen. Die verschenken das dann an Kinder, die nicht viel haben und sich sicher über den ein oder anderen neuen Kuschelfreund freuen würden.«
»Wovon redest du, Mum?«
Zögerlich öffnete sie den Kofferraum und stammelte etwas von »Du bist doch jetzt wirklich schon zu alt für so was«.
Dann sah ich es: zwei überquellende Wäschekörbe mit all meinen plüschigen Freunden aus meiner gesamten Kindheit. Traurig blickten mir Schaf Lulu und Tintenfisch Jotti entgegen. Ein Auge von Timur, dem Babytiger, fixierte mich. Mitten im Plüschberg entdeckte ich noch den Panzer von Schildkröte Jolanda und das rosa Einhorn von Fritz.
Doch dann traf mich der vorwurfsvolle Blick eines Kuscheltieres mitten ins Herz.
Hoppel!
Sie hatte Hoppel aussortiert. Das war eine Unverschämtheit. Er war nicht einfach nur irgendein weißgrauer Hase, er war mein bester Freund, mein Beschützer, mein Kamerad. Wir schliefen jeden Abend zusammen ein. Ich griff ihn und drückte ihn an mein Herz.
»Hoppel geht nirgendwohin und die anderen auch nicht«, rief ich und war so aufgebracht, dass ich erst jetzt bemerkte, dass wir eine interessierte Zuschauerin hatten. Zwei Meter von uns entfernt stand Filine und glotzte wie hypnotisiert auf den Berg aus Kuscheltieren. Heute trug sie einen gelb-lila gestreiften Eierwärmer auf dem Kopf, unter dem zwei geflochtene rotbraune Zöpfe hervorlugten, und einen passenden Schal, der länger als ihr Jeans-Latzrock war und dessen Fransen über ihren nackten Knien baumelten.
Blitzartig warf ich Hoppel von mir, als hätte er die tödliche Hasenseuche, und schlug den Kofferraum zu. Das war mir so was von peinlich.
»Lass uns fahren«, fauchte ich meine Mutter an und stieg ein, ohne noch einmal zu Filine zu sehen. Erst als wir beide im Wagen saßen und losfuhren, da riskierte ich einen Blick in den Seitenspiegel und sah, dass sie immer noch wie angewurzelt dastand und uns hinterherstarrte.
Das war er, der Urknall. Aber das verstand ich erst viel später.
In diesem Moment war ich einfach nur wütend. Ich wusste nicht, was mich mehr aus der Fassung brachte. Dass meine Mutter Hoppel und meine anderen Kameraden hatte verschenken wollen oder dass Filine diese Szene eben live miterlebt hatte. Wenn sie es weitererzählte, dann konnte ich den Eignungstest überspringen, mir gleich schwarze Klamotten kaufen und mich zu den traurigen Taxioten gesellen. Dann war ich so oder so der Lacher der Schule und für immer ausgestoßen.
»Wie war’s in der Schule? Irgendwas Besonderes?«, fragte meine Mutter genau in dem Moment, als wir am Rosengarten vorbeifuhren. Verzweifelt betete ich um eine Eingebung, da entdeckte ich zwischen weißen und roten Rosenbüschen meinen Vater. Es war ein seltsamer Anblick. Er saß ganz alleine auf einer Parkbank und aß ein riesiges Baguette-Sandwich.
»Da ist Papa«, rief ich aus.
»Wo?« Meine Mutter blickte schnell noch zur Seite, doch da waren wir schon vorbeigefahren.
»Da eben. Im Rosengarten.«
»Dein Vater in einem Park? Um die Uhrzeit? Der hat für so was keine Zeit. Der ist jetzt Chef.« Sie kicherte ein wenig dabei, was ich verstehen konnte, denn mein Vater war eigentlich überhaupt nicht der Typ Chef. Zumindest nicht bei uns zu Hause. Ich war mir trotzdem zu hundert Prozent sicher, dass er es gewesen war, aber ich wollte nicht streiten.
»Du hast wahrscheinlich recht«, nuschelte ich daher und war froh, dass damit auch das Schulthema vergessen war. Jetzt wollte ich nur noch nach Hause, doch statt nach links abzubiegen, ordnete sich meine Mutter auf der Geradeaus-Spur ein.
»Wo fährst du denn jetzt hin?«
Sie zeigte mit dem Daumen nach hinten auf den ausrangierten Kram.
»Und was ist da noch drin, das ich wissen sollte?«
Ich fürchtete um meine Legosammlung.
»Hauptsächlich Klamotten. Ich will sie der Kleiderkammer spenden. Aber keine Sorge. Die meisten Sachen sind von mir. Manchmal muss man sich einfach von altem Ballast befreien, um neue Wege gehen zu können.«
Ich verstand kein Wort. Neue Wege gehen, indem man Kleider weggab? Manchmal waren Erwachsene sehr seltsam.
»Du kannst es dir jetzt noch überlegen«, sagte sie, als wir die Brücke überquert hatten. »Wir kommen gleich beim Kinderschutzbund vorbei. Liegt auf dem Weg. Ich könnte kurz anhalten.«
Sie hatte es weiterhin auf meine Kuscheltiere abgesehen. Versuchte sie gerade, mich zu überreden?
»Du könntest dein Zimmer umgestalten. Als Jugendzimmer. Mit coolen Postern und so.«
»Ein Jugendzimmer?«, fragte ich und kratzte unauffällig meinen rechten Arm. Es juckte wie die Hölle.
»Du bist zwölf. Glaub mir, es geht jetzt alles ganz schnell. Wenn die ersten Pickel kommen, bedeutet das, dass der Hormonspiegel sich ändert. Dann ist es so weit.«
Wovon redete sie?
»Was ist dann so weit?«
»Na, die Pubertät geht los. Das sagt zumindest der Pickel auf deiner Nase.«
»Pickel?« Sofort tastete ich mit der Spitze meines Zeigefingers meine Nase ab. Da war ein Hubbel. Nervös klappte ich den Blendschutz an der Frontscheibe nach unten und öffnete die kleine Spiegelklappe. Tatsächlich. Oh nein! Ein gelber Eiterknubbel leuchtete auf meiner Nasenspitze.
»Das ist typisch für Teenager. Die Talgdrüsen verstopfen. Und wenn sich dann die Propionibakterien vermehren, gibt es entzündliche Papeln und eitrige Pusteln.«
»Mama. Hör auf.« Ich hasste es, wenn sie die Professorin gab und mit Fremdwörtern um sich warf.
»Aber so ist es nun mal. Biologisch ganz normale Vorgänge. Du wirst jetzt eben ein Mann.«
Wahnsinn, sie konnte so ätzend sein. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten.
»Also, dahinten ist das Büro vom Kinderschutzbund. Entscheide dich jetzt. Was soll mit den Kuscheltieren passieren? Du spielst doch schon seit Jahren nicht mehr damit.«
Ich war völlig irritiert. Hatte sie möglicherweise recht? War ich wirklich zu alt für Kuscheltiere? Bedeutete, ein Teenager zu werden, dass man seine geliebten Spielsachen weggab und sich ein Jugendzimmer einrichtete? Was sollte das auch sein, ein Jugendzimmer? Das klang nach 1980.
»Ich spiele nicht mehr mit ihnen. Das stimmt«, sagte ich so ruhig und cool wie möglich. »Aber in unserem Haus ist doch jetzt genug Platz.«
Meine Mutter seufzte tief: »Von mir aus. Dann kommen sie eben in den Keller.«
In den Keller?
Ich stellte mir Hoppels traurige Augen vor, alleine in der Dunkelheit. Aber besser als Verschenken war es allemal.
»Okay«, entgegnete ich deshalb nur kleinlaut.
Was ich nicht sagte, aber jetzt ganz deutlich in meinem Herzen spürte: Ich liebte jedes einzelne meiner Kuscheltiere immer noch genauso sehr wie an dem Tag, als ich es bekommen hatte. Und daran änderte auch der Pickel auf meiner Nase rein gar nichts!
SELTSAME EREIGNISSE
Als wir zu Hause ankamen, schickte mich meine Mum direkt in mein Zimmer. Zum Hausaufgabenerledigen. Währenddessen räumte sie die Wäschekörbe mit den Kuscheltieren in den Keller. Ich brauchte dringend einen Plan. Ich kannte sie. Sie würde ein paar Wochen warten, bis Gras über die Sache gewachsen war, und die Kuscheltiere dann heimlich verschwinden lassen. Nach und nach waren meine Kleinkindspielsachen auf diese mysteriöse Art und Weise vom Erdboden verschluckt worden. Manchmal hatte sie gefragt, ob sie den Bagger an das Kind von Frau Sowieso oder das Bilderbuch an das Kind von Herrn Sowieso verschenken dürfe, meistens waren dann aber mehr Dinge verschwunden als nur der Bagger und das Buch.
Spätestens beim Einschlafen war sonnenklar, dass ich zumindest meine liebsten Kameraden retten musste. Ohne Hoppel fühlte es sich an, als würde mir ein Arm fehlen oder ein Bein. Einschlafen dauerte ewig. Und am nächsten Morgen fühlte ich mich wie vom Bus überfahren.
Müde und schlecht gelaunt betrat ich die Küche, in der gerade eine Party gefeiert wurde. Im Radio sang eine Frauenstimme »It’s my life« zu stampfenden Beats, während meine Mutter mit hochgereckten Armen vor dem dröhnenden Mixer tanzte und zwischendurch mit den Fingern auf der Arbeitsplatte trommelte. Das mit dem Tanzen und dem Smoothie waren nicht das Seltsamste an diesem Anblick, sondern ihr Aufzug. Sie trug eine schwarze, glänzende Leggings, ein gelbes Muskelshirt und ein Schweißband um den Kopf.
»Morgen, Schatzi«, sagte sie mit wippendem Kopf und setzte gut gelaunt in den Gesang ein: »It’s my life.«
Dann schüttete sie grünen Glibber in ein Glas, hielt ihn mir entgegen und fragte: »Auch ein Schlückchen? Sehr gesund. Mit Spinat und Mangold.«
Normalerweise war sie morgens immer schon wie aus dem Ei gepellt, meistens in einem schicken Hosenanzug mit Bluse und Jackett. Und sie trank Kaffee.
Das hier war nicht meine Mutter!
»Gehst du gar nicht zur Arbeit?«, fragte ich daher und stieg über eine der Umzugskisten hinweg, um zum Küchentisch zu gelangen.
»Doch, klar. Aber erst nach dem Joggen.« Dann lächelte sie, als wäre es das Normalste der Welt, und stellte mir meinen Kakao neben meine Frühstücksflocken, in denen heute ein paar Himbeeren und Bananenstücke schwammen.
Joggen? Hatte sie gerade joggen gesagt?
Es war 7.15 Uhr!
Eine Viertelstunde später verließen wir gemeinsam das Haus. Im Rausgehen hörte ich die Klospülung im oberen Bad. Mein Vater war gerade aufgestanden. Er musste immer erst um neun Uhr im Büro sein, der Glückliche.
Draußen wurden wir stürmisch von Kolumbus begrüßt. Bellend stand er am Nachbarzaun und wuffte uns in einem tiefen Hundebass ein »Guten Morgen« zu. Speichel rann ihm an der Schnauze herunter. Meine Mutter verzog angewidert das Gesicht.
»Ich hasse Hunde«, sagte sie zähneknirschend. »Er sieht aus wie ein Kalb. Meine Güte. Wie groß können Hunde nur werden?«
»Er ist ein Leonberger«, erklärte ich. Das hatte ich im Internet recherchiert. »Die gehören zu den größten Hunderassen.«
»Zum Glück ist ein Zaun zwischen uns«, sagte meine Mutter, die schon vor dem Sport zu schwitzen begann. Wahrscheinlich vor Angst. Als Kind war sie mal gebissen worden, von einem Dackel namens Edgar. Als Biologin konnte sie Frösche sezieren, aber keinen Hund streicheln. Das war irgendwie verrückt.
Ich dagegen mochte Hunde und hatte mich bereits beim Einzug über den tierischen Nachbarn gefreut, der sein Reich im Vorgarten hatte. Dort stand seine Hundehütte in der Form eines Schiffs. Auf die blauen Planken hatte sein Herrchen in weißer Schrift »Kolumbus« gepinselt. Zwei Meter davor erhob sich ein riesiger eiserner Anker aus dem Rasen und ein Mast, an dem jeden Tag eine andere Fahne flatterte. Heute war es die Europaflagge, blau mit gelben Sternen.
Am Gartentor hielt meine Mutter an und holte einen Zettel aus dem Briefkasten. Mit rollenden Augen faltete sie ihn auseinander und las ihn halblaut vor: »Kleiner Hinweis. Der gelbe Sack wird immer mittwochs abgeholt, in den geraden Wochen. Nicht dienstags in den ungeraden. Es grüßt Sie, Alfred Bohnenberger, Kapitän a. D.«
»Ich hasse Nachbarn«, knurrte meine Mutter, dann joggte sie einen Meter zum Mülleimer und entsorgte die Nachricht. Anschließend beugte sie sich nach vorne und versuchte vergeblich, mit den Fingerspitzen ihre Füße zu erreichen. Dabei legte sich ihr Bauch in mehrere Speckfalten. Das sah aus wie ein Gebirge.
Endlich kam Leon oben um die Ecke gebogen. Cool, dass wir jetzt nur noch zwei Straßen voneinander entfernt wohnten. Darauf hatte ich mich am meisten gefreut. Jeden Morgen holte er mich ab, um gemeinsam zur Straßenbahn zu laufen.
Bevor Leon uns erreichte, hielt mich meine Mutter noch kurz am Arm fest. Sie war bereits außer Atem von ihren Dehnübungen.
Hoffentlich fragt sie jetzt nicht nach der Schule, schoss es mir durch den Kopf. Ich hatte nämlich immer noch keinen Plan. Morgen würde ich mich mit einem »Hab ich vergessen« durchmogeln können, aber bis Freitag brauchte ich unbedingt diese blöde Unterschrift.
»Kannst du mir noch einen Gefallen tun?«, fragte sie.
Ich nickte erleichtert.
»Könntest du mich ab sofort Ändy nennen?«
»Ändy?«, wiederholte ich.
»Ja. Andrea klingt voll Achtziger. Ändy find ich besser.« Dann tätschelte sie mir den Kopf, als wäre ich Kolumbus, und joggte davon.
Den ganzen Weg zur Schule ließ mich dieser letzte Satz nicht mehr los. Ändy? Das klang ja so bescheuert. Das würde ich niemals über die Lippen bekommen. Ich nannte sie schon immer Mama, seit Kurzem auch manchmal Mum. Einfach weil es cooler klang. Aber Ändy?
»Alles klar, ToHo?«, riss mich Leon aus meinen Gedanken. »Irgendwas stimmt nicht mit der verrückten Filine«, sagte er dann.
»Ja, sie trägt Wollmützen im Sommer. Das ist schräg«, antwortete ich.
»Das meine ich nicht. Sie glotzt schon die ganze Zeit zu uns rüber.«
Jetzt folgte ich seinem Blick und entdeckte Filine in der Menge zusammengepferchter Kinder, die alle mit der Straßenbahn auf dem Weg zur Schule waren. Sie stieg immer eine Haltestelle nach uns ein. Aber ich schenkte ihr nie viel Beachtung. Sie redete oft mit einem Mädchen aus der Siebten. Das war mir schon mehrfach aufgefallen, weil dieses Mädchen echt außergewöhnlich schön war. Auf eine seltsame Weise waren sich die beiden ähnlich, dann aber doch auch wieder nicht. Ach, im Grunde waren sie mir schnuppe. Mädchen interessierten mich nicht sonderlich. Sie redeten nicht mit mir und ich nicht mit ihnen. In der ganzen Klasse war das einfach so Gesetz. Die Jungs blieben unter sich und die Mädchen eben auch. Außer in Projektgruppen unter Zwang, da wurden wir schon mal gemischt. Aber das war auch irgendwie auszuhalten. Sie sind ja auch nur Menschen. Also, ich will sagen: Man kann es überleben, auch wenn man sich nichts zu sagen hat.
Jetzt bemerkte ich aber, dass Filine uns wirklich fixierte. Sie sah auch nicht weg oder tat so, als wäre es nur ein blöder Zufall. Ungeniert stierte sie immer noch in unsere Richtung. Ich musste an gestern denken, an den Kofferraum voller Kuscheltiere, und schämte mich in Grund und Boden. Dann sah ich sie mit dem Mädchen flüstern. Ob sie ihr gerade die Sache mit Hoppel erzählte? Die beiden kicherten. Garantiert würde das Mädchen meine Geschichte weitertratschen. Und all die coolen Kids würden sich über mich totlachen.
»Wer ist die bei Filine?«, fragte ich Leon.
»Dein Ernst?« Leon schüttelte den Kopf. »Das ist Ariana, Filines Cousine. Die kennt doch jeder. Ihren Eltern gehört das Bistro Russo.«
Er sah mich an, als müsse mir das was sagen.
»Kenn ich nicht.«
»Typisch! Du Blindfisch. Das ist das Bistro bei euch gegenüber. Andere Straßenseite. Ein Stück den Hügel hoch.«
Jetzt, wo er es sagte, hatte ich plötzlich den Schriftzug vor Augen.
»Okay. Kenn ich doch. War aber noch nie drin. Bin neu in der Gegend.«
»Dann wird es aber höchste Zeit«, sagte Leon. »Die Yucca-Pommes mit Käsesoße. Die musst du dir geben. Hammer!«
Dann kicherte er. »Ich glaube, die steht auf dich.«
»Halt die Klappe«, zischte ich. Mir war überhaupt nicht zum Lachen zumute.
Im Laufe des Tages wanderte meine Laune noch weiter in den Keller. Am Anfang hielt ich es für verrückte Zufälle, doch dann sah ich wirklich überall Filines gelb-lila Wollmütze. Sie lauerte mir auf. Verließ ich die Klasse, folgte sie mir. Ging ich aus dem Jungsklo, verließ sie gerade das Mädchenklo. In der Schlange an der Brötchentheke kam sie mir sogar so nahe, dass ich ihren Atem in meinem Genick spüren konnte. Ich erstarrte, erwartete ein Flüstern, eine Drohung, ein Zischen in einem Ohr. Aber sie sagte nichts. Sie sprach mich nicht an. Sie verfolgte mich einfach nur. Total psycho!
Sogar in der Pause gab es kein Entkommen. Die verrückte Filine hatte mich auf dem Radar. Und sie kam mir immer näher. Meter für Meter!
Ich musste verhindern, dass sie mich ansprach. Was auch immer sie von mir wollte, es interessierte mich nicht.
Also blieb mir nichts anderes übrig, als mich zu verstecken, irgendwo, wo sie auf keinen Fall hinkonnte. Vielleicht würde sie dann einfach das Interesse an diesem Spiel verlieren. Leon und die anderen Jungs aus meiner Klasse kickten gerade. Da die Spieler der Mannschaften in jeder Pause wechselten, würde mich sicher keiner vermissen. Daher brachte ich mich spontan in Sicherheit.
Das dachte ich zumindest.
Doch hinter mir löste sich ein Schatten aus der Wand und folgte mir in die Jungentoilette. Ich wollte mich schon umdrehen und »Jetzt reicht es aber! Für Mädchen ist das hier Sperrgebiet!« brüllen, als ich meinen Verfolger im Spiegel über den Waschbecken erkannte.
Es war der unheimliche Mike.
Kein Lächeln, keine Regung war in seinem Gesicht zu sehen. Wie ein Zombie stierte er auf meinen Rücken.
Mit ihm alleine in einem Raum zu sein, lag auf Platz zwei meiner Albtraumliste, nur getoppt von »In einem Taxi ertrinken«. Er war definitiv noch verrückter als Filine, und es gab Gerüchte, dass er schon mal beinahe jemanden umgebracht hätte.
Ich rettete mich ans Waschbecken und ließ ihn vorüberziehen. Als ich mich umdrehte, war er zum Glück verschwunden.
Ich beschloss, mich bis zum Ende der Pause in einer der Klokabinen zu verstecken.
Natürlich war es kein Aufenthalt in einem Luxusapartment. Es roch nicht gut, war ungemütlich und die Zeit schlich nur gaaanz langsam voran. Schüler kamen, Schüler gingen. Ich konnte sie pinkeln, quatschen und lachen hören. Langsam schliefen schon meine Füße ein, als ich seltsame Geräusche aus der Nachbarkabine hörte. Kein Wasserplumpsen oder Füßescharren. Kein Spülen oder Gürtelklappern. Es war mehr ein zischendes, bedrohliches Flüstern. Vorsichtig kniete ich mich auf den Boden und linste neugierig unter der Seitenwand hindurch.
Dabei erschrak ich zu Tode, denn ein Paar eiskalte Augen schauten zurück.
Mike!
Er war wohl die ganze Zeit in der Kabine neben mir gewesen. Was zur Hölle tat er da? Wer lungerte denn die ganze Pause auf dem Klo herum? Nur Verrückte taten so was.
Voller Angst stürzte ich aus dem Jungenklo, ohne mich noch einmal umzudrehen. Auf dem Schulhof lief ich auf eine Traube von Schülern zu und tauchte darin unter. Ich sah im Grunde ja aus wie alle Sechstklässler: Shirt, kurze Jeans und Sneakers. Ich würde in der Menge einfach verschwinden. Und außerdem hatte er nur meine Augen gesehen. Blaue Augen hatten doch viele.
Um meinen Atem zu beruhigen, versuchte ich ganz bewusst, dem Weberknecht zuzuhören, der gerade einen Fünftklässler verhörte.
»Herr Weber, ich schwöre es. Eben war der Stift noch in meiner Hosentasche und jetzt ist er weg. Jemand hat ihn mir geklaut«, sagte der Junge mit hochrotem Kopf.
»Bist du dir auch sicher, dass du ihn dabeihattest? Vielleicht hattest du ihn schon vorher verloren?«
»Ich passe sehr gut darauf auf. Er ist wertvoll, aus Silber, und so was wie mein Glücksbringer.«
Dann zuckte sein Blick über die Menge und er zeigte mit dem Finger direkt auf mich. »Der da war es. Ich bin mir ganz sicher. Durchsuchen Sie ihn.«
»Nein«, wollte ich rufen, da bemerke ich, dass er gar nicht mich meinte, sondern an mir vorbeischaute. Als ich mich umdrehte, lief mir ein eiskalter Schauder über den Rücken. Mike stand genau hinter mir. Sein Gesicht war wie versteinert. Er hatte die Kapuze seines Hoodies über die schwarz gefärbten Haare gezogen und so sah man nur das weiße Antlitz des Todes.
Alle Augen waren auf ihn gerichtet, und der Weberknecht stiefelte seufzend los, um ihn abzuführen.
»Na klar, wer sonst«, nuschelte er.
Dass Mike schuldig war, schien für ihn sonnenklar.
Natürlich, Mike war unheimlich, sehr sogar.
Auch ich fürchtete mich vor ihm. Und bestimmt war er kriminell. Aber diesen Stift hatte er nicht geklaut. Denn er war ja gar nicht am Tatort gewesen.
Warum sagte er denn nichts?
Los, Junge, mach den Mund auf, rief ich innerlich. Doch Mike schwieg.
Ohne nachzudenken, brüllte ich: »Das ist totaler Quatsch. Er kann es nicht gewesen sein. Er war doch die ganze Pause über mit mir auf dem Klo.«
Nicht nur der Weberknecht, auch die anderen Schülerinnen und Schüler und vor allem Mike blickten mich entgeistert an. In diesem Moment bemerkte ich, wie bescheuert das geklungen hatte.
Nur Mädchen gingen zusammen aufs Klo. Jungs nicht. Das war so was von uncool. Die ersten Kids begannen zu kichern.
Jetzt musste mir schnell etwas einfallen. Wieder quakte ich drauflos, um zu retten, was zu retten war: »Also, das war so. Mir war ein bisschen schlecht. Und der Mike war so nett, bei mir zu bleiben und abzuwarten, ob es mir gleich wieder besser geht oder ob er einen Lehrer rufen soll. Na ja, wurde von allein wieder besser. Das war echt prima von dir. Danke, Kumpel.«
»Stimmt das?«, fragte der Weberknecht grimmig. Die Menge schwieg gespannt und lauschte. Aber Mike sagte nichts, er nickte nur kurz, dann drehte er sich um, nicht ohne mich mit einem messerscharfen, vernichtenden Blick zu strafen, und verschwand als Schatten hinter der nächsten Ecke.
Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Vor diesem Vorfall hatte Mike nicht mal gewusst, dass es mich gab. Und jetzt hasste mich der unheimlichste Junge der ganzen Schule.
Am nächsten Morgen waren Filine und Mike nicht meine einzigen Probleme. Den ganzen Vormittag hatte ich mich schon vor der Biostunde gefürchtet. Nicht wegen des Themas, denn wir hatten Mikroskopieren in einem Extraraum, den sonst nur die höheren Klassenstufen benutzen durften. Etwas durch ein Mikroskop zu betrachten, stellte ich mir ausnahmsweise mal spannend vor.
Das, was mich zermürbte, war die Sache mit der Unterschrift. Gleich zu Beginn der Stunde sammelte der Weberknecht die Tests ein. Hektisch durchsuchte ich meinen Ranzen, schlug mir dann klatschend die Hand auf die Stirn und sagte entschuldigend: »Das gibt es doch nicht! Den muss ich zu Hause liegen lassen haben. So ein Mist.«
Der Weberknecht sah mich grimmig an. Er glaubte mir natürlich kein Wort. Dann knurrte er: »Gnadenfrist bis Freitag.«
Nach außen cool, aber innerlich zitternd, nickte ich.
Anschließend passierte etwas sehr Ungewöhnliches. Statt uns zu Zweiergruppen zusammenzuwürfeln, sagte er: »Auf Wunsch einer Schülerin dürft ihr euch heute einen Partner aussuchen. Wenn ihr euch gefunden habt, dann könnt ihr euch hier am Pult ein Mikroskop und die Versuchsanweisung abholen.«
Wie kleine Äffchen sprangen meine Mitschüler auf. Um mich herum wurde es laut und unübersichtlich. Ich klemmte mich sofort an Leon.
»Wir beide«, raunte ich ihm zu. Er nickte und nahm noch einen kräftigen Schluck aus seiner Wasserflasche. Dann reihten wir uns in die Schlange ein. Nur wenige Augenblicke später hielt er sich seinen Bauch, den sogar ich laut grummeln hörte.
»Mir ist nicht gut. Gar nicht gut«, stammelte er.
Inzwischen war er ganz grün im Gesicht. Ohne Vorwarnung rannte er zum Ausgang und rammte noch ein paar Mädchen um, die im Weg standen.