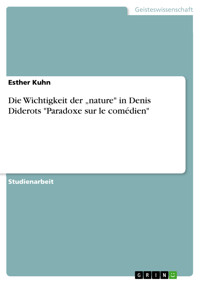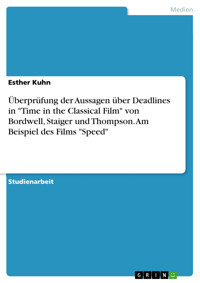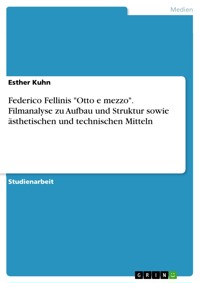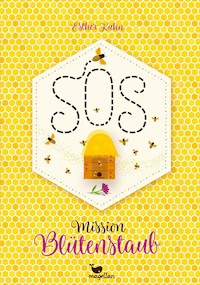11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Magic Kleinanzeigen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Kimia hätte es nie für möglich gehalten, dass es echte Magie gibt. Doch als sie vorübergehend in die Villa der Westhagens einzieht, wird sie schnell eines Besseren belehrt. Kein Wunder, dass Caroline, die Tochter der Familie, immer perfekt gestylt ist, wenn sie dabei auf einen Zauberspiegel und eine magische Bürste zurückgreifen kann. Caroline ist jedoch alles andere als begeistert, dass sie ab sofort einen unerwarteten Feriengast an der Backe hat. Aber Kimia lässt sich nicht abschütteln und will unbedingt mehr über die Welt der Magic Kleinanzeigen erfahren, bis sie eine unglaubliche Entdeckung macht: Der Zauberspiegel hat einen heimlichen Bewohner und der braucht dringend Kimias Hilfe … Wer hätte gedacht, dass Kleinanzeigen so magisch sein können? Ein fantastisches Kinderbuch ab 10 Jahren für abenteuerlustige Mädchen und Jungs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Ähnliche
Magic Kleinanzeigen
Band 1: Gebrauchte Zauber sind gefährlich
Band 2: Im Zauberspiegel
Für meine Hexen
ESTHER KUHN
Nur wer sich selbst mit Liebe betrachtet,kann seine wahre Schönheit erkennen.
INHALT
ENDLICH FERIEN
DAS UMSTYLING
DIE VILLA WESTHAGEN
DAS FLÜSTERN
DIE FÜHRUNG
DIE VERWANDLUNG
PARTYTIME
DIE INSEL
VARKAS
DAS PASSWORT-PROBLEM
DAS WICHTELBALLETT
DIE TAUFE
DAS KAFFEEKRÄNZCHEN
ZAUBERTAUSCH XXL
DAS GEHEIMVERSTECK
DER MAGENBITTER
DAS BEWERBUNGSGESPRÄCH
DIE ANDERE SEITE
DIAMANTENFIEBER
EDERRA
DER ZAUBERLEHRLING
KATZENJAMMER
DIE GEISTERFABRIK
SCHLECHTE NACHRICHTEN
RAUTGUNDIS’ REZEPTE
BESUCH AUS AMERIKA
DIE EISKÖNIGIN
DIE ÜBERRASCHUNG
DIE FLUCHT
LOGE NUMMER FÜNF
DER SPIEGELZAUBER
DIE OPTISCHE TÄUSCHUNG
DAS RENNEN
ENDLICH FERIEN
Fünf Meter.
Das ist, als würde man vom Balkon im ersten Stock auf die Straße springen. Unglaublich hoch und grandios gefährlich.
Doch hier oben, wenn man sich auf den Turm getraut hat und runterguckt, dann fühlt es sich noch viel höher an, als stünde man auf dem Dach eines Hochhauses.
Über meine nackten Zehen hinweg, die sich am Rand der Sprungplatte festkrallen, betrachte ich die Wasseroberfläche unter mir. Ein paar kleine Wellen kräuseln sich darauf, die Schwimmer der anderen Bahn mit Arm- und Beinschlägen auf die Reise geschickt haben. Irgendwo zwischen den Wogen werde ich gleich ins Wasser eintauchen, nach einer spektakulären Rolle vorwärts in der Luft.
Angestrengt versuche ich, alles um mich herum auszublenden. Das Gebrabbel von der Liegewiese gegenüber, meinen hämmernden Pulsschlag und die Aussicht auf unglaubliche Schmerzen, wenn ich den ersten Salto meines Lebens vermassele und stattdessen einen brennenden Bauchplatscher lande.
Noch einmal atme ich tief ein. Gleich bin ich so weit. Ich spüre bereits das Kribbeln in meinen Fingerspitzen, das mir sagt, dass es nur noch Sekunden dauert, bis ich es einfach tun werde.
»Hey, mach mal schneller. Das kann doch nicht so schwer sein. Zack, springen und fertig.« Die Stimme hinter mir reißt mich aus meinem inneren Flow. »Na, mach schon. Spring.«
Mit einem Mal sackt mir das Blut in die Füße. Alles ist schwer, das Kribbeln schlagartig verschwunden.
»Ich muss mich konzentrieren, du Idiot. Kannst du einfach die Klappe halten?«, schnauze ich zurück, ohne mich umzudrehen. So ein blöder Kasper!
»Los, sonst schubs ich dich. Ich zähle bis drei. Eins, zwei …«
Wütend drehe ich mich um. Jetzt ist die Konzentration endgültig im Eimer.
»Wag es ja nicht«, fauche ich einen Jungen an, der einen Kopf größer ist als ich. Seine nassen, langen Haare kleben ihm in Strähnen im Gesicht, seine grünblauen Augen blitzen feindselig. Hinter ihm kichern zwei Mädchen, die sich an der Balustrade des Sprungturms rekeln, während ein Junge Fotos von ihnen schießt. Ein anderer Junge, der dem Kasper wie aus dem Gesicht geschnitten ist, nur vielleicht zwei Jahre älter und mit raspelkurzem blondem Haar, versperrt wie ein Bodyguard die Leiter nach oben und lässt niemanden mehr auf die Plattform.
»Zweieinhalb.« Der Kasper grinst mir kackfrech ins Gesicht und holt bereits Luft zur »Drei«, als sich der Fotograf einmischt. Mein Herz bleibt kurz stehen. Ich kenne ihn aus meiner Schule. Er ist dort der Star der Foto-AG. Sein Name ist Tammes. Das weiß ich noch, weil er uns Anwärtern aus der Sechsten in einer Schnupperstunde vor den Ferien alles gezeigt hat, was sie so machen. Es war wirklich spannend. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem den Kletterkurs.
»Freddy, lass das Mädchen jetzt in Ruhe. Niemand schubst hier irgendwen«, sagt Tammes streng. Kurz streifen sich unsere Blicke. Er hat dunkelbraune, geheimnisvolle Augen wie ein Bär, die sich jetzt aber wieder auf das Display seines Smartphones und die Models konzentrieren. Der Kasper neben mir schnauft verärgert.
Mein Bauchgefühl sagt, ich sollte es lassen und einfach kerzengerade springen, wie immer. Aber die Wildkatze in mir will es jetzt erst recht wissen.
Deshalb schließe ich kurz die Augen. Die volle Konzentration, nur ich, der Wind auf meiner Haut, das Wasser wie ein weiches Federkissen unter mir und mein Atem. Das Kribbeln kommt zurück. Jetzt gehe ich in die Knie, stoße mich mit den Füßen ab und springe. In der Luft ziehe ich blitzartig meine Beine zum Oberkörper und drehe mich um mich selbst.
Als meine Füße Sekunden später durch die Wasserdecke stoßen, füllen sich meine Adern schlagartig mit Glück. Kein Bauchplatscher, kein Schmerz, nur Freude. Und um mich herum herrliche Stille und ein paar Sonnenstrahlen, die verzweifelt versuchen, den Boden des Sprungbeckens zu erreichen.
Als ich mich umdrehe, um nach oben zu schwimmen, sehe ich plötzlich einen schwarzen Umriss über mir. Zuerst erschrecke ich.
Ein Wal?
Im Schwimmbad?
Dann fällt mir ein, dass es ja nur ein Graffito ist, das irgendjemand vor ein paar Tagen nachts auf die Unterseite der Fünf-Meter-Plattform gesprayt hat.
»Ey, Kimia, das war ja der Hammer«, begrüßt mich mein bester Freund Taylan, der von unserer Picknickdecke aus alles beobachtet hat, und applaudiert mir.
»Am liebsten würde ich gleich noch mal. Aber da oben findet gerade ein Fotoshooting statt«, antworte ich und lasse mich neben ihn plumpsen.
»Nicht mehr lange«, sagt Taylan und weist mich mit einem Kopfnicken auf den Bademeister hin, der gerade zielstrebig den Sprungturm ansteuert. Innerlich reibe ich mir die Hände. Das wird ein lautes Donnerwetter! Denn seit der Walattacke ist er noch schlechter gelaunt als sonst.
Doch die Vögelchen flüstern die Nachricht schneller, als der Griesgram die Leiter hinaufklettern kann, und so springen erst der Kasper, dann die beiden Mädchen und zum Schluss noch der Bodyguard einfach vom Turm in die Freiheit. Nur Tammes muss sich das Gezeter anhören, kommt aber anscheinend mit einer Verwarnung davon.
Wie zwei geheimnisvolle Nymphen tauchen die Models aus dem Wasser auf und ziehen sich elegant am Beckenrand hinauf. Dann sitzen sie dort, tropfnass glänzend wie Schmuckstücke in der Sonne und mit Frisuren, als kämen sie gerade vom Stylisten. Auf dem Turm hatte ich kein Auge für sie. Aber jetzt erkenne ich sogar eine von ihnen. Es ist Caroline von Westhagen. Sie ist die Tochter von Mamas Chefin. Wir sind uns schon ein paarmal kurz im Museum begegnet, wenn ich meine Mutter dort besucht habe, aber ich glaube, sie hat mich nie wirklich wahrgenommen. Zumindest sagt sie nicht mal Hallo, wenn wir uns an anderen Orten sehen. Sie gehört zu den coolen Kids, die sich immer auf den Steinstufen hinter dem Sprungbecken treffen. Von der Liegewiese aus betrachtet, sieht es bei ihnen nach jeder Menge Spaß aus. Die meisten sind auch älter als ich. Caroline mindestens ein Jahr. Aber wenn ich mir so ihre Kurven betrachte, vielleicht auch zwei.
Ohne nachzudenken, sehe ich an mir herunter. Auf meinen blauen Sportbadeanzug, der überhaupt nicht so cool aussieht wie die Bikinis der beiden Schönheiten. Er ist einfach nur ein Stück Stoff, das schnell in der Sonne trocknet. Null Stylefaktor! Ich kann nicht verhindern, dass mein Blick kurz auf den zwei kleinen Erhebungen haften bleibt, die irgendwann einmal meine Brüste werden sollen. Ich überprüfe es täglich, aber in letzter Zeit hab ich das Gefühl, dass sie einfach nicht weiterwachsen wollen.
Als ich aufblicke, schaue ich in Taylans mitfühlende Augen. Manchmal würde ich meine Gedanken so gerne vor ihm verbergen, aber er kennt mich schon seit dem Kindergarten. Es ist unmöglich, etwas vor ihm geheim zu halten. Und er hat zu allem eine Meinung, die er nicht für sich behält, auch wenn es manchmal echt besser wäre: »Mach dir keine Sorgen. Die wachsen schon noch. Vielleicht isst du einfach zu wenig. Oder nicht fettig genug. In unserem Alter braucht man viele Kalorien. Ich geh mir Pommes kaufen. Soll ich dir welche mitbringen?«
Ich schüttele den Kopf und zeige ihm einen Vogel. »Brüste wachsen doch nicht, weil man Pommes isst.«
»Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie herausfinden.«
»Na gut«, sage ich. »Ich komme mit zum Kiosk. Vielleicht wäre dann aber eine Kugel Eis besser. Wegen der Form.«
Es dauert einen Moment, bis Taylan meinen Witz versteht, doch dann prustet er los: »Haha, dann musst du aber zwei Kugeln essen. Sonst sieht das später doof aus.«
Blödelnd machen wir uns auf dem Weg zum kleinen Imbissstand neben dem Eingang. Während wir uns an der Schlange anstellen, sehe ich, wie Caroline und ihre Clique das Schwimmbad verlassen. Sie ziehen die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Nicht nur ich glotze. Zusammen würden sie eine gute Band abgeben, so stylisch, wie sie aussehen. Vor allem der Kasper stolziert umher wie ein Pfau und fährt sich immer wieder durchs blonde, lange Haar, das dann in Strähnen zurück in sein schönes Gesicht fällt. Wie gerne würde ich ihm ans Bein treten. So ein Vollidiot.
Währenddessen erzählt mir Taylan vom türkischen Teil seiner Familie, die er in den Ferien besuchen wird, denn seine Uroma wird neunzig.
»Wann genau fahrt ihr?«, frage ich.
»Irgendwann heute Nacht geht es los zum Flughafen. Der Flieger nach Istanbul startet ganz frühmorgens. Und von da aus fahren wir dann an die Küste in ein superschickes Hotel. Meine Uroma lässt sich die Party richtig was kosten. Und du, wann fliegt ihr?«
»Erst in zwei Wochen«, schnaufe ich. »Manno, Tay. Nächstes Jahr müssen wir das besser abstimmen. Wenn ich dann noch drei Wochen in Australien bin, haben wir nur noch die letzte Ferienwoche zusammen.«
»Bleib doch hier. Australien! Wer will denn schon dahin? Das wird bestimmt todlangweilig.«
»Langweilig? Spinnst du? Ich fliege schließlich zum Great Barrier Reef, das ist das größte Korallenriff der Erde«, entgegne ich, obwohl ich es Tay schon tausendmal erzählt habe und er mich einfach nur ein bisschen foppen will. Aber das Reisefieber packt mich, und ich kann nicht anders, als weiterzuplappern: »Und ich werde tauchen und Clownfische sehen. Vielleicht sogar Haie. Das wird einfach bombastisch. Und außerdem treffe ich meinen Papa endlich wieder.«
Wir sind an der Reihe. Während Taylan seine Portion Pommes und zwei Kugeln Zitroneneis für mich mitbestellt, denke ich an das letzte Weihnachtsfest zurück, als ich meinen Papa zum letzten Mal live und in Farbe gesehen habe. Klar, wir chatten und sehen uns per Videocall, aber das ist nicht dasselbe. Für ein ganzes Jahr ist er beruflich in Sydney und baut dort eine Zweigstelle der Firma auf, für die er hier in Linneberg arbeitet. Eine Zeit lang hatte ich sogar darüber nachgedacht, mit ihm mitzugehen, aber ich wollte Tay nicht alleine lassen und meine Mama auch nicht. Die wollte nämlich nicht hier weg, weil sie einen Job hat, den sie liebt, und weil »ein Jahr nicht so lange ist, wie es klingt« und »wir das schon überstehen«. Das betont sie ständig, obwohl ich spüren kann, wie viel Sehnsucht sie hat und dass sie es auch nicht mehr abwarten kann, bis wir endlich in diesem Flieger sitzen und einmal um die halbe Welt reisen, um für drei kostbare Wochen wieder eine Familie zu sein.
Eis schleckend und Pommes essend machen wir uns auf den Weg zurück auf die Liegewiese. Vor dem Aufgang zur Wasserrutsche stoppt uns ein Mädchen, das ich im ersten Moment beinahe nicht erkannt hätte.
»Hey, Leute, auch hier?«, fragt Tabea und schüttelt auffällig ihr schulterlanges Haar. Sie geht mit uns in die 6a, also nach den Ferien dann schon 7a.
»Auch hier?« ist die bescheuertste Frage, die ich je gehört habe. Ich möchte »Nein!« antworten, aber ich lasse es. Denn ich bin immer noch gefesselt von ihrem Anblick.
»Du siehst anders aus«, stellt Taylan fest.
Und so hübsch, denke ich, spreche es aber nicht laut aus, denn Tabea ist bereits eingebildet genug. Tabea gluckst: »Ja, den Look hat mir gestern meine Schwester verpasst. Sie macht eine Ausbildung zur Friseurin. Cool, was?«
Ich gebe es ungern zu, aber sie sieht unglaublich aus. Die Highlights in ihrem Haar machen sie mindestens zwei Jahre älter. Sie könnte jetzt locker vierzehn sein. Ihr Anblick ärgert mich. Jedes Mal, wenn ich zum Friseur gehe, versuche ich, der Friseurin klarzumachen, dass ich auch einen cooleren Look möchte, aber am Ende sehe ich immer aus wie eins der Playmobilmännchen aus meiner Rittersammlung. Oder wie Tay es sagen würde: Topfschnitt mit Pony.
Ich muss dringend die Friseurin wechseln.
Nachdem wir in Ruhe aufgegessen, dann im Wasser Ball gespielt haben und ein paarmal gerutscht sind, kommt mir noch eine andere Idee in den Kopf. Als wir wieder auf unserer Decke sitzen und uns von der Sonne trocknen lassen, bin ich mir sicher. Es ist Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. »Tay? Wann musst du heute zu Hause sein?«
»Gegen sieben«, antwortet er. »Ich muss noch packen.«
Ich gucke auf mein Handy. Es ist kurz nach vier. »Okay. Dann müssen wir jetzt los.«
DAS UMSTYLING
»Bist du dir ganz sicher?«, fragt Tay und streift sich die knisternden Plastikhandschuhe über.
»Wir haben uns die Anleitung durchgelesen und alles aus der Packung zusammengemixt, wie es da steht«, antworte ich. »Was soll schon schiefgehen? Es ist nur Farbe und keine Bombe.«
Wir sitzen im Badezimmer und ich bin so was von aufgeregt. Gleich bekomme ich ein Umstyling wie bei Germany’s Next Topmodel. Klar, an meiner Haarlänge bis zum Kinn lässt sich nichts ändern. Aber am Style schon. Von mir aus kann es jetzt losgehen.
»Komm, wir machen noch schnell ein Selfie von uns beiden«, sagt Tay.
»Auf keinen Fall«, wehre ich ab. »Keine Selfies.«
»Dann ohne mich. Nur du im Vorher-nachher-Vergleich.«
»Nein. Keine Fotos von mir. Das ist das Gesetz«, betone ich, denn ich hasse mich auf Fotos. Irgendwie sehe ich immer hässlich aus. Entweder hab ich die Augen zu, ein bescheuertes Grinsen im Gesicht oder ich ziehe eine Grimasse.
»Schade«, grummelt Tay und greift brav die Tube mit der Farbmischung, die neben dem Waschbecken liegt.
»Ich glaub, ich kann das nicht«, sagt er zögernd. Unsere Blicke treffen sich im Spiegel. Er ist wirklich unsicher, ob er das jetzt tun soll, also ermutige ich ihn: »Wenn das die Schwester von Tabea kann, dann kannst du das schon lange.«
Endlich drückt er die Farbe aus der Tube auf den Strähnchenkamm, der auch extra in der Packung dabei war, und wagt es. Ich spüre die Striche auf meiner Kopfhaut. Aber er ist sehr vorsichtig. Zwischendurch stehe ich vom Badezimmerschemel auf, um zu gucken, wie er die Farbe verteilt. Irgendwie sieht man ja gar nichts. Ich greife die Tube und lasse einen fetten Fladen auf meinen Kopf klatschen. »So und jetzt mal ordentlich verteilen. Am besten mit den Händen«, befehle ich. Und Tay macht folgsam, was ich sage.
Anschließend muss das Ganze noch eine Zeit lang einwirken. Dreißig Minuten laut Gebrauchsanweisung. Währenddessen spielen wir eine Runde Yu-Gi-Oh!. Obwohl ich ihn mit meiner ägyptischen Götterkarte plattgemacht habe, hilft er mir danach trotzdem beim Ausspülen und Trocknen. Das ist ein wahrer Freund. Er hasst es nämlich, wenn ich gewinne.
Ich bin sehr gespannt aufs Ergebnis und will mich überraschen lassen. Deshalb stehe ich nicht vorm Spiegel, sondern sitze auf dem Schemel, während Tay meine Haare föhnt.
»Ich hab’s mir, ehrlich gesagt, anders vorgestellt«, nuschelt er kurze Zeit später. »Nass sah es besser aus.«
Wie meint er das denn? Irgendwie beschleicht mich ein ungutes Gefühl.
»Vielleicht guckst du es dir mal an.«
Mit klopfendem Herzen stehe ich auf.
»Oh mein Gott.«
Mehr kann ich zu dem, was ich im Spiegel sehe, nicht sagen.
Der Blondton war vielleicht ein bisschen zu hell und die Menge der Farbe vielleicht ein bisschen zu viel.
Auf jeden Fall habe ich jetzt einen blonden Haaransatz, als hätte mir jemand die Farbe einfach über den Kopf geschüttet, oben alles hell und unten dunkel. Es sieht schrecklich aus und es steht mir überhaupt nicht. Tränen schießen mir in die Augen.
»Nicht weinen, Kimia«, versucht Tay, mich zu trösten. »Wir kriegen das schon wieder hin. Versprochen. Ich hab schon eine Idee.«
Zwanzig Minuten später ist er zurück, völlig außer Atem. »Das ist ein Braunton. Der überfärbt sogar graue Haare, steht drauf. Wir machen alles einfach wieder rückgängig. Steuerung Z, wie am Computer. Als wäre es nie passiert.«
Da Tay ja jetzt Experte für Farbmixturen ist, bereitet er alles vor. Ich schließe die Augen und bete. Aber schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden.
Oder doch?
Eine Dreiviertelstunde später, nach Einwirken lassen, Ausspülen und Föhnen, blicke ich der Wahrheit ins Gesicht.
»Ich finde es gar nicht so schlecht. Jetzt siehst du aus wie Billie Eilish am Anfang ihrer Karriere«, sagt Tay, aber das Entsetzen in seinen Augen kann er nicht verbergen.
»Wie meinst du das denn?«, schluchze ich.
»Na, wie ein Promi«, flunkert er weiter.
Keine Worte der Welt können die Wahrheit schönreden. Denn das, was mich da aus dem Spiegel heraus anguckt, das ist kein Popstar, sondern ein Kobold mit explodierten grünen Haaren.
»Shit, so kann ich nie mehr ins Freibad. Tabea und die anderen werden sich schlapplachen«, jaule ich auf. »Und was wird meine Mama sagen? Die wird sich ja zu Tode schämen, wenn sie sich so mit mir im Urlaub zeigen soll. Das ist das Ende.« Tränen steigen mir in die Augen, meine Haare sehen so scheußlich aus. Ich fühle mich richtig hässlich.
Unruhig trippelt Tay neben mir auf den Zehenspitzen. »Sorry, Kimia, ich muss jetzt leider los. Meine Mutter flippt aus, wenn ich zu spät komme«, sagt er und zeigt auf die Uhr auf der Ablage des Spiegelschranks. Es ist kurz nach sieben.
»Du kannst nicht gehen«, flehe ich, obwohl ich ja weiß, dass er dringend noch packen muss. Aber in meiner Verzweiflung ist er gerade mein einziger Halt: »Was soll ich denn jetzt machen? Meine Mama kommt gleich nach Hause.«
Nachdenklich kratzt sich Tay am Kopf. »Keine Ahnung.«
»Wenn wir uns beeilen«, sage ich schließlich, »könntest du vielleicht noch was retten. Ich hole nur schnell eine Schere.« Aufgebracht laufe ich in mein Zimmer und steuere meine große Bastelkiste an. Kurzhaarfrisuren liegen im Trend. Der ganze Schrott kommt jetzt einfach ab.
Doch als ich zurück bin, ist der Feigling weg. Einfach abgehauen. Na, dann muss ich das eben selbst erledigen.
Tränen laufen mir die Wangen hinunter, als ich eine Strähne über meinem Ohr anhebe und sie zwischen die beiden Schneiden lege. Langsam drückt meine Hand die Klinken zusammen und ich schließe die Augen.
Schnipp, schnapp, ab.
Es ist eine Sache von Sekunden.
Ding. Ding. Dong.
Die Klingel lässt mich zusammenzucken. Vor Schreck fällt mir die Schere aus der Hand und die Haare segeln zu Boden. Mit Entsetzen erblicke ich das Loch rechts in meiner Frisur. Ich habe es noch schlimmer gemacht. Jetzt ist es eine grüne Kobold-Punk-Frisur.
Ding. Ding. Dong.
Das ist bestimmt Tay, der sich entschuldigen will. Er hasst es, wenn wir Streit haben. Doch die Stimme, die verzerrt durch die alten Leitungen der Gegensprechanlage zu mir nach oben in den ersten Stock rasselt, gehört nicht meinem Freund, sondern einer Frau.
»Kimia, bist du das?«, fragt sie.
»Jaaaa«, antworte ich zögernd.
»Hier ist Gisela von Westhagen«, erklärt sie. »Wir kennen uns aus dem Museum.«
Mamas Chefin?
Was will die denn hier?
»Ich bin gekommen, um dich abzuholen.«
Einem lauten, rasselnden Ausatmen folgt ein Räuspern: »Deine Mutter hatte einen Unfall.«
DIE VILLA WESTHAGEN
Ich sehe sie fallen. Wie sie die Treppenstufen vom ersten Stock hinunter ins Foyer purzelt. Dort liegt sie reglos am Boden, bis der Krankenwagen kommt. Das sind die Bilder, die ich mir ausmale, während Frau von Westhagen mir kurz und knapp berichtet, was meiner Mama passiert ist, und gleichzeitig ein paar Sachen für sie zusammenpackt.
»Es wird alles gut«, sagt sie immer wieder, um mich zu beruhigen. Aber sie ist selbst sehr bestürzt. Obwohl ihre Stimme fest und gefasst wirkt, sehe ich, dass ihre Hand zittert, als sie die Türklinke herunterdrückt und wir gemeinsam das Haus verlassen.
Vorsichtig schlängeln wir uns durch die Tischreihen vor der Eisdiele am Elseplatz, über der ich wohne. Im Vorbeigehen spüre ich die Blicke der Leute. Sie glotzen uns an und vergessen sogar kurz vor ihren Mündern das Eis auf ihren Löffeln. Wahrscheinlich fragen sie sich, wer diese Frau ist, die mit roten Pumps, weißem Hosenanzug und hochgestecktem schwarzem Haar aussieht wie aus einem Promimagazin, und was sie mit diesem kleinen Häuflein Elend will, das völlig planlos neben ihr herschlurft.
Doch dann sehe ich den wahren Grund für die Aufregung. Am Straßenrand parkt eine weiße Stretch-Limousine. So ein Auto habe ich auch noch nie in echt gesehen. Es ist bestimmt sieben Meter lang.
»Guten Tag«, begrüßt mich eine zierliche Frau im feinen Anzug und öffnet mir die Tür. Dabei verzieht sie keine Miene. Unsicher steige ich ein und nehme auf dem grauen Ledersofa Platz. Ja, kein Scherz. Drinnen sieht es aus wie in einem schmalen Wohnzimmer. Es gibt sogar einen Bildschirm und eine Soundanlage.
Frau von Westhagen setzt sich auch nach hinten neben mich. Anscheinend hat sie meine Verunsicherung bemerkt. »Oh, wir fahren nicht immer mit so einer Riesenkiste. Sie ist nur übers Wochenende geliehen. Später hole ich noch ein paar wichtige Leute vom Flughafen ab. Sie mögen es pompös.«
Sie lächelt.
»Du kannst deinen Hut hier gerne absetzen.«
Das Ding auf meinem Kopf ist kein Sonnenhut mit großer Krempe, sondern eher eine lila Mütze aus Stoff, die an eine umgedrehte Müslischüssel erinnert. Meine Mama hat sie mir extra für Australien gekauft.
»Die möchte ich lieber auflassen«, sage ich und muss an meine neue Frisur denken, die ich so gerade noch rechtzeitig vor ihren Augen verstecken konnte. Alles Grüne ist bedeckt, nur ein paar braune Spitzen gucken unter der Mütze hervor. Sie hing zum Glück an der Garderobe im Flur. Ein Griff und ich war gerettet.
»In die Sommerberg-Klinik?«, fragt die Chauffeurin, die inzwischen vorne eingestiegen ist, und startet den Wagen. Doch Frau von Westhagen antwortet nicht sofort, weil sie gerade ihre Mailbox abhört. Dann schüttelt sie den Kopf und sagt: »Nein, Darja. Planänderung. Direkt zur Villa, bitte.«
»Aber, aber …«, stammele ich und spüre, wie mir das Blut vor Aufregung zu Kopf steigt: »Ich will sofort zu meiner Mama.«
Beruhigend legt Frau von Westhagen ihre Hand auf meine, die ich reflexartig zurückziehe.
»Die Nachricht kam aus dem Krankenhaus«, erklärt sie. »Deine Mama wird jetzt gerade operiert. Sie hat sich anscheinend die Schulter gebrochen. Keine Sorge, ich kenne Professor Angelo persönlich. Er wird alles tun, damit sie wieder ganz gesund wird. Wir besuchen sie morgen direkt nach dem Frühstück. In Ordnung?«
»Nach dem Frühstück?«, frage ich entsetzt.
»Ja. Ich dachte, es wäre am besten, wenn du heute Nacht bei uns bleibst. Und morgen sehen wir weiter.«
Kurze Zeit später fahren wir durch ein großes gusseisernes Tor. Dahinter liegt ein großer Park mit Teich und Rosengarten, an dessen Ende sich die Villa Westhagen erhebt. Was für ein beeindruckender alter Kasten. Eidottergelb, mit herrschaftlichen Säulen und einer riesigen Treppe.
»Herzlich willkommen«, sagt Frau von Westhagen, als wir die Eingangshalle betreten. Staunend sehe ich mich um. Hier sieht alles aus wie aus einer anderen, längst vergangenen Zeit. Auf einem Marmortisch neben einem Sessel steht ein riesiger Blumenstrauß, daneben auf einer Kommode ein antikes schwarzes Telefon mit Wählscheibe und in einer Vitrine sind Stücke des berühmten Westhagener Porzellans ausgestellt. Das kennt in Linneberg wirklich jeder.
»Das sind meine Vorfahren«, sagt die Hausherrin, als sie bemerkt, dass ich die Gemälde an den Wänden genauer betrachte. »Sie sehen ein bisschen grimmig aus. Aber ich denke, sie waren nette Zeitgenossen.«
Dann lächelt sie mich an: »Du wirst noch genug Zeit haben, dir alles in Ruhe anzusehen, aber jetzt zeigen wir dir erst mal dein Zimmer. Darja, könnten Sie Sergej rufen?«
»Tut mir leid, aber er ist heute Abend nicht im Dienst«, antwortet die Chauffeurin.
»Natürlich nicht. Hatte ich ganz vergessen. Es ist ja Freitag. Die Proben für sein Musicalprojekt. Es hat schon bald Premiere, nicht wahr?«
Statt zu antworten, rollt Darja nur mit den Augen und schaut dann auf ihr Handy. »Boss, es tut mir leid, aber die Bellegardes werden früher da sein als erwartet. Wir müssten gleich schon wieder los, wenn wir pünktlich am Flugplatz sein wollen.«
»Oje«, seufzt die Hausherrin und blickt zu mir herüber. »Heute geht wirklich alles drunter und drüber.«
Ohne dass ich Gedanken lesen kann, verstehe ich ihr Problem: Sie weiß nicht, wohin mit mir. Ich überlege noch, ob ich ihr sagen soll, dass ich alleine klarkomme, aber da hebt sie bereits klackernd den Hörer des antiken Telefons von der Gabel und bringt mit dem Zeigefinger die Wählscheibe zum Surren. Das alte Ding ist gar kein Museumsstück. Es scheint tatsächlich noch zu funktionieren, denn einen Moment später spricht sie in den Hörer: »Könntest du bitte schnell mal in die Halle kommen? … Keine Widerrede. Sofort.«
Kurz darauf poltern Füße die elegante Holztreppe hinunter. Erst sehe ich braun gebrannte Beine und pinke Turnschuhe, dann erscheint Caroline in einem coolen Jeans-Minirock und einem mintfarbenen Top. Sie könnte so makellos schön sein, wäre da nicht ihr genervter, motziger Gesichtsausdruck.
»Was denn? Ich hab keine Zeit. Bin gleich verabredet. Wir müssen noch megaviel für die Party morgen Abend vorbereiten.«
»Tja, manchmal gibt es im Leben Wichtigeres als Partys«, erwidert Frau von Westhagen streng. »Darf ich vorstellen? Das ist Kimia. Du kennst sie vielleicht noch aus dem Museum. Sie ist die Tochter von Frau Larsen.«
Caroline sieht mich so entsetzt an, als wäre ich ein unheimlicher Geist. Dann mustert sie mich von oben bis unten, sodass ich mich sofort schäme, für meine alten Sneakers, meine langweiligen blauen Shorts und das T-Shirt mit Gänseblümchenaufdruck, das mir jetzt sehr kindlich vorkommt. Natürlich bleibt ihr Blick an meiner Sonnenmütze hängen.
Was ist das denn?, sagen ihre Augen, aber zum Glück reißt sie sich zusammen und schweigt.
»Ich möchte, dass du dich um Kimia kümmerst, bis ich zurück bin. Du könntest ihr schon mal unsere Gästezimmer zeigen. Sie darf sich gerne eins aussuchen.«
Caroline wirkt überhaupt nicht begeistert.
»Was tut sie überhaupt hier?«, fragt sie über meinen Kopf hinweg, als wäre ich gar nicht anwesend.
»Ihre Mutter hatte einen Unfall und liegt im Krankenhaus. Mindestens bis morgen ist Kimia deshalb unser Gast. Und ich muss jetzt die Bellegardes vom Flughafen abholen und ins Hotel fahren.«
»Wo ist Papa? Kann der das nicht machen?«
»Der musste in Berlin bleiben. Wichtige Sitzung. Er kommt erst in ein paar Tagen zurück.«
»Und Sergej?«
»Der hat heute Abend Musicalprobe. Keine Diskussion mehr. Sonst ist die Party morgen gestrichen.«
Caroline knurrt. Dann dreht sie sich langsam zu mir um, während ihre Mutter und Darja das Herrenhaus eilig wieder verlassen.
An meinem Bein spüre ich plötzlich etwas Weiches. Für einen Moment glaube ich, ein Schnurren zu hören, aber da ist nichts. Sehr seltsam.
»Habt ihr Katzen?«, frage ich.
»Einen Kater«, antwortet Caroline. »Wieso? Hast du ihn irgendwo gesehen?«
»Gesehen? Das nicht gerade«, entgegne ich, verschweige aber meine kleine Wahnvorstellung. Sonst hält sie mich noch für verrückt.
»Na los. Komm mit«, fordert sie mich auf und geht zur Treppe. »Wir suchen dir jetzt ein Zimmer aus. Wo willst du lieber wohnen? Bei Vincent oder bei Wassily?«
Bei Vincent oder bei Wassily?
Was ist das für eine komische Frage?
Statt zu antworten, muss ich an noch mehr mögliche Haustiere denken. Vincent klingt nach einem lustigen kleinen Hund. Wassily könnte eine Rennmaus sein. Weil ich nicht sofort reagiere, wiederholt sie genervt: »Vincent oder Wassily?«
»Vincent«, sage ich und versuche, völlig gechillt und selbstbewusst zu klingen, obwohl ich mich in ihrer Nähe so ungewollt und verachtet fühle wie eine Laus.
»Gut. Wie du willst«, antwortet Caroline und führt mich über die herrschaftliche Treppe nach oben. Ich folge ihr durch einen breiten Flur mit wunderschönen stuckverzierten Decken und Landschaftsmalereien an den Wänden bis zu einer Tür mit der Aufschrift »Suite Vincent«. Ich lausche, höre aber kein Bellen. Und drinnen ist auch niemand. Kein Hund, keine Rennmaus, kein anderes Lebewesen namens Vincent. Nicht mal eine Stubenfliege.
»Ich hätte mich ja an deiner Stelle für Wassily Kandinsky entschieden«, sagt Caroline. »Seine Bilder sind viel cooler als die von van Gogh.«
Jetzt bemerke ich die Gemälde an den Wänden. Ein Olivenhain neben dem Spiegel über der Kommode, ein Dorf bei Nacht im Sternenschein neben dem Himmelbett und eine Vase mit Sonnenblumen an der Wand neben dem Holzschrank.
Ach herrje. Ich Depp. Vincent ist kein Hund, sondern der berühmte Maler Vincent van Gogh. Das Sonnenblumenbild habe ich schon mal in einer Zeitschrift im Museum gesehen.
»Sind die echt?«, frage ich erstaunt. Möglich wäre es, denn Frau von Westhagen ist schließlich die Geschäftsführerin der Linneberger Museen und damit eine Fachfrau für Kunst.
»Du Dulli«, sagt Caroline kopfschüttelnd. »Von Kunst hast du keine Ahnung, was? Das Original der Sternennacht hat einen Wert von über hundert Millionen Dollar. Das hier sind natürlich Kopien. Die haben Studierende gemalt und meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt.«
Ich bin völlig überfordert und bringe kein Wort heraus. Innerlich ärgere ich mich über ihre überheblichen Worte. Auch wenn ich keine Expertin bin, bin ich doch oft im Museum bei meiner Mutter, und ich mag die Kunstwerke dort.
Ungeduldig schaut Caroline auf ihr Handy und schnauft genervt. »Ich muss los. Wenn meine Mutter fragt, hast du mich weggeschickt. Haben wir uns verstanden?«
Dann lässt sie mich einfach alleine zurück.
Aber im Grunde bin ich ganz froh.
Ihre Nähe nimmt mir irgendwie die Luft zum Atmen, deshalb reiße ich erst mal das Fenster auf, um Sauerstoff in die Bude zu lassen.
Von hier aus habe ich einen grandiosen Blick über einen Teil der Parkanlage und den weiten Himmel. Ich lasse mich in den Sessel am Fenster fallen und schnappe mir mein Handy. Oh, wie gerne würde ich mit meinem Papa reden. Aber in Sydney ist es jetzt schon mitten in der Nacht. Kurz entschlossen öffne ich meinen Chat mit Tay, aber er ist offline. Schade. Genau jetzt hätte ich ihn dringend gebraucht.
Eine Weile später steht Frau von Westhagen in meinem Zimmer und schnaubt vor Wut, als sie Caroline nicht vorfindet.
»Ich wollte mich ausruhen. Da hab ich ihr gesagt, dass ich alleine klarkomme«, erkläre ich, wie befohlen. Es passt mir zwar nicht, für Caroline zu lügen, aber ich möchte sie auch nicht in die Pfanne hauen.
»Aha«, sagt Frau von Westhagen, und ich spüre, dass sie der Sache nicht traut, aber sie bohrt nicht weiter nach. Dann hält sie mir ein ultrapeinliches Kindernachthemd mit einem rosa Einhorn darauf vor die Nase, das bestimmt mal Caroline gehört hat. Ich lächele gequält und bedanke mich höflich. Anschließend fragt sie mich, ob ich Hunger habe, aber ich schüttele den Kopf. Tatsächlich ist mir irgendwie schlecht.
Bevor sie geht, zeigt sie mir noch das Gästebad nebenan und erklärt mir das antike Haustelefon in meinem Zimmer. »Wenn du etwas brauchst, einfach die 111 wählen. Es ist der direkte Draht zu Sergej, unserem Hausmanager. Also normalerweise. Heute meldet sich seine Frau Darja. Die hast du ja bereits kennengelernt.«
Sie zeigt aus dem Fenster auf ein Nebengebäude. »Sie wohnen drüben in der alten Remise. Ganz früher waren dort die Kutschen untergebracht. Heute sind unten die Garagen und oben ist die Angestelltenwohnung. Aber sie sind schnell im Haupthaus, wenn du etwas brauchst. Also keine Scheu.«
Dann verabschiedet sie sich und wünscht mir eine gute Nacht. Völlig erschöpft mache ich mich bettfertig und schlüpfe in das riesige Himmelbett, dessen Kissen und Decken so bauschig sind, dass sie mich fast verschlucken.
Jetzt, wo ich liege und alles um mich herum still ist, spüre ich plötzlich die Sorge um meine Mama in mich hineinkriechen wie die Kälte eines nassen Badeanzugs an einem zu kühlen Sommertag.
Hoffentlich geht es ihr gut.
Hoffentlich hat sie die Operation gut überstanden.
Hoffentlich hat sie keine Schmerzen.
Und hoffentlich ist sie wieder fit, bis wir nach Australien fliegen.
Australien!
Jetzt erst kommt mir der Gedanke, dass durch den Unfall möglicherweise der ganze Urlaub in Gefahr ist. Was, wenn wir nicht fliegen können? Dann sehe ich meinen Papa bis Weihnachten nicht mehr, der Tauchkurs fällt ins Wasser und statt Abenteuer warten hier nur langweilige Ferien in Linneberg. Plötzlich fühle ich mich noch schlechter, weil ich so was Egoistisches denke, und ich kann nicht anders und fange an zu weinen.
DAS FLÜSTERN
Drei Stunden später liege ich immer noch wach und mein Magen knurrt jetzt wie ein ganzes Rudel hungriger Wölfe. So wird das nie was mit dem Einschlafen. Ich muss dringend noch etwas essen. Eine Weile stehe ich vor dem antiken Haustelefon und denke darüber nach, die 111 zu wählen. Aber es ist bereits kurz nach Mitternacht, da schlafen der Hausmanager und seine Frau bestimmt schon längst.
Im Grunde könnte ich mir auch einfach selbst was zu essen machen. Jedes normale Haus hat eine Küche. Das wird in dem alten Kasten ja nicht anders sein. Vorsichtshalber ziehe ich meine Mütze auf den Kopf, dann schleiche ich mich aus meinem Zimmer und die Treppe hinunter.
In der Eingangshalle versuche ich, mich zu orientieren. Ein Flur führt von hier nach rechts, einer nach links. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet. Von ihren Gemälden aus glotzen mich alte Männer mit Bärten und Frauen mit Turmfrisuren miesepetrig an. Es gefällt ihnen wohl nicht, dass jemand in ihrem Haus herumschleicht. Mit Vergnügen mache ich ihnen eine lange Nase. Dann biege ich in den rechten Flur ab. Doch nur ein paar Meter weiter halte ich inne und lausche.
Was war das denn gerade?
Es klang wie ein Flüstern.
Nein, bestimmt waren es nur meine eigenen Schritte auf dem Holzboden oder der Wind vor den Fenstern.
Aber da. Wieder.
Jemand flüstert.
Ein gruseliger Gedanke überfällt mich. Vielleicht sind es die Ahnen der von Westhagens, die als Geister aus ihren Gemälden gestiegen sind und mir nun folgen. Mein Herz klopft jetzt bis zum Hals. Ich kann unmöglich umkehren, ohne ihnen direkt in die Arme zu laufen. Deshalb sause ich einfach weiter den Flur entlang. Dann, zwei Flügeltüren später, stehe ich plötzlich dort, wo ich hinwollte: mitten in der Küche des Herrenhauses.
Hier ist es ganz still. Ich höre nichts außer meinem eigenen Atem. Plötzlich muss ich über mich selbst grinsen. Manchmal bin ich wirklich noch ein kleines Kind mit zu viel Fantasie.
Ein Flüstern?
Geisterstimmen.
Na klar! Was sonst?
Kopfschüttelnd mache ich mich auf die Suche nach etwas Essbarem. Wenn ich was im Bauch habe, sehe ich bestimmt wieder klarer. Doch als ich gerade voller Vorfreude die Kühlschranktür öffne, höre ich ein Knirschen ganz in der Nähe. Es kommt von unter dem Dielenboden. Noch ein leises Ächzen folgt, das immer lauter wird.
Oh Gott, es sind keine Geister, es sind Einbrecher im Haus!
Schnell lasse ich die Kühlschranktür los und verstecke mich unterm Küchentisch. Durch die Stuhlbeine hindurch sehe ich plötzlich, wie sich der Boden in der Ecke des Raumes hebt und sich vor meinen Augen eine Falltür öffnet.
Wäre ich doch nur in meinem Zimmer geblieben.
Mit angehaltenem Atem beobachte ich einen Mann, der in die Küche kriecht. Im Schein der Laterne in seiner Hand sehe ich sein kantiges, grummeliges Gesicht. Er sieht gefährlich aus, groß und breitschultrig. Ich frage mich, ob ich schreien soll oder weglaufen oder einfach stumm abwarten, bis er wieder verschwunden ist.
Doch dann – noch während er die Laterne abstellt, um besser hinausklettern zu können – beginnt der Einbrecher tatsächlich, leise zu singen.
Hä???
»Probier’s mal mit Gemütlichkeit«, brummelt er vor sich hin, und sein Gesicht erstrahlt dabei. Kaum steht er in der Küche, macht er einen wackligen Tanzmove, dreht sich um sich selbst und verbeugt sich vor einem unsichtbaren Publikum. Ich sehe zwar nur den Saum seines gestreiften Herren-Nachthemdes und die Bärenpantoffeln an seinen Füßen. Aber es sieht so albern aus, dass ich beinahe laut lachen muss.
Das ist definitiv kein Einbrecher. Das muss Sergej, der Hausmanager, sein. Aber wieso kommt er mitten in der Nacht aus dem Keller?
»Das kann doch nicht wahr sein. Wer hat den Kühlschrank offen gelassen? Wenn ich den erwische«, höre ich ihn grummeln. Doch statt die Tür zu schließen, räumt er Sachen aus dem Kühlschrank und bringt sie zum Tisch.
Dann höre ich ihn mit sich selbst schimpfen: »Oje, Sergej, eine Katastrophe wäre das geworden. Wie konnte dir das nur passieren? Noch nie hast du es vergessen.« Anscheinend bereitet er über meinem Kopf etwas zu, und zwar so eifrig, dass er mir mit Schwung ein Stuhlbein an meinen großen Zeh donnert. Vor Schreck entfährt mir ein Laut. Natürlich halte ich mir sofort die Hand vor den Mund, aber ein Fiepsen ist schon raus.
Eine Sekunde später blendet mich das Licht der Laterne, ein funkelndes Augenpaar taucht daneben auf und blickt mir unter der Tischkante entgegen.
»Erwischt!«, sage ich und versuche es mit einem unschuldigen Lächeln.
»So, jetzt ganz langsam herauskommen«, bittet der Hausmanager ruhig, aber bestimmt.
Kleinlaut klettere ich aus meinem Versteck.
»Oha«, sagt er. »Wen haben wir denn hier?«
»Ich hatte Hunger«, verteidige ich mich.
»Tatsächlich«, sagt er, und ich merke, dass er mit seinem breiten Rücken den Blick auf den Tisch zu verstellen versucht. Er will nicht, dass ich sehe, was er so treibt.
»Und was machen Sie hier? Mitten in der Nacht?«, frage ich daher neugierig.
»Ich? Wieso? Ich musste nur noch etwas erledigen.«
»Tatsächlich«, äffe ich ihn nach, laufe um den Tisch herum und sehe hinter ihm einen Klumpen Teig liegen: »Aha, Sie backen im Dunkeln. Interessant.«
»Erwischt«, sagt er nun kleinlaut und setzt sich auf einen Stuhl: »Ich habe noch nie, wirklich noch nie, den Teig für den Hefezopf vergessen. Der muss über Nacht in den Kühlschrank, sonst wird er morgen früh nicht so fluffig, wie er soll. Eben im Bett ist es mir eingefallen. Da musste ich mich noch mal heimlich rausschleichen. Wenn das meine Frau mitbekommt. Dann ist die Hölle los. ›Sergej, du darfst in diesem blöden Musical mitmachen, aber nur, wenn du deine Arbeit nicht vernachlässigst.‹ Darja ist da sehr streng. Sie ist eher eine Freundin der klassischen Musik.«