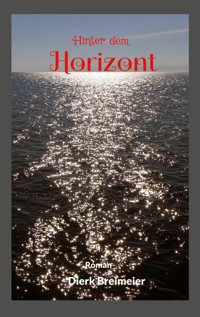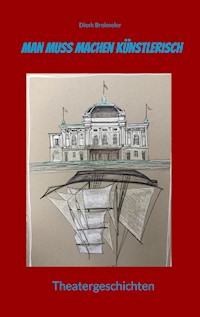
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In der hier vorliegenden Erzählung beschreibt der Autor seine ganz persönlichen Erinnerungen eines fast vierzig Jahre währenden Befufslebens an einem der renommiertesten Theater des deutschsprachigen Raumes, dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Ein Zufall hatte ihn ans Haus gebracht. Als einfacher Beleuchter begann er eine Laufbahn, die ihn schließlich an die Spitze der Abteilung führte. Die Geschichte seiner Karriere bildet gleichzeitig ein Bild der Geschichte des Deutschen Schauspielhauses ab. Er arbeitete u.a. mit Theatergrößen, wie Peter Palitzsch, Giorgio Strehler, Peter Zadek, Jürgen Gosch und Hans Kresnik zusammen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 Der Anfang
Kapitel 2 Auf der Bühne
Kapitel 3 Hans Lietzau
Kapitel 4 Geheimnisvolle Räume
Kapitel 5 Rolf Liebermann
Kapitel 6 Claus Peymann
Kapitel 7 Die neue Bühne Malersaal und dein Schauspieler das geheimnisvolle Wesen
Kapitel 8 Buh’s in Hamburg Bravos in Berlin
Kapitel 9 Im Stellwerk
Kapitel 10 Giorgio Strehler
Kapitel 11 Kunst und Politik
Kapitel 12 Wieder ein neuer Intendant
Kapitel 13 Kampnagel Halle 6
Kapitel 14 Zurück in der Kirchenallee
Kapitel 15 Ein Stück über die IRA
Kapitel 16 Andi
Kapitel 17 Der neue Malersaal
Kapitel 18 Karate Billy kehrt zurück
Kapitel 19 Ulrich Heising und die Reise nach Leningrad
Kapitel 20 Zum Abschluss eine Operette
Kapitel 22 Eine neue Ära
Kapitel 23 Die Zeit der Kronleuchter
Kapitel 24 Was hat das Flams mit der Fremdenlegion zu tun
Kapitel 25 Ein Sturm fegt durchs Theater, Hans Kresnik
Kapitel 26 Kein Tag wie jeder andere
Kapitel 27 Wieder Woyzeck
Kapitel 28 Ein frischer Wind weht durchs Haus
Kapitel 29 Jürgen Gosch und Johannes Schütz
Kapitel 30 Der Meister ist zurück
Kapitel 31 Wie dem Schauspielhaus Hörner aufgesetzt wurden
Der Anfang
Ja, und so fand ich mich dann an einem Montagmorgen, etwa Ende Oktober des Jahres 1969, bekleidet mit einem grauen Kittel, auf den Brettern, die die Welt bedeuten wieder.
Zur damaligen Zeit allerdings konnte ich mit diesem Begriff absolut nichts anfangen. Für mich wären Bretter, die die Welt bedeuteten, bisher eher die Decksplanken eines Schiffes gewesen.
Es war ja gerade einmal knapp ein halbes Jahr her, dass ich, als Dritter Offizier, auf der Brücke der „Gertrud Russ“ gestanden und mich auf der Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal, zusammen mit dem Rudergänger, über die Besatzung eines Schiffes der Bundesmarine lustig gemacht hatte.
Und es war auch durchaus nicht Berufung, die mich nun zum Theater geführt hatte. Tatsächlich hatte ich keinerlei Vorstellung davon, was mich dort erwartete.
Wie die meisten von uns war ich wohl als Schüler ein oder zweimal im Theater gewesen, und, da ich dachte, Theaterbesuche dienten der Bildung, sogar noch zweimal während meiner Zeit bei der Marine, im Stadttheater Flensburg und Bremerhaven.
Aber das war es dann auch schon gewesen.
Das Einzige das ich mitbrachte, an diesen heiligen Ort der Kunst, war die mir von meiner Mutter mit auf den Lebensweg gegebene Liebe zur Literatur.
In der Zeit, als ich noch als Matrose in der sogenannten Großen Fahrt fuhr, da besprachen wir manchmal in der Mannschaftsmesse, dass es vielleicht nicht verkehrt sei, sich rechtzeitig genug um einen Job an Land zu kümmern, solange es da für Seeleute noch etwas gäbe.
Die ersten Reedereien hatten zu jener Zeit damit begonnen, Schiffe „auszuflaggen“, wie man das nannte. Plötzlich wehte dann nicht mehr die deutsche Flagge am Heck, sondern diejenige von Liberia oder Panama.
Das klingt für Uneingeweihte zunächst einmal recht harmlos.
„Ja, die Reeder wollen wahrscheinlich Steuern sparen.“, das dachte man sich wohl dabei.
„Ist ja vielleicht verständlich.“
In Wirklichkeit bedeutete es aber das Ende einer Art von Seefahrt, wie es sie seit hunderten von Jahren gegeben hatte und die sich seit der Zeit der Phönizier kaum geändert hatte. Sie dauerte nur noch fast genau bis Ende der siebziger Jahre. Hier vielleicht ein Hinweis: so sahen die Veränderungen aus Wenn ein Schiff nicht mehr deutsch ist, sondern zum Beispiel panamesisch, dann gilt auf dem Schiff plötzlich nicht mehr deutsches Recht, sondern panamesisches. Man unterliegt dann plötzlich nicht mehr deutscher Rechtsprechung, und man ist auch nicht mehr durch deutsche Gesetze geschützt. Desweiteren gelten keine deutschen Sicherheitsvorschriften und natürlich auch nicht mehr die mit der Gewerkschaft ausgehandelten Tarifverträge.
In der Konsequenz bedeutete das, dass man von heute auf morgen seinen Job los sein konnte, es sei denn, man wäre bereit gewesen, das alles zu akzeptieren und sich mit dem Lohn eines philippinischen Matrosen zufrieden zu geben, und das war weniger als ein Zehntel dessen, was ein deutscher Matrose verdiente. Die Reedereien sparten somit Unmengen von Geld, und da der Sitz der Reederei in Deutschland verblieb, kamen sie nebenbei noch in den Genuss von nicht gerade wenigen Subventionen.
Handel gilt als wichtig und als nationales Anliegen. Das Ganze nennt man, wie wir heute wissen, Globalismus, und man gilt im Allgemeinen als nicht mehr zeitgemäß, wenn man Globalismus nicht gut findet.
Aber das alles hätte vielleicht die Seefahrt nicht verschwinden lassen. Den Todesstoß gab ihr die Containerschifffahrt. Die Schiffe wurden mehr und mehr zu riesigen, schwimmenden Behältern und mit ihnen verschwanden die Hafenstädte dieser Welt. Seefahrt und das bunte Treiben in verqualmten Hafenkneipen und Hafenbordellen, das gehört zusammen.
Mit den Schiffen verschwand eine ganze Welt, eine lebhafte, faszinierende und zutiefst romantische Welt.
Jahre später, ich hatte dann doch noch die Seefahrtsschule besucht und mein Steuermannspatent gemacht, beschloss ich, die Seefahrt an den Nagel zu hängen und mir einen Job an Land zu suchen. Es wurde hohe Zeit dafür. Im Gegensatz zu meinen ehemaligen Matrosenkollegen hatte ich keine Sorge, Arbeit zu finden. Ich hatte ja irgendwann vor langer Zeit Elektriker gelernt. Dass ich inzwischen nicht mehr die geringste Ahnung mehr von all diesen Sachen hatte, brauchte ja niemand zu erfahren.
Und so geschah es dann, dass die erste Elektrofirma, die ich zwecks Bewerbung anrief, mich sogleich einstellte. Ich vermute, die glaubten, wie jeder andere dem ich erzählte, dass ich zur See gefahren sei, auch, dass ich natürlich als Schiffselektriker gearbeitet hätte. Wozu hätte ich wohl sonst Elektriker lernen sollen? Dass ich alle technischen Dinge im Grunde meines Herzens hasste, musste ich ja niemandem aufbinden. So schickte man mich, als leitenden Monteur, dann auch sogleich mit zwei Lehrlingen auf den Bau. Ach herrje, ich erinnerte mich, dass ich stets nach Feierabend, es war ja Sommer, im Liegestuhl des Gartens meines Großvaters in Hamburg-Langenhorn, lag, um Formeln und Schaltpläne zu studieren.
Befragte mich einer der Lehrlinge zu irgendwelchen technischen Problemen, so vertröstete ich ihn auf Morgen, ich hätte im Augenblick gerade furchtbar viel zu tun.
Eines schönen morgens geschah es, dass mir mein Großvater, für mich war er der Hamburg-Opa, obwohl ich nur diesen einen hatte und er war nicht einmal mein leiblicher, eine Stellenanzeige in der Hamburger Morgenpost zeigte.
„Hier, guck mal, das wäre doch vielleicht etwas für dich.“
Das Schauspielhaus in Hamburg suchte einen gelernten Elektriker als Beleuchter.
Beleuchter?? Was war das denn für eine komische Berufsbezeichnung? Hatte ich noch nie gehört. Andererseits mussten die Schauspieler in einem Theater ja vielleicht auch irgendwie beleuchtet werden.
Ich stellte mir das so vor, dass irgendwo hinter dem Portal ein großer Schalter, vielleicht so eine Art von Hebel, sein müsste, wo das Licht eingeschaltet werden sollte, wenn der Vorhang aufging.
Die Annonce war schon einige Tage alt, aber der Herbst nahte und dann käme der Winter und ich hatte irgendwie keine Lust im Winter auf dem eiskalten, zugigen Bau zu arbeiten. Im Theater war es sicher warm und vielleicht wäre dieser Job, wenn er mir auch ein wenig anspruchslos erschien, im Augenblick genau das Richtige.
Ja, und dann stand ich dort in meinem grauen Kittel auf der Bühne und kam mir ein wenig blöd vor. Ich hatte den Abteilungsleiter nach der Dienstkleidung gefragt und diese Auskunft erhalten, dass man als Beleuchter einen grauen Kittel trüge. Also hatte ich mir einen solchen gekauft, hatte ihn aber, um nicht gar zu bescheuert darin auszusehen, von meiner Freundin um einige Zentimeter kürzen lassen.
Wie ich bald feststellte, gab es einige Beleuchter mehr als ich angenommen hatte. Diese waren an jenem Tag gerade dabei, die Vormittagsprobe einzurichten.
Das Stück, welches geprobt werden sollte, hieß „Woyzeck“ und in einer Woche sollte Premiere sein. Der Regisseur war Niels Peter Rudolph, ein junger, begabter Künstler, welcher der neuen Riege deutscher Theatermacher angehörte, die Klassiker neu und in Bezug zu gesellschaftspolitischen Fragen der Gegenwart auf die Bühne brachten. Niemand von uns Anwesenden ahnte natürlich, dass dieser nachdenkliche und hoch intellektuell wirkende junge
Regisseur einmal Intendant dieses Hauses werden würde. Aber es ahnte ja ebenfalls niemand, dass ich selber von diesem Tage an achtunddreißig Jahre an diesem
wunderschönen Haus zubringen würde, ja, dass ich einmal sogar Abteilungsleiter werden würde und das Theater sogar zeitweilig zu meiner Wohnung werden sollte.
Ich fand mich schnell hinein in die Arbeit eines Beleuchters und das Stück „Woyzeck“ gefiel mir ausnehmend gut. Ich hatte im Laufe meines Werdeganges und meiner Reisen um die Welt eine, ich möchte sagen, starke Neigung zu den Ideen des Sozialismus entwickelt und diese Geschichte, des einfachen, gequälten Mannes, der durch die Arroganz und die Niedertracht der Mächtigen in einer solchen Weise in die Verzweiflung getrieben wurde, dass er am Ende die eigene (geliebte?) Frau umbrachte, zog mich in ihren Bann.
Den „Woyzeck“ spielte Fritz Lichtenhahn und die Marie Angela Schmid, sehr eindringlich und überzeugend.
Es gibt in dem Stück eine Jahrmarktszene, in der ein Affe von einem Gaukler vorgeführt wird, der auf ein Zeichen hin die Hand zum militärischen Gruße an die Mütze führt.
Vielleicht erinnert sich der eine oder der andere an die alten Zeiten, als die Kaufhäuser der Städte in der Weihnachtszeit ihre Schaufenster mit allerlei Szenen aus der Wichtelwelt dekorierten. Da gab es schneebedeckte Tannen und Holzhütten, vor denen Zwerge allerlei Verrichtungen zur Herstellung von Weihnachtsgeschenken für den Weihnachtsmann herstellten. Rehe und Hasen schauten ihnen dabei zu. Es war eine wundervolle Traumwelt und ich drückte mir als Kind die Nase platt an der großen Glasscheibe der Schaufenster. Die Wichtel und auch die Tiere bewegten sich dabei richtig. Sie hämmerten und sägten, nickten mit dem Kopf und die Tiere drehten ihre Köpfe von links nach rechts. Sie alle wurden von einer unsichtbaren Mechanik angetrieben.
Von dieser Art war auch der Affe hier im „Woyzeck“. Er hockte auf einer Holzkiste, in der ein Motor und die Mechanik verborgen waren. Der Schauspieler musste nur einen Schalter auf der rückwärtigen Seite der Kiste betätigen, damit der Affe sich im rechten Moment bewegte und dreimal seinen militärischen Gruß ausführte.
Dieser Affe nun verbrachte, nachdem das Stück abgespielt hatte, Jahre um Jahre in den Lagern der Beleuchtung. Irgendwann gab es nur noch mich, der wusste was der Inhalt dieser Kiste war, die da jahrelang herumstand, in den hintersten Ecken des Lagers, und eines Tages war er dann auch verschwunden. Niemand bemerkte es. Der Fundus des Theaters, welcher mit den Zeiten immer mehr aus den Nähten platzte, zog häufig um, entweder, weil gerade umgebaut wurde oder weil einfach mehr Platz gebraucht wurde.
Jetzt aber kommt der eigentliche Teil der Geschichte, die so typisch für das Theater ist.
Ich war bereits seit etwa zehn Jahren pensioniert und besuchte eines Abends mit meiner Frau eine Premiere. Es war ein Stück von Christoph Marthaler.
In einer der typisch Marthalerschen Massenszenen am Ende des Stückes, fuhr ein ferngelenkter Affe auf einer Kiste durch das Gewusel der Schauspieler.
Plötzlich, ich traute meinen Augen nicht, aber das war doch der Affe aus ´Woyzeck`!
Anna Viebrock, die Bühnenbildnerin, hatte, immer auf der Suche nach Außergewöhnlichem, die Leidenschaft, die Fundi der Theater, an denen sie arbeitete, zu durchsuchen, nach etwas, das sie vielleicht für ihr Bühnenbild gebrauchen könnte. Da muss ihr dann wohl dieser Affe nach seinem jahrzehntelangen Schlaf in die Hände gefallen sein, den sie daraufhin zu neuem Leben erweckte.
Warum das erst bei diesem Stück geschehen war und nicht schon früher, schließlich war sie sieben Jahre lang Ausstattungsleiterin dieses Hauses gewesen und sicher schon ein Dutzend Mal durch den Fundus gestrichen, ist eines der Geheimnisse des Theaters.
Alles taucht, längst vergessen, irgendwann wieder auf.
Auf der Bühne
Meinen Kittel ließ ich nach etwa zwei Wochen zu Hause.
Etwa zeitgleich mit meinem Eintritt in die Beleuchtung des Schauspielhauses Hamburg war ein weiterer Kollege eingestellt worden. Wir waren nicht allein die beiden Neuen sondern auch die beiden Jüngsten. In einer Abteilung, in der bis auf uns beide, alle älter als fünfzig waren, war dies eine Zäsur.
Die grauen Kittel waren für uns das, was für die Studenten die Talare waren, und unter ihnen steckte der Muff von tausend Jahren.
Man schrieb das Jahr 1969 und die Hippie-Welle hatte, aus San Franzisko kommend, Hamburg erreicht. Mein Kollege war Halbgrieche und er trug eine Haarpracht wie „Angela Davis“. Man nannte das damals „Afro-Look“, und auch ich hatte mir inzwischen eine beachtliche Matte wachsen lassen. Nicht allein, dass ich mich der Hippie Generation zugehörig fühlte, nein, ich betrachtete mich sogar sozusagen als Fachmann. War ich doch zwei Jahre zuvor selber in „San Franzisco“ und im „Ashbury-Haight District“ gewesen.
Etwa drei Wochen später kam noch ein dritter Kollege von ähnlichem Kaliber hinzu und man kann es sich unschwer vorstellen, wir waren in dieser Truppe von Graukitteln so eine Art von Paradiesvögeln.
Im ehrwürdigen Deutschen Schauspielhaus hatte die „neue Zeit“ begonnen! Zumindest in der Technik, mit der Kunst tat man sich aber, wie wir bald lernen sollten, ebenfalls schwer. Nach nur wenigen Tagen in der Beleuchtung, hatte ich das Wesen dieser Tätigkeit begriffen und kam zu dem Schluss, dass sich der Aufwand, vom Anspruch und von der Menge der Arbeit her gesehen, durchaus in Grenzen hielt.
Die Abteilung Beleuchtung bestand damals aus achtzehn Mitarbeitern, also gar nicht einmal so viel weniger als heute, da sich die Arbeit inzwischen allerdings fast verdreifacht hat. Die Belegschaft setzte sich zusammen aus dem
Abteilungsleiter, zwei Beleuchtungsmeistern, drei Stellwerksbeleuchtern und jeweils drei Beleuchtern auf der Saaldecke, der Brücke und den Galerien, sowie drei auf der Bühne links sowie auf der Bühne rechts. Von denen wiederum war dann jeweils einer der sogenannte Oberbeleuchter (Hihi), alles in allem also eine geradezu klassische Hierarchie.
Die Anzahl von drei Personen je Station wurde gebraucht, um Wechselschichten sowie Dienste an Sonn- und Feiertage bedienen zu können. Das ging rechnerisch nicht immer auf, und so konnte es vorkommen, dass man sich mitunter auch einmal zu zweit auf einer Station befand. Nun sollte man vielleicht annehmen, dass dies vornehmlich immer dann der Fall war, wenn auf der Station mehr Arbeit als gewöhnlich anfiel, aber weit gefehlt, es steckte eher das schöne Prinzip Zufall dahinter. Nicht genug damit - wenn auf einer Station besonders viel zu tun war, könnte man sich vielleicht denken, dass die Personen, die auf ihrer Station nicht so viel zu tun hatten, denen dann zu Hilfe kamen, die viel Arbeit hatten.
Irrtum Nummer zwei: Das war völlig ausgeschlossen.
Stellen wir uns vor, auf der linken Bühnenseite stünden fünf oder sechs Stative mit Scheinwerfern, (aus einem mir unbekannten Grunde verhielt es sich tatsächlich meistens so, dass auf der linken Seite stets viel mehr Licht aufgebaut war) auf der rechten aber nur zwei, und obendrein wäre die rechte Seite an diesem Tage aus dem nun bekannten, weil zufälligen Grunde, mit zwei Beleuchtern, also doppelt besetzt. In so einem Fall verhielt es sich dann stets so, dass diese beiden Beleuchter nach Stückschluss ihre zwei Scheinwerfer abbauten und nach Hause gingen.
Der Kollege auf der linken Seite aber baute alle seine sieben Scheinwerfer alleine ab. Die Kollegen auf den so genannten oberen Stationen, Brücke und Saaldecke, waren in einem solchen Fall ohnehin längst verschwunden.
Nicht ohne Grund nannten wir die Saaldecke die „Rentner Station“. Es gab dort sechsundzwanzig Scheinwerfer, die aber natürlich nicht alle in jeder Vorstellung spielten, plus zwei Verfolger. Der Deckenbeleuchter hatte nichts anderes zu tun, als beim Einleuchten der
Abendvorstellung oder der Probe, diese paar Scheinwerfer einzurichten, zu „fokussieren“, wie der Österreicher sagen würde.
In den oberen vorderen Logen und an der Proszeniumskante hingen noch einmal acht bis zehn Scheinwerfer. Diese aber wurden, einfach nebenher, von den Bühnenbeleuchtern bedient, die wiederum alle in und neben der Dekoration aufgebauten Scheinwerfer aufzubauen, zu verkabeln und zu leuchten hatten. Dazu kam noch das Einleuchten der Turmscheinwerfer und, wenn man mit alldem fertig war, gab es noch Auftrittslampen und Lichtzeichen einzurichten. Das war, gelinde ausgedrückt, eine seltsame Arbeitsverteilung.
Tatsächlich handelte es sich bei den Mitarbeitern in der Saaldecke um die ältesten Mitarbeiter der Abteilung und vielleicht wollte man sie bis zum Erreichen ihrer Rente noch etwas schonen. Sie hatte ja auch noch ihre Verfolger zu bedienen. An ihrem Arbeitsplatz dort in der Saaldecke, der so genannten Z-Brücke, hatten sich die Kollegen hinter den beiden Verfolgern eine Schlafmatte ausgebreitet und man mag es glauben oder nicht, es soll hier und da vorgekommen sein, dass Schnarchgeräusche von dort oben während der Probe im Parkett zu hören gewesen sein sollen.
Na, da war ich nun wohl in einer richtigen deutschen Behörde gelandet.
Ich hatte zu jener Zeit die vielleicht ein wenig alberne Angewohnheit, wie die Chinesen zu sprechen, die ja bekanntlich kein R sprechen können, möglicherweise hatte ich mir das aus China mitgebracht. In der gesamten Zeit, die ich am Schauspielhaus verbrachte und sogar später noch als Abteilungsleiter, hatte ich immer wieder so alberne Angewohnheiten, die häufig über mehrere Jahre anhielten. So kam es, dass ich unsere ehrwürdigen Oberbeleuchter immer mit „Hell Obelbeleuchtel“ ansprach.
Meine jungen Kollegen wollten sich schier schieflachen dabei und so blieb es bei dieser Bezeichnung. Witzigerweise bedienten sich später auch die Altgedienten und sogar die Betroffenen dieser Ausdrucksweise.
Die Einrichtung der Scheinwerfer und der Aufbau von so genannten Versatzscheinwerfern, so hießen die, die im oder am Bühnenbild aufgebaut wurden, wurde während der Beleuchtungsproben festgelegt und in sogenannten „Kontenten“ notiert, so dass jeder Beleuchter wusste, oder besser wissen sollte, was es bei den verschiedenen Aufführungen zu tun gab. Wenn der Aufbau eines Bühnenbildes beendet war, es gab derer zwei am Tag, morgens für die Probe und abends für die Vorstellung, wurde eingeleuchtet.
Wenn man jetzt aber vermuten sollte, dass ein jeder wusste, wo seine Scheinwerfer, die er zu bedienen hatte, hinzuleuchten hatten, schließlich stand es ja akribisch genau in seiner Kontente vermerkt, liegt man wiederum falsch.
Ich will damit auch gar nicht sagen, dass es nicht Kollegen gab, die das alles wussten, ich selber war nämlich so einer und meine jungen Kollegen auch, aber die Hierarchie ließ dies einfach nicht zu. Der Meister oder der Chef pflegten in der Regel persönlich auf der Bühne zu stehen und wie die Dompteure ihre Kommandos, bellend und wild gestikulierend, in Richtung der Beleuchter auszustoßen, um mit Akribie die Richtung der Scheinwerfer zu weisen.
Es war der reinste Kindergarten.
Ich, der ich noch vor Monaten ein Frachtschiff durch die Ostsee navigiert hatte, konnte im Grunde nichts anderes tun, als dies alles mit Humor zu nehmen.
Was blieb mir anderes übrig.
Außerdem, wir waren ja jung und niemand von uns wusste genau zu sagen, wie lange er diesen Zirkus überhaupt mitmachen würde.
Obwohl ich ja damals noch nicht viel vom Theater verstand, hätte ich dennoch niemals vermutet, dass der Unterschied zwischen der technischen und der künstlerischen Belegschaft derartig krass sei.
Hier die „Behörde“ mit geregelten Arbeitszeiten, dort die Künstler, die in ihrem Beruf förmlich aufgingen und so gut wie rund um die Uhr arbeiteten.
Erstere arbeiteten etwa so, als würden sie beispielsweise Autos herstellen oder Häuser bauen, letztere aber machten Kunst. Wie soll so etwas wohl zusammengehen?
Das mochten sich Regisseure und Bühnenbildner wohl auch denken und bedauern, aber zur damaligen Zeit war es in allen deutschen Theatern gleich.
Die Folge war, dass Regisseure und Bühnenbildner im Umgang mit der Technik ohne Ende pöbelten und herumbölkten. Manche konnten es mit Humor nehmen und lästerten eher als herumzuschreien, oder sie halfen sich mit Zynismus, das waren fast die schlimmsten.
Viele Jahre später, als sich das Missverhältnis zwischen Kunst und Technik erheblich verbessert hatte, denn es suchten nicht allein die Künstler nach neuen Wegen, sondern auch in der Technik wuchs mit der Zeit eine neue Generation heran, die mehr und mehr Verständnis und Engagement für die besondere Art der Arbeit zeigten. Das Theater, man muss es deutlich sagen, befand sich zu jener Zeit im Umbruch und es dauerte viele, viele Jahre bis die Zusammenarbeit sich merklich veränderte und dahin kam, wo man heute ist.
Ich selber habe, etwa ab den neunziger Jahren, fast nur noch freundliche Regisseure und Bühnenbildner kennengelernt, aber diejenigen der „Sturm und Drangjahren“ der Sechziger gab es natürlich auch noch. Sie konnten sich wohl nicht mehr ändern und brachten in der Regel immer noch ihr Vorurteil über die „schlechte“ Technik mit, wenn sie bei uns ans Haus kamen.Leider muss ich sagen, dass mir manche von ihnen damals das Leben wirklich schwer gemacht haben.
Aber zurück in die Sechziger. Unser Abteilungsleiter war so klug, uns Neue immerhin zusammen auf eine Station zu schicken. Für uns war das schön, für den Rest der Mannschaft indes nicht. Wir steckten sie nach kürzester Zeit alle in die Tasche. Die Folge war, dass sich Neid und Intrigen in der Abteilung breit machten.
Eigentlich glaube ich aber, dass das Miteinander wohl schon immer so gewesen war. Nun, ich will nicht übertreiben, es waren nicht alle so. Das erstaunlichste aber war, zumindest für uns junge Kollegen, dass an dem eigentlichen Produkt, nämlich an den Theaterstücken, niemand der älteren Kollegen Interesse hatte. Das konnte ich nun gar nicht verstehen.
Wir drei, wir glühten für das Theater.
Auf dem unteren Podest des linken Beleuchterturms hatten wir uns einen kleinen Hocker hingestellt und sahen uns von dort aus jede Probe und jede Vorstellung an. Ich lernte sehr schnell die vielen Schauspieler kennen und am Ende konnte ich fast alle ihre Texte mitsprechen.
Noch Jahre später, wenn ein Stück, dass ich aus meinen ersten Jahren kannte, in einer neuen Inszenierung probiert wurde, dachte ich immer, „diesen Satz muss man doch ganz anders aussprechen“.
Auf diese Weise lernte ich nach und nach das wahre Wesen des Theaters kennen. Ich begriff, dass ein Satz, wenn man ihn ganz anders oder auf eine besondere Weise ausspricht, dieser eine völlig neue Bedeutung erhält.
Es erschien mir als der wesentliche Unterschied zwischen dem Lesen eines Buches und dem Besuch eines Theaterstückes. Die Phantasie, die wir beim Lesen entwickeln, oder auch die Aussage, die wir in der Geschichte zu erkennen glauben, hat uns der Theaterregisseur scheinbar abgenommen.
Aber gar so einfach ist es nun doch wieder nicht, denn ein guter Regisseur oder auch gutes Theater lässt uns am Ende dann häufig doch wieder ratlos zurück, und man fragt sich hinterher nur allzu oft, was will uns der Künstler damit sagen. Das Denken wird uns bei hochwertigem Theater gerade eben nicht abgenommen und die eigene Phantasie, die uns beim Lesen eines Buches nie im Stich lässt, muss sich nun auch noch zusätzlich mit der Auslegung des Stoffes durch den Regisseur beschäftigen.
So lernte ich sehr schnell, dass jede Geschichte vielerlei, manchmal sogar erstaunliche Deutungen zulässt.
Und mit dieser Einsicht wären wir dann auch bei dem Problem, welches die Stadt Hamburg in den sechziger und auch noch in den siebziger Jahren mit dem Theater hatte.
Es befand sich, wie schon gesagt, zur damaligen Zeit in einem Umbruch.
Die Zeit war weiter gegangen und man suchte nach neuen Wegen.
Das Wesen des Theaters ist es ja, immer aktuell zu sein. Aber so war es in der Realität eben oft nicht.
Bis zum Jahre 1963 war es immer recht gut am Schauspielhaus gelaufen. Die Vorstellungen waren ausverkauft, die Zuschauer begeistert. Der Intendant war zum damaligen Zeitpunkt der legendäre Gustav Gründgens gewesen.
Da ich ihn aber nie kennengelernt und auch nie etwas von ihm gesehen habe, kann ich mir kein Bild von seiner Arbeitsweise und seinem Kunstverständnis machen. Die Hamburger schienen ihn jedenfalls heiß geliebt zu haben.
Er war, was damals noch die Regel war, ein Schauspieler-Intendant gewesen. Während der Nazizeit war er Generalintendant in Berlin gewesen, hatte nicht allein direkt Hermann Göring unterstanden, sondern soll wohl auch familiär mit ihm verkehrt haben. Wie auch immer, es gibt ja genug Geschichten über dies alles, in meiner Geschichte soll er keine Rolle spielen. Das heißt, ganz auslassen kann ich ihn auch nicht, denn im Schauspielhaus war Gustav Gründgens weiterhin auf eine fast unheimliche Art präsent. Man hätte ihn im Haus wohl am liebsten heiliggesprochen.
Ständig und überall hörte ich den Satz:
„Bei Gründgens ist das aber noch anders gewesen“, (soll heißen: da war die Welt noch in Ordnung), oder: „Bei Gründgens standen die Zuschauer an der Kasse bis in die Elmenreichstraße hinein“ und dergleichen mehr.
So dauerte es bis in die Spielzeit von Ivan Nagel, bis man halbwegs geschluckt hatte, dass es auch eine Ära nach Gründgens gab.
Endgültig aber wurden die Gründgens-Gespenster allerdings erst von Peter Zadek aus dem Haus gejagt. Geholfen hat ihm dabei eine gnadenlos gute und gnadenlos laute Rockgruppe namens „Einstürzende Neubauten“.
Aber ich will nicht abschweifen. Wenden wir uns zurück in die Sechziger.
Die Hamburger liebten es in diesen Jahren, ihre Schauspielhaus Intendanten nach mehr oder weniger kurzer Zeit, und stets noch vor Ablauf ihrer Verträge, aus dem Haus zu jagen. Niemand von ihnen wollte und konnte wie der selige Gründgens sein.
Der letzte Intendant, bevor ich dort meinen Dienst antrat, hatte es gerade einmal knapp drei Monate ausgehalten und der Verwaltungsdirektor führte mehr schlecht als recht, oder auch umgekehrt, das Haus.
Aber es gab Licht am Horizont, ein Neuer war ausersehen und sollte im nächsten Monat eintreffen, um dann ein bisschen so wie ein „Kai aus der Kiste“ das Haus zu retten.
Sein Name war Hans Lietzau und er wurde mein erster Intendant.
Sein erstes Stück wurde ein krachender Misserfolg.
Das lag aber nicht an ihm. Er war ja holterdiepolter ans Haus geholt worden und ihm fehlte natürlich die Vorlaufzeit. Das Stück „Clavigo“, welches seine Spielzeit eröffnete, war zudem bereits von seinem Interimsvorgänger geplant worden. Sein Regisseur war Fritz Kortner, ja ich möchte sagen, der berühmte Fritz Kortner, und die Schauspieler allesamt sehr hochkarätig, die besten, die man zu jener Zeit kriegen konnte. Namen wie Rolf Boysen und Werner Hinz, die allerdings vorher schon zum Ensemble gehört hatten, Thomas Holtzmann, (noch heute habe ich seine unverwechselbar eindrucksvolle, knarrende Stimme im Ohr), Martin Benrath, Judith Holzmeister, Kyra Mladek und Christine Ostermeier. Später kamen dazu noch Herbert Mensching, Heinz (Schubi) Schubert und Helmut Griem dazu.
Fritz Kortner nun als Regisseur - ich spürte bei fast allen Mitarbeitern eine Art von Antipathie gegen ihn. Das konnte ich mir zunächst nicht so recht erklären, bis ich hörte, dass er Jude sei und während der Nazizeit emigriert gewesen war. Wie ein Mann wie Fritz Kortner, so bald nach der Nazi Zeit, in Deutschland wieder arbeiten mochte, das konnte ich damals nicht so recht nachvollziehen.
Viele, viele Jahre später begriff ich erst, was Menschen jüdischen Glaubens dazu gebracht hat, nach dem Krieg gleich wieder nach Deutschland zu kommen. Denn sie waren ja alle noch da, die Nazis, und sie saßen durchaus auch noch vielerorts an den Schalthebeln. Es wäre wohl mehr als naiv gewesen anzunehmen, dass plötzlich alle geläutert gewesen wären.
Aber ich habe dann irgendwann in einem Interview mit einem überlebenden KZ-Insassen gelesen, dass es für die Juden fast schlimmer als der Tod gewesen war, dass man sie ihrer Heimat beraubt hat. Sie waren ja Deutsche gewesen, gute und schlechte, aber Deutsche, und sie hatten ihre Heimat geliebt wie jeder andere.
Kortner muss diese unterschwellige Feindschaft eigentlich auch unbedingt gespürt haben, aber er ließ sich wenig davon anmerken. Allerdings war er gegenüber der Technik oft recht ungehalten und der fehlende Enthusiasmus und das Ungeschick seitens der Technik stimmten ihn unzufrieden.
Ich konnte das gut verstehen.
Aber er hatte ja seine Schauspieler und ich persönlich bekam zum ersten Mal einen Eindruck vom intensiven Zusammenhalt unter den Künstlern.
Das war am Theater so und es war wirklich einzigartig in der gesamten Berufswelt.
Ja, und das war jetzt wirklich tragisch, Kortners „Clavigo“ wurde bei der Premiere gnadenlos ausgebuht.
Lietzau war drauf und dran, seinen Regisseur auf die Bühne zu begleiten um ihn zu schützen und die ´Buh’s` auf sich zu nehmen, aber Fritz Kortner ließ es sich nicht nehmen.
„Ich habe das Stück gemacht und ich stehe dazu!“
Im Gegensatz zur Hamburger Presse, die allesamt, mit Ausnahme des „Spiegel“ und „Die Zeit“, das Stück verrissen hatten, fielen die Zeitungskritiken deutschlandweit durchweg begeistert aus.
Das Stück wurde zum Theatertreffen nach Berlin eingeladen und von den Berlinern bejubelt.
Mir selber, ich muss es leider gestehen, gefiel es allerdings nicht besonders. Ich war nicht so der große Klassik Fan. Mir hatten sie die Klassiker bereits in der Schule ausgetrieben.
Wie hatten die Deutschlehrer uns nicht mit Goethe, Schiller, Lessing und Kleist gequält.
Der erste „Clavigo“ der mir dann wirklich gefiel, ja, der mich förmlich vom Sitz riss vor Begeisterung, war viele, viele Jahre später der „Clavigo“ von Frank Castorf.
Hans Lietzau
Die lebhafte deutsche Theaterlandschaft, um die uns die ganze Welt beneidet, zumindest kann man das immer wieder irgendwo lesen, entstand vermutlich durch die Viel- und Kleinstaaterei. Jeder Fürst, Graf oder was es sonst noch so gegeben haben mag, ließ es sich natürlich nicht nehmen, der restlichen Welt zu zeigen, welch kunstsinniger Mensch er doch sei. Das war eine Zeit, in der man mit Fördern von Kunst noch punkten konnte. Den Reichen und Mächtigen von heute reicht da heute schon ein besonders PS-starker SUV oder in der Steigerung vielleicht eine sündhaft teure, eigene Yacht.
Und der Staat, der heute für das Weiterbestehen der vielen Theater zahlt, würde wohl am liebsten wenigstens die Hälfte davon schließen. Kunst ist teuer, wird sowieso von niemandem verstanden und im Grunde nerven die nur, die Künstler. Diese Haltung gegenüber der Kunst herrschte zum Glück nicht immer, sonst hätten wir wohl schwerlich das Volk der Dichter und Denker werden können.
In Hamburg, vor etwas über hundert Jahren, wollte das wohlhabende Bürgertum es den Fürsten einmal richtig zeigen, nämlich, dass sie auch etwas von Kunst verstünden, und sie bauten die bis heute größte Sprechbühne Deutschlands, das Schauspielhaus Hamburg.
Es war bereits 69 Jahre alt, als ich zu diesem stolzen Tempel der Kunst stieß und ich sollte dann, ich hätte es damals nicht für möglich gehalten, 38 Jahre lang dortbleiben.
Es waren Jahre des Auf und Ab, aber es wurde unbestritten, und darauf sind wir, die wir dazugehörten, mächtig stolz, deutsche Theatergeschichte geschrieben.
Zunächst aber sah es gar nicht danach aus.
Zugegeben, es war auch wirklich schwer. Das Haus war viel zu groß, als dass man es hätte mit Schauspiel füllen können. Außerdem gab es ein zweites Theater in der Stadt, und das war immer gut verkauft. Dieses gehörte zu der von mir schon erwähnten Kategorie zwei, in der die Regisseure dem
Publikum das Denken freundlicherweise weitgehend abnahmen. Flotte, unterhaltsame Aufführungen von, zugegeben, durchaus hoher Qualität fanden hier statt, und an diesem Haus, das heißt, genauer gesagt an dessen abendlichen Einnahmen, wurde das Schauspielhaus stets gemessen.
Das scheinbare Dilemma des Schauspielhauses war, was soll man sagen, in etwa so: Sie bekamen es einfach nicht hin, entweder so zu sein wie der viel gepriesene Gustav Gründgens, oder wenigstens so wie die Konkurrenz. Dass das Konkurrenzunternehmen lediglich etwas mehr als halb so viel Plätze wie das Schauspielhaus hatte, wurde bei diesen Debatten unseriöser Weise verschwiegen.
Hans Lietzau, Schauspieler-Intendant wie seine Vorgänger, war ein Vollblut Theatermann und hatte einen exzellenten Ruf. Er war ein Macher aber kein Diktator, stets gut gelaunt, was angesichts seiner denkbar undankbaren Aufgabe etwas verwunderte, und er war von einem überschäumenden Temperament.
Ich sehe ihn noch, als wäre es erst gestern gewesen - bei jeder Unterbrechung der Proben, voller Elan und mit beiden Händen gestikulierend, stürmte er die kleine Rampentreppe auf der linken Seite auf die Bühne.
Wenn er mit der Art, wie seine Schauspieler eine bestimmte Szene spielten, nicht ganz zufrieden war, kam es nicht selten vor, dass er ihnen vorspielte, wie er diese Rolle verstanden haben wollte. Das war unbedingt sehenswert, denn damit ein jeder auch wirklich verstehen sollte, was er meinte, übertrieb er stets dabei und häufig in geradezu slapstickhafter Weise. Ich mochte ihn sehr und ich genoss es ebenso, seinen Proben zuzusehen.
Von allen Stücken, die er in seiner viel zu kurzen Zeit am Schauspielhaus machte, gefiel mir „Indianer“ von Arthur Copit am besten. Es war ein Stück über die Ausrottung der
Indianer durch die weißen Landräuber, wenn ich die Amerikaner hier mal so nennen darf.
Es war damals die Zeit des Vietnamkrieges, und natürlich fassten die Feuilletonisten das Stück als ein auf Vietnam bezogenes Antikriegsstück auf. Ich erinnere mich noch an den Satz eines der Kritiker: „Lietzau sagt „Indianer“, meint aber Vietnam.“
Tut mir leid, ich verstand damals noch nicht sehr viel von Theater, aber ich hielt das für kompletten Unsinn. Ich konnte in der Handlung des Stückes keine Assoziation zu Vietnam entdecken.
Da ich über die Geschichte der USA allerdings recht gut Bescheid wusste, schließlich war ich ja auch schon selber dort gewesen, kannte ich natürlich die Namen all der Personen des Stückes.
Da gab es den „Buffalo Bill“, gespielt von Rolf Boysen, den Indianerhäuptling „Sitting Bull“, gespielt von Thomas Holtzmann. Werner Hinz spielte „Häuptling Joseph“, Heinz Schubert „Buntline“, ferner traten auf „Wild Bill Hickock“, gespielt von Hubert Suschka, und „Doc Hollyday“ den der junge Volker Lechtenbrink spielte.
Frauen kamen in diesem Stück, etwas verständlich, eher selten vor und wenn, dann als unschuldige Opfer. Besonders schwer hatte es die junge „Carola Regnier“, die von den Revolverhelden auf dem großen runden Billardtisch erst vergewaltigt und zu allem Überfluss später auch noch von Indianern an den Marterpfahl gebunden und mit wildem Kriegsgeheul umtanzt wurde.
Aber es gab eben auch sehr dichte, fast poetische Szenen, und natürlich absolut tragische, und es waren einfach wirklich großartige Schauspieler. Schauspieler wie diese, gibt es heute nicht mehr. Damit sollen aber keinesfalls die heutigen Schauspieler abgewertet werden, es ist einfach eine andere Art von Theater, das damals gemacht wurde.
Man legte damals sehr viel Wert auf Sprache. Sie hatten eine Sprache, eindringlich, klar, verständlich ohne dabei übertrieben laut zu sein, wirkmächtig möchte ich es nennen. Und es wurde lange nicht so viel herumgeschrien, wie das heute leider oft getan wird. Schreierei auf der Bühne habe ich nie gemocht und fand es auch niemals in irgendeiner Weise überzeugend. Die Schauspielstars jener Zeit konnten, indem sie ihre Stimme nur wenig erhoben und lediglich durch Akzentuierung, alle Gefühle ausdrücken, die man sich nur vorstellen konnte.
Es war wirklich sehr besonders und sehr beeindruckend, die Schauspielstars der damaligen Zeit zu erleben. Der Regisseur Frank Patrik Steckel sagte einmal während einer Probe zu mir, es handelte sich in diesem Fall um Adolph Spalinger und Peter Roggisch:
„Wenn die einmal gestorben sind, gibt es so etwas nicht mehr, solche Schauspieler wachsen nicht mehr nach“. Er hatte recht!
Nun gut, das Theater ist deshalb heute nicht weniger spannend. Heute wird eben anderes Theater gemacht, das ist ja auch richtig und gut, und es ist ja auch eine andere Zeit. Derjenige aber, der diese Schauspieler noch selber erlebt hat, konnte sich reich beschenkt fühlen. Was bleibt, ist die Erinnerung und auch diese wird mit uns sterben.
Das ist das Wesen des Theaters.
Theater ist und bleibt eine Kunstform, die immer stark an der Gegenwart ist und von daher, immer mit der Zeit gehend. Große und bewegende Momente aus der Vergangenheit des Theaters leben nur noch in den Köpfen derjenigen, die dabei gewesen sind.
Es ist wohl ein menschliches Urbedürfnis, große Ereignisse aufzuheben und für alle Zeiten wieder abrufbar zu machen: So ist es mit Filmen, bei der Musik und in der Malerei sowieso, wir können heute immer noch einen „Raffael“ oder einen „Manet“ im Original betrachten.
Eine Theateraufführung hingegen ist, wenn sie abgespielt ist, ist dann einfach weg. Sie lebt nur noch in den Köpfen derjenigen Menschen, die dabei gewesen sind und stirbt mit ihnen.
Ich frage mich immer, wie werden Theaterschauspieler damit fertig?
Oder auch Theaterregisseure und Bühnenbildner?
Ich selber habe in der Zeit meines Theaterlebens vielleicht nur einen kleinen Beitrag zur Theaterkunst beigetragen, und Jahre später erinnere ich mich nur noch selber an das, was ich gemacht habe, vielleicht noch der eine oder andere Regisseur oder Bühnenbildner, aber sonst niemand. Man hat wochenlang zusammengearbeitet, hat gelacht und geweint miteinander, war gestresst, oft schlecht gelaunt, hat manche Nacht nicht geschlafen, die unvorstellbare Aufregung vor der Premiere, man nennt es auch Lampenfieber, und dann, Erfolg oder Reinfall, alle gingen danach auseinander. Ich bin selten bis nie auf eine Premierenfeier gegangen, mir war jedes Mal nach einer Premiere seltsam melancholisch zumute, ja nur zu oft war ich auch richtig traurig.
Ich liebte es, am Schluss über die leere Bühne zu gehen, wenn alle fort waren und nur noch das Arbeitslicht an war, und das habe dann nicht selten auch selber ausgemacht.
Haha, ich war ja der Beleuchter. Dann fuhr ich nach Hause, legte mich schlafen und dann begann ein neuer Tag und es war wieder Alltag. Man las die Kritiken, gute oder schlechte, und freute sich, wenn man selber erwähnt wurde, was selten genug vorkam.
Wer interessiert sich schon groß für das Licht.
Und dann kam eines Tages wieder ein anderer Bühnenbildner und Regisseur, neue Assistenten kamen auf mich zu um ein neues Stück zu besprechen, und das Ganze ging wieder von vorn los. Es ist wohl vielleicht genau das, weshalb ich diese Geschichten geschrieben habe, eine Erinnerung an Zeiten, die nur noch sehr wenige kennen, und auch die werden mit der Zeit immer weniger.
Aber zurück in die sechziger Jahre zu „Hans Lietzau“.
Damals ging es mir ja noch nicht so.
Alles war ja noch so neu und so aufregend.
Es ist in meiner gesamten Theaterzeit nur dieses eine und einzige Mal vorgekommen, aber fast hätte ich in „Indianer“ sogar mitgespielt, naja, natürlich nur als ein Statist.
Lietzau hatte mich vermutlich bei der Arbeit auf der Bühne gesehen, und aus welchem Grund auch immer, er wollte mich unbedingt in seinem Stück haben. Deshalb kontaktierte er meinen damaligen Abteilungsleiter und bat ihn um meine Freistellung für die Dauer des Stückes. Der allerdings sah sich hierzu nicht in der Lage. Begreifen konnte ich das nicht wirklich, denn für gar so anspruchsvoll hielt ich die Arbeit eines Beleuchters damals nicht. Wenn ich also in dieser Aufführung hätte mitwirken wollen, hätte ich wohl kündigen müssen. Das aber wollte ich nach reiflicher Überlegung nun doch nicht. Schade war’s schon.
Wer weiß, wie sonst mein Leben danach weiter verlaufen wäre.
Der Bühnenbildner von Indianer war Jürgen Rose. Lietzau hat stets nur mit ihm gearbeitet.
Wo ist denn mein „Jürrrgen“, sagte er immer, wenn er ihn brauchte und dieser gerade nicht zu sehen war.
Als das Stück abgespielt hatte, wanderte der große runde Tisch aus rot gestrichenem Eisenrohr, mit der glänzenden schwarzen Tischplatte, auf der die arme Carola Regnier vergewaltigt worden war, in den Aufenthaltsraum der Beleuchtung und ebenfalls die riesengroße Petroleumlampe, die darüber gehangen hatte. Die Lampe lebt schon lange nicht mehr, aber dieser Tisch steht auch heute, nach mehr als fünfundvierzig Jahren, immer noch im Aufenthaltsraum der Beleuchtung. Es gibt dort inzwischen niemanden mehr, der noch weiß, woher dieser Tisch stammt und was er für eine Geschichte erzählen könnte.
Es hat so ein wenig etwas vom Affen in „Woyzeck“ und ist irgendwie auch nur am Theater möglich.
Insgesamt machte Hans Lietzau ein gehobenes anspruchsvolles Theater, für die Zeit durchaus modern, aber nicht übermäßig. Aber immerhin brachte er den jungen Klaus Peymann, den damals noch kaum jemand kannte, ans Schauspielhaus.
Dieser machte ein Stück von Thomas Bernhard, „Ein Fest für Boris“, der Bühnenbildner war Karl Ernst Hermann. Dieses Gespann, man ahnte es damals noch nicht, sollte ja später geradezu berühmt werden, mehr noch, Peymann wurde quasi der Hofregisseur Bernhards und als es ganz schlecht lief mit Österreich und Bernhard, verbot Bernhard sogar, seine Stücke in Österreich zu spielen, es sei denn, Peymann inszenierte sie.
Nach nur zwei Jahren, man ahnt es angesichts der kurzlebigen Zeit seiner Vorgänger an diesem Haus vielleicht schon, jagte man auch Lietzau, zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrages, davon.
Das muss man sich nun aber nicht so vorstellen, dass der Kultursenator (haha), die Reitgerte in der Hand, seinen Intendanten über die Elbbrücken trieb. Etwas in dieser Art wäre vielleicht zur Zeit der Renaissance vorstellbar gewesen, als man Schauspieler noch für Gaukler und diebisches Gesindel hielt. Heute wird so etwas ein wenig subtiler vollzogen.
Der Senat rügte Lietzau wegen Überziehung seines Etats und erteilte ihm eine Ausgabensperre, was im Genaueren bedeutete, dass er sich bei jeder Ausgabe über 500(!) DM die Genehmigung der Finanzbehörde hätte holen müssen.
Es war ein Affront und für Lietzau unannehmbar. Ich denke, dass man diesen Vorgang als ein Beispiel nehmen kann, wie zynisch die Politik mit Menschen umzugehen pflegt, die sie gerade eben noch gefeiert hat. Es gibt ja durchaus auch heute immer wieder Beispiele solchen Tuns.
In diesen ersten Jahren meiner Zeit am Theater lernte ich, dass das Schlimmste, was man „Hamburger Pfeffersäcken“, wie sie immer gern genannt werden, wenn es ums Geld geht, antun konnte, war, dass man mit dem Geld nicht auskam, das sie geruhten, der Kunst zur Verfügung zu stellen. Kunst behandelte man zu jener Zeit als ein Geschäft, ebenso, wie wenn man eine Straße baut, oder etwas in dieser Art. Die Qualität der Kunst, wenn sie denn überhaupt in der Lage waren sie als Kunst erkennen zu können, spielte da keine Rolle.
Während meiner gesamten Theaterzeit habe ich nur zwei, drei Bürgermeister erlebt, die regelmäßig ins Theater gingen.
Man muss allerdings zugeben, dass, von etwa Mitte der sechziger Jahre bis weit in die siebziger hinein, das Schauspielhaus sehr oft nicht besonders gut besucht war. Allerdings ging es in jenen Tagen vielen Theatern so. Das Theater tat sich einfach schwer in der damaligen Zeit, da das Fernsehen immer populärer wurde und die Menschen anfingen, sich statt der Kunst, immer mehr der reinen Unterhaltung zuzuwenden.
Wie auch immer, es gab also erneut einen fürchterlichen Krach um die Intendanz des Schauspielhauses, zur besonderen Freude der Bildzeitung, und was dieses Mal die Sache besonders schlimm machte war, dass es einen Selbstmord gab.
Der Verwaltungsdirektor, der ein finanzielles Desaster hatte kommen sehen und nebenbei vermutlich mit dem temperamentvollen Hans Lietzau überhaupt nicht klargekommen war, hatte anscheinend wiederholt den Kultursenator vor einem absehbaren Finanzproblem gewarnt, aber kein Gehör gefunden. In seinem Abschiedsbrief beklagte er sich bitter über die Schlechtigkeit der Menschen und über unerträgliche Intrigen in Bezug auf seine Person.
Was da genau vorgegangen war, wusste niemand und, wie das immer so ist, brodelte die Gerüchteküche gewaltig. Dazu kam, dass die Rolle, die die Presse damals spielte, ausgesprochen widerwärtig war.
In Hamburg dominierte damals die Springer-Presse, und wir erinnern uns vielleicht, dass es ja auch die Zeit der Demonstrationen gegen den Springer Verlag war. Heute mag die Bildzeitung ja, wenn auch unter Niveau, gerade noch durchgehen, damals aber war sie ein richtiges Hetzblatt.
Das alles war keine sehr schöne Situation, passte aber, wie ich fand, zur Hamburger Kulturpolitik und es sollte auch für die nächsten Jahrzehnte nicht besser werden.
Ich erinnere mich noch an Lietzaus Abschiedsrede an die Belegschaft. Er kämpfte mit den Tränen und beschwor nicht allein nur die Schauspieler, sondern uns alle, der Kunst und seinen Stücken die Treue zu halten.
Ein Jahr später wurde er Intendant des Schillertheaters in Berlin, und so nach und nach folgten ihm auch alle seine Schauspieler dorthin.
Viele Jahre später hörten wir von seinem angeblichen Tod. Es war absolut tragisch, passte aber irgendwie ein bisschen auch zum Theater: Es hieß, Lietzau soll in London, so temperamentvoll wie er eben war, auf der falschen Seite seines Taxis ausgestiegen sein, und in England herrscht bekanntlich Linksverkehr!
Die Meldung über seinen tragischen Tod stellte sich bald darauf als falsch heraus. Die Geschichte mit dem Taxi stimmte zwar, aber er überlebte den Unfall, soll aber sehr schwer verletzt worden sein.
Diejenigen, die ihn kannten, sagten, dass er danach nicht mehr derselbe gewesen sein soll.