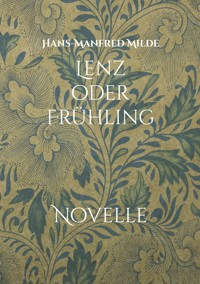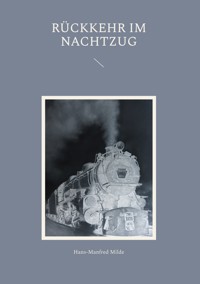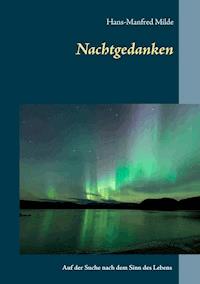Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vom hohen Riesengebirge bis weit über die Oder hinweg ins Katzengebirge, überall im Schlesierland standen und stehen noch heute viele Schlösser und Burgen. Ob Könige, Fürsten oder Ritter darin lebten, alle kämpften um Macht und Ruhm. Behandelte der eine seine Untertanen mit Güte, herrschten andere mit Hinterlist und Härte. Nicht anders war das Leben der einfachen Leute. Auch unter ihnen gab es fleißige und faule, ehrliche und Betrüger, traurige und glückliche. Dieses Buch führt zurück in uralte Zeiten. Um Prinzessinnen wurde geworben, wie um die Bauernmägde. Wandernde Handwerksgesellen zogen vom Schlesischen übers Gebirge ins Böhmische und kamen wieder zurück, oft der Liebe wegen. Arme Schneider und alte Musikanten gingen ihrer Berufung nach, jeder auf seine Art --- und Rübezahl wachte von der Koppe herab und mischte sich ein, wenn es die Menschen zu arg trieben. Wer heute an Schlesien denkt, dem fallen wohl zuerst die drei Worte ein, die allen Märchen voran stehen: Es war einmal …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Johannes und Jule
Das Märchen vom Eulenprinz
Der fürstliche Schneider
Der eitle Gockelhahn
Das Märchen vom Engel, der Katze und dem kranken Kind
Das Märchen vom Tränensee
Das Märchen vom König, der ewig regieren wollte
Der misstrauische Ritter
Prinzessin Ilsemild
Der alte Fiedler
Der Fürst und seine sieben Söhne
Der treue Knappe
Rübezahls Zorn
Johannes und Jule.
In der Nähe von Bunzlau lebte einmal ein Tagelöhner, der war sehr arm. An manchen Tagen wusste er nicht, wie er Frau und Kinder satt bekommen sollte. Zu allem Unglück hatte seine einzige Kuh vor einiger Zeit ein männliches Kalb geboren, das niemals Milch geben würde. Da sagte der arme Mann eines Tages zu seinem Sohn:
„Johannes, kumm ock, loass ins ei die Stadt giehn. Mir wulln versucha, den kleenen Stier zu eenem gutten Preis zu verkoofen.“
In seinem Kopf kreiste aber ein anderer Plan. Er hoffte, einen Meister zu finden, bei dem Johannes ein Handwerk erlernen könnte. Dann wäre dem Jungen eine gute Zukunft sicher, und im eigenen Haus gäbe es einen Esser weniger.
So machten sich Vater und Sohn auf den Weg in die Stadt.
Der erste Metzger, bei dem sie vorsprachen, bot ihnen einen halben Dukaten für das nicht gerade gut genährte Stierkälbchen. Bevor der Vater mit seinen Überlegungen zu Ende gekommen war, winkte Johannes ab. Für solch kleine Münze wollte er seinen geliebten Spielgefährten nicht hergeben. Das war auch gut. Am Ring1 wurde ein ganzer Dukaten geboten. Schnell waren die Männer handelseinig und schlugen ihre Hände ineinander.
Johannes glaubte, der Vater würde nun etwas einkaufen, was nicht in ihrem kleinen Garten wuchs oder im Wald zu finden war. Ein wenig Salz, ein paar Nägel.
Der Vater blieb aber vor der Werkstatt eines Schuhmachers stehen.
„Woas willste denn hier?“, fragte Johannes erstaunt. „Mir tragen doch keene Schuhe nich. Keen eenziger vun ins. Barbs2 loofen ies ooch viel scheener.“
Da legte der Vater seinem Sohn die Hand auf die Schulter.
„Weeßte, Johannes, es ies haalt asu. Ich mechte … der Meester … nu ja nu, vielleicht tät ar dich uffnehm, ei die Lehre … und du mechst een richtiges Handwerk erlern. Dann wirste stets geachtet sein und bekummst een bessres Laba3, als doas meine.“
Betroffen blickte Johannes seinen Vater an.
Das karge Leben hatte ihm nie etwas ausgemacht. Auch mal hungrig ins Bett zu gehen nahm er klaglos hin. Die Kuh, die Ziege und die Hühner waren seine liebsten Spielgefährten. Er wollte nicht weg von daheim, doch er hatte auch gelernt, dass ein Sohn seinem Vater zu gehorchen hat. So nickte er nur stumm mit dem Kopf und ging hinter dem Vater her.
Der Schuhmacher betrachtete den schmalen Jungen von oben bis unten, von vorn und von hinten. Unentwegt schüttelte er seinen Kopf. Er fürchtete, dieses dürre Bürschlein niemals satt zu bekommen. Erst als der Vater den soeben erzielten Dukaten aus dem Sack zog und ihn als Lehrgeld anbot, willigte der Meister ein.
Schon nach kurzer Zeit bereute der Schumacher nicht mehr, Johannes in die Lehre genommen zu haben. Der Junge war geschickt und wusste bald, wie geflickte Sohlen am besten hielten. Während er so an alten, schon arg zertretenen Schuhen herum klopfte, nützte Johannes aber auch jede Gelegenheit, dem Meister zuzuschauen, wenn dieser einem reichen Kunden das Maß für ein Paar neue Schuhe nahm. Oder gar für langschäftige Stiefel. Er wusste, erst wenn er diese Kunst beherrscht, würde er ein echter Schuhmacher sein, nicht nur ein einfacher Flickschuster.
Das Einzige, was Johannes nicht gefiel, war die Art, wie ihn der Meister rief: Hans. Und aus dem Hans machte er manchmal sogar ein Hänschen. Niemals rief er ihn bei seinem richtigen Namen. Einmal hatte Johannes es sogar gewagt, den Meister zu bitten, ihn doch nur mit seinem richtigen Namen anzusprechen, doch verärgern wollte er den Meister nicht. Er fühlte sich vom ersten Tag an wohl in diesem Haus.
Das hatte aber auch noch einen ganz anderen Grund.
Johannes hatte Gefallen an der Tochter des Meisters gefunden; und auch sie, die blonde Jule, suchte seine Nähe. Kaum war die Arbeit in der Werkstatt beendet, hielt sie dem Lehrling die Pantoffeln bereit. Gab es an besonderen Feiertagen einmal Fleisch zu essen, richtete sie es ein, dass Johannes ein fast gleichgroßes Stück bekam wie der Meister. Saßen sie dann am Tisch, setzte sie sich neben ihn, oder sie suchte sich ihren Platz ihm gegenüber, damit sie einander in die Augen blicken konnten. Ging Johannes, müde nach getaner Arbeit, in seine Kammer, begleitete sie ihn bis zur Treppe und wünschte ihm mit ihrer wohlklingenden Stimme eine „Gute Nacht“.
Es dauerte eine Weile, bis die Frau des Meisters bemerkte, wie nahe sich die beiden kamen. Als sie eines Tages gar mit ansehen musste, wie beide Hand in Hand zum Brunnen gingen, verlangte sie von ihrem Mann, er solle diesen Hans sofort aus dem Haus jagen.
„Insere Tochter hoat woas Besseres verdient als den Suhn vun eenem Tagelöhner“, zischelte sie ihrem Mann ins Ohr. Mit Hilfe ihrer Finger zählte sie die Namen der Söhne auf, die ringsum bei anderen Handwerksmeistern aufwuchsen. Sogar die Sprösslinge des Bürgermeisters und des Amtsrichters standen auf ihrer Wunschliste.
Nur ungern wollte der Meister auf seinen fleißigen Gesellen verzichten, das Gezeter seiner Frau war ihm aber bald zuwider.
„Johannes, poass amol uff“, sagte er deshalb eines Abends nach getaner Arbeit.
„Es werd Zeit, doass de ei die Weltnaus giehst, wie es asu ieblich ies ei insererm Handwerk. Zeig oallen Leuten, woas de bei mir gelernt hoast und lern noch manches hinzu. Vielleicht werd aus dir eenes Tages dann een richtiger Schuhmacher und nich bluß een kleener Flickschuster.“
Der Abschied fiel weder Meister noch Gesellen leicht. Zum Lohn für die gute Arbeit erhielt Johannes neben einem Beutel voll kleiner Münzen auch noch Werkzeug und Lederreste mit. Die Meisterin hantierte in der Küche so laut mit dem Geschirr, als wolle sie die Abschiedsworte übertönen. Das schmerzte Johannes weniger. Dass aber Jule nicht zu sehen war, trieb ihm Tränen ins Gesicht. Sollte es wirklich so sein, wie es im Sprichwort heißt: Aus den Augen, aus dem Sinn?
Da hatte sich Johannes aber sehr getäuscht. Kaum hatte er die letzten Bunzlauer Häuser hinter sich gelassen und den Waldrand erreicht, trat Jule hinter einem Baum hervor und sah ihn mit traurigen Augen an.
„Ich mecht mit dir giehn“, sagte sie mit weinerlicher Stimme. „Oalles, woas de ertragen musst uff deinem Weg ei die Fremde, doas will ooch ich ertragen.“
Diese Worte rührten Johannes. Er war aber inzwischen so gereift, dass er die Unmöglichkeit dieses Verlangens erkannte. Mit festem Griff zog er seine Jule an sich, nahm ihre Hand und drückte sie auf seine Brust.
„Asu fest, wie de meenen Herzschlag verspüren tust, genau su feste versprech ich dir, doass ich zu dir zurück kumm. Wenn de asu lange uff mich warten tust.“
Da nahm auch Jule die Hand des geliebten Burschen und drückte sie auf ihre jungfräuliche Brust.
„Genau su feste, wie de meinen Herzschlag verspierst, genau su feste versprech ich dir, uff dich zu warten.“
Und während sie sich bei alldem, was sie zueinander sprachen, tief in die Augen sahen, kamen sich ihre Münder immer näher.
So zog Johannes nun als Wanderbursche von Stadt zu Stadt, von einem Meister zum anderen. Wo es Neues zu lernen gab, blieb er länger, an anderen Stellen eine kürzere Zeit. Manchmal ertappte er sich dabei, seine Schritte in die Richtung zu lenken, in der er Jule wusste, die ihm so lange nachgeschaut hatte. Dann aber nannte er sich einen dummen Träumer, drehte auf der Stelle um und lief in eine andere Richtung. Die Meisterin hatte sicherlich schon einen standesgemäßen Ehemann für ihre Tochter gefunden.
An einem wunderschönen Morgen wurde Johannes durch lautes Jammern und Winseln aus dem Schlaf geweckt. Nachdem er sich die Augen gerieben hatte, sah er nicht allzu weit entfernt am Waldrand einen Zwerg herumhüpfen.
„Woas ies denn blußig los, du kleener Kerle“, rief Johannes und fragte, ob er helfen könne. Einen Moment stutzte der Wichtelmann, kam dann aber humpelnd nahe heran.
„Seht euch nur das an. Diese Unverschämtheit. Nichts als Disteln. Meine Füße sind voller Stacheln und Dornen oder wie dieses Zeug heißt.“
„Nee, weeßte, ich gloobs nich. Wie konnste bluß durch diese Wüstenei barbs loofen4, doas ies wohl nich grad recht klug von euch.“
„Papperlapapp! Dummes Gerede. Ich will heim. Dort drüben, in der Höhle unter dem Felsen steht mein Bett. Und das seit einer Ewigkeit.“
„Wenn ihr hier derheeme seid, da müsstet ihrs doch wissen, doass ringsum oalles vuller Disteln ies.“
„Papperlapapp! Sie hat es heimlich gemacht, in der Nacht, um mich zu ärgern.“
„Und wer ies die, die euch ärgern will? Wenn’s zu fragen gestattet ies.“
Zwischen all den Sprachfetzen war der Zwerg nahe herangekommen und zeigte auf seine blutenden Füße.
„Seht nur, wie sie mich traktiert hat. Diese Hexe. Nur weil ich ab und an mal länger wegbleibe. Eifersüchtig ist sie. Hätte ich sie nur nicht geheiratet.“
„Mit eener Hexe seid ihr verheiratet?“
„Verheiratet!“ In hohem Bogen spuckte der Zwerg auf das Distelfeld. „Verheiratet – wie man das halt so nennt bei euch Menschen. Bei uns ist das … ach, quatsch nicht so lange herum. Zieh die Stacheln raus. Aber vorsichtig.“
Johannes hob den Kleinen auf seinen Schoß und befreite ihn von allen Dornen.
„Warum tragt ihr keene Stiefel nich? Dann kenntet ihr unbeschadet durchs Distelfeld loofen.“
„Papperlapapp! Mein Leben lang – und das ist schon sehr lange lang – laufe ich barfüßig. Glaubt ihr vielleicht, ich könnte so einfach in die Stadt gehen und einen Schuster fragen, ob er den richtigen Leisten für mich hat?“
Johannes musste dem kleinen Kerl Recht geben. Solch kleine Stiefel herzustellen, dazu bedürfe es schon einer besonderen Kunst.
Aber - warum sollte er es nicht versuchen? Leder und Werkzeug hatte er ja in seinem Wandersack. So nahm er Maß und begann mit der Arbeit. Aufmerksam sah ihm der Zwerg dabei zu, versäumte aber auch nicht, seinen Blick immer wieder einmal über das Distelfeld schweifen zu lassen. Vom Felsen her war manchmal ein höhnisches Gelächter zu hören, dann wieder ein Zetergeschrei.
„Sie traut sich nicht in die Nähe von Menschen“, lachte der Zwerg, „sonst wäre sie schon hier und würde mich heim treiben.“
Als sich die Abendsonne dem Horizont näherte, waren zwei wunderschöne kleine Stiefel fertig, deren Schäfte bis zu den Knien des Zwergs reichten.
„Nu könnt ihr unbeschadet durchs Distelfeld loofen, wenn ihr den Mut dazu habt.“
„Ich, keinen Mut haben? Dass ich nicht lache!“
Der kleine Kobold steckte seine Füße in die Stiefel und stolzierte auf und ab.
„Passt ausgezeichnet. Gute Arbeit, muss ich sagen. Und wie soll ich euch nun entlohnen?“
„Es war mir eine Freude, euch helfen zu können.“
„Papperlapapp!“ Der Zwerg kramte in seinen Taschen und zog ein kleines Tongefäß hervor. „Das schenke ich euch zum Dank. Viel ist nicht mehr drin, aber die Stiefeln sind ja auch nicht allzu groß.“
Voller Neugier nahm Johannes das Töpfchen in die Hand. Vorsichtig versuchte er es zu öffnen, es gelang ihm aber nicht.
„Ach, was seid ihr Menschen einfältig. Glaubt ihr, ein jeder könne einen Zaubertopf so mir nix dir nix aufmachen? Schaut genau zu, wie es gemacht wird.“
Der Zwerg nahm das Töpfchen in seine Hände, drehte es blitzschnell nach rechts und nach links, von oben nach unten - Johannes Augen konnten den schnellen Bewegungen gar nicht folgen.
„Lasst’s gutt sein, doas ies viel zu kompliziert für mich.“
„Papperlapapp! Wer solch schöne Stiefel machen kann, dem gelingt es auch, diese Dose zu öffnen. Schaut genau zu und lasst euch nicht von einfachen Tricks verwirren.“
Dieses Mal verzichtete der Zwerg auf alle Drehungen. Er stellte das Töpfchen auf seine rechte Handfläche, tippte mit der Fingerspitze des linken Mittelfingers dreimal auf den Deckel, und schon öffnete sich das Gefäß. Johannes musste sich weit vorbeugen, um den Inhalt zu erkunden. Irgendein Fett schien darin zu sein. Vielleicht konnte man damit den Schuhen einen besonderen Hochglanz geben. Aber der Zwerg hatte längst erraten, welche Gedanken durch den Kopf des Schustergesellen gingen.
„Ihr glaubt wohl, das wäre eine Schuhschmiere, wie ihr sie bei jedem Flickschuster findet. Papperlapapp! Schmiere ist es wohl, aber sie enthält einen Zauber. Jedem Gegenstand verleiht sie eine Kraft, die ihr euch wünscht. Aber seid sparsam. Ich sagte wohl schon, es ist nicht mehr viel drin.“
Bevor der Zwerg das Töpfchen an Johannes zurückgab, tauchte er schnell noch einen Finger hinein und verstrich das, was er entnommen hatte, auf seine neuen Stiefel. Dabei murmelte er:
„Sagt ihr meine Meinung, Stiefelchen. Sagt ihr meine Meinung!“
Danach stampfte der Zwerg quer durch das Distelfeld seinem Felsenloch entgegen.
Frohgemut machte sich Johannes wieder auf den Weg. Er sang dabei ein fröhliches Wanderlied und freute sich seines Lebens.
„Halt! Wer da?“
Versteckt hinter den Bäumen, die am Wegesrand standen, hielten Soldaten dem Wanderburschen ihre Gewehre entgegen. Erschrocken blieb Johannes stehen und hob seine Arme.
„Hoabt Gnade mit mir. Ich bin nur een armer Wandergesell, der von hier nach durte loofen tutt.“
„Aus welcher Zunft?“
„Wie? Woas? Ach, ihr wullt wissen, woas ich für een Handwerk ausüben tuu. Ich bin bluß een kleener Schuster.“
Kaum hatte Johannes diese Worte ausgesprochen, schon bereute er sie. Hätte er, wie es jeder gute Schuhmacher macht, zuerst auf die Schuhe der Menschen geschaut, wäre ihm nicht entgangen, in welch erbärmlichem Zustand diese Soldatenstiefel waren.
Im gleichen Moment trat der Hauptmann der Truppe zwischen den Bäumen hervor.
„Ein Flickschuster ist er? Da kommt er uns gerade recht. Mitnehmen!“
Ehe Johannes weglaufen konnte, packten ihn die Wachposten und führten ihn tief in den Wald hinein. Auf einer Lichtung lagerten wohl mehr als zwanzig Soldaten. Wohin Johannes auch blickte, er sah nur Stiefel, bei denen Zehen oder Fersen viel Frischluft bekamen.
„Schau dich nur um, Flickschuster. Du siehst, es gibt viel zu tun für dich.“
„Hoabt ihr denn ieberhaupt asu viel Lader,5 wies notwendig wär? Da misst ihr wohl zuerscht eene große Kuh schlachten, doamit es für oalle Stiefel reichen tutt.“
Der Hauptmann klopfte sich auf die Schenkel vor Lachen.
„Das haben wir. Frisch geschlachtet, frisch gegerbt. Richtige Kommandos zur richtigen Zeit, das ist die Kunst eines guten Offiziers. Da staunst du wohl?“
Schnell wurde die gegerbte Kuhhaut herbeigeschafft. Johannes war sich nicht zu gut, Soldatenstiefel zu flicken, er hatte aber keine Lust, wochenlang bei dieser Truppe zu bleiben. Deshalb bat er den Hauptmann, er möge ihm denjenigen als Gehilfen zur Seite stellen, der dieses Leder so vorzüglich gegerbt hatte.
„Wers Lader asu gutt gerben konn, der lernt ooch, es uff die Schuhe zu nageln.“
So geschah es denn auch. Der ausgewählte Soldat war ein guter Lehrling und wusste bald, wie die Flicken richtig zu setzen sind.
Nach zwei Tagen und drei Nächten war es Johannes leid, weiter in diesem Lager zu bleiben. Die üblen Schweißgerüche und derben Soldatenflüche waren ihm längst zuwider. Angestrengt überlegte er, wie er weiterziehen könne, ohne den Hauptmann zu verärgern. Bald fiel ihm eine Ausflucht ein.
Als der Kommandant wieder einmal bei einem Rundgang an seinem Zelt vorbei kam, sprach Johannes ihn an:
„Euer Suldat hoat das Handwerk eenes Flickschusters schnell begriffen. Loasst euch vun ihm Maß nehmen für een paar scheene neue Stiefel. Ihr werdet sahn, woas ar vun mir gelernt hoat.“
Über dieses Angebot empörte sich der Hauptmann.
„Ein Offizier braucht besondere Stiefel. Allein bei ihrem Anblick müssen die Soldaten strammstehen. Nur ihr könnt so etwas machen. Habt ihr das verstanden?“
„Nun gutt“, gab Johannes zurück. „Ich will euch sulche Wunderwerke machen. Aber nur, wenn ihr mir versprecht, doass ich danach frei weiterziehen derf.“
Beide drückten ihre Hände aufs Herz und gelobten, ihr Wort zu halten. Schnell nahm Johannes Maß, schnitt das beste Stück Leder aus der Kuhhaut und begann mit der Arbeit. Am Abend des nächsten Tages waren die Stiefel fertig. Bevor Johannes sie dem Besitzer übergab, strich er etwas Zaubersalbe aus dem Tontopf, den ihm der Zwerg geschenkt hatte, auf Schäfte und Absätze und hauchte sie an:
„Kommandiert, als seiet ihr selbst der Offizier!“
Voller Wohlwollen betrachtete der Hauptmann die Stiefel. Sofort steckte er seine Füße hinein und schlug, wie es sich für Soldaten gehört, die Hacken fest gegeneinander. Da brüllten die Schäfte:
„Achtung! Stillgestanden!“
Hurtig sprangen die Soldaten auf, standen aufrecht und steif, wie es bei einem solchen Kommando üblich ist. Selbst erschrocken, über das, was soeben geschehen war, klopfte der Hauptmann nochmals die Absätze gegeneinander, und schon schrien diese den Befehl:
„Antreten!“
Wie aufgescheuchte Hühner rannten die Soldaten durcheinander, bis jeder seinen Platz in der Dreierreihe gefunden hatte. Kaum standen alle in Reih und Glied, versuchte es der stolze Stiefelbesitzer auf andere Art. Er schlug mit dem rechten Absatz gegen den linken, und schon tönte die unbekannte Stimme:
„Augen nach links!“
Schlug er den linken Stiefel gegen den rechten, kam der Befehl:
„Augen rechts.“
Immer neue Variationen probierte der Hauptmann aus und fand seine Freude daran. Und während die Soldaten mal nach links, dann wieder nach rechts blickten, mal sich im Kreis drehten oder gar hinlegen mussten, packte Johannes sein Ränzlein und wanderte still und heimlich weiter.
Wie lange er schon gelaufen war, wie weit er sich inzwischen von Bunzlau entfernt hatte, das alles wusste Johannes nicht. Am Abend aber, wenn er sich in Gottes freier Natur zum Schlaf unters große Sternenzelt legte, suchten seine Augen unter den abertausend Himmelslichtern nach dem Hellsten, dem Schönsten, dem Strahlendsten. Seine Gedanken wanderten zurück in die kleine Schusterstube, in der er sein Handwerk erlernt hatte, und seine Lippen flüsterten leise: „Jule!“
Eines Tages sah Johannes in der Ferne ein Schloss. Von den Türmen und Türmchen blinkten goldene Kugeln. Bunte Fahnen wehten im Wind. Im Innersten seines Herzens fürchtete er, fürstlichen Gewohnheiten nicht zu entsprechen. Seine geringe Bildung könnte ihn falsche Worte wählen lassen. Dann aber dachte er sich, bin ich schon einmal hier, so will ich mir solch eine Pracht mal aus der Nähe ansehen.
Schüchtern betrat er den großen Schlosspark. So etwas Schönes hatte er noch nie gesehen. Bäume und Sträucher standen wie Soldaten in langen Reihen. Am liebsten hätte Johannes etwa von seiner Zaubersalbe auf die Stämme gestrichen und dazu geflüstert:
„Bewegt euch! Tanzt im Kreis herum!“
Aber ehe er es sich versah, kam ihm eine Gruppe junger Damen entgegen. Schnell huschte Johannes hinter einen Baum, um ja nicht gesehen oder gar angesprochen zu werden. Je näher die Frauen kamen, umso verwunderter betrachtete er deren ausladende Kleider. Alle Röcke waren weit und lang, schliffen sogar auf dem Boden entlang. Welche Schuhe sie trugen, (das hätte ihn am meisten interessiert), konnte er dadurch nicht sehen. Aber etwas fiel ihm sofort auf. Die zierliche Mädchengestalt in der Mitte, die eine kleine Krone trug und von den anderen Damen hofiert wurde, zog ihr linkes Bein immer nach. In seiner Bauernsprache hätte er gesagt, sie humpelt.
Einen kleinen Moment zögerte er. Dann nahm er all seinen Mut zusammen und trat hinter dem Baum hervor.
„Verzeiht mein vielleicht folsches Benehmen“, sagte er schnell und beugte sein Knie. „Ich bin nur een einfacher Mann, oaber een Könner in meinem Fach.“
Voller Schreck drängten die Damen die junge Prinzessin in ihre Mitte, als müssten sie sie beschützen. Hätte ihnen ihre Bestürzung nicht die Sprache geraubt, sie hätten wohl lauthals um Hilfe geschrien.
„Lasst nur“, sagte die sorgsam Beschützte aus der Mitte des Kreises heraus. „Er soll uns sagen, in welchem Fach er ein Meister ist. Vielleicht kann er uns mit seinen Späßen erfreuen.“
Noch immer kniend wehrte Johannes ab.
„Oh nein, Verehrte. Zu Späßen bin ich nich uffgelegt. Mir bricht oaber mei Herz, wenn ich sahn muss, wie ihr euren linken Fuß nich richtig uffsetzen kennt. Sicherlich