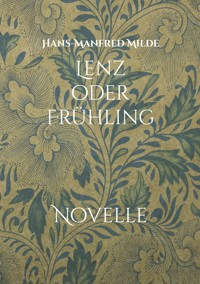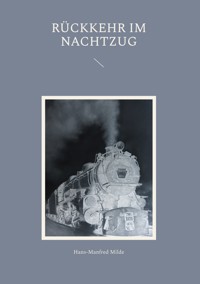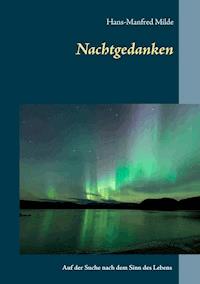Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach den beiden Erzählungen „Der Zwirlezwack“ und „Mechthild“, sowie „Märchen 1“ und „Märchen 2“ beschließt der Autor die Reihe „Erzählungen aus Schlesien“ mit Kurzgeschichten und Gedichten. Welcher Schlesier erinnert sich nicht gern an das „Sommersingen“, bei dem die Kinder am Sonntag Lätare mit bunt geschmückten Stecken von Haus zu Haus zogen, um den Sommer einzusingen. In kleinen Geschichten wird an die Kindheit in Schlesien erinnert und an unseren schlesischen Dialekt; wechselnd zwischen Selbsterlebtem und Erdachtem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort.
Nu ja, nu nee, woas woar doas fier eene scheene Zeit, doamals. Doa warn mer haalt noch jung. Asu richtig jung, meen ich. Kinder sein merr gewaast1, glieckliche, weil mir woarn haalt derrheeme2.
Asu ies es nu eenmoal eim Laaba3: Derrheeme ies haalt derrheeme!
Kaum wühlen die Gedanken in den Verstecken der Vergangenheit herum, versucht unsere Zunge die Schwingungen des heimatlichen Dialekts wiederzuerlangen. Große Mühe muss sie sich geben, den richtigen Ton zu treffen, den Niederschlesischen. Wenn auch das Sprechen schwer fällt, vergessen soll er aber nicht werden, unser schlesischer Dialekt. Natürlich sprachen die Breslauer „Lergen“ etwas anders als die Glatzer „Natzla“. Die Riesengebirgler anders als die Glogauer, die Görlitzer als die Namslauer.
„Wenn du so pauerst,4 wirst du nie lernen, richtig Deutsch zu sprechen“, hat mich meine Deutschlehrerin in Freiburg/ Schlesien damals ermahnt – und heute wünschte ich mir, ich könnte noch immer so „pauern“, so reden wie damals, halt wie derrheeme.
Wenn 70 Jahre nach der Vertreibung ein Schlesier sagt: „Heem, heem, suste nischt ock heem!“5 – will er keine geografischen Veränderungen herbeiführen.
Aber Gefühle, die tief wurzeln, lassen sich nicht vertreiben. Wie sich jeder ältere Mensch gern an die Zeit, die er mit seiner Mutter erlebte, zurückerinnert, genau so ist es mit der Sehnsucht nach dem Land, aus dem seine Vorfahren ihre Kraft bezogen, gefühlvolle Menschen zu werden. Schlesier eben.
1 sind wir gewesen
2 daheim
3 Leben
4 reden wie ein Bauer
5 Heim, heim, sonst nichts als heim!
Inhaltsverzeichnis
Sommersingen.
Oma Anna jagt einen Mörder.
„Es brennt!“
Erinnerungen an meinen Großvater.
Die Taube.
Oma Anna und der Fremde.
Der Gockel.
Traum
Die schöne Grafentochter auf der Bolkoburg.
Oponkel.
Die Geschichte vom armen Hans.
Die Treibjagd.
Das Gespenst auf der Zeisburg.
Der alte Schmied.
So zogen sie hinaus
Heimkehr.
Sommersingen.
Auch wenn uns Kindern damals das Lateinische noch ein Buch mit sieben Siegeln war, das Wort Lätare konnten wir übersetzen. Das hieß bei uns einfach: Sommersingen. Es war zwar noch kein richtiger Sommer, aber den wollten wir ja mit unseren Liedern herbeisingen. Zwei Wochen vor Ostern war die Wärme in Schlesien oft schon gut zu spüren. Lag Ostern gar spät im Kalender, konnten wir sogar barbs6 zum Sommersingen gehen.
Mit meinem Lieblingslied soll die Geschichte beginnen.
„Rot Gewand, rot Gewand,
schöne grüne Linden,
suchen wir, suchen wir,
wo wir etwas finden,
geh’n wir in den grünen Wald
sing’n die Vögel jung und alt,
Frau Wirtin sind sie drinne,
wir hören ihre Stimme.
Sind sie drin dann komm sie raus,
teilen uns den Sommer aus.
Lasst uns nicht zu lange stiehn
woll’n noch een Häusla weitergiehn.“
Wir gingen immer zu dritt.
Meine Schwester Ilse, ihre Freundin Gerda, die im Nachbarhaus wohnte, und ich. Wer in größeren Gruppen von Haus zu Haus zog, musste die Gaben mit allen, die dabei waren, teilen. So blieb pro Nase manchmal nur ein einziges Bonbon, oder besser gesagt pro Mund. Wenn die Leute uns nicht mehr gaben, war das kein Geiz; in den Straßen, in denen wir sangen, lebten nun einmal keine Reichen. Weiter unten im Dorf, wo die wohlhabenden Bauern ihre großen Höfe hatten, konnten wir uns nicht sehen lassen. Nach einem ungeschriebenen Gesetz durften im Unterdorf nur die Kinder singen, die dort wohnten. Wir wollten ja mit denen keinen Ärger haben.
Ärger gab es schon genug bei uns.
„Dei folsches Gesinge macht ins oalles kaputt“, meckerte die Gerda jedes Mal über mich.
„Wenn de asu folsch singa tuust, do denka ja die Leute, mir wulln se veräppeln!“
Gerda wäre lieber allein mit meiner Schwester losgezogen, aber unsere Muttel hatte bestimmt, dass Ilse mich mitnimmt und auf mich aufpasst.
„Der trift ja keenen eenzigen richtiga Ton nich. Die Leute kennta ja denka, mir hätta een kleenes Kitschla7 derbei“, zischte Gerda, noch bevor ich überhaupt meinen Mund aufgemacht hatte.
„Und du greelst!“8, gab ich ihr zurück; schließlich wollte ich mir von einem Mädel nichts gefallen lassen, auch wenn Gerda schon zwei Köpfe größer war, als ich. Ich wusste ja selber, dass mein Gesang keine Freude machte. Unsere Nachbarin hatte einmal zu meiner Muttel gesagt:
„Wissa se, ihr Hans der singt a ganza lieba Tag; oaber er konn goar nich singa nich – oaber ar singt und singt!“
Auch über meinen Stecken empörte sich Gerda.
Wer zum Sommersingen ging, trug einen etwa meterlangen Stecken in der Hand, meist von einem Haselnussstrauch abgeschnitten. Vom oberen Ende hingen bunte Bänder herab, das waren Streifen aus farbigem Papier. Wer es besonders schönmachen wollte, faltete noch eine Papierblume und brachte sie oben am Stecken an.
„Deine Bändel sein ja noch vum letzta Joahr. Die sein ja schun ganz ausgebleecht“,9 räsonierte Gerda. “Doas macht uff die Leute keenen gutten Eindruck nich.“
Gerda fand immer etwas an mir auszusetzen. Um dem Ärger mit ihr zu entgehen, bin ich auch mal allein losgezogen. Den Text der langen Lieder konnte ich mir nicht merken, deshalb habe ich nur kurze Strophen gesungen. Nun ja, eigentlich mehr gesprochen.
„Summer, Summer, Summer,
ich bin een kleener Pummer,
ich bin een kleener Keenich,10
gabt mer nich zu wenich;
lußt mich nich zu lange stiehn,
muss noch a Häusla weitergiehn.“
Weil es aber Sitte war, beim Sommersingen in kleinen Gruppen aufzutreten, blickten mich Einzelgänger manche Leute argwöhnisch an. Sie konnten ja nicht wissen, dass die Gerda mich nicht dabeihaben wollte.
„Kummst wohl alleene, weil de nich teilen willst. Willst oalles blußig alleene eisacken.11 Nee, nee, asu gieht doas nich, doas Summersinga.“
Und schwupps, schon war die Tür vor meiner Nase zu. Da wusste ich mich aber zu wehren! Ganz laut habe ich dann gegrölt:
„Hiehnermist und Taubamist,
ei dam Hause kriegt ma nischt,
is doas nich `ne Schande
ei dam ganza Lande!“
Oder gar:
„Geizhoals, Geizhoals,
friß ock olls, friß ock olls!
Wenn de wirscht gesturba sein,
warn de Krooha12 tichtig schrein -
Geizhoals, Geizhoals!“
Dann hieß es aber weglaufen, so schnell die kleinen Beine nur tragen konnten.
Einmal hatte Ilse neben der Gerda noch zwei Mädchen aus unserer Straße dabei. Die konnten zwar gut singen, dafür mussten die Geschenke aber durch fünf geteilt werde. Das gefiel mir, ehrlich gesagt, nicht so gut. Außerdem sangen sie unendlich lange Lieder, besonders vor den Türen jener Familien, von denen bekannt war, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gingen.
„Wir hoan der Wirtin a Summer gebrucht,
doas hoat der liebe Gott beducht;
a Summer und a Mai, schee Bliemlein13 vielerlei.
Schee Bliemlein vuller Zweigelein,
der liebe Gott wird bei euch sein,
er wird ooch bei euch wohnen.
Durt uba14 ei der Herrlichkeit,
doa is der Wirtin a Stuhl bereit.
Durt uba soll se sitzen,
sull woartn uff Jesum Christen.“
Beim nächsten Haus dann:
„Die goldne Schnur geht um das Haus,
die schöne Frau Wirtin geht ein und aus,
sie ist wie eine Tugend.
Wenn sie morgen früh aufsteht
und in die liebe Kirche geht,
da setzt sie sich an ihren Ort
und hört gar fleißig Gottes Wort.“
Besonders beliebt waren auch folgende Verse:
„Rute Riesla15, rute Riesla, wachsa uff`m Stengel,
der Herr is schien, der Herr is schien,
die Frau is wie a Engel.
Der Herr, der hoot ne huhe Mütze,
der hoot se vuul Dukoata16 sitze,
a werd sich wull bedenka
und werd uns wull woas schenka.“
Die Reihe der Lieder zum Sommersingen ist unendlich lang und auch von Gegend zu Gegend verschieden.
„Wir treten in ein schönes Haus.
das Unglück wolln wir jagen raus,
den Segen wolln wir bringen,
darum wir fleißig singen:
Den Herren und den Frauen,
die lieblich anzuschauen.
Ein schönes Paar tritt jetzt hervor.
so schön kam uns kein anderes vor.
Dort oben auf dem Trone,
da sing’n die Englein schone.
Die Englein singen allzugleich
dem lieben Gott im Himmelreich.“
Bei alleinstehenden älteren Damen sangen wir:
„Frau Kunze hat gar spitze Schuh
sie eilt wohl auf die Kirche zu.
In die Kirche geht sie beten,
in den Himmel wird sie treten.
Bescheer ihr Gott, bescheer ihr Gott,
dass sie Glück und Segen hoat.“
„Die Frau, die hoot a ruta Rook,17
die greift wull ei a Eeertoop,18
sie werd sich wull bedenka,
und uns a Eela19 schenka.“
In unserer Straße lebte auch ein alter Witwer. Ihm sangen wir jedes Jahr das gleiche Lied:
„Derr Herr, der hat`n hohen Hutt,
dem sein ja alle Madel gutt.
A wird sich wohl bedenka,
zum Summer uns was schenka.“
Die Lieder, in denen der Tod vorkam, haben wir nicht gesungen. Da hätten wir ja selber dabei naatschen 20 müssen.
Heute, wenn ich so darüber nachdenke - weit weg von „derrheeme“21, weit weg von der „Kinderzeit“ - wird mir recht warm ums Herz, wenn Lätare im Kalender steht.
***
6 barfuß
7 kleines Kätzchen
8 grölst
9 ausgebleicht
10 König
11 allein einstecken
12 Krähen
13 Blümchen
14 oben
15 Rote Röslein
16 voll Dukaten
17 hat einen roten Rock
18 Eiertopf
19 Ei
20 weinen
21 daheim
Oma Anna jagt einen Mörder.
Oma Anna stöhnte laut auf.
Was sie soeben gehört hatte, ließ sie erbleichen.
„Nee, Jungele, doas gloob ich nich. Doas konns doch goar nich geben nich. Ei inserem kleenen Durfe22? Nee, weeßte, man kennt ja reen glooben, die Welt wird immer verrieckter. Sodom und Gomorra, und doas hier bei ins ei Popelwitz. Doas wird noch biese23 enden.“
Ihr Enkelsohn, der siebenjährige Felix, drückte, am ganzen Körper zitternd, seinen Kopf in die weiten Röcke der Oma. Ein heftiges Kribbeln lief ihm über den Rücken. Wen wundert es? Wenn die lebenserfahrene Oma von einem bösen Ende sprach, musste dann der kleine Felix nicht erschauern?
In der Hilflosigkeit des Augenblicks begann Oma Anna aufzuzählen, was in den letzten Tagen in Popelwitz an ungewöhnlichen Dingen geschehen war:
„Do gibts eim ganza Durfe blußig zwee Autos, und die zwee stußen zusamm. Man möcht nich glooben, doass doas mit rechta Dinga zugeganga ies. Und ooch die nächtlichen Krawalle ei der Scheune vum Wermut-Bauern; woas doas bluß ies? Und jetze kummst du mit dem Zettel. Ich weeß nich, ich weeß nich.“
Aber, ich will die Geschichte der Reihe nach erzählen, sonst verdreht sich der Kopf und alles wird noch verrückter, als es schon ist.
Es begann an einem Freitagabend.
In Popelwitz – (den richtigen Namen des Dorfes will ich verschweigen, damit sich die Leute nicht schämen müssen, wenn ihre Geschichte später in der Zeitung steht) – in Popelwitz war es Sitte, am Freitag die Kinder zu baden. So war es nichts Ungewöhnliches, wenn an diesen Abenden kaum jemand auf der Dorfstraße zu sehen war.
Heute war es aber anders.
Der kleine Felix war noch unterwegs. Er hatte sich verspätet. Unten am Dorfweiher hatte er gesessen, wo eine Wildente sieben kleine Entlein ausbrütete, was aber nur er wusste. Das Nest lag gut versteckt unter tiefhängenden Ästen einer alten Weide. Felix wollte, wenn er groß ist, Tierforscher werden und Filme drehen. Den Titel wusste er schon: „Das Leben der Tiere“. Deshalb legte er sich jetzt schon überall auf die Lauer, wenn er glaubte, etwas erforschen zu können.
An diesem Freitag waren die ersten Entenküken ausgeschlüpft, da gab es viel zu sehen. Felix musste sich sputen, seine Verspätung betrug schon über eine Viertelstunde. Auf dem Heimweg, mitten auf dem Dorfplatz – geschah aber das Unheimliche.
Obwohl er so schnell rannte, wie er nur konnte, hatte er den Zettel entdeckt.
Irgendjemand musste ihn an den vorderen Holzbalken des Glockenturms geheftet haben. Der Glockenturm gehörte zu keiner Kirche. Nein, so groß war Popelwitz nicht, dass es hier eine Kirche gegeben hätte. Auf dem Dorfplatz von Popelwitz stand, aus kräftigen Holzbalken erbaut, ein Turm, in dem hoch oben die Feuerglocke hing. Sollte einmal ein Feuer ausbrechen, würde der, der das Feuer zuerst bemerkt, hierherlaufen und kräftig am Seil ziehen. Die Jungen im Dorf hat es oft kräftig in den Fingern gejuckt. Zu gern hätten sie aus Schabernack am Seil gezogen, aber keiner hatte das bisher gewagt.
Als Felix den Zettel sah, der in Höhe seiner ausgestreckten Hand am vorderen Holzbalken hing, erwachte seine Neugier. Obwohl er es eilig hatte, hielt er inne.
„Vielleicht hoat doas woas mit den kleenen Entla zu tun?“, überlegte er, stellte sich auf die Zehenspitzen und angelte den Zettel herunter. Als er las, was da geschrieben stand … erschrak er.
Seine Hand zitterte. Er las erneut. Seine Augen wurden immer größer. Natürlich konnte er lesen, er ging schließlich schon in die zweite Klasse. Zur Sicherheit las er noch einmal. Und noch einmal. Die Buchstaben begannen vor seinen Augen zu tanzen, so krakelig waren sie geschrieben. Aber Felix las immer die gleichen Worte:
Im Dorf ist ein Mörder! Seid vorsichtig!
Felix wusste nicht, was er tun sollte. Wäre nicht jetzt die beste Möglichkeit, kräftig am Glockenseil zu ziehen? Wenn ein Mörder im Dorf ist, ist das nicht genau so schlimm wie Feuer? Sollte er die Glocke läuten? Musste er jetzt nicht die Glocke läuten?
Er könnte ja auch so tun, als habe er den Zettel gar nicht gesehen. Den Zettel einfach wieder an den Nagel hängen und heimgehen. Es war sowieso schon viel zu spät. Mutter würde schimpfen.
Felix überlegte.
Würde er den Zettel wieder hinhängen und so tun, als habe er ihn gar nicht gesehen, er könnte sicher die ganze Nacht nicht schlafen. Bestimmt nicht! Vielleicht schlich der Mörder schon um sein Elternhaus? Oder um das Haus der Oma?
Wen würde ein Mörder wohl zuerst ermorden: Kleine Kinder? Oder alte Leute? Oma Anna womöglich? Der Gedanke an Oma Anna war wie ein Blitz. Oh ja! Zu ihr wollte er den Zettel bringen. Oma Anna wusste immer einen guten Rat. Außerdem würde Mutters Schimpfen nicht so stark ausfallen, wenn er wahrheitsgemäß sagen könnte:
„Es tutt mer leid, Muttel, doass ich asu spät heem kumm. Aber ich woar bei der Oma.“
Nachdem ihm diese Ausrede eingefallen war, wurde ihm leichter ums Herz.
"Oma ... eim Durfe ies een Mörder!"
Oma Anna bekreuzigte sich.
"Lieber Gott! Junge. Woas redste denn?"
Felix zog den zerknitterten Zettel aus der Hosentasche. Er hatte ihn tief hineingesteckt, um ihn beim schnellen Laufen nicht zu verlieren. Oma Anna suchte ihre Brille.
"Wer hoat denn den Zettel dir gegaan?24"
Oma Annas Hände zitterten, obwohl sie noch gar nichts gelesen hatte.
"Uffm25 Dorfplatz ... am Glockenturm ...", stammelte Felix.
Oma Anna las. Für Felix dauerte das alles viel zu lange. Deshalb fragte er:
"Meenste, ich hätt glei die Glocke läuten sulln?"
Weil Oma Anna immer noch las, fügte er hinzu:
"Een Mörder, doas ies doch genau su schlimm wie Feuer!"
Noch einmal rückte Oma Anna ihre Brille zurecht und las, jedes Wort einzeln betonend, laut vor:
"Im Dorf ist ein Mörder. Seid vorsichtig".
Wieder schlug sie das Kreuz. Dann kamen die Worte, die wir schon kennen:
"Ich hoabs ja glei gesoat! Es werd noch biese enden!"
"Oma? Hast du Angst?"
Felix sprach ganz leise.
"Wer vor Mördern keene Angst nich hoat, der ist keen Mensch nich", antworte Oma Anna und zog ihren Enkel fest in ihren Schoß.
"Ich muss aber heem. Es ies schun spät. Is Boadewoasser wird kalt …“
Oma Anna trat ans Fenster und lüftete vorsichtig den Vorhang. Sie blickte hinaus auf die Straße.
"Nee, Jungele, es ies schun dunkel. Du kannst jetzt nich mehr naus."
"Ich muss aber heem. Heute ies doch Freitag."
"Ja, ich weeß schun. Euer Badetag. Ich weeß.“
Oma Anna wog den Zettel in der Hand, als wiege sie einen geheimnisvollen Mondstein. Dann hob sie den Kopf, atmete tief und verkündete:
"Alleene giehste nich!"
Oma Anna war eine resolute Frau. Mit einer Hand fasste sie ihren Enkel, mit der anderen ihren Regenschirm. Den großen Schlüssel ihrer Haustür drehte sie zweimal um und steckte ihn zusammen mit dem Zettel tief in ihre Schürzentasche. Ihren Enkelsohn fest an der Hand, steuerte sie mit großen Schritten auf das Haus zu, in dem ihr Sohn Walter wohnte. Den Regenschirm hielt sie wie eine Lanze nach vorn gerichtet.
Die Haustür des Hauses, in dem ihr Sohn Walter mit seiner Familie lebte, war unverschlossen. Mehr noch. Die Tür war nicht einmal richtig zu. Durch einen breiten Spalt konnten Oma und Felix in den hell erleuchteten Flur blicken.
Oma Anna war entsetzt.
" Doas derf doch nich wahr sein! Doa stieht die Tür uff.“
Zuerst rief sie nach ihrem Sohn: "Walter!"
Dann nach der Schwiegertochter: "Edeltraud!"
Weil beide keine Antwort gaben, rief sie die Namen der Kinder.
"Sibylle! - Udo! - Heinz!"
Fast hätte sie auch noch "Felix!" gerufen, bemerkte aber rechtzeitig, dass sie ihren Enkel Felix an der Hand hielt. Alle Rufe blieben ohne Antwort. Oma Anna entsetzte sich.
"Doa ies een Mörder eim Durfe und hier stieht die Haustür uff!“
Im gleichen Moment ertönte aus der Tiefe des Hauses ein furchtbarer Schrei. Kinderstimmen überschlugen sich. Schrien in den höchsten Tönen.
Wie von einer Tarantel gestochen stürzte Oma Anna ins Haus, riss Türen auf, schlug sie wieder zu - bis sie entdeckte, woher die Schreie kamen. Aus dem Badezimmer. Die Zwillinge Udo und Heinz saßen in der Badewanne. Am lautesten schrie Udo. Ihm war Seife in die Augen gekommen. Heinz schrie, weil Udo schrie.
"Wo ies die Mama?"
Omas Frage wurde mit noch lauteren Schreien beantwortet.
"Ich gloob, die ies Eier hulln“, gab Felix als Antwort.
"Jetzt, um die Zeit?"
"Muttel sagt immer: Wenn ich am Abend geh, dann weeß ich mit Bestimmtheit, dass die Eier frisch sein."
*
Damit sie auch wirklich frisch gelegte Eier bekam, ging Edeltraud Trautwein tatsächlich jeden zweiten Abend zum Elsnerbauern. Sie folgte ihm sogar bis in den Hühnerstall oder in die Scheune, wo die Nester lagen, um zu sehen, ob die Eier wirklich direkt aus dem Nest kämen.