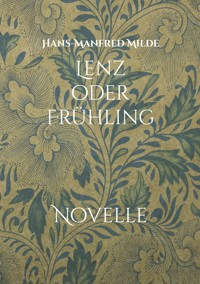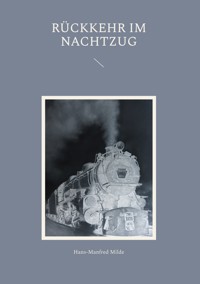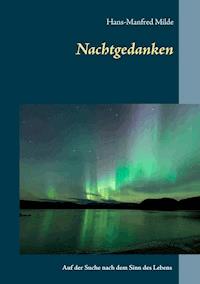Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auf hohem Fels thront das Schloss über dem tiefen, dunklen Fürstengrund, in dem die wilden Phole hausen, Halbgötter aus uralten Zeiten. Sie lauern den Mägden auf, die im Schloss arbeiten, jagen ihnen Schrecken ein und stehlen ihnen aus Übermut ihre mühsam verdienten Groschen. In Wirklichkeit sind sie aber auf einen anderen Schatz aus. Nur wenn es einem der wilden Burschen gelingt, seinen Samen einem jungfräulichen Menschenweib anzuvertrauen, können sie überleben. Die Magd Mechthild, unschuldig und fromm, verfällt dem Werben von Balder, einem dieser Phole, der sie mal als Jäger, als Gärtner oder als Wandersmann umwirbt. Als aber das Kind geboren wird, erleben alle eine große Überraschung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Deine Jungfräulichkeit wäre ein Geschenk für mich.“
Die sonore Stimme, die diesen Satz im verwinkelten Kellergewölbe unter dem großen Schloss leise hauchte, bekam einen dräuenden Widerhall. Die Worte wogten und kamen von vielen Seiten in Wellen zurück.
In den Ohren der jungen Magd, die erschreckt ihre vielfältigen Röcke wie eine Kordel vor dem zitternden Körper in eine Spirale drehte und krampfhaft festhielt, lösten sie jedoch Erschrecken aus, aber auch bange Erwartung.
Sie war neu im Schloss, die junge Mechthild, vor drei Tagen erst eingestellt zur niederen Arbeit in Küche und Keller. Weder die Örtlichkeiten, noch die genaue Verrichtung der aufgetragenen Arbeiten waren ihr hinreichend bekannt. So nahm es nicht Wunder, dass sie sich in den unendlich langen und dunklen Gängen unter dem Schloss verlaufen hatte. Zu allem Übel war ihr auch noch die Laterne aus der Hand gefallen, die Flamme erloschen.
Als Kind hatte sie gelernt zu beten in der Not.
Von irgendwo werde ein Lichtlein kommen, hieß es - und so war es jetzt auch. Ob es am Gebet gelegen oder am vorherigen Angstschrei, blieb Mechthild einerlei. Hell war es plötzlich um sie geworden, ein unwirkliches Licht, aber hell genug, ihr die Tür zu zeigen, die zugefallen war. Davor aber stand, hoch aufgerichtet, ein junger Mann, der ein blau schimmerndes Leuchten in seinen Händen trug.
„Ich dank Euch scheen, lieber Herr!“, stammelte die Magd. Mühsam erhob sie sich und machte einen braven Knicks. „Ich dank Euch scheen, hoher Herr!“, wiederholte sie. „Könnt’ ich mei Ungeschicke blußig wieder gutt machn.“
Ohne die Tür freizugeben fügte die sonderbare Gestalt seinen anfänglichen Worten, deren Echo noch immer nachhallte, hinzu:
„Du kannst es gut machen, Zartmägdelein. Meinen Wunsch, tat ich dir kund. Wohl an, so lass’ uns beginnen.“
Über diese befremdlichen Worte erschrak die Küchenmagd. Das Frohlocken, welches in der Stimme des Unbekannten mitklang, war ihr nicht verborgen geblieben.
‚Wisst ich blußig, war ar ies1’, stammelte Mechthild in sich hinein und drückte die vor die Brust gepressten Röcke noch fester an ihren Leib. ‚Ies ar een höherer Lakai? Oder goar eener vun die Fürstensöhne? Woas sull ich blußig macha?’
Ihr Grübeln dauerte zu lange.
Das bläuliche Licht erlosch. Verschluckt von der Dunkelheit auch die Gestalt. Nur schwerer Atem war noch zu hören. Mechthild wusste nicht, ob der allein ihrem Munde entfloh.
„Dein Missgeschick wolltest du tilgen“, hörte sie von der lockenden Stimme, die ihr sehr nahe war, und zugleich hörte sie ihr pochendes Herz.
„Schenke sie mir, deine Jungfräulichkeit…“, hallte es durch den Gang, und schon spürte die Magd die Hand, die nach ihr griff, spürte die fremden Finger, die ihr den Rock weg schoben, ihre Schürzenbänder lösten, das Tuch von ihren Haaren zog. Willenlos war sie plötzlich und wie betäubt. Und auf einmal gab es keine Dunkelheit mehr. Keine Kälte.
Ein Blitz. Ein Stich. Ein Schrei.
Trotz geschlossener Augen sieht die Magd den Blitz. Spürt den Stich, der ihren Leib zerteilt. Hört den Schrei, der ihrer röchelnden Kehle entweicht. Ein Sog erfasst sie. Eine Sturmflut mit peitschenden Wellen. Danach ein maßloses Wallen, ein wildes Wogen. Wohin nur, wohin?
Als Mechthild wieder aller Sinne Herr wurde, wusste sie nicht, was ihr geschehen war. Neben ihr, auf steinkaltem Boden, stand die Laterne mit flackernder Flamme, warf lange Schatten gegen die Wand. Vom Kerzenstummel flossen Tropfen herab, wie rinnende Tränen erschienen sie ihr.
Mit zitternden Fingern ordnete sie ihre Kleider, band ihre Haare ins Tuch. Mit all ihrer Kraft öffnete sie die schwere Eisentür und blickte in den Gang, an dessen Ende die rote Glut aus den Küchenöfen Gespenster malte.
„Wo treibste dich blußig rum, die lange Zeit?“
Die Drittköchin fuhr die junge Magd barsch an und warf ihr ungezählte Schimpfworte ins Gesicht. Mechthild, noch immer wirr von allem, was ihr widerfahren war, knickste brav und senkte den Kopf. Ohne Gegenrede. In ihrem bisherigen Leben hatte sie gehorchen gelernt: Daheim, beim gestrengen Vater; beim Lehrer in der Schule; beim Pfarrer in der Kirche. Nie hätte sie einer Person, die über sie herrschte, widersprochen. Und über ihr, so empfand sie ihr Leben, waren viele. Wenn nicht gar alle.
Erst am Abend wagte sie es, der Gundel, deren Bett dem ihren nahe stand, zu erzählen, welch ungerechte Schelte sie hatte einstecken müssen. Verlaufen habe sie sich, nichts weiter, die vielen sich kreuzenden Gänge hätten sie verwirrt.
„Bin ja erschte drei Tage eim Schlusse2. Asu schnell hoab ich mir die richtiga Wege nich merken kinna.“
Von der Gestalt, die ihr begegnet, und von dem, was ihr Wirres widerfahren war, erzählte sie der alten Gundel nichts. Mechthild wusste ja selbst nicht genau, was es gewesen.
Wer als Magd im Schloss neu eingestellt wurde, musste, einer alten Tradition folgend, seine Arbeit tief unten beginnen, in den Kellergewölben, wo Spinnen ihre unsichtbaren Netze zogen, die sich wie Schleier über Kopf und Gesicht legten; wo die Schaben ihre Brutstätten besaßen; die Ratten ihre wilden Spiele trieben. Kohlen mussten herbeigeschafft, in die Feuerschlünde riesiger Öfen geschaufelt werden.
Schwere Arbeit war für Mechthild nicht neu.
Sie kannte das seit der Kindheit. Nur - die Arbeit in einem Schloss hatte sie sich ganz anders vorgestellt. Für die fürstliche Familie fließe zu jeder Tages- und Nachtzeit warmes Wasser aus goldenen Hähnen, hatte man ihr erzählt, und sie hatte gehofft, diese jeden Tag blitzblank putzen zu dürfen. Nun aber war sie im untersten Keller gelandet. Alles war anders, als erträumt. Aber egal. Wie beschwerlich und schmutzig ihre Aufgaben auch sein mochten, sie würde sie tun - nur daheim davon erzählen, das würde sie nicht. Reden über Wunderdinge, die es im Schloss geben soll, von anderen Mägden ehrfurchtsvoll geflüstert, die würde sie im Dorf gern verbreiten, von der Finsternis der Keller jedoch nichts.
Schon seit Kindertagen war es für Mechthild stets ein Leichtes gewesen, alles, was ihr zugetragen wurde, in bunte Bilder zu verwandeln. Fantasiereich malte sie sich aus, in welcher Pracht die Säle und Zimmer hoch über ihr im Kerzenlicht leuchten - auch wenn ihr eisernes Bettgestell, neben sechs oder gar acht anderen, (die Dunkelheit ließen keine genaue Zählung zu), in einem fensterlosen Kellerraum stand. So fremd und widerwärtig das alles auch sein mochte, es gab jedoch etwas, was für Mechthild Dunkelheit, Schmutz und kargen Lohn aufwog. Zum ersten Mal in ihrem Leben, das spürte sie ganz stark, war sie etwas geworden: Sie war jetzt eine „Fürstliche“.
Zwei arbeitsreiche Wochen zogen sich lang hin, erst danach bekamen die Mägde einen freien Tag. Mechthild wünschte sich, es würde an einem Sonntag sein. Sehr früh würde sie aufstehen, eiligen Schritts heim laufen, um rechtzeitig in der Kirche zu sein. Frohgemut säße sie dann neben ihren Freundinnen auf dem für die Jungfrauen reservierten Plätzen, direkt vor dem Altar der Muttergottes, dem Schönsten der drei Altäre, die es in der kleinen Dorfkirche gab. Doch dieser Traum war schnell ausgeträumt. Die Drittköchin gewährte Mechthild den auf den Sonntag folgenden Tag.
Ein Montag trieb sie nicht zur Eile.
Mechthild genoss an ihrem ersten freien Tag den wunderbaren Moment, an dem alle anderen Mägde aus den Betten gescheucht, an die Arbeit getrieben wurden. Das Glücksgefühl, heute nicht auf Kommando aufstehen zu müssen, kostete sie genüsslich aus. Sie drehte sich einfach auf die andere Seite und zog die graue Schlafdecke bis über den Kopf. Am liebsten hätte sie sich noch einmal einen Tiefschlaf herbeigewünscht, doch der Krach, den die eisernen Kessel und Pfannen in der nahen Küche verursachten, machte diesem Verlangen ein schnelles Ende.
Voller Bedacht kramte Mechthild ihr bestes Kleid aus dem Holzkasten, der ihr zum Aufbewahren ihrer Habseligkeiten zur Verfügung gestellt war. Ihr langes Haar flocht sie in einen Zopf und band ihn ins Kopftuch. Weil sie in der Dunkelheit ihrer Behausung nicht wusste, ob es draußen regnete oder die Sonne schien, blieb sie unschlüssig, auch noch das geblümte Schultertuch umzulegen. Sie unterließ es. Freudig erregt trat sie in den langen Gang, doch das rot flackernde Licht aus den offenen Feuerlöchern der großen Öfen, welches zuckende Schatten an die Wände warf, verwirrte sie.
Und zu allem Übel löste sich plötzlich einer dieser Schatten von der Wand, kam näher. Mechthild dachte sofort an das, was ihr im lichtlosen Keller geschehen war, erst vor wenigen Tagen. Würde sich der Unbekannte wieder in ihren Weg stellen? Nach ihr greifen?
Es war nur die alte Gundel, die ihr entgegenkam. Einen Keil vom dunklen Brot und einen Zipfel der alltäglichen Dauerwurst brachte sie ihr, als Wegzehrung.
„Ich dank dir scheen, Gundel“, sagte Mechthild mit erleichterter Stimme, machte sogar einen braven Knicks vor der alten Magd.
Zu gern wäre Mechthild durch das von steinernen Löwen bewachte Schlosstor hinaus in den Sonnenschein gegangen, hätte damit aller Welt kundgetan:
„Guckt ock oalle har, hier kummt eene „Fürschtliche“!
Den niederen Mägden war aber geboten, nur durch den Kellerausgang, der im tiefsten Talgrund hinaus ins Freie führte, das Schloss zu verlassen und zu betreten.
„Keene Gerechtigkeit ies doas nich“, dachte sich Mechthild. „Oaber es ies haalt asu wie es ies.“
Aus Sorgfalt trug Mechthild ihre Schuhe zusammengebunden über der Schulter, sie sollten bis hinaus auf die Dorfstraße sauber bleiben.
Mutig öffnete sie die schwere Außentür, trat ins Freie.
Endlich frische Luft atmen! Endlich das Tageslicht sehen!
Vor Freude drehte sich Mechthild im Kreis. Hoch über ihr stand das mächtige Schloss auf hohem Fels, darüber ein strahlenden Blauhimmel. Nur ein winziges weißes Wölkchen schien sich am großen Turm festzuhalten, als wolle es ein Spielkamerad für die Fahne des Fürsten sein. Unten im Tal lag alles noch in tiefem Schatten. Hierher würde die Sonne erst gegen die Mittagsstunde vordringen. Trotzdem freute sich die fürstliche Magd endlich wieder einmal das Rauschen des Baches zu hören, dazu das Lispeln der Blätter der gewaltigen Buchen.
Bevor Mechthild ihren Fuß in die Furt des Höllebachs setzte, raffte sie ihr Kleid, hob es bis weit über die Knie und drückte es an ihre Brust. Von der Lust der freien Natur berührt, blieb sie mitten im Bach stehen. Zwei lange Wochen ohne Tageslicht hatten sie süchtig werden lassen nach Sonne und frischer Luft. Und so kam es über sie. Voller Übermut jauchzte sie laut und strampelte mit ihren Füßen.
Das Wasser des Höllebaches spritzte hoch auf.
Mechthild war eine andere geworden. Die so arme Tochter des Bierkutschers Emil Pielok aus dem kleinen, niedrigen Häuschen direkt neben der Bache war nun eine „Fürstliche“; war eine stolze Frau, die in einem Schloss lebte, wenn auch im tiefsten Keller. Allein die dicken Mauern, die sie umgaben, die ihr Obhut gewährten, (zwei, manchmal sogar drei Schritte waren vonnöten, sie zu durchschreiten), einen solch starken Schutz hatte sie in ihrem bisherigen Leben noch nie verspürt. Aber auch all das andere, das sie umgab, das Glänzende, das Strahlende in den Räumen hoch über ihr, (auch wenn sie es noch nie zu Gesicht bekommen hatte), in ihre Gefühle war es längst hineingekrochen, hatte sich verinnerlicht, strahlte aus ihren Augen zurück. Noch nie war sie so glücklich gewesen, noch nie hatte sie sich so hochgestellt empfunden, ein noch schöneres Gefühl konnte sie sich gar nicht vorstellen. Wie oft hatte sie als Kind geträumt, ein Prinz werde vom Schloss, das hoch auf dem Fels über ihrem Elternhaus stand, herabkommen, werde sie mitnehmen, sie auf seinen starken Armen über die fürstliche Schwelle tragen. Träume seien Schäume hatte man ihr immer erzählt, nun aber fühlte sie: „Een kleenes bisserle von meinem Troom3 hoat sich schun erfüllt“.
Sie war eine „Fürstliche“, das wollte sie sich nie mehr nehmen lassen.
In ihrer Freude ließ Mechthild das Wasser des Höllebachs gegen die Felswände spritzen, stieß dabei spitze Lustschreie aus - doch bald kehrte ihre Vernunft zurück.
Ihr einziges Sonntagskleid durfte keinen Schaden nehmen, die kleine Münze, ihr Lohn für zwei Wochen harter Arbeit, sollte nicht verloren gehen. In weiser Vorsicht hatte Mechthild das Geldstück in ein kleines Tuch gewickelt und in ihren linken Schuh gesteckt, denn im Dorf wurde stets geraunt:
‚Im Fürstengrund lauern die Räuber! Sie wissen, dass alle Mägde, die aus dem Schloss kommen, eine oder gar zwei Münzen bei sich tragen.’
Die Taschen, das Kleid, vielleicht auch ihr Kopftuch würden die Räuber durchsuchen, vermutete Mechthild, die Schuhe aber wohl kaum. Trotz des guten Verstecks beschloss die Magd, fortan still zu sein und die Enge des Tales möglichst schnell hinter sich zu bringen.
Zurückgekehrt auf den schmalen Weg, der zum Talausgang und damit hin zu ihrem Dorf führte, blickt sie immer wieder auf das hoch über ihr thronende Schloss.
„Eene Ferschtliche4 bin ich, nu wern se mich oalle beneiden!“, jubilierte ihr Herz und machte sie stolz. So schritt sie fröhlich dahin und suchte in ihren Gedanken nach Worten, mit denen sie daheim ihr neues Leben beschreiben würde.
Und wie sie so dahin ging, war ihr plötzlich, als spräche jemand zu ihr.
„Zartmägdelein …“
Und noch einmal:
„Zartmägdelein …“
Erschrocken verhielt Mechthild ihren Schritt, stieß einen kurzen Schrei aus und drückte ihren Schuh vor die Brust. In ihrem Schreck erwischte sie den, der ohne Münze war.
„Mein allerliebstes Zartmägdelein, sei ohne Furcht.“
Mitten in ihrem Weg stand ein Mann, eingehüllt in einen großen Umhang.
Mit einer galanten Geste wurde der großrandige Hut gelüftet, in weitem Bogen höfisch geschwenkt. Lange schwarze Haare fielen bis weit über die Schultern. Durch Mechthilds Kopf rasten die wildesten Befürchtungen. Was sollte sie nur tun? So stolz sie auch über ihr erstes selbstverdientes Geld war, beschloss sie, die einzige Münze, die sie besaß, dem Räuber zu übergeben, wenn auch nur schweren Herzens. Dieses Opfer wollte sie bringen, bevor sie sich schänden ließe. Um Gnade wollte sie bitten, um Gnade für Leben und Leib und dessen Unversehrtheit. Doch bevor sie auch nur ein Sterbenswörtlein hervorbringen konnte, hörte sie wieder die melodische Stimme, die ihr bekannt vorkam, von der sie glaubte, sie schon einmal gehört zu haben.
„Du musst dich nicht fürchten, Zartmägdelein. Nicht vor mir sollst du dich fürchten. Ich bin ja hier, um dich und deine Tugendhaftigkeit zu beschützen.“
Während der Fremde mit lieblicher Stimme auf Mechthild einredete, kramte diese in ihrer Verwirrung in ihrem Schuh, suchte nach der Münze. Weil sie aber selbige nicht fand, glaubte sie schon, den hart verdienten Lohn beim ungestümen Herumtoben im Wasser bereits verloren zu haben.
„Lass’ deine Münze stecken. Sie ist im anderen Schuh. Ich will sie nicht. Was ist eine Münze schon wert gegen deine Sittsamkeit. Den wahren Schatz, den du bei dir trägst, der passt in keinen Schuh. Ich bin hier, dir die Räuber vom Leib zu halten.“
Wie der, so modisch gekleidete Mann redete, war es Mechthild erneut, als habe sie diese Stimme schon einmal gehört. War es nicht die, welche ihr Hilfe angeboten hatte an ihrem dritten Arbeitstag, als ihr Licht erlosch in den dunklen, unbekannten Gängen unter dem Schloss? Hätte sie damals nur sein Gesicht sehen können. Vielleicht auch seine Hände. Zartmägdelein hatte er sie genannt, damals, und heute wieder. Wer so redet, der musste ein Galan sein. Mit solch gewählten Worten redet nur ein Fürst. Während Mechthild das alles bedachte, überlegte sie gleichzeitig, ob sie diese Begegnung voller Stolz daheim schildern solle. Den Eltern auf gar keinen Fall, nur ihren Freundinnen, Josefa und Ida. Die würden sie sowieso beneiden, sie, die bislang so armselige Tochter des Bierkutschers Emil Pielok. Sie, die jetzt eine Fürstliche war. Über ihren geringen Verdienst für zwei Wochen harte Arbeit würden die Mädchen lachen. Aber gab es nicht das bekannte Sprichwort: „Lieber an Biehma winger, oaber färschtlich!“
Mechthild würde diesen Spruch natürlich auf Hochdeutsch aufsagen: „Lieber einen Zehner weniger, aber fürstliches Geld!“ - das würde ihre Fürstlichkeit noch stärker hervorheben. Ob es ihr gelänge, alles, was sie vom Schloss erzählen wollte, in der Schriftsprache vorzutragen, wusste sie noch nicht. Bemühen wollte sie sich aber.
Ein lautes Rascheln im nahen Gebüsch entlockte Mechthild erneut einen Angstschrei. Schnell stand der Fremde neben ihr, öffnete seinen Umhang und hüllte sie ein.
„Du musst dich nicht fürchten“, hauchte er und zog die Magd eng an seinen Körper.