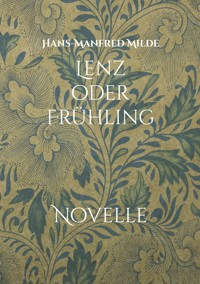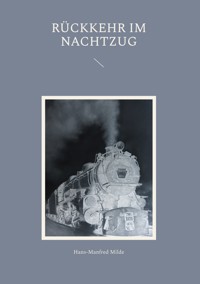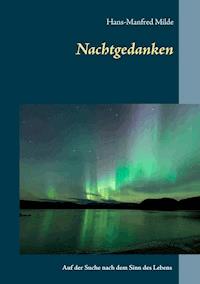Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Erzählung basiert auf dem vom gleichen Autor stammenden Roman "Der Lockruf des Kumm ocke", ist aber auf das Schicksal der Gärtnerstochter Maria konzentriert. Ihr Kindheitstraum, auch zu ihr werde ein Märchen-Prinz kommen, sie in ein fremdes Land führen, geht in Erfüllung, aber anders als erdacht. Die Verwendung des schlesischen Dialekts wurde eingeschränkt, was das Lesen erleichtert. Die kriegsbedingte Zerteilung Deutschlands mit dem Übergang Schlesiens in polnische Oberhoheit verändert das Leben der Protagonistin in epochaler Weise. Neu konzipiert und mit detailreichen und emotional tiefgehenden Szenen wird die Erzählung zu einem packenden Leseerlebnis. Ein gelungenes Werk, das berührt und zum Nachdenken anregt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hochzeitsmorgen
Vater
Mutter
Maria
Die Gärtnerei
Léon
Józef
Alfred
Zeitenwende
Maria und Józef
Hochzeitsmorgen
Hochzeitsmorgen.
Die Kühe heben verwundert ihre Köpfe. Lange bevor die Sonne die Nachtschatten auflöst, ihre Reste in die Stallecken vertreibt, wird frisches Heu in die Krippe gelegt. Auch der Griff ans Euter ist ungewohnt um diese Zeit. Die Kühe lassen gewähren, füllen die Eimer nur zur Hälfte. Józef ist damit zufrieden, den Rest wird er am Abend ausmelken.
Dann ist es so weit.
Im blauen Hochzeitskleid schreitet Maria durchs Hoftor. Józef trägt ihren Arm. Der kleine Léon liegt im Kinderwagen. Ein Nachbarmädchen, die Urszula Krychowiak, schiebt ihn hinter dem Brautpaar her. Die Straße wirkt wie ausgestorben, der Kirchturm ist schon zu sehen.
Plötzlich stockt Marias Schritt. Zweifel wachsen, Qualen der Ungewissheit halten sie fest. Józef streichelt ihren Arm.
Dreh dich nicht um, sagt er. Was hinter uns liegt, ist vorbei. Was vor uns liegt steckt voller Geheimnis. Ein neues Leben beginnt. Dreh‘ dich nicht um.
Vater.
Dick gegen die Kälte geschützt trat Wilhelm Menzel aus dem Haus. Unter der Tür blieb er stehen, öffnete seine Hände, drehte ihre schwieligen Flächen nach oben, wollte sie segnen lassen. Vom Großvater hatte er diese Geste übernommen. Traditionen weiterzutragen, bereitete ihm Freude.
Die im rechten Winkel gebauten Gebäude (Wohnhaus, Scheune, Remise) zwangen den Hof ins Quadrat. Zur Dorfstraße schützte eine übermannshohe Mauer, durchbrochen von einem zweiflügeligen Tor für Fuhrgespanne oder Autos. Daneben ein kleines Eingangstor aus Sandstein für Kunden und Besucher. Im Firststein ist die Zahl 1769 eingemeißelt. Balthasar Menzel war der Erste der langen Gärtnerreihe. In seinem dreiunddreißigsten Lebensjahr hieb er sie in den Torbogen. Generation folgte auf Generation. Nun war es an Wilhelm, sie weiterzuführen. Soviel er wusste, (mehr gaben die Kirchenbücher des kleinen Dorfes nicht preis), folgte auf Baltasar ein Benjamin. Danach kamen Gottfried und Gottlieb. Letztgenannter sein Großvater. Nach ihm Vater Karl. Und nun er. Nicht nur Jungpflanzen, die furchtsam aus den Samenkörnern krochen, fanden Geborgenheit und Schutz bei den Menzels. Alle Lebewesen, die Not verspürten, fanden bei ihnen sicheren Hort. Ganze Geschichten gäbe es zu erzählen, wäre nur Zeit.
Fest eingemummt stapfte Wilhelm in dieser Januarnacht durch den Schnee. Alle drei Stunden musste er ins Treibhaus, Koks nachschaufeln, sonst verglomm die Glut. Vor der gläsernen Tür blieb er stehen und starrte zum Himmel. Farbige Wellen zogen bunte Bänder. Zartestes Grün wechselte in faserndes Gelb. In den Glasscheiben spiegelte sich der himmlische Zauber wider. Kein Laut war zu hören, die Stille stand wie ein starker Baum. Verstört lehnte sich Wilhelm an die niedere Mauer, das Wunder des nächtlichen Schauspiels erregte ihn. Schrecken und Staunen begannen zu balancieren. Alle Ambivalenzen menschlicher Gefühle durchströmten ihn. Aus seiner Hosentasche, (in der sich neben Messer und Bindfäden auch eine halbvertrocknete Kastanie befand), zog er sein Taschentuch und wischte über sein Gesicht.
Schon vor drei Stunden war ihm ein eigenartiges Leuchten aufgefallen. Er hatte gefürchtet, in einem der nach Norden liegenden Dörfer brenne eine Scheune. Die Angst der Menschen, das angstvolle Schreien der Kühe und Schweine, das Gegacker der Hühner, das Geschnatter der aufgescheuchten Gänse, alles war ihm leibhaftig geworden. Das war vor drei Stunden. Jetzt wusste er den brennenden Himmel zu deuten. Mit fahrigen Händen suchte er zu greifen, was weder zu fassen noch zu begreifen war. Er befingerte die eiskalte Luft, in die sein Atem eine lange weiße Fahne schickte. Als er ansetzte zu sprechen, zerriss das weiße Band und bildet kleine zerfasernde Inseln. Wie Traumbilder schwebten sie vor seinen Augen.
Ja, ja, nee, nee - doas gibt es nich. Das kann es nicht geben. Ein Polarlicht bis hierher zu uns ins Schlesische? Nee, das gibt es nicht.
Wilhelm stotterte, suchte mit der rechten Hand nach der Stelle, an der sein Herz verborgen lag, doch seine Finger verirrten sich in der Fütterung seiner Jacke. Sein Herz lag weit entrückt. Sein Kopf glühte. Es kostete Kraft, die Augen zu schließen, aber die wehenden Farben blieben, brannten sich ein. Um sicher zu gehen, dieses Wunder der Natur sei noch über ihm, öffnet er seine Augen erneut und fuhr mit seiner kalten Hand über die heiße Stirn, als könne er damit Irrgärten verwischen. Halluzinationen vertreiben. Die Farben blieben, webten neue Bilder, wogten auf und ab.
Nun ja, nu nee. Das muss een Nordlicht sein. Een Polarlicht bis hier zu ins, doas gibt es doch gar nicht. Ich weeß nicht, ich weeß nicht.
Wilhelm Menzel war kein gebildeter Mann. Er hatte die Schule des kleinen Dorfes besucht, danach bei einem befreundeten Gärtner die Lehre begonnen. Zwei lange strenge Jahre wurden das. Wie man sät, Keimlinge pikiert, Pflanzen in größere Töpfe umtopft, das alles wusste Wilhelm vom Vater. Manches machte der Lehrmeister anders, sollte er doch. Nur wenn der Lehrmeister die Art, wie es Vater machte, unmodern oder gar falsch nannte, geriet Wilhelm in Zwiespalt.
Alles, was die Natur vollbrachte, alles, was außergewöhnlich war, faszinierend, ans Lemurenhafte grenzte, interessierte ihn über alle Maßen. Nordlichter werden auch Polarlichter genannt, wurde ihm in der Dorfschule gelehrt. Ein Wunder der Natur nannte es der Lehrer und weckte Wilhelms Interesse. Fotos des gewaltigen Himmelsschauspiels kannte er, doch mit eigenen Augen hatte er noch keines zu Gesicht bekommen. Trotz klirrender Kälte verharrte er und begann zu träumen. Seine Gedanken trugen ihn in die eisige Kälte des Nordpols. Doch wie kommt ein Gärtner aus der Mitte Schlesiens so hoch in den Norden, wenn nicht durch Krieg? Allein Kriege waren es, welche die kleinen Leute in die große weite Welt führten. Mit Varus von Rom in den Teutoburger Wald. Mit Gustav Adolf von Schweden nach Franken. Mit Steuben nach Amerika. Mit Napoleon von Paris nach Moskau. Für den deutschen Kaiser von Schlesien nach Verdun. Doch jetzt beim Anblick der wehenden Lichter fanden derartige Gedanken bei Wilhelm keinen Eingang, weder in seinen Kopf noch in sein Herz. Beides war übervoll. Verunsichert brummelte er leise vor sich hin, als fürchte er, die Stille zu stören.
Bis nach Hamburg soll manchmal so ein Nordlicht scheinen, wenn‘s überaus stark ist. Aber bis hierher ins Schlesische, nee, das gibts doch nicht. Das gloob ich nich.
Durch alle Fasern seiner Haut drangen die wechselnden Farben tief in ihn ein. Vorsichtig tastete er sich zur Tür. Sie war mit Eis überzogen, der Frost hatte sie verklemmt. Kräftig musste er ziehen, bis ihm endlich die feuchte Wärme ins Gesicht schlug. Wie eine Erlösung empfand er es. Hier im Treibhaus quoll sein Leben. Hier war der Speicher der Geheimnisse des Werdens und Vergehens. Mit seinem Garten und seinen Pflanzen war er längst eine Symbiose eingegangen. Traumtänzer hatte ihn der Vater genannt, hatte gefürchtet, der Sohn werde eines Tages Gedichte über Blumen schreiben, statt Unkraut zu zupfen oder mit der Harke den Boden zu lockern. Der Vater irrte.
Im schwachen Schein der Taschenlampe bewegte sich Wilhelm durch den engen Gang, ließ dabei seine Hand über das Grün des Asparagus gleiten. Ein schneller Blick huschte über die keimenden Pelargonien, über Nelken und Primeln. Freude empfand er dabei nicht. Im Gegenteil. Er fürchtete, in ihm könne ein Irrsein erwachsen. Hatte er draußen gesehen, was die Leute gemeinhin Gesichter nennen?
Erst im Heizungsraum fühlte er sich geborgen. Jeder Handgriff, jede einzelne Bewegung war ihm vertraut. Aus dem geöffneten Feuerloch überflutete ihn rotglühendes Licht. Wilhelm hielt der Glut seine gespreizten Hände entgegen, streckte das Kinn weit nach vorn. Die Augen hielt er geschlossen. Wärme und Farben des Feuers drangen auch so tief in ihn ein.
Mein Gott, Wilhelm, du bist doch erst achtunddreißig, da kannste doch nicht schon verblöden.
Gewaltsam riss er die Augen wieder auf, löste Hände und Gesicht von der Wärme und griff nach der Gabel. Mit geübtem Schwung warf er vier Schippen Koks in den glühenden Schlund und stellte zufrieden die Gabel wieder zurück. Sorgsam verschloss er die Ofentür, kramte aus seiner Joppe die Taschenlampe hervor. Weil sie nicht aufleuchten wollte, klopfte er sie gegen das warme Eisen des Ofens. Das Klopfen half. Den Lichtstrahl richtete er auf das am Kessel befindliche Thermometer; was er sah, befriedigte ihn. Vorsichtig drehte er sich wieder um und tastete zum Ausgang. Noch bevor er den ersten Schritt in die gespenstische Nacht wagte, verharrte er und begann mit schwerem Atem zu sprechen.
Wenn ich jetzt raus komm‘ und das Polarlicht leuchtet noch immer, dann hol‘ ich die Frau, damit sie‘s auch sieht. Und dem Mariele zeig‘ ich‘s auch.
Der Gedanke gefiel ihm. Am Nordhimmel waberten noch immer die Farben, liefen in Wellen auf und ab. Das Grün leuchtete kräftiger als vorher. Mit großen Schritten eilte Wilhelm zurück ins Haus, stürzte in die Wohnstube und plapperte los.
Frau, komm, schnell, ich zeig‘ dir was, was du noch nie gesehen hast, in deinem ganzen Leben nicht. Und Mariele muss auch mit.
Mutter.
Die hölzerne Eckbank war Henriettes Domizil. Nach getaner Arbeit kuschelte sie in den Kissen, zog sie eng um ihren Körper, als müsse sie sich verbarrikadieren. Sie liebte das Lesen. Niemals wäre sie draußen im Hof oder im Garten mit einem Buch herumgelaufen. Allein aus Furcht, die Nachbarn würden über sie Spott ausschütten. Sie ist halt eine aus der Stadt, würden sie labern; sie will angeben, wie gebildet sie ist.
Angeben wollte sie nicht, blieb deshalb im Haus, drückte ihren Rücken in die Kissen. So lag sie bequem, hielt das Buch mit beiden Händen und wiegte den Kopf. Geflüstert hauchte sie die Worte, die sie gerade las.
Hätt‘ ich irgend wohl Bedenken
Balch, Bochara, Samarkand,
süßes Liebchen, dir zu schenken,
dieser Städte Rausch und Tand?!
Nein, er hatte keine Bedenken. Nackt ist sie am schönsten!
Still seufzte Henriette in sich hinein, streichelte zärtlich über das Buch. Der Roman Wanda von Gerhart Hauptmann war ihr ans Herz gewachsen. Zwei Jahre nach der Hochzeit mit dem Gärtner Wilhelm Menzel war ihr bei einem Besuch im Elternhaus in der Vossischen Zeitung eine Artikelserie in die Hände gefallen, die unter dem Titel Der Dämon veröffentlicht wurde. Mit großer Begeisterung hatte sie alles gelesen und die Eltern gebeten, die Fortsetzungen für sie aufzuheben. Zum Weihnachtsfest kam die Überraschung. Der inzwischen als Buch erschienene Hauptmann-Roman Wanda lag unter dem Baum. Wenn sie jetzt darin las, zog sie Vergleiche zu ihrem Leben, stellte ihre Welt gegen die des Künstlers Paul Haake. Seelennahrung nannte sie es. Vor Jahren hatte sie Gerhart Hauptmanns Roman Die Insel der großen Mutter gelesen. Bei aller Schönheit der Sprache, der Fülle der Leidenschaften, blieb es für sie eine ferne Welt. Gut hätte sie sich vorstellen können, eine der gestrandeten Frauen auf der Ìle des Dames zu sein, ihren Part zu spielen im Kreis dieser Frauenrepublik. Auch der Schönheit der Südseeinsel zu erliegen wäre ihr sicher gelungen; vielleicht auch Phaon, dem Jüngling. Doch dieses Inselleben lag weit weg in einer fremden, wenn auch schönen Welt. Wanda dagegen, dieses Zirkusmädchen, das hätte auch hier gastieren können, hier in dem kleinen Dorf, in dem sie jetzt lebte. Alles, was im Roman Wanda geschah, atmete die Luft, die auch sie umgab.
Warum bin ich nie einem Paul Haake begegnet. Warum ist kein Mann zu mir in so großer Liebe entbrannt, wie dieser geniale Bildhauer zu dieser schmutzigen Seiltänzerin?
Diese Frage stellte sie sich immer wieder. Müsste ich arm sein, im kalten Winter hinter dem Schweidnitzer Keller Streichhölzer feilbieten? Arm und Elend, die Haare voller Perlenschnüre, die nichts weiter als Läuseeier waren? Wäre ich nur so einem leidenschaftlichen Mann wie diesem Künstler Paul Haake aufgefallen? Die gepflegte Tochter eines Beamten der Stadtverwaltung bleibt da ohne Chance. Liebe, was ist das? Gibt es diese großen leidenschaftlichen Lieben nur für besondere Menschen? Für besonders Reiche? Besonders Geniale? Dieses verlauste Mädchen Wanda Schiebelhut – (allein schon dieser Name) - wie ein Engel, der aus Versehen aus dem Himmel gefallenen ist, so hat sie der Bildhauer Paul Haake gesehen und geliebt. Das ist Leidenschaft. Liebe!
Henriette spürte Röte ins Gesicht ziehen. Ohne aufzublicken, schob sie einen roten Wollfaden zwischen die Seiten, klappte mit einer schwermütigen Bewegung das Buch zu und ließ ihre Hände auf ihm liegen, als wolle sie alles, was darin geschrieben stand, beschützen. Manchmal ärgerte es sie, dass Wilhelm keine Bücher las. Seine Welt war eng. Haus, Garten, Wochenmarkt, mehr war da nicht. Der Mittelpunkt seines Lebens war sie nicht. Ein Amts Akt vollzog den Wandel. Nun lebte sie in diesem verschlafenen Dorf. Was ihr zuerst als Paradiesgarten erschien, wurde bald zur Einöde, manchmal gar zu einem Zwinger. Auszubrechen aus dieser Abgeschiedenheit hatte sie nie versucht. Pflichterfüllung nannte sie es. Allein mit Hilfe ihrer Bücher versuchte sie, diese unsichtbaren Gitterwände zu überwinden. Freiräume zu erträumen. Ihre Bücher waren es, die sie in andere Welten führten, ihrer Sehnsucht uferlose Meere boten. Kam sie nach harter Gartenarbeit am Abend müde ins Haus, träumte sie sich in den Schlaf. Manches Mal hegte sie heimlich den Wunsch, in ein leichteres Geschäft eingeheiratet zu haben; in eines, welches kein Staketenzaun abgrenzt. Fand sie bei der Arbeit eine Weinbergschnecke, deutete sie ihr Gleichnis: Ans Haus gefesselt, die Fühler aber weit voraus in der Ferne gestreckt. Die Bilanz ihrer Ehe hieß Zufriedenheit. Unter Glücklichsein verstand sie etwas anderes. Oft hatte sie nachgegrübelt, wie es dazu gekommen war. Schuld gab sie den Freitagen. Am Freitag war in der Stadt Markt. Gurken, Tomaten, Radieschen, Mohrrüben, Oberrüben, Salate und viele andere Gemüse wurden zum Verkauf angeboten. Auch Blumen. An einem dieser Freitage geschah die Annäherung. Beim Auswählen geradegewachsener Mohrrüben war ihr eine Kiste umgefallen. Der Gärtnerjunge hatte sie angelacht und gefragt, ob sie die Möhren essen wolle oder einen Blumenstrauß daraus binden. Frech empfand sie das. Aber mit seiner geraden Haltung, seinem sonnengebräunten Gesicht hatte er Eindruck hinterlassen. Sie war damals mit Oskar aus Kunzendorf befreundet. Oskar arbeitete in der Spinnerei, war blass und ausgezehrt von der Arbeit. Außerdem plante er, nach Amerika auszuwandern. Durch die Stadt lief das Gerücht, die Fabrik werde geschlossen. Als Arbeitsloser kann ich dich nie heiraten, hatte er geklagt. In Amerika finde ich Arbeit, das kannst du mir glauben. Gebettelt hat er: Komm mit nach Amerika.
Auswandern? Mutter gab sich empört. Wenn der Oskar eine reiche Amerikanerin kennenlernt, verlässt er dich. Dann sitzt du allein herum, verstehst die fremde Sprache nicht und heiratest in deiner Dummheit einen Schwarzen. Mütter haben ihre eigene Logik. Auch Vater redete dagegen. Seine ewigen Sprichwörter mussten dafür herhalten. Bleibe im Lande und nähre dich redlich.
Der Gärtnerjunge sah nicht nur besser aus als Oskar, in der Gärtnerei wuchs das Essen hinterm Haus. Eine Freundin hatte ihr geholfen den Namen des Gärtnerjungen auszuklamüsern. Wilhelm Menzel.
Verträumt wischte Henriette eine Locke von der Stirn; es sah aus, als wolle sie ihre Gedanken auslöschen.
Am nächsten Freitag hat er mir eine Rose geschenkt. In der Mitte honigfarbiges Gold, die Blütenblätter darum in feurigem Rot, die Ränder mit gelben Streifen. Was Rot bedeute, wisse ich wohl, hat er mich angelächelt. Die gelbe Farbe stehe für Eifersucht. Er habe mich in der vorigen Woche mit einem anderen Mann gesehen, deshalb gehöre das Gelb in die Rose.
Zu gut erinnerte sich Henriette an diese Worte. Auch im Benehmen konnte es der Gärtnerbursche mit Oskar aufnehmen. So kippte die Waage. Von da an war sie regelmäßig zum Wochenmarkt gegangen, hatte auf Amerika verzichtet. Heute klang das skurril. Drei Bagatellen hatten sie verführt, in dieses kleine Dorf gelockt. Ein Lächeln aus braungebranntem Gesicht. Eine Rose mit roten Rändern. Die Aussicht auf gesichertes Essen. Das Schicksal kann grausam sein. Doch Henriette glaubte, alles sei vorbestimmt. So hatte sie sich für Wilhelm entschieden. Aber die Sehnsucht war ihr geblieben. Nicht nach Oskar, sondern nach der Ferne. An ein Leben hinter dem Horizont. Eine Postkarte mit der Ansicht der fackeltragenden Freiheitsstatue von New York brachte alte Gefühle zurück.
Henriette seufzte tief. Andere Wünsche hielten sie besetzt. Sonntags in der Stadt spazieren gehen. Schaufenster betrachten. In einem Café sitzen, vorübergehenden Menschen zuschauen. Stadtluft atmen. Sonntags fuhr aber kein Omnibus. Sollte sie Wilhelm bitten, sie mit dem Lieferwagen in die Stadt zu fahren, abends wieder abzuholen? Nein, das wollte sie nicht. Sie wusste nicht einmal, ob sie es annehmen würde, böte er es ihr an. Lieber verträumte sie die Sonntage in der Stube. Dreizehn Jahre normales Eheleben lagen hinter ihr, ein einziges Kind hatte sie geboren. Ob sie ein Zweites gewollt hätte, wusste sie nicht. Liebe, echte Liebe, wie die eines Paul Haake, hatte sie nicht erlebt. Sie wusste nicht einmal, ob sie alles wusste, was sie als Frau wissen sollte. Ein aufklärendes Buch gab es nicht, mit den Eltern darüber sprechen wäre ihr nicht im Traum eingefallen. Den wahren Grund für die schnelle Heirat kannte nur sie. Zwölf Wochen vor der Hochzeit hatte sie erstmals ihren Schoß für Wilhelm geöffnet, danach gefürchtet, Ungewolltes könne geschehen sein. Die Angst vor Schande im Kleinstadtmilieu ließ sie schnell heiraten. Erst vier Jahre später wurde sie schwanger. Vier Jahre kopuliert mit den gleichen eintönigen Gefühlen. Kaum hatte sie entbunden, kam die nächste Enttäuschung.
Hätt‘ mir einen Sohn gewünscht! Ich brauch doch einen, der den Namen Menzel weiterträgt.
Wilhelms Kommentar hatte sie schwer verletzt. Neun lange Jahre waren seit Marias Geburt vergangen, noch immer kein Junge.
Liegt es an mir? Oder an Wilhelm?
Blütenblätter der Gänseblümchen abzupfen, dabei die Frage stellen: Er liebt mich ... er liebt mich nicht ... er liebt mich ... er liebt mich nicht … Henriette hätte sich das nie getraut. Aber beim Auszupfen zu dicht stehender Salatpflänzchen hatte sie heimlich abgezählt: Es liegt an ihm ... es liegt an mir ... es liegt an ihm ... es liegt an mir. Das Leben ist widersprüchlich, man kann es ohne Glauben an Wunder nicht bestehen.
Wilhelm stürmte in die Stube, verscheuchte alle Gemütlichkeit. Zögernd schob Henriette ihr Buch auf den Tisch, blickte aber nicht auf.
Frau komm. Draußen gibt’s was, so was hast du noch nie gesehen. Glaub‘ mir, das ist was Einmaliges.
Henriette hob den Kopf und mahnte, leise zu reden, das Kind schlafe schon. Wilhelm hörte nicht auf ihre Worte und stürmte die knarrende Holztreppe hinauf. Selbst wenn das Kind schliefe, er würde es wecken.
Mariele? Maria!
Das Mädchen spürte die Erregtheit in Vaters Stimme, die so verlockend klang.
Was ist denn, Vatel?
Komm, Mariele, kumm ock. Steh auf, ich zeig‘ dir was, was du noch nie gesehen hast. So was wirst du in deinem ganzen Leben nimmer sehn. Kumm schnell.
Der siebenjährigen Maria war, als reite Vaters Stimme auf einer lang nachschwingenden Glocke, erzeuge Echo. Sie legte ihr Märchenbuch zur Seite, verließ Dornröschen, die hinter der Rosenhecke auf die Ankunft des Prinzen gewartet, der sie mitnehmen wollte auf sein Schloss in einem fremden Land. Maria war gewiss, auch zu ihr werde eines Tages ein Prinz kommen, sie mitnehmen in ein fremdes Land, werde ihr ins Ohr raunen: Kumm ock, Maria, komm!
Vaters Worte klangen wie ein Lockruf, wie ein Zauberspruch, der den Weg in Mysterien öffnet. Ihr Herz begann zu klopfen, eine wohlig kribbelnde Gänsehaut zog über ihren Rücken. Auf der Zunge spürte Maria den wohltuenden Geschmack von warmem Kakao und spürte den Wunsch, diesen Becher leer zu trinken. Der Lockruf des Kumm ock hatte sie erfasst, wie sollte sie ahnen, dass diese zwei Worte wie Meilensteine ihren Lebensweg säumen. Schnell sprang sie aus dem Bett und stolperte an Vaters Hand die Treppe hinab.
Du wirst das Madel doch nicht aus dem Bett in die eiskalte Nacht jagen. Was wird schon zu sehen sein? Der Stern von Bethlehem bestimmt nicht.
Wilhelm Augen glühten, als habe das himmlische Leuchten seine Seele bis zum Rand aufgefüllt. Mit jeder Minute des Wartens wuchs seine Erregung. Henriettes Einwand fand keine Beachtung. Wieder lockte er, draußen gäbe es was Außergewöhnliches zu sehen, sie solle mitkommen, doch Henriette schüttelte nur den Kopf.
Sternschnuppen fallen nicht so langsam, dass sie jetzt noch zu sehen sind.
Nach zwölfjähriger Ehe glaubte Henriette, ihren Wilhelm genau zu kennen. Er verstand sein Metier, das gab sie unumwunden zu. Aber er war auch ein Phantast, ein Schwärmer, der mit Blumen sprach, aus wandelnden Wolken Figuren deutete. Nachts, so glaubte Henriette, versuche er, die Sterne zu zählen. Sie kannte seine Naturverbundenheit, wusste um seine Liebe zu Blumen und Pflanzen. Oft hatte sie ihn heimlich beobachtet, hatte gesehen, wie er Blätter und Blüten liebkoste. Hatte sogar mitansehen müssen, wie er eine voll aufgeblühte Rose, nachdem er ihren Duft eingesogen hatte, zärtlich küsste. Ein Hauch von Eifersucht war durch sie gezogen.
Kann ich die Pootschen1 anlassen, Vatel?
Setz dir die dicke Mütze auf. Es ist verflucht kalt draußen.
Das Kind mitten in der Nacht aus dem Bett jagen und fluchen auch noch, du bist mir vielleicht ein Vorbild.
Der Gärtner ließ sich nicht beirren und lockte weiter.
Kumm ock, Mariele, kumm. Weißt du, mir gucken uns was ganz Verrücktes an, draußen im Garten.
Wieder kroch dieser nach Geheimnissen gierende Lockruf in Marias Ohr. Sie wollte fragen, was Vater mit seiner Stimme gemacht habe, sie klinge anders als sonst, wusste aber nicht, wie sie das sagen sollte, ihr fehlten die richtigen Worte. Indes drängte der Vater zur Eile, fürchtete, sie kämen zu spät, der Himmel sei inzwischen wieder sternenklar ohne wogende Farben und ihm bliebe die Ungewissheit, Traumgesichter gesehen zu haben.
Kumm ock, schnell, lockte seine Stimme erneut.
Vatel, lauf nicht so schnell, sonst verlier ich meine Pootschen!
Maria spürte den wuchtigen Schlag der grimmigen Kälte mitten ins noch bettwarme Gesicht. Mit beiden Händen drückte sie ihren Mantel zusammen, versuchte den Pelzkragen dicht um den Hals zu schlagen. Der Schnee knirschte unter Vaters Schritt, es hörte sich an, als trete er auf zersplitterndes Glas. Kaum im Garten angekommen, sah er die leuchteten Farben und freute sich, von seine Tochter bestätigen zu bekommen, er sei weder meschugge noch sehe er Gesichter.
Kumm rüber zum Treibhaus. Von dort hat man den schönsten Blick.
Er führte Maria an jene Stelle, von der er vorhin die Himmelslichter betrachtet.
Siehste, Mariele. Guck mal, der Himmel brennt.
Vatel! Nee, ich hab‘ Angst.
Wilhelm spürte die zitternde Kinderhand, spürte den zuckenden Arm, der gegen seine Schenkel schlug. In der eisigen Stille glaubte er sogar, die Zähne des Kindes klappern zu hören. Schnell knöpfte er die unteren Knöpfe seiner Joppe auf, zog Marias frierenden Körper zwischen seine Beine und schlug die vorderen Zipfel um sie herum. Von den Knien bis hinauf zum Bauch spürte er Marias bebenden Körper.
Du brauchst keine Angst nicht zu haben. Und fürchten musst‘ du dich auch nicht. Nee, Madel, du brauchst wirklich keine Angst nicht zu haben. Das Licht tut uns nichts.
Weil es sich von oben herab schlecht sprechen ließ – (Wilhelm glaubte, angesichts dieses himmlischen Wunders nur flüstern zu dürfen) - hob er Maria auf seinen Arm und drückte das zitternde Kind fest an sich. Ihm war, als ströme aus dem Körper des Kindes die gleiche Wärme, wie vorhin aus dem Feuerschlund des Treibhausofens. Ihre Köpfe klebten aneinander. Weil er fürchtete, zu laute Worte könnten das Wunder des Himmels verlöschen, sprach er leise und mühte sich, hochdeutsch zu sprechen.
Weißt du, Maria, das ist ein Polarlicht. Das kommt von der Sonne.
Von der Sonne? Mitten in der Nacht?
Marias Stimme zitterte.
Ja, wirklich. Am Tag schickt die Sonne Lichtstrahlen, damit es hell wird auf der Erde. Und Wärmestrahlen, damit es warm wird. Das weißt du ja. Nachts kommen andere Strahlen von der Sonne, die die Erde nicht haben will und deshalb nicht rein lässt. Die tanzen dann außen um die Erde herum und ärgern sich grün und blau. Davon glüht der Himmel.
Kommen die jede Nacht?
Ich glaub‘ schon. Die kommen jede Nacht, aber nicht immer bis zu uns. Die bleiben meistens ganz oben im Norden, in der Nähe vom Nordpol.
Und warum kommen die heute bis zu uns?
Das weiß ich nicht. Die Sonne hat vielleicht zu viel auf einmal geschickt von dem Zeug, deshalb leuchtet es bis zu uns.
Ich hab‘ aber Angst, Vatel.
Du brauchst dich nicht zu fürchten. Das Licht tut uns nichts.
Aber es ist doch Feuer? Du hast doch gesagt, der Himmel brennt.
Nun ja, eigentlich sind es Lichter. Früher haben die Leute gesagt, wenn‘s Polarlicht so stark leuchtet, dann ...
Wilhelm stockte, wollte das Wort, welches ihm auf der Zunge tanzte, dem Kind nicht zumuten.
... was ist dann, Vatel?
Wilhelm versuchte abzulenken.
Guck, jetzt färbts sich neu! Jetzt guckts aus wie eine riesige Girlande, grün und blau und untenherum blühen die Veilchen so richtig lila.
Was haben die Leute früher gesagt, Vatel?
Maria suchte weiter nach dem, was ihr der Vater verborgen hielt.
Früher haben die Leute geglaubt, im Himmel wohnen viele Götter. Der eine von denen war der Kriegsgott. Wenn der seinen Hammer schwingt, brennt der Himmel.
Und heute?
Heute wissen wir, die vielen Götter gibt es nicht. Das war bloß so ein Gerede von den Leuten. Früher haben sie das nicht besser gewusst.
Und Krieg gibts auch nicht mehr?
Nu ja, nu nee! Krieg gibts schon immer noch. Krieg hat‘s immer gegeben. Ich glaub‘, der Krieg wird nicht aussterben nicht.
Und wenn der Himmel brennt, dann gibts Krieg?
Nu ja, früher haben die Leute so gesagt, wenn‘s Nordlicht flackert gibt‘s Krieg.
Und heute?
Die vielen Fragen des Kindes verwirrten Wilhelm. Ihm wäre lieber, er könnte still das Wunder am Himmel anstarren, doch Marias Erregung ließ das nicht zu.
Ist Krieg schlimm?
Schlimm? Oh, Madel, schon das allein ist eine ganz schlimme Frage. Reden mir lieber über was anderes, über das Wunder und die Schönheit, die uns der liebe Gott zeigt. Den heutigen Tag müssen mir uns gut merken, so was kommt nicht gleich wieder.
Da machen wir einen dicken roten Strich in unseren Kalender, der an der Wand hängt, damit wir uns merken, wann das Wunder gewesen ist. Dann können wir ausrechnen, wie lange es dauert, bis es Krieg gibt, oder ob es überhaupt keinen Krieg nicht gibt.
Nu ja, wenn’s Krieg geben sollte, dann ist das nicht gleich nächste Woche oder im nächsten Monat. Das kann dauern.
Wie lange denn?
Ach Madel, das weiß ich auch nicht so genau. Warten wir‘s ab und hoffen, dass es überhaupt keinen Krieg nicht gibt.
Aber wenn‘s keinen Krieg gibt, dann hat der Himmel ja Unrecht. Muss nicht der Himmel immer recht haben?
Du frägst einem ja Löcher in den Bauch. Sei mal ganz stille, vielleicht hören wir was.
Maria umklammerte den Hals des Vaters und fürchtete, der Himmel könne anfangen zu reden, könne klingen wie Vaters Stimme.
Henriette war es, die das heimliche Lauschen zerstörte.
Werdet ihr gleich reinkommen! Das ist ja eine furchtbare Kälte hier draußen. Das Kind holt sich den Tod, sie hat nicht einmal Strümpfe an.
Guck mal, Menzeline. Ist das nicht ein Wunder?
Maria wühlte ihren Kopf aus Vaters Joppe und flüsterte.
Muttel, guck mal, der Himmel brennt.
Das ist ein Nordlicht. Es geht fast bis über unsere Köpfe. Die Leute sagen, wenn es so stark leuchtet, wird‘s Krieg geben. Das würde aber ein großer Krieg werden.
Die Gewalt des himmlischen Leuchtens ließ Henriettes Stimme verstummen. Sie drängte sich an Wilhelms Seite, umschlang ihren Mann und das Kind, gewährte und suchte Schutz gleichermaßen.
Als sie wieder in der warmen Stube waren, ging Wilhelm Menzel zur Wand, nahm den Kalender vom Nagel und malte in das Datumsfeld des Dienstags, 25. Januar 1938 einen dicken roten Kreis.
1 Hausschuhe
Maria.
An einem Mittwoch trug Maria ihr Sonntagskleid. Es war ihr neunter Geburtstag. Ein besonderes Geschenk sollte sie bekommen. Ein richtiges Schloss wollten ihr die Eltern zeigen, hoch oben auf einem Felsen.
Im Führerhaus des Lieferwagens saßen sie eng. Maria wäre lieber auf die Ladefläche geklettert, hätte die frische Luft um die Ohren wehen lassen, doch das Kleid durfte nicht schmutzig werden. Vater hatte ein dickes Kissen zwischen die Vordersitze gequetscht, so konnte sie von ihrem erhöhten Platz dem Kopfsteinpflaster zuschauen, wie es zwischen den Vorderrädern des Autos hindurchwanderte.
Wilhelms Wunsch, einen Sohn zu bekommen, der den Namen Menzel von Generation zu Generation weiterträgt, war noch immer unerfüllt. Was den Vorvätern über Jahrhunderte gelang, blieb ihm verwehrt. Erst als Maria laufen lernte, wie ein treuer Vasall hinter ihm durch den Garten lief, Blumen liebkoste, mit täppisch kindlichem Freudengeschrei ihre Begeisterung kundtat, wandelte sich sein Empfinden. Von da an stürzte seine Zuneigung auf Maria, er überschüttete sie mit seiner Liebe und merkte nicht, was er Henriette entzog.
Ein richtiges Schloss? fragte Maria erstaunt.
Du wirst du staunen, wie groß das ist.
Kann man es schon von weitem sehen? Gibt’s dort auch einen König? Und einen Königssohn?
Groß ist das Schloss schon, doch ein König wohnt dort nicht. Nur ein Fürst. Aber ein Fürst ist auch ein mächtiger Mann, vor allem ein sehr reicher. Sogar der Kaiser war beim Fürsten schon zu Besuch.
Sehen wir den Kaiser?
Aber Mariele, wir haben keinen Kaiser mehr. Unser Kaiser ist doch weggelaufen.
Warum ist er weggelaufen, der Kaiser?
Einen Kaiser darfst du nicht fragen, was er macht. Der kann tun, was er will. Den darfste nicht einmal fragen, warum er etwas tut. Der macht, was er will.
Maria lebte, trotz ihrer neun Jahre, noch immer verwoben in der Welt der Märchen. Sie liebte Dornröschen, litt mit Schneewittchen, träumte von Prinzen auf weißen Pferden. Allen Märchen fügte sie den selbsterdachten Schlusssatz bei ... einmal kommt auch zu mir einer und führt mich in ein fremdes Land. Sie glaubte fest an den Prinz, der sie wachküsst, der sie in ein fremdes Land führt, dort glücklich macht – ohne zu ahnen, wie nah alles war, wie bitter ihre Träume eines Tages schmecken werden.
Unruhig rutschte Maria auf ihrem ungewohnten Platz herum, griff vor Aufregung ins Lenkrad, nur um Vaters Hand zu berühren. Wilhelm nahm es still hin und strich über die Stirn des Kindes, als wolle er ihre Träume verwischen. Langsam näherten sie sich der Stadt. Marias Augen waren überall.
Guck mal, Vatel, das große Haus dort hinten. Ist das das Schloss?
Nee, das große Haus ist eine Fabrik. Dort drin arbeiten viele Menschen. Hundert. Vielleicht gar zweihundert oder noch mehr. Das ist eine Spinnerei. Aber jetzt sei mal ein bisserle still, hier in der Stadt muss ich mehr aufpassen als bei uns auf dem Dorf.
Bei dem Wort Spinnerei flohen Henriettes Gedanken zu Oskar, zu seiner Blässe, aber auch zu seiner Karte aus Amerika mit der Freiheitsstatue. Um diese Gedanken zu verscheuchen, begann sie zu sprechen.
In der Spinnerei wird aus Flachs ein langer Faden gemacht. Den braucht man zum Weben. Das ist eine schmutzige Arbeit.
Das Auto fuhr um eine enge Kurve. Henriette musste ihr Reden unterbrechen und sich und das Kind festhalten. Kaum war alles wieder im Gleichgewicht sprach sie weiter.
Dahinten, siehst du den großen Schornstein mit dem Anker? Das ist eine Uhrenfabrik. Unser Wecker, der frühmorgens immer so laut klingelt, der wurde auch in dieser Fabrik gemacht.
Maria kam aus dem Staunen nicht heraus. Zweihundert Menschen in einem Haus, das konnte sie sich nicht vorstellen. Wie man eine Uhr macht, die so tickt, als schlage ein Herz in ihr, noch weniger.
Fahr nicht so schnell, Vatel. Sonst seh‘ ich ja nicht alles.
Gleich bleib ich an der Schokoladenfabrik stehen. Dort machen sie die Hochwald-Schokolade. Gell, Mariele, dort tätste am liebsten auch arbeiten, wenn du mal groß bist.
Maria schüttelte den Kopf. Sie war nach dem Vater geraten, liebte die Natur, kannte die Jahreszeiten. Wann welcher Samen in die Erde gesät, wann die einzelnen Blumen blühen, eine Frucht reif, alles wusste sie. Schon an den kleinsten Samenpflanzen erkannte sie, ob daraus ein Krautkopf oder ein Blumenkohl wachsen wird. Sie wusste Nutzpflanzen von Unkraut zu unterscheiden, auch wenn es ihre Seele schmerzte, wenn sie zusehen musste, wenn Vater blühenden Löwenzahn mit dem Spaten ausstach und auf den Kompost warf. Seine goldgelbe Blüte liebte sie, wie auch die Pusteblume, die sich aus ihr entwickelte. Vor Jahren hatte sie den Wunsch geäußert, zum Geburtstag ein ganzes Beet voller Pusteblumen zu bekommen. Es war der erste Geburtstagswunsch, den ihr der Vater nicht erfüllte. Seine Ablehnung schmerzte sie, in der Nacht hatte sie ihr Kopfkissen nassgeweint. Am nächsten Tag war sie heimlich in die hinterste Ecke des Gartens gehuscht, hatte selbst den Wind gespielt, die weißen Federkronen über ein frisch umgegrabenes Feld geblasen und gehofft, ihre frevlerische Tat werde dem Vater verborgen bleiben. In ihren Träumen flog sie mit den Samenfedern hoch in die Wolken. Ihre Fantasie war riesengroß. In einem Haus mit hundert oder gar zweihundert Menschen arbeiten zu müssen, konnte sie sich nicht vorstellen, selbst wenn dort süße Schokolade hergestellt wird. Gedankenverloren schüttelte sie ihren Kopf, während das Auto unter Lindenbäumen eine Brücke ansteuerte und anhielt.
Guck mal, Mariele, in dem Haus dort drüben, dort wird Schokolade gemacht. Die schmeckt dir doch immer so gut.
Wilhelm mühte sich, Hochdeutsch zu sprechen, doch Maria hörte ihm nicht zu. Das Summen der Bienen unter den Lindenbäumen interessierte sie mehr.
Fliegen unsre Bienen auch bis hierher, Vatel?
Nein, das ist für unsere Bienen zu weit. Soweit zu fliegen, das schaffen sie nicht. Aber guck mal auf das Wasser in der Bache, kohlrabenschwarz ist es. Man könnte meinen, es kommt aus der Hölle.
Auf Marias Frage, warum es so schwarz ist, mischte sich Henriette ins Gespräch und versuchte zu erklären, das Wasser sei durch die Kohlegruben in Waldenburg geflossen, habe sich dabei verfärbt. Maria interessierte das alles nicht, sie wäre gern weitergefahren zum Schloss, doch der langausgestreckte Am des Vaters zeigte zur Brücke.
Guck mal, das erstaunt mich aber. Die haben eine neue Brücke gebaut. Die Alte hatte drei Bögen, in der Mitte ein großer und rechts und links zwei kleine. Warum sie die weggerissen haben, versteh‘ ich nicht.
Während er noch über die neue Brücke sinnierte, kamen zwei Jungen laut lachend über die Straße gerannt. Einer trug ein kleines Holzschiff im Arm, der andere zog während des Laufs seinen rechten Kniestrumpf hoch. Sie liefen aber nicht zum tief fließenden Wasser, sondern setzten sich auf die Brückenmauer direkt unter ein gelbes Straßenschild. Sorgsam drapierten sie das Schiff auf dem Steinsims, den Bug richteten sie nach vorn. Eine dunkel gekleidete Frau, die ihnen folgte, hielt einen Fotoapparat an ihren Bauch gepresst. Schon im Heranlaufen blickte sie von oben in den Sucher. Zuerst trat sie nahe an die Jungs heran, ging danach wieder ein paar Schritte zurück. Das wiederholte sich mehrere Male. Sie schien durch ihren Sucher auch zu sehen, dass Fremde ihr dabei zuschauten. Ohne ihren Blick von der Suchlinse zu lösen, forderte sie die Fremden auf, vorüberzugehen. Sie müsse erst den richtigen Winkel für das Foto zu finden, das sei nicht so leicht. Wilhelm Menzel antwortete lächelnd, sie solle nur zuerst fotografieren, die beiden Kerlchen würden sonst ungeduldig. Die Frau machte wieder einen Schritt nach vorn und rief:
Lachen! Ihr müsst lachen.
Endlich drückte sie ab. Wie erlöst sprangen die Jungen von der Steinmauer und stürmten mit dem Schiff die Böschung hinunter zum Wasser. Wilhelm räusperte sich.
Liebe Frau, könnten sie uns auch mal fotografieren? Wissen sie, unsere Maria hat heute Geburtstag. Wir machen einen Ausflug ins Fürstliche, als Geburtstagsgeschenk sozusagen. Wenn sie mir verraten, was das Foto kostet, bezahl ich‘s ihnen gleich.
Die Frau hob ihren Blick und zeigte erstmals ihr Gesicht. Der sehr kleine Mund fiel Wilhelm sofort auf. Sie drehte an einem Hebel, bis aus dem Apparat ein Klicken zu hören war.
Das mache ich gern, aber das mit dem Bezahlen hat Zeit. Erst müssen wir gucken, ob das Bild auch gut wird. Stellen sie sich unter das Schild, dann wissen sie später, wo es aufgenommen wurde.
Maria wollte sich zwischen Vater und Mutter stellen, die fremde Frau verlangte aber, sie solle sich auf die Steinmauer setzen. Sie sei noch zu klein, das Schild solle doch mit auf das Foto. Zögernd ließ sich Maria vom Vater hochheben, hielt sich aber krampfhaft an seiner Jacke fest. Vom tief im Bachbett fließenden schwarzen Wasser drangen die spitzen Schreie der spielenden Jungen herauf.
Wenn du Geburtstag hast, musst du lachen und genau vorn in die Linse gucken. Dort kommt gleich ein Vögelchen raus!
Während die Menzels an der Brückenmauer lehnten, lief die Frau wieder vor und zurück, suchte die richtige Position. Während dieser Prozedur verstärkte sich ein eigenartiges Geräusch, schwappte zwischen den Häusern hin und her, wurde lauter. Mit erhobener Stimme forderte die Frau Maria auf, sie solle lachen. Ein Geburtstagskind müsse lachen - doch die Furcht vor dem Abgrund hinter ihrem Rücken und den immer lauter anschwellenden Tönen ließ Maria still werden. Es gelang ihr kaum, den Mund in die Breite zu ziehen. Endlich löste die Frau aus.
Wilhelm vereinbarte, das Bild in der nächsten Woche abzuholen, doch die anschwellenden Geräusche übertönten seine Stimme. Er musste lauter sprechen. Mit erhobenem Zeigefinger zeigte die Frau quer über die Kreuzung auf das Sparkassengebäude.
Dort oben wohne ich im zweiten Stock, links.
Dann ging alles sehr schnell. Ein Motorrad mit Beiwagen kam die abschüssige Straße herabgebraust. Bremsen quietschten. Ein Soldat sprang aus dem Beiwagen, stellte sich mitten in die Kreuzung und sperrte mit hoch erhobener roter Kelle jede Durchfahrt. Sogar die Frau durfte nicht mehr auf die andere Straßenseite. Maria drängte sich an Vaters Beine. Henriette fasste angstvoll nach seinem Arm. Die klirrenden Geräusche kamen näher. Plötzlich tauchten aus einer Kurve Militärlastwagen auf, die trotz ihres Tarnanstrichs in der Sonne glänzten. Maria begann zu zählen, brach aber schnell wieder ab. Was jetzt an ihr vorbeifuhr, hatte sie noch nie gesehen. Gespensterautos schienen es zu sein. Vorn fuhren sie auf normalen Gummireifen, hinten liefen gezackte eiserne Räder über klirrende Ketten. Von denen kam das furchteinflößende Rasseln. Auf den Ladeflächen der Autos saßen Soldaten dicht an dicht, ihre aufgerichteten Gewehre reichten über ihre Gesichter hinaus. Einige winkten Maria zu, doch sie mochte ihre Hände nicht vom Vater lösen. Wilhelm stand wie erstarrt. Ihm war, als rolle Gewaltiges auf ihn zu. Das Rasseln der Ketten wirkte auf ihn wie eine dämonische Kraft, der Anblick der Gewehre drohte ihn zu würgen. Das Klirren weckte die Furcht, sie würden auch nach ihm greifen, ihn auf Wege zwingen, die er niemals gehen wollte. Wilhelm wünschte, er wäre daheim geblieben. Hätte Rosen geschnitten. Erde aufgelockert. Kompost ausgebreitet. Oder sonst etwas getan.
Als die Kolonne endlich vorübergerollt war, überquerte die Frau die Straße und ließ noch hören, es gehe jeden Tag so. Das sei kein gutes Zeichen.