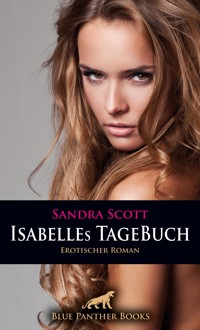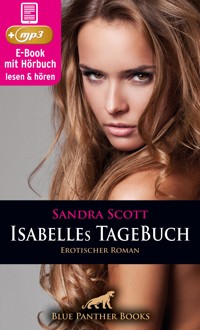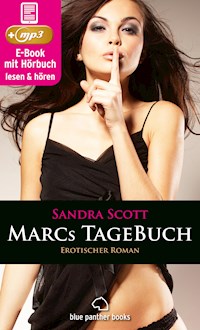Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: blue panther books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Erotik Romane
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book entspricht 224 Taschenbuchseiten Ich heiße Marc und bin Wissenschaftler. In Barcelona erforsche ich die Orgasmen von Studenten. Wenn eine Testperson allein nicht zum Höhepunkt kommt, helfen meine Kollegin Isabelle und ich gern ein wenig nach … Mit Isabelle teile ich nicht nur den Job, sondern auch die Wohnung und das Bett. Allerdings ist nicht jeder darüber glücklich und schon bald passiert ein folgenschwerer Unfall …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum:
Marcs TageBuch | Erotischer Roman
von Sandra Scott
Sandra Scott wurde 1981 in München geboren. Als Tochter eines Engländers und einer Deutschen verbrachte sie ihre frühe Kindheit in München, ihre Pubertät in London. Schon in ihrer Schulzeit begann sie zu schreiben – zunächst kurze Kriminalgeschichten, inspiriert von ihrem großen Idol Sherlock Holmes. Während ihres Psychologiestudiums verfasste sie dann romantische und später zunehmend erotische Geschichten, die sich rasch zu einem Geheimtipp unter ihren Kommilitoninnen entwickelten.Heute lebt Sandra in Edinburgh und arbeitet dort als Psychotherapeutin. Sie ist überzeugter Single. Für sie ist das Leben einfach zu kurz, um sich auf einen einzigen Sexualpartner festzulegen. In ihre erotischen Romane lässt sie ihre zahlreichen persönlichen Erlebnisse sowie ihre Erfahrungen mit ihren Patienten einfließen, wenngleich die Figuren und Handlungen natürlich frei erfunden sind.
Lektorat: Nicola Heubach
Originalausgabe
© 2013 by blue panther books, Hamburg
All rights reserved
Cover: © HadK @ shutterstock
Umschlaggestaltung: www.heubach-media.de
ISBN 9783862773411
www.blue-panther-books.de
Am späten Abend
Die kleine Praxis lag scheinbar in völliger Stille. Nur schwach drang der Schein der Straßenlaternen durch die Gardinen an den Fenstern. Im kleinen Wartezimmer mit den gemütlichen, altmodischen Sesseln lagen Zeitschriften und Ratgeber in unordentlichen Stapeln auf dem runden Beistelltisch. Der Kleiderständer war verwaist bis auf eine bedruckte Stofftasche, die ein Patient dort vergessen hatte. Im Eingangsbereich und im Flur knackte das helle Echtholzparkett leise, als die Hitze des Tages nach und nach der Kühle des späten Abends wich.
Die Tür zum Büro war nur angelehnt. Ein schwacher Lichtschein schimmerte durch den Spalt und fiel auf das Parkett im Flur. Und dann war da plötzlich noch etwas anderes, das durch den Türspalt drang: ein leises, aber beharrliches Brummen, wie von dem Vibrationsalarm eines Mobiltelefons, der auf Dauerbetrieb lief.
Im Schein einer Schreibtischlampe saß Doktor Victoria Summer hinter ihrem wuchtigen, antiken Schreibtisch aus dunklem Holz. Sie war ganz und gar in die Lektüre des schmalen Buches vertieft, das vor ihr auf der ordentlich aufgeräumten Tischplatte lag. Ihre langen roten Haare fielen ihr ins Gesicht und schimmerten im Licht der Lampe wie Strahlen aus Feuer.
Victoria Summer stieß einen tiefen Seufzer aus, während sie mit der rechten Hand das Buch umblätterte. Die linke Hand befand sich unter der Schreibtischplatte. Zwischen ihren Fingern hielt sie die Ursache des Brummens: einen kleinen, violetten Vibrator, den sie unter ihren hochgeschobenen Rock zwischen ihre Schenkel bugsiert hatte und langsam in ihrer feuchten Spalte vor und zurück bewegte.
Victoria Summer war Psychotherapeutin und lebte für ihren Beruf. Den größten Teil ihres Lebens verbrachte sie in ihrer kleinen Praxis, und selbst wenn sie sich in ihrer Wohnung aufhielt, beschäftigte sie sich meistens mit der Arbeit. Ihr Privat- und insbesondere ihr Intimleben waren bereits seit einiger Zeit so gut wie nicht mehr existent. Und jetzt dieses Buch …
Einer ihrer Patienten, ein junger Mann namens Marc Turner, hatte es, auf ihre Anregung hin, geschrieben. Sie hatte geglaubt, dass es ihm helfen würde, seine Gedanken zu ordnen. Er sollte aufschreiben, was er erlebte und was er dabei fühlte und dachte – nur für sich, niemand sonst sollte es jemals lesen.
Doch dann war Marc von seinem Aufenthalt in Spanien zurückgekehrt und hatte laufend zweideutige Andeutungen gemacht, die Victorias Neugier geweckt hatten. Als er ihr dann sein Tagebuch anbot mit dem Wunsch, sie möge ihm doch bitte mitteilen, was sie davon hielte, hatte ihre Neugier gesiegt.
Die Wirkung der Lektüre hatte nicht lange auf sich warten lassen. Marc hatte die amourösen Abenteuer, die er im Ausland erlebt hatte, sehr explizit und ausführlich beschrieben. Sie hatte sich glücklicherweise an ihren kleinen violetten Freund erinnert, der aus einer Zeit stammte, in der sie sexuell noch wesentlich aktiver gewesen war, und der seit Jahren irgendwo tief vergraben in der untersten Schublade ein trostloses und vergessenes Dasein gefristet hatte. Batterien hatte sie auch auftreiben können und dann hatte sie den Vibrator seiner zweckmäßigen Bestimmung zugeführt.
Gierig sog Victoria Wort für Wort und Satz für Satz in sich auf, fieberte dem Höhepunkt der Szene, die sie gerade las, entgegen. Und dann durchzuckte sie ein wilder Orgasmus, und ein kehliges Stöhnen löste sich von ihren Lippen.
Victoria nahm den Vibrator weg und gönnte ihrer erhitzten Muschi einige Minuten Ruhe, während sich ihr Atem langsam beruhigte. Doch sie legte das Spielzeug nicht fort, sondern blätterte die Buchseite um und las weiter. Sie hatte das dumpfe Gefühl, dass dies nicht ihr letzter Höhepunkt des Abends sein sollte.
Sie schätzte kurz die Dicke des Tagebuches ein. Auf ihrem geistigen Notizzettel vermerkte sie: Ich brauche mehr Batterien.
4. Juni
Wie beginnt man seinen ersten Tagebucheintrag? Auf keinen Fall mit »liebes Tagebuch«, das ist klar. Ich sinke nicht so tief, dass ich ein Buch wie eine Person anspreche.
Vielleicht mit einer Vorstellung? Also schön, mein Name ist Marc Turner, ich bin 27 Jahre alt und komme aus London. Beruflich … Nein, das ist doch lächerlich! Was soll das? Niemand außer mir wird dieses Tagebuch jemals lesen.
Ich habe noch nie ein Tagebuch geführt und ich sehe auch jetzt keinen Sinn darin. Aber Doktor Summer hält es für eine gute Maßnahme, wenn ich meine Gedanken aufschreibe. Das ist alles Teil der Therapie. Genauso wie meine Reise nach Barcelona.
Also sitze ich hier und schreibe, statt aus dem Fenster des Flugzeuges zu sehen und die Landschaft unter mir zu betrachten. Eigentlich habe ich keine Lust und auch keinen Nerv dafür, jetzt einen ellenlangen Roman zu verfassen. Aber irgendwann muss ich damit anfangen und jetzt erscheint mir ein guter Zeitpunkt, ehe mich mein Abenteuer in Beschlag nimmt.
Mein Abenteuer. Meine Auszeit. Ich habe ihnen gesagt, dass ich keine Auszeit brauche. Ich habe ihnen gesagt, dass mein Zusammenbruch – mir fällt kein besserer Name dafür ein – nichts mit Stress zu tun hatte. Ich habe es meinen Eltern gesagt. Meinem Chef. Meiner Therapeutin. Keiner wollte es hören.
Aber ich will mich nicht beschweren. Sechs Wochen lang in einem anderen Land, in einer anderen, aufregenden Stadt – bezahlt von meinem Chef. Ich habe keinen Grund, mich zu beklagen und will versuchen, die Zeit zu genießen, auch wenn ich überzeugt davon bin, sie nicht zu brauchen.
Barcelona – schon der Klang des Wortes lässt es in meinem Bauch kribbeln. Was für eine Stadt! Ich war schon einmal hier, für einen Kurzurlaub, und habe mich ein bisschen in die Stadt verliebt. Ich freue mich auf die Gelegenheit, hier sechs Wochen zu verbringen und die Teile der Stadt kennenzulernen, die dem gewöhnlichen Touristen verschlossen bleiben.
Ist es Zufall, dass mein Chef ausgerechnet eine Reise hierher vorschlug? Oder Schicksal? Eigentlich glaube ich nicht an Schicksal. Ich soll hier ein Forschungsinstitut besuchen und helfen, die Experimente dort mit unserer eigenen Forschung zu koordinieren. Wir beide, mein Chef und ich, wissen, dass das allenfalls drei Wochen in Anspruch nehmen wird, selbst wenn ich mir Zeit lasse. Er hat trotzdem einen sechswöchigen Besuch rausgeschlagen – meinetwegen.
Jetzt muss ich es doch schreiben: Ich mache gerade meine Doktorarbeit. Hirnforschung. Um genauer zu sein, messe ich die Gehirnaktivität von Ratten, während sie sexuell stimuliert werden. Klingt ziemlich abgefahren, aber eigentlich ist es eine ganz bodenständige Grundlagenforschung, wenn ich es mit einigen anderen Themen vergleiche, von denen ich schon gehört habe. Vor kurzem hat unsere Arbeitsgruppe eine Kooperation mit einer Forschungseinrichtung in Barcelona begonnen: Die Leute hier wollen die gleichen Beobachtungen, die wir anhand der Rattengehirne gemacht haben, jetzt an Menschen wiederholen. Ich bin ehrlich gesagt schon sehr gespannt darauf, wie man das praktisch umsetzt. Schließlich geht es darum, dass Freiwillige sich in eine klaustrophobisch enge Röhre legen, während ein überdimensionierter Magnet um sie herum einen fürchterlichen Krach produziert, und dabei sexuell erregt werden sollen. Wie soll das …
***
Nachtrag:
Entschuldigung, ich bin unterbrochen worden.
Ach, Mist. Der zweite Eintrag und schon ist es soweit: Ich entschuldige mich bei einem Tagebuch!
Egal.
Ich musste leider mit dem Schreiben aufhören, weil das Flugzeug plötzlich in einige leichte Turbulenzen geriet, und dann begann auch schon der Landeanflug. Ich musste mich zwingen, nicht die Augen zu schließen und mich in die Armlehnen zu krallen – ich fliege nicht allzu gern und das Wissen, dass mich nur ein dünner Metallboden von tausend Metern freiem Fall trennt, hilft mir nicht gerade, mich zu entspannen. Aber den Ausblick hätte ich nicht verpassen mögen.
Wir flogen geradewegs an der Küste entlang und am Fenster glitt die Stadt vorbei. Ich erkannte Barcelonas Hafen mit der Kolumbus-Statue, den metallenen Fisch, der sich über den Port Olímpic erhebt, die berühmte Rambla, die Barcelonas Altstadt mit ihren engen, verwinkelten Gassen in der Mitte durchteilt, und den Montjuic, den Hausberg der Stadt, auf dem die alte Festung über Stadt und Hafen wacht.
Dann ging das Flugzeug in eine Kurve und ich sah nur noch Wasser, weil wir den Flughafen geradewegs vom Meer aus anflogen. Unter mir rauschten die Küste und anschließend ein Industriegebiet vorbei, dann tauchte auch schon das Flugfeld auf, und nur Augenblicke später setzten die Fahrwerke sanft auf der Landebahn auf.
Durch den engen Schlauch drängten die Passagiere aus dem Flugzeug. Ein sauberes, lichtdurchflutetes Terminal mit endlosen Reihen rotbrauner Stühle erwartete mich. Ich ließ mich von der Menge weiterspülen, an Abfluggates, weiteren Sitzreihen und Toiletten vorbei, bis wir über eine kurze Treppe die Gepäckhalle erreichten. Zwanzig Minuten später zog ich meinen schweren Koffer hinter mir her ins Freie. Vor dem Flughafen standen Palmen und heiße Sommerluft wehte mir ins Gesicht.
Einige Augenblicke stand ich einfach nur da und genoss die Sonne auf meiner Haut. Vor weniger als drei Stunden war ich in London ins Flugzeug gestiegen, bei circa zwölf Grad Außentemperatur und einer dichten, seit Tagen nicht aufbrechenden Wolkendecke am Himmel. Jetzt war ich im Sommer angekommen! Ich schälte mich aus meiner Regenjacke, die ich hoffentlich in den nächsten sechs Wochen nicht mehr brauchen würde, packte meinen Koffer und machte mich auf die Suche nach dem Aerobus, der mich in die Innenstadt bringen sollte.
***
Eine knappe halbe Stunde später stieg ich am Plaça de Catalunya aus dem blauen Bus und blickte mich suchend um. Meine zukünftige Kollegin, und gleichzeitig Mitbewohnerin, Isabelle, wollte mich hier treffen. Sie stand am Anfang ihrer Doktorarbeit in dem Institut, das ich besuchte, und hatte, als ich nach einer passenden Unterkunft suchte, ein Zimmer in ihrer WG angeboten. Sie hatte mir versprochen, vor dem Springbrunnen auf mich zu warten. Die Frage war jetzt nur: vor welchem? Es gab zwei völlig gleich aussehende große Brunnen an zwei Ecken des Platzes eingebettet in ein Meer aus Blumen. Ich näherte mich demjenigen, der näher lag – und da sah ich sie, mit einem Schild in der Hand, auf dem mein Name stand.
Mit ihren langen goldblonden Locken und dem weißen Sommerkleid, das sie trug, sah sie aus wie ein Engel – ein wunderschöner Engel, muss ich hinzufügen, mit einer umwerfenden Figur, endlosen, schlanken, gebräunten Beinen und einer beeindruckenden Oberweite. Die Struktur ihres BHs zeichnete sich deutlich unter dem Kleid ab und ich ertappte mich dabei, sie mit den Augen auszuziehen. Ihr Körper musste umwerfend aussehen! Verdammt, ich habe einfach schon viel zu lange keinen Sex mehr gehabt! Ich sah in ihr schönes, herzförmiges Gesicht, dem die Sommersprossen auf ihrer Nase eine gewisse Niedlichkeit verliehen, und stellte mir unwillkürlich vor, wie es sich vor Lust verzerren würde, wenn ich es ihr besorgen würde. Auch jetzt lassen mich diese Bilder nicht los. Im Grunde eine ziemlich absurde Vorstellung, denn ich kenne mich schließlich: Ich bin viel zu zurückhaltend und schüchtern. Außerdem ist Isabelle wohl eindeutig eine Klasse zu hoch für mich. Am besten, ich schlage mir das gleich wieder aus dem Kopf.
Figur hin, Oberweite her, am meisten, ob man es glaubt oder nicht, waren es Isabelles großen, himmelblauen Augen, die mich auf Anhieb faszinierten. In diesen Augen konnte ich mich verlieren, und ich hätte sie ewig anstarren können.
Ihre Erscheinung hatte mich derart in den Bann geschlagen, dass ich für einige Augenblicke vergaß, dass sie wegen mir hier stand und die eben ausgestiegenen Touristen musterte. Also riss ich mich zusammen, sammelte mich kurz und trat einen Schritt näher. »Isabelle?«
Sie drehte sich mit einem strahlenden Lächeln zu mir um. »Hola, Marc, da bist du ja! Du bist doch wohl Marc, oder?«
»Erwartest du sonst noch jemanden?«
Sie lachte. »Nein.« Dann trat sie an mich heran, umarmte mich und gab mir einen Kuss auf jede Wange. Für einen Augenblick konnte ich ihre Oberweite an meiner Brust spüren, dann löste sie sich wieder von mir. Ich spürte, wie mir das Blut in das Gesicht stieg. Verspätet erinnerte ich mich daran, dass dies die übliche Begrüßung in Spanien war.
»Und, wie war der Flug?«, fragte Isabelle.
Ich zuckte mit den Schultern. »Ruhig, bis auf die letzten Minuten. Ich bin froh, wieder festen Boden unter mir zu haben.«
Isabelle nickte. »Okay. Du willst wahrscheinlich erst mal dein Gepäck loswerden. Oder willst du dich gleich ins Gewühl stürzen? Die Rambla beginnt gleich da vorn.«
Ich schüttelte meinen Kopf. »Nein, wenn du nichts dagegen hast, würde ich gern gleich zur Wohnung fahren.« Ich blickte an mir hinab. »Ich bin für diese Hitze unpassend angezogen.«
»Stimmt.« Isabelle setzte sich in Bewegung und ich folgte ihr quer über den Platz. »Wie ist das Wetter zurzeit in England?«
»Wir haben den Sommer übersprungen und sind direkt zum Herbst übergegangen«, antwortete ich und Isabelle lachte.
Sie führte mich zu einem anderen Platz in der Nähe, wo wir in die Metro einstiegen und einige Stationen weit fuhren. Ich wusste, dass sich unsere Wohnung im Stadtteil Pomblenou befand, einem ehemals industriell geprägten Wohngebiet, das direkt am Meer lag. Während der kurzen Fahrt fragte mich Isabelle neugierig über meine Reise aus. Doch bereits nach wenigen Minuten erreichten wir unser Ziel und stiegen aus. Mühsam zerrte ich meinen schweren Koffer die Treppe hinauf auf die Straße und sah mich aufmerksam um.
Um mich herum herrschte geschäftiges Treiben. Im Erdgeschoss der meisten Häuser befanden sich kleine Läden, Bars oder Cafés, darüber fünf- bis achtstöckige Wohneinheiten. Die Häuser schienen aus den siebziger oder achtziger Jahren zu stammen und befanden sich in unterschiedlichen Stadien der Abnutzung. Einige sahen frisch renoviert und einladend aus, aber die meisten befanden sich in keinem sonderlich beeindruckenden Zustand. Auf den Bürgersteigen erledigten Menschen ihre Einkäufe und auf den Straßen brausten alte Autos und Mopeds vorbei.
Isabelle führte mich zwei Straßen weiter bis zu einer Ecke der charakteristischen, schachbrettartig angelegten Häuserblöcke, die Barcelona rings um die Altstadt herum prägen. Als wir den Eingangsbereich betraten, staunte ich nicht schlecht über den schicken, glänzenden Steinboden, die Glastür mit dem goldenen Rahmen und die Briefkästen, die aussahen wie aus Marmor gefertigt. Die Bewunderung verschwand sogleich, als wir das enge, heruntergekommene Treppenhaus betraten. Die Wohnungstüren waren alt, das Metall der runden Türknäufe in ihrer Mitte angelaufen, der Steinboden abgenutzt. Der Lift, mit dem wir in das oberste Stockwerk fuhren, war so eng, dass ich mich unvermittelt ganz nahe bei Isabelle wiederfand. Ich roch ihr dezentes Parfüm, das mich an Gänseblümchen erinnerte, und als der dünne Stoff ihres Sommerkleides meinen Arm streifte, spürte ich eine Gänsehaut, die sich über meine Haut ausbreitete.
In der Wohnung selbst war es angenehm kühl. Ein langer Flur verband den Eingangsbereich mit einer Glastür, die auf eine kleine Dachterrasse führte. Mehre Türen gingen davon ab.
»Hier vorn ist die Küche«, erklärte Isabelle und zeigte mir einen kleinen Raum mit einer Küchenzeile, Gasherd und einem gewaltigen Kühlschrank. »Daneben ist das Bad. Und danach kommen unsere Zimmer. Und hier gegenüber ist das Wohnzimmer!«
Isabelle schob mich in einen relativ großen Raum, dessen eine Hälfte von einem altmodischen, dunklen Esstisch mit vier dazu passenden Stühlen und die andere Hälfte von einer bequem aussehenden Sitzecke samt Fernseher beherrscht wurde. Auf einem Sofa saßen zwei Mädchen.
»Das sind«, sagte Isabelle, »Claire und Carmen, deine neuen Mitbewohnerinnen. Mädels, das ist Marc.«
Ich musste in diesem Augenblick kein sonderlich intelligentes Gesicht gemacht haben. Ich war so überrascht, dass ich einige Sekunden brauchte, um mich an die grundlegendsten Umgangsformen zu erinnern und zu grüßen.
Isabelle hatte mir schon per Mail im Vorfeld mitgeteilt, wie die anderen beiden Mädchen heißen. Und bei den Namen Claire und Carmen hatten sich bestimmte Bilder vor meinem inneren Auge gebildet, die nun an der Realität zerbarsten.
Carmen war eindeutig asiatischer Abstammung: Sie war klein und zierlich, hatte schimmerndes schwarzes Haar, das ihr bis zum Po reichte, braune Mandelaugen und ein fein geschnittenes Gesicht wie eine Porzellanfigur. Wie ich später erfuhr, waren ihre Eltern aus Thailand hierher eingewandert, sie selbst war in Spanien geboren und aufgewachsen. Carmen lächelte mir schüchtern zu und wandte dann den Blick ab.
Claires Herkunft verortete ich richtigerweise irgendwo in Lateinamerika – sie stammte in der Tat aus Französisch-Guayana, einem der letzten verbliebenen französischen Überseegebiete. Als sie aufstand, um mich zu begrüßen, bot sie einen beeindruckenden Anblick. Sie war groß, beinahe so groß wie ich, und hatte den Körper eines Models. Endlose Beine, schlank, aber mit Kurven an den richtigen Stellen. Ihre Haut hatte die Farbe von Cappuccino. Schwarze glatte Haare und dunkle, beinahe schwarze Augen, aus denen sie mich abschätzend, aber nicht unfreundlich musterte, vervollständigten ihre Erscheinung.
Nach der Begrüßung und einigem Smalltalk zeigte mir Isabelle noch mein Zimmer. Ich packte meinen Koffer aus, schlüpfte in gemütlichere Kleidung und nahm das Zimmer in Augenschein. Irritiert stellte ich fest, dass es, wie auch alle anderen Räume der Wohnung, mit einfachen Steinfliesen ausgelegt war, die ich bisher allenfalls von Hausfluren kannte. Ansonsten war das Zimmer zweckdienlich und ein wenig spartanisch eingerichtet. Die leeren schmutzig-weißen Wände wirkten trostlos, doch immerhin würde ich nur einige Wochen hier sein und mich zudem vermutlich nur zum Schlafen in diesem Raum aufhalten. Nachdem ich meine Sachen eingeräumt hatte, gesellte ich mich wieder zu meinen Mitbewohnerinnen, die es sich inzwischen auf der Dachterrasse gemütlich gemacht hatten.
Die Abenddämmerung brach herein und mir bot sich ein wundervoller Ausblick über die Dächer Barcelonas und den nahen Strand. Claire öffnete eine Flasche Rotwein – später noch eine zweite – und wir saßen bis in die tiefste Dunkelheit zusammen und machten uns miteinander bekannt.
Jetzt bin ich hundemüde und freue mich auf mein Bett. Morgen werde ich meinen Arbeitsplatz für die nächsten Wochen kennenlernen und bin gespannt darauf, was mich erwartet. Mein Abenteuer beginnt!
5. Juni
Das! Ist! Der! Pure! Wahnsinn!
Meine Hand zittert noch ein wenig vor Aufregung. Wahrscheinlich kann ich morgen kein Wort von diesem Gekrakel mehr entziffern, aber ich muss es einfach aufschreiben. Jetzt, wo das Erlebte noch frisch ist.
Ich kann es noch gar nicht glauben, dass mir so etwas passiert ist! Ich dachte, so was gibt es nur in Filmen. Vorzugsweise in solchen, in denen schlüpfrige Männerfantasien bedient werden.
Aber der Reihe nach.
Isabelle und ich machten uns am Morgen zu Fuß auf den Weg zum Institut, der geradewegs am Strand entlanglief. Es war einfach herrlich. Die Sonne war gerade am Horizont über den Wellen aufgegangen. Es war bereits angenehm warm, aber noch nicht heiß. Der Weg aus rotbraunen Steinplatten, die wie Holzbohlen gemasert waren, wurde auf der einen Seite von Palmen und auf der anderen Seite von einer endlosen Reihe steinerner Sitzbänke gesäumt. Gut zwei Meter unter uns verlief der breite Sandstrand. Auf dem Strand selbst, ebenso wie auf der Promenade darüber, waren Fahrradfahrer, Inlineskater, Jogger und Spaziergänger unterwegs, die ihre Hunde Gassi führten. Während wir uns auf die beeindruckende Fischskulptur aus Stahlgeflecht zubewegten, die in einiger Entfernung zwischen zwei Bürotürmen am Strand aufragte, sah ich ein Flugzeug auf die Küste zufliegen und erinnerte mich an die fantastische Aussicht, die ich beim Anflug gehabt hatte.
Nur mit Mühe konnte ich ein enthusiastisches Auflachen unterdrücken. Ich fühlte mich einfach großartig! Die ungewohnte Sonne so früh am Morgen belebte mich, dazu die wunderschöne Aussicht auf das Meer, die Wellen, die sanft gegen den Strand brandeten, die Palmen, die Möwen … das alles machte mir eine verboten gute Laune.
Das entging auch Isabelle nicht, die mich von der Seite aus neugierig ansah. »Das ist anders als London, oder?«, fragte sie.
Ich lachte. »Es ist fantastisch!«
Isabelle nickte. »Ich weiß genau, was du meinst. Es liegt vor allem am ständigen Sonnenschein. Im ersten Jahr hier war es wie ein Rausch, weißt du? Ich hatte ständig den Drang, etwas zu unternehmen, die Sonne auszunutzen. Das ist man ja gewöhnt aus England: die wenigen wirklich schönen, warmen Tage nutzen. Aber irgendwann habe ich begriffen: Sonnentage sind hier nichts Kostbares.«
»Für mich schon«, erwiderte ich. »Ich habe jetzt sechs Wochen Sonne vor mir, und das finde ich einfach großartig!«
Im Institutsgebäude angekommen, führte mich Isabelle zu den Räumen ihrer Arbeitsgruppe, wo ich vom Gruppenleiter, einem kleinen, pummeligen Franzosen in den Vierzigern, überschwänglich begrüßt wurde. Er führte mich in den Räumen des Instituts herum und stellte mir die anderen Mitglieder seiner Gruppe vor. Dann fragte er Isabelle, wann sie denn den nächsten Probanden erwarte.
»Jetzt«, antwortete Isabelle. »In ein paar Minuten.«
»Ausgezeichnet«, freute er sich. »Dann kann Marc gleich mal sehen, wie es abläuft.« Er wandte sich wieder an mich. »Wir reden dann später weiter.«
Isabelle führte mich in einen Raum, in dem sich auf zwei Schreibtischen Computertürme und Bildschirme drängten. Durch eine Glasscheibe konnte man die große weiße Röhre des Magnetresonanztomographen, kurz MRT, erkennen. Ich musste ein Schaudern unterdrücken, als Erinnerungsfetzen vor meinem inneren Auge erschienen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte man mich selbst in eine solche Maschine geschoben. Mir war schwindelig und übel gewesen, ich hatte meine rechte Körperhälfte nicht bewegen und überdies nur noch lallen, statt sprechen können. Ein halbes Dutzend Ärzte und Pfleger waren um mich herumgewuselt, hatten mir Kontrastmittel gespritzt und meine Kleidung nach metallischen Gegenständen durchsucht. Dann kam ich mit fixiertem Kopf in diese Röhre und hatte das Gefühl, lebendig in einem Sarg zu stecken, nur dass es auf dem Friedhof sicher nicht so höllisch laut wäre.
Ich versuchte, mich damit zu beruhigen, dass es diesmal ganz anders sein würde. Nicht nur, weil ich nicht selbst in die Röhre musste, sondern andere dabei überwachte. Vor allem aber waren es gesunde Freiwillige, die keine potentiell lebensbedrohlichen Krankheiten hatten, sondern für eine Tafel Schokolade oder eine kleine Aufwandsentschädigung ein wenig Zeit der Wissenschaft opferten.
»Kennst du dich damit aus?«, wollte Isabelle wissen.
Ich nickte. Ich konnte nicht behaupten, die genauen physikalischen Vorgänge zu begreifen, die dazu führten, dass man mithilfe eines starken Magnetfelds Gehirnaktivität messen konnte, aber im Prinzip quantifizierte man Änderungen in Durchblutung und Sauerstoffgehalt von Gehirnarealen, von denen wiederum auf Aktivitäten der entsprechenden Regionen geschlossen werden konnte. »Ich weiß, wie es funktioniert«, sagte ich einfach.
»Gut. Wenn du den Raum mit dem MRT betreten willst, darfst du nichts Magnetisches am Körper haben. Pack dein Handy, deine Uhr und alles, was du sonst noch hast, am besten in deinen Rucksack.« Sie sah mich abschätzend an. »Hast du irgendwelche versteckten Piercings?«
Ich bildete mir ein, dass sie leicht enttäuscht wirkte, als ich den Kopf schüttelte. Aber sie nickte nur und sagte: »Gut. Die hättest du sonst rausnehmen müssen.«
In diesem Moment klopfte es an der Tür zum Vorraum und Isabelle ging hinaus, um das Opfer, beziehungsweise den Freiwilligen, hineinzulassen. »Mach’s dir bequem«, rief sie mir zu. »Ich erklär dir gleich alles.«
Ich nahm auf einem der Bürostühle Platz und ließ meinen Blick über die Computermonitore schweifen. Auf einer Benutzeroberfläche mit vielen kleinen Fenstern waren Diagramme und Einstellungen abgebildet, andere waren schwarz und warteten offensichtlich auf Dateninput.
Durch die Glasscheibe konnte ich jetzt Isabelle sehen, die eine Studentin zum MRT führte, ein zierliches schwarzhaariges Mädchen, das höchstens zwanzig sein konnte. Sie trug einen einfachen grünen Kittel und offensichtlich keine Hosen. Isabelle bedeutete ihr, sich auf eine weiße Liege zu legen, brachte einige Klebe-Elektroden an und spannte dann ihren Kopf in ein weißes Gebilde ein, von dem ich wusste, dass es für die genaue Detektierung der Veränderungen im Gehirn verantwortlich war. Anschließend instruierte Isabelle das Mädchen und schob die Liege in die monströse Röhre. Dann kam sie zu mir in den Computerraum.
Sie drückte auf einen kleinen Knopf, der die Gegensprechanlage mit dem schallisolierten Raum aktivierte. »Ich starte jetzt die Aufnahme. Bleib ganz ruhig liegen.«
Isabelle klickte auf einigen Schaltflächen der Bediensoftware herum, und im Nebenraum begann das MRT deutlich hörbar durch die isolierten Glasscheiben zu brummen und dröhnen.
»Ich mache jetzt erst mal eine Messung im unerregten Zustand«, erklärte mir Isabelle.
Ich nickte. »Als Referenz.«
»Richtig. Danach messen wir, während sie sexuell erregt ist.«
»Und wie macht ihr das?«, fragte ich neugierig.
»Sie macht es sich selbst«, erklärte Isabelle schlicht.
»Hier, in der Röhre?«
»Ihre Muschi ist außerhalb.« Isabelle grinste. »Ihre Hände darf sie bewegen, nur den Kopf nicht. Ziel ist, dass sie sich zum Höhepunkt bringt.« Isabelles himmelblaue Augen strahlten, als sie mich ansah. »Ist das nicht spannend? Herauszufinden, was beim Orgasmus so im Kopf passiert?«
»Jaaah«, dehnte ich. Ich konnte ihr ja schlecht sagen, dass »spannend« nicht unbedingt das Wort war, das mir dazu spontan eingefallen wäre. Die Vorstellung, jetzt gleich zu erleben, wie diese junge Studentin sich selbst zum Höhepunkt masturbierte, während ich schon seit Monaten auf Sex-Entzug war, fand ich zugleich erregend und frustrierend.
Die erste Messung war nach einigen Minuten abgeschlossen. Isabelle betätigte wieder die Sprechanlage. »Du kannst jetzt anfangen, Maria.«
Zeitgleich drückte Isabelle noch einen weiteren Knopf, der die Jalousien an der Glasscheibe herabließ. »Damit sie ein wenig Privatsphäre hat«, erklärte Isabelle mir lächelnd. »Es ist so schon schwer genug in dieser Umgebung. Für Notfälle haben wir die Überwachungskamera«, sie deutete auf einen kleinen Monitor und zwinkerte mir zu, »aber verrate das den Studenten nicht.«
Durch die Lautsprecher der Gegensprechanlage drang jetzt ein leises, unterdrücktes Stöhnen. Ich blickte auf eine Darstellung des Gehirnscans, auf dem sich bunte Lichter bewegten.
»Das sagt dir gar nichts«, erklärte Isabelle, als sie meinen Blick bemerkte. »Um wirklich irgendwelche sinnvollen Ergebnisse zu bekommen, müssen die Daten ausführlich analysiert werden.«
Nach einigen Minuten erklang Marias leise Stimme: »Es klappt nicht.«
»Du machst das großartig«, behauptete Isabelle in das Mikrofon. »Versuch, dich zu entspannen.«
Nach einigen weiteren Minuten meldete sich Maria erneut. »Es geht einfach nicht.« Ihre Stimme klang zu gleichen Teilen entschuldigend und frustriert.
Isabelle drehte sich zu mir um. »Wer soll ihr zur Hand gehen?«, fragte sie. »Du oder ich?«
Ich starrte sie aus großen Augen an und glaubte zunächst, mich verhört zu haben. »Was?«
Isabelle zuckte mit den Schultern. »Sie schafft es nicht allein, sie braucht Hilfe.«
»Du willst da reingehen und sie befriedigen?«, vergewisserte ich mich ungläubig.
»Wenn du es nicht tun willst«, erwiderte Isabelle ungerührt. »Was glaubst du, wie wenigen es gelingt, sich in dieser Situation so fallen zu lassen, dass sie zum Orgasmus kommen? Wenn ich es ihnen selbst überlassen würde, bekämen wir nur von jedem zehnten Freiwilligen Daten, wenn überhaupt.« Sie zwinkerte mir zu. »Mit meiner Hilfe schaffen es fast alle.«
»Aber das kannst du doch nicht machen!«, stieß ich erschrocken hervor.
»Warum nicht?«, wollte Isabelle wissen. »Bist du einer von diesen Moralaposteln? Nur weil ich eine Frau bin, heißt das nicht, dass ich Sex und Gefühle nicht voneinander trennen kann. Und außerdem … warum sollen hier nur die Studenten ihren Spaß haben?«
Ich schüttelte den Kopf. Abgesehen davon, dass ich die Vorstellung unglaublich fand, dass jemand, um mehr Daten für eine Studie zu bekommen, massenweise fremde Menschen sexuell befriedigte, gingen meine Bedenken in eine völlig andere Richtung. Schließlich war ich durch und durch Wissenschaftler.
»Aber das verfälscht doch die Ergebnisse!« Ich dachte daran, wie peinlich genau ich bei meinen eigenen Experimenten darauf achtete, die Versuchstiere in keiner Weise zu beeinflussen.
Isabelle zuckte mit den Schultern. »Wieso denn? Wir wollen einen Orgasmus messen, oder? Ist doch egal, wie der zustande kommt.«
»Was soll ich machen?«, fragte Marias ungeduldige Stimme aus dem Lautsprecher. »Brechen wir ab?«
»Also willst du es ihr jetzt besorgen oder nicht?«, fragte Isabelle herausfordernd.
Mir fielen spontan mindestens ein Dutzend Gründe ein, wieso es überhaupt nicht wissenschaftlich korrekt war, was wir da taten. Aber andererseits – wie lange war es jetzt her, dass ich zum letzten Mal die Muschi einer Frau geschmeckt hatte? Die einzige richtige Antwort darauf war: viel zu lange.
Ich betätigte die Sprechanlage und räusperte mich. »Soll ich dir helfen?«
Einige Augenblicke war es still auf der anderen Seite, dann kam zögernd die leise Antwort: »Ja.«
Isabelle zwinkerte mir zu, als ich zur Tür ging. »Viel Spaß. Und sei nicht zu heftig, sonst verwackelt das Bild.«
Ich betrat den Untersuchungsraum und näherte mich dem MRT. Marias grüner Kittel war bis über ihren Bauchnabel hochgerutscht und gab den Blick auf ihre nackten, braungebrannten Beine und ihren Intimbereich frei.
Ich erinnerte mich daran, dass Marias Kopf im Inneren der Röhre festgeklemmt war und sie mich nicht sehen konnte. Um sie nicht zu erschrecken, sprach ich sie leise an: »Hallo Maria. Ist alles in Ordnung?«
»Ja«, kam die zaghafte Antwort aus dem Inneren.
»Versuch, dich zu entspannen«, riet ich ihr. »Schließ einfach die Augen und stell dir vor, du lägst auf deinem Bett.« Ich überlegte kurz. »Stell dir vor, du hast diesen netten und unglaublich süßen Typen kennengelernt, der dich jetzt verwöhnen will. Versuch, alles andere zu vergessen und dich fallen zu lassen.«
»Okay.«
Ich berührte mit einer Hand sanft ihren Unterschenkel. Sie zuckte kurz zusammen, entspannte sich dann aber wieder. Ich legte meine andere Hand auf ihr anderes Bein. In zärtlichen, langsamen Bewegungen streichelte ich über ihr Knie, ihre Oberschenkel, ihren flachen Bauch und den zarten Flaum dunkler Schamhaare, die über ihrer Spalte sprossen. Mit den Fingerspitzen beschrieb ich kleine Kreise über die Innenseite ihrer Oberschenkel und registrierte zufrieden den leichten Schauer, der über ihre Haut fuhr. Als ich das erste Mal mit einem Finger ihre Schamlippen entlangstrich, spürte ich, wie sie den Atem anhielt. Ich beugte mich nach vorn, stützte mich zwischen ihren gespreizten Beinen mit meinen Ellenbogen auf die Liege und näherte mich mit meinem Gesicht ihrem Intimbereich.
Ich nahm ihre zarte junge Muschi ausgiebig in Augenschein, während ich genussvoll ihren Duft einsog. Es war eindeutig viel zu lange her, seit ich so etwas das letzte Mal getan hatte, und am liebsten hätte ich mich auf sie gestürzt und mich in dem zarten rosa Fleisch vergraben. Aber ich wollte die eingeschüchterte junge Studentin nicht verschrecken. Ich streckte meine Zunge weit heraus und leckte einmal langsam von unten nach oben über ihre gesamte Spalte. Marias Kehle entrang sich ein leises Seufzten, als meine Zunge über ihre Klitoris glitt. Ich ließ meine Zungenspitze jetzt jeden Millimeter der jungen Möse erkunden, die kleinen Fältchen dort, wo die äußeren Schamlippen zusammenlaufen, den Rand der Lippen selbst, den kleinen Ausgang der Harnröhre, bis hinunter zum Damm zwischen Vulva und Anus. Immer wieder ließ ich dabei meine Zunge auch zwischen ihre Schamlippen schnellen und erntete dabei jedes Mal ein wohliges Stöhnen. Mit zwei Fingern spreizte ich ihre Lippen, um mit der Zunge tiefer in das rosa Fleisch eindringen zu können und kostete den süßen Geschmack ihrer feuchten Möse.
Dann beschloss ich, ernst zu machen, und glitt mit der Zunge nach oben zu ihrem bereits angeschwollenen Kitzler. Ich stülpte meine Lippen um ihre zarte Perle und saugte leicht daran. Inmitten des Vakuums, das ich dadurch schuf, begann meine Zungenspitze mit der Knospe zu spielen, zunächst ganz zärtlich und schließlich immer schneller und wilder. Marias unterdrücktes Stöhnen und die Zuckungen ihres Unterleibs feuerten mich nur zusätzlich an. Ich ließ währenddessen meine Hände über ihren schlanken Körper gleiten, über ihre Schenkel, ihre Pobacken und über den Bauch hinauf bis zu ihren kleinen, festen Brüsten, die ich unter dem Kittel ertasten konnte.
Ich steigerte meine Bemühungen immer weiter, bis plötzlich ein lautes »Dios mío!« aus der Röhre drang. Maria spannte alle Muskeln ihres Unterkörpers an und ihre Möse begann wild zu zucken. Ich verharrte bewegungslos wie ich war, bis der Höhepunkt abgeklungen war, drückte einen zärtlichen Kuss auf ihre klatschnasse Spalte und erhob mich dann.
»Sehr gut«, erklang plötzlich Isabelles Stimme aus dem Lautsprecher und ich fragte mich, wen sie damit meinte. »Bleib bitte noch einige Minuten still liegen, Maria, dann bist du erlöst.«
Maria antwortete nicht. Ich sah am Heben und Senken ihres Bauches, dass sie immer noch schwer atmete. Lächelnd verließ ich das Untersuchungszimmer und gesellte mich wieder zu Isabelle. Sie drehte sich auf ihrem Bürostuhl zu mir um, musterte mich und grinste dann. »Du hast das genossen«, stellte sie fest.
Ich zuckte nur mit den Schultern.
»Und du warst sehr gut«, fuhr Isabelle fort. »Sehr einfühlsam.«
»Danke«, erwiderte ich und ließ mich auf meinen Stuhl fallen. Ich spürte Isabelles forschenden Blick weiter auf mir ruhen, beschloss aber, ihn zu ignorieren.
»Was passiert jetzt?«, fragte ich betont sachlich.
»Wir messen noch das Abklingen der Erregung«, antwortete Isabelle. »Das dürfte in diesem Fall eine Weile dauern, schätze ich.«
Ich konnte mir ein leichtes Lächeln nicht verkneifen. Es war offensichtlich, dass Isabelle mich provozieren wollte. Ich ging absichtlich nicht darauf ein, um zu sehen, wie weit sie gehen würde. Das Spiel begann, mir Spaß zu machen.
Wir brachten den Rest der Untersuchung größtenteils schweigend hinter uns und befreiten Maria dann aus der Röhre.
Ich reichte ihr eine Hand, um ihr von der Liege zu helfen. Ihr Gesicht war gerötet und sie blickte mich aus großen Augen an, als ich sie zur Umkleide brachte. Bevor sie darin verschwand, drehte sie sich noch einmal zu mir um.
»Das … das war sehr schön«, flüsterte sie in gebrochenem Englisch und wich dabei meinem Blick aus. »Danke.«
»Ich fand es auch schön«, gab ich zu und schenkte ihr ein Lächeln.
Das schien sie nur noch nervöser zu machen. Mehrmals öffnete sich ihr Mund und schloss sich wieder, ohne etwas zu sagen. Ich wollte mich schon abwenden, als sie plötzlich doch noch einige Worte hervorstieß: »Wollen wir mal … ich meine … vielleicht könnten wir …« Verlegen brach sie ab.