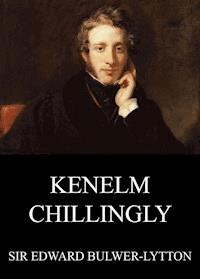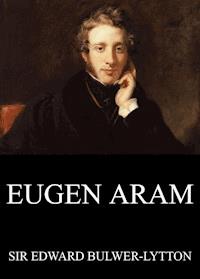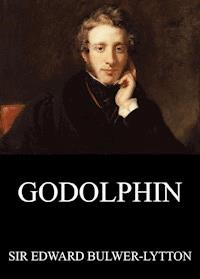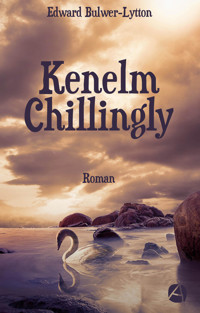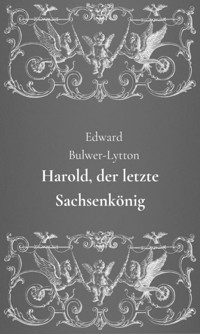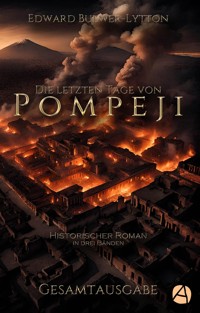Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Die seltsame Geschichte eines schwarzen Magiers" ist ein außergewöhnlicher Beweis für den Glauben und die Faszination für das Okkulte und Spirituelle, das in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts herrschte, und spiegelt Bulwer-Lyttons eigene Ansichten wider. Der junge Held, Doktor Allen Fenwick, ist völlig unfähig, dem bösartigen Einfluss des unheimlichen Margrave auf seine Geliebte, die mystische Lilian, durch wissenschaftliche Methoden entgegenzuwirken. Wird dies ihn dazu bringen, sein rationalistisches Glaubensbekenntnis beiseite zu legen und die Vorstellung einer Welt jenseits unserer eigenen anzunehmen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 939
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margrave
Die seltsame Geschichte eines schwarzen Magiers
Edward Bulwer-Lytton
Impressum
2022 ©Verlag Heliakon
Umschlaggestaltung: Verlag heliakon
Titelbild: Pixabay (Mysticsartdesign)
Übersetzung: Dr. Karl Kolb
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
66. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
1. Kapitel
Im Jahre 18... begann ich meine Praxis als Arzt in einer der reichsten von unseren großen englischen Städten, die ich nur mit dem Anfangsbuchstaben L… bezeichnen will. Ich war noch jung, hatte mir aber schon einigen Ruf erworben durch ein wissenschaftliches Werk, das, wie ich glaube, noch jetzt in Betreff des behandelten Gegenstandes als eine Autorität gilt. Ich machte meine Studien in Edinburg und Paris und erwarb mir an diesen ausgezeichneten medizinischen Schulen den Beifall meines Lehrers in einem Grade, welcher den Ehrgeiz des Studenten wohl zu der Aussicht aus künftige Auszeichnung berechtigte. Nachdem ich Mitglied des Ärztekollegiums geworden, bereiste ich die Hauptstädte Europas, an deren ausgezeichneten Praktiker ich mit Empfehlungsschreiben versehen war, sammelte mir aus den verschiedenen Theorien und Heilmethoden das Material, um die auf den Universitäten gelegten praktischen Grundlagen umfassend und vorurteilsfrei zu erweitern, und nahm mir vor, schließlich meinen Wohnsitz in London zu nehmen. Ehe ich jedoch meine wissenschaftliche Reise beendigt hatte, trat eines jener unerwarteten Ereignisse ein, welche so oft die selbstständigen Entwürfe des Menschen vereiteln, und bewog mich, meinen Plan zu ändern. Als ich auf dem Weg nach dem nördlichen Italien durch Tirol kam, fand ich in einem kleinen, von ärztlicher Hilfe weit abgelegenen Wirtshaus einen englischen Reisenden, der an einer Lungenentzündung gefährlich erkrankt war. Ich widmete mich ihm Tag und Nacht, und so hatte ich, vielleicht mehr infolge der sorgsamen Pflege, als der angewandten Arzneimittel, das Glück, ihn vollständig wieder hergestellt zu sehen. Der Reisende war selbst ein ausgezeichneter Arzt, Julius Faber, der sich beschieden hatte, seinen Geburtsort, die Provinzialstadt L…, zu seinem Wirkungskreis zu wählen, obschon er als denkender und origineller Pathologe einen weitverbreiteten Ruf besaß, wie denn auch seine Schriften einen nicht unwichtigen Teil meiner Spezialstudien ausgemacht halten. Er war im Begriff, mit erneuerter Kraft von einem kurzen Erholungsausflug wieder heimzukehren, als ihn die erwähnte Heimsuchung traf. Der Patient, der mir so zufällig in den Wurf kam, wurde der Gründer meines Glücks als Arzt. Er fasste eine warme Zuneigung zu mir, vielleicht um so mehr, weil er ein kinderloser Hagestolz war und der Neffe, auf den sein Reichtum übergehen sollte, nichts von dem Wunsche merken ließ, auch in die Mühen einzutreten, durch welche dieser Reichtum errungen worden. Ein Erbe für diesen war vorhanden; nach einem Nachfolger in jenen aber hatte er sich lange vergeblich umgesehen, und er setzte sich nun in den Kopf, denselben in mir gefunden zu haben. Ich musste ihm beim Abschied versprechen, mit ihm einen regelmäßigen Briefwechsel zu unterhalten, und es stand nicht lange an, als er mir schrieb, welche Plan er zu meinen Gunsten vorhabe. Er sei alt, lautete sein Brief, die Praxis überbiete seine Kräfte, und er bedürfe einer Unterstützung; er könne es nicht über sich gewinnen, die Gesundheit seiner Patienten, die ihm wie Kinder nahe ständen, zu einem Gegenstand des Verkaufs zu machen, um so weniger, da er nach dem Geld nicht zu fragen habe; dagegen liege ihm sehr am Herzen, dass der Menschheit, welcher er gedient, und dem Ruf, den er erworben habe, durch die Wahl eines Nachfolgers kein Nachteil erwachse. Kurz, er machte mir den Vorschlag, ich solle ohne Weiteres nach L… kommen und ihm in seiner Praxis an die Hand gehen, nach Ablauf von zwei Jahren aber dieselbe ganz übernehmen, da er nach dieser Frist sich vom Geschäft zurückzuziehen beabsichtige.
Ein so vorteilhafter Antrag bietet sich nicht oft einem jungen Mann dar, der im Begriff ist, in einen übersetzten Beruf einzutreten; und obschon mein Streben nicht so fast auf großen Erwerb, als auf Ruhm und Auszeichnung ging, so galt mir doch der Ruf des Arztes, der mir so großmütig die unschätzbaren Vorteile seiner langjährigen Erfahrung anbot und mich mit solcher Herzlichkeit in die Praxis einzuführen beabsichtigte, als Bürgschaft, dass ein Wohnsitz in der Hauptstadt nicht eben notwendig sei, um sich in die Reihen der Größen zu erheben, welche von der Nation gefeiert werden.
Ich begab mich also nach L…, und noch ehe die zwei Jahre meiner Geschäftsteilhaberschaft zu Ende waren, sah mein wohlwollender Freund, durch das Vertrauen, das ich gewann, und das meine eigenen Erwartungen weit überstieg, seine Wahl gerechtfertigt. Ich war gleich am Anfang so glücklich, einige Kuren zu erzielen, die zum Stadtgespräch wurden, und es fällt bei einem Arzt sehr ins Gewicht, wenn schon bei seinem ersten Auftreten einige bedenklich scheinende Fälle, die ein erfolgreiches Handeln zulassen, ihm das Vertrauen anbahnen, welches die Patienten meist nur der reiferen Erfahrung zu schenken pflegen. Zu dem raschen Aufschwung, den meine Laufbahn nahm, trugen wahrscheinlich auch einige andere Umstände bei, die mit meinem ärztlichen Wissen nichts zu schaffen hatten. Die Zufälligkeiten einer guten Herkunft und eines schönen Privatvermögens schützten mich vor dem Verdacht, dass ich ein medizinischer Abenteurer sei. Ich gehörte einer alten Familie, einem Zweig der ehedem mächtigen Grenzclans der Fenwicke, der seit vielen Generationen ein schönes Gut in der Nähe von Windermere besaß. Diese Besitzung war mit dem Antritt der Volljährigkeit auf mich, als den einzigen Sohn, übergegangen und von mir verkauft worden, um die Schulden meines Vaters abzutragen, welcher für seine Liebhaberei, Altertümer zu sammeln, große Summen aufgewendet hatte. Der Rest des Erlöses sicherte mir, abgesehen von dem Ertrag meiner Praxis, eine bescheidene Unabhängigkeit, und da ich gesetzlich nicht verpflichtet war, die Verbindlichkeiten meines Vaters zu tilgen, so gewann ich durch mein Verhalten den Ruf der Uneigennützigkeit und Rechtschaffenheit, welcher in England das Publikum stets günstig stimmt für die Erfolge, die man durch Talent oder Betriebsamkeit erwirbt. Man gestand mir vielleicht Geschicklichkeit in meinem Beruf um so bereitwilliger zu, weil ich auch die medizinischen Hilfswissenschaften mit Eifer betrieben hatte, mit einem Wort, ich befand mich in der Lage, in der Gesellschaft eine Stellung einzunehmen, die meinem ärztlichen Ruf zu Hilfe kam und großenteils den Neid zum Schweigen brachte, welcher den Erfolg gewöhnlich verbittert und bisweilen sogar hindert.
Doktor Faber zog sich der Übereinkunft gemäß nach Ablauf von zwei Jahren von der Praxis zurück. Er blieb nicht im Land, sondern machte, da er noch eine rüstige Gesundheit und einen forschbegierigen Geist besaß, viele Reisen, während welcher wir anfangs einen fleißigen Briefwechsel unterhielten, der jedoch im Lauf der Zeit flauer wurde und endlich ganz und gar stockte.
Der größte Teil der Praxis, welche sich mein Vorgänger in einer dreißigjährigen Wirksamkeit gesammelt hatte, ging auf mich über. Mein Hauptrival war ein Doktor Lloyd, ein wohlwollender, heißblütiger Mann, — nicht ohne Genie, wenn von Genie die Rede sein kann, wo das Urteil fehlt und nicht ohne Wissen, dem es freilich an Gründlichkeit gebrach; einer von jenen begabten, aber flüchtigen Männern, welche nicht fähig sind, dem Beruf, dem sie sich widmen, die volle Kraft und Glut ihres Geistes zuzuwenden. Derartige Personen verfallen gewöhnlich bald in eine mechanische Routine, weil in der Übung des Berufs, den sie zum Aufhängeschild machen, ihre Fantasie stets zu verlockenderen Gegenständen hingezogen wird. Sie sind daher als Fachmänner selten kühn oder erfinderisch, obschon sie diese Eigenschaften außer ihrem Beruf bisweilen sogar im Übermaß zeigen; taucht aber in Letzterem etwa eine Neuigkeit auf, so sind sie geeignet, dieselbe mit einem Starrsinn zu pflegen und mit einer Leidenschaftlichkeit an ihr festzuhalten, wie sie der ruhige, forschende Geist nicht kennt, welcher die neuen Ideen mit besonnenem nüchternem Blicke prüft, um sie beiseite zu legen, teilweise zu verwenden oder ganz sich anzueignen, je nachdem er sie durch den vergleichenden Versuch bestätigt oder als unstichhaltig erfindet.
Doktor Lloyd hatte sich als gelehrter Naturforscher einen Ruf gewonnen, lang, ehe ihm der eines leidlichen Praktikers zugestanden worden war. Trotz seiner von Haus aus dürftigen Verhältnisse hatte er es sich von Jugend auf angelegen sein lassen, ein zoologisches Kabinett zusammenzubringen, nicht aus lebenden, sondern zum Glück für den Beschauer nur aus ausgestopften und einbalsamierten Tieren. Aus dem Gesagten wird man erkennen, dass Doktor Lloyds frühere Laufbahn eben keine glänzende war; in späteren Jahren aber hatte er sich in das ärztliche Ansehen eher hineingealtert als gearbeitet, welches die seit einer durchaus achtbaren Persönlichkeit zu verschaffen pflegt, die man allgemein gern hat und die zu beneiden sich niemand veranlasst sieht.
Nun gab es in L… zwei geschiedene gesellschaftliche Kreise — den der reichen Kauf- und Gewerbsleute und den einer kleinen Anzahl privilegierter Familien, welche den sogenannten Abteiberg, einen von den Märkten und dem Gewühl des geschäftlichen Verkehrs abgesonderten Stadtteil, bewohnten. Diese stolzen Areopagiten übten über die Frauen und Töchter der niederen Klasse, welcher mit Ausnahme des Abteiberges alle Stadtangehörigen ihren Wohlstand verdankten, denselben geheimnisvollen Einfluss aus, den man unter ähnlichen Verhältnissen in allen großen und kleinen Städten wahrnehmen kann.
Der Abteiberg war nicht reich, aber mächtig, da er seine Hilfsquellen in allen Arten von Gönnerschaft geltend machte. Er hatte seine eigene Putzmacherin, seine eigene Modewarenhandlung, seinen eigenen Konditor, Schlächter, Bäcker und Spezereihändler, und der Schutz- des Abteiberges war wie der, den der Hof in seinen Titeln erteilt, weniger einträglich an sich, als vielmehr eine feierliche Beglaubigung allgemeinen Verdienstes. Die Läden, welchen er seine Kundschaft zuwandte, gehörten nicht zu den wohlfeilsten und durchweg vielleicht nicht einmal zu den Besten, waren aber jedenfalls imponierend, indem die Eigentümer sich anständig pomphaft, die diensttuenden Personen sich mit hochmütiger Höflichkeit benahmen, ganz so, als ob sie zum Staatsdienst gehörten und das Recht hätten, stolz herabzusehen auf diejenigen, von denen sie lebten. Die Damen der um den Berg herliegenden unteren Stadt betraten diese Läden mit einer gewissen ehrfurchtsvollen Scheu und verließen sie wieder mit einer Art von Stolz; denn sie wussten jetzt, was bei dem Berg Beifall fand. Sie hatten Einkäufe gemacht, gerade, wie sie der Berg machte, und es ist schon etwas im Leben, wenn man sich der Überzeugung erfreuen kann, das Rechte getan zu haben, mag sie auch noch so teuer erkauft worden sein. Der Abteiberg pflegte unter anderem seine Gönnerschaft auch auf den Arzt auszudehnen, obschon diese Gewohnheit in den letzten Jahren von meines Vorgängers Praxis etwas außer Brauch gekommen war. Seine Überlegenheit über alle anderen Ärzte der Stadt stand so unbestritten fest, dass der Berg, welcher gelegentlich auch den physischen Gebrechen der geringeren Sterblichen unterworfen war, doch den Ehrenpunkt nicht so weit trieb, das Leben selbst für ihn einzusetzen, obschon Doktor Faber, weil er den städtischen Kranken- und Armenhäusern vorstand, vorzugsweise nur der Doktor der unteren Stadt hieß. Da die untere Stadt einen der berühmtesten Ärzte Englands besaß, so entschloss sich der Abteiberg großmütig, ihn nicht durch einen Nebenbuhler zu erdrücken, sondern ließ sich in Gnaden von ihm den Puls fühlen.
Als mein Vorgänger abtrat, gab ich der anmaßenden Hoffnung Raum, der Berg werde fortfahren, sich seines normalen Rechts an einen besonderen Arzt zu begeben, und mir dieselbe großmütige Gunst zu teil werden lassen, die er dem Mann erwiesen, welcher mich für würdig erklärt hatte, ihm in seinen Ehren nachzufolgen. Ich besaß für diese Vermessenheit um so mehr einen Entschuldigungsgrund, weil mir der Berg bereits eine ziemliche Anzahl seiner Patienten zu besuchen gestattete, mir manches Verbindliche über die hohe Achtbarkeit der Familie Fenwick gesagt, und mich hin und wieder zum Dinner und sehr häufig zum Tee eingeladen hatte.
Doch mein Dünkel erlitt einen gewaltigen Stoß. Der Abteiberg erklärte, dass die Zeit gekommen sei, das eingeschlafene Privilegium wieder ins Leben zu rufen — er musste einen Doktor nach eigener Wahl haben, einen Doktor, dem man wohl gestatten konnte, aus Beweggründen der Menschenliebe oder des Erwerbs die Unterstadt zu besuchen, der aber seine besondere Lehenstreue gegen den Abteiberg nachdrücklichst dadurch bekundete, dass er in dessen ehrwürdigem Banne seine Wohnung nahm. Fräulein Brabazon, eine Dame von ungewissem Alter, aber unzweifelhaftem Stammbaum, mit einem kleinen Vermögen und einer großen Nase — sie erklärte dieselbe scherzhaft für einen Beweis ihrer Abkunft von Humphrey, dem Herzog von Gloucester — wurde beauftragt, ohne dem Berg durch einen offenen Antrag eine Blöße zu geben, mich diplomatisch auszuholen, ob ich geneigt sei, ein aus der Höhe des Berges gelegenes großes altertümliches Herrenhaus zu beziehen, welches der Sage nach vor Jahrhunderten von den Äbten bewohnt und daher vom Volk noch immer das Abthaus genannt wurde; wenn ich mich dazu entschließen könne, werde der Berg an mich denken.
»Es ist allerdings ein großes Haus für einen unverheirateten Mann«, bemerkte Fräulein Brabazon offen und fügte dann mit einem Seitenblick von beunruhigender Süßigkeit bei: »aber wenn Doktor Fenwick seine wahre Stellung, wie sich es für seine alte Familie ziemt, unter uns eingenommen hat, so braucht er nicht lange vereinzelt zu leben, wofern es ihm nicht selbst darum zu tun ist.«
Ich entgegnete mit größerer Derbheit, als durch den Anlass gerechtfertigt wurde, dass ich vorderhand nicht daran denke, meine Wohnung zu verändern, und wenn der Berg mich brauche, so solle er nach mir schicken.
Zwei Tage nachher mietete sich Doktor Lloyd in dem Abthaus ein, und eine Woche später war er der erklärte Arzt des Berges. Die Wahl erhielt den Ausschlag durch den Machtspruch einer großen Dame, welche unter dem Namen und Titel einer Frau Oberst Poyntz auf der heiligen Höhe als Alleinherrscherin gebot.
»Doktor Fenwick«, sagte diese Dame, »ist wohl ein geschickter junger Mann und aus einem guten Haus, aber dabei doch sehr eingebildet, und der Berg kann erwarten, dass man sich nach ihm richte. Dazu kennen wir ihn noch nicht lange und der Widerstand gegen neue Ankömmlinge, überhaupt gegen alles Neue, Hüte und Romane ausgenommen, ist eines von den wichtigsten Banden, um alte Gesellschaften zusammen zu halten. Doktor Lloyd hat deshalb aus meinen Rat hin das Abthaus gemietet; der Aufwand dafür würde jedoch seine Mittel übersteigen, wenn sich der Berg nicht zur Ehrensache machte, das in seine Protektion gelegte Vertrauen zu rechtfertigen. Ich versicherte ihm, dass alle meine Freunde in Krankheitsfällen ihn berufen würden, und wer sich dazu zählt, wird mein Wort nicht Lügen strafen. Was der Berg tut, findet bei vielen von dem gemeinen Volk da drunten Nachahmung. Die Sache kann also als abgetan betrachtet werden.« Und sie war abgetan.
Doktor Lloyd, dem in solcher Weise an die Hand gegangen wurde, dehnte den Kreis seiner Besuche bald über die Grenzen des Berges aus, der für den Arzt freilich kein Goldberg war, und teilte sich mit mir, obschon verhältnismäßig nur schwach, in die einträglichere Praxis der unteren Stadt. Ich hatte keine Ursache, ihm seinen Erfolg zu missgönnen, und tat es auch nicht; doch war nach meinen Ansichten von der Heilkunst seine Diagnose nur oberflächlich und seine Rezeptur veraltet. Wenn wir miteinander sein Consilium hatten, konnten wir uns selten über die Behandlungsweise verständigen. Ohne Zweifel meinte er, ich müsse vor seinen Jahren Respekt haben; aber ich hielt es mit dem Satz, an den junge Ärzte glauben, obschon die alten ihn für eine Abgeschmacktheit erklären, dass in Beziehung auf die Wissenschaft die Jungen in Wirklichkeit die Älteren seien, so fern ihre Schule schon sie in die neuesten Erfahrungen einweihte, während die alten Ärzte an den Lehrsätzen festhalten, in welchen sie unterrichtet wurden, als die Welt noch einige Jahrzehnte weniger zählte.
Inzwischen breitete sich mein Ruf rasch auch über den Bereich meines Wohnorts aus, und mein Rat wurde sogar von Kranken aus der Hauptstadt eingeholt. Der Ehrgeiz, der mir schon in früher Jugend meine Laufbahn vorgezeichnet und mir alle ihre Mühen versüßt hatte — der Ehrgeiz, einen Rang und Namen unter den großen Ärzten einzunehmen, denen die Menschheit eine dankbare, wenn auch prunklose Anerkennung zollt, sah ein ebenes Feld und ein sicheres Ziel vor sich.
Ich weiß nicht, ob ein weit vor der gewöhnlichen Zeit errungener Erfolg, wie ich ihn erreicht hatte, dazu diente, den Hauptzug in meiner moralischen Organisation, den wissenschaftlichen Stolz zu steigern; jedenfalls glaubte ich darin eine Berechtigung dafür zu finden.
Bei aller Milde und Zartheit gegen die meiner Sorge vertrauten Leidenden, da dies zu den notwendigen Erfordernissen meines Berufes gehörte, war ich doch unduldsam gegen jeden Widerspruch von Seite meiner Amtsgenossen oder überhaupt derjenigen, die in der öffentlichen Meinung gegen meine Lieblingstheorien ankämpften.
Meine medizinischen Grundsätze richteten sich streng nach den Regeln der induktiven Logik. Mein Glaubensbekenntnis war ein starrer Materialismus. Ich hatte eine sehr geringe Meinung von der geistigen Begabung derjenigen, welche gläubig hinnahmen, was sich nicht durch den Verstand erklären ließ, wie denn auch „gesunder Menschenverstand“ meine Lieblingsphrase war. Gegen kühne Entdeckungen hatte ich allerdings kein Vorurteil, da sie weiterer Forschung einen Spielraum öffneten; aber ich verwarf jede Hypothese als eitel, wenn sich nicht der Probierstein der Erfahrung an sie anlegen ließ.
Auf medizinischem Feld war ich ein Schüler Broussais, auf metaphysischem ein Schüler Condillacs gewesen. Ich glaubte mit diesem Philosophen, dass wir „all unser Wissen der Natur verdanken, dass wir im Anfang uns nur aus ihren Lehren unterrichten können, und dass die ganze Kunst der Spekulation nur in der Fortsetzung dessen, was sie uns zu beginnen genötigt hat, bestehe.“ Da ich die Naturphilosophie von den Dogmen der Offenbarung gesondert hielt, so kam ich nie mit den letzteren in Konflikt; aber ich behauptete, dass aus ersterer ein richtiger Denker nie das Vorhandensein der Seele in der Eigenschaft eines dritten Prinzips, das etwas anderes sei, als der Geist und der Körper, abzuleiten vermöge. Dass der Mensch durch ein Wunder wieder lebendig werden könne, sei eine Frage des Glaubens, nicht aber des Verstandes. Den Glauben überließ ich der Religion und verbannte ihn aus der Philosophie. Wie konnte man mit einer Bündigkeit, welche auch die Logik der Philosophie befriedigte, definieren, was wieder lebendig werden sollte? Der Leib? Wir wissen, dass er im Grab ruht, bis der Zersetzungsprozess seine Elemente in andere stoffliche Formen übergeführt hat. Der Geist? Aber er war so klar das Resultat der körperlichen Organisation, wie die Musik der Harfe das des instrumentalen Mechanismus. Teilt doch der Geist die Hinfälligkeit des Leibes im hohen Alter, und in der vollen Kraft der Jugend kann eine plötzliche Beschädigung des Gehirns die Denkkraft eines Plato oder Shakespeare vernichten. Aber das dritte Prinzip — die Seele, dieses etwas, das im Körper wohnt, sollte dieses fortleben können? Wo barg es sich außerhalb des Baues? Mussten nicht die Philosophen, wenn sie es zu definieren suchten, seine Natur und seine Tätigkeiten mit denen des Geistes vermischen? Konnten sie es auf das bloße moralische Gefühl zurückführen, das so wandelbar ist, je nach Erziehung, Umständen und Leibesbeschaffenheit? Und selbst dieses kann bei den tugendhaftesten Menschen aufgehoben werden durch ein Fieber. Dies waren die Ansichten, mit denen ich mich trug in der Zeit, von der ich jetzt spreche. Sie hatten allerdings nichts Bestechendes und entbehrten auch des Verdienstes der Originalität; aber ich hielt sie mit einer Anhänglichkeit und Hartnäckigkeit fest, als wären sie tröstliche Wahrheiten und ich ihr Entdecker gewesen. Gegen diejenigen, welche entgegengesetzte Lehren verteidigten, benahm ich mich unduldsam, indem ich sie für Schwachköpfe oder für Heuchler erklärte. Wenn ich daher die Laufbahn, die mir mein Ehrgeiz voraussagte, vollendet, mich zum Gründer einer neuen pathologischen Schule aufgeschwungen und meine Sätze in akademische Vorlesungen zusammengefasst hätte, so würde ich zuverlässig eine, wenn auch schwache, Autorität weiter für die Sekten abgegeben haben, welche die Interessen der Menschen auf das Leben beschränken, das mit dem Grab zum Abschluss kommt.
Vielleicht fand auch das, was ich meinen wissenschaftlichen Stolz nannte, mehr Nahrung, als ich zuzugestehen geneigt gewesen wäre, in jenem Selbstvertrauen, das so gern aus einem ungewöhnlichen Grad von physischer Kraft erwächst. Von Natur war ich mit der Muskulatur eines Athleten begabt. Unter den mutigen Jünglingen des nördlichen Athens hatte ich mich durch Proben von Behändigkeit und Kraft ausgezeichnet. Meine geistigen Arbeiten und die Sorge, welche von einer gewissenhaften Ausübung des ärztlichen Berufs unzertrennlich ist, ließen mich zwar des Lebens nicht so recht froh werden, hatten aber doch meine seltene körperliche Gesundheit in keiner Weise geschwächt. Ich ging durch die Menge mit dem festen Tritt und dem stolz erhobenen Haupt eines der geharnischten Ritter des Altertums, der sich in seiner eisernen Hülle ganzen Haufen gewachsen fühlte. So trug das Gefühl der geistigen sowohl als der körperlichen Kraft und die Gewohnheit, anderen Hilfe zu bringen, während ich selbst keiner Hilfe benötigt war, dazu bei, meinen Willen gewalttätig und meine Meinungen anmaßend zu machen. Diese Mängel taten mir in meinem Beruf allerdings keinen Abtrag, sondern dienten, da sie von einem ruhigen Wesen und von jener Art Würde im Auftreten begleitet waren, welche die Livree der Selbstachtung ist, im Gegenteil dazu, mir Achtung zu schaffen und Vertrauen einzuflößen.
2. Kapitel
Ich war ungefähr sechs Jahre in L… gewesen, als ich plötzlich in eine Kontroverse mit Doktor Lloyd verwickelt wurde. Dieser unglückliche Mann beging in dem Augenblicke, als seine ärztlichen Erfolge in der Glanzhöhe zu stehen schienen, die Unklugheit, sich nicht nur für einen begeisterten Anhänger des Mesmerismus als einer Heilpotenz, sondern auch als einen eifrigen Gläubigen an die Wirklichkeit des somnambulen Hellsehens als einer unschätzbaren Gabe zu erklären, die gewissen begünstigten Organisationen verliehen sei. Solchen Lehren setzte ich eifrigen Widerspruch entgegen, vielleicht mit um so größerer Heftigkeit weil Doktor Lloyd einen Beweis für das Vorhandensein der Seele und der Unabhängigkeit des Geistes vom Körper daraus ableitete und auf seinen Sätzen einen Bau von physiologischen Fantasien ausführte, welche, wenn er als wesenhaft nachzuweisen gewesen wäre, allen metaphysischen Sätzen, auf welche eine als solche anerkannte Philosophie einzugehen bereit ist, eine andere Grundlage gegeben hätte.
Doktor Lloyd hatte ungefähr zwei Jahre, ehe er ein Schüler nicht so fast von Mesmer, als vielmehr von Puysegur wurde (letzterer war, wie ich glaube, der erste, welcher kühn das Vorhandensein des Hellsehens behauptete, in das Mesmer noch wenig Vertrauen setzte), seine viel jüngere Frau, die er zärtlich liebte, durch den Tod verloren. Dieser Verlust, welcher ihn in der Hoffnung auf eine Welt jenseits Trost suchen hieß, war vielleicht Ursache gewesen, ihn für die Erscheinung, in welcher er neue Beweise für ein rein geistiges Fortbestehen sah, gläubiger zu machen. Wenn ich mich freilich in der Bestreitung der Ansichten eines anderen Physiologen auf den ehrlichen Kampf beschränkt hätte, wie er der wissenschaftlichen Kontroverse ziemt, wenn sie nur die Wahrheit sich zum Ziel setzt, so läge mir jetzt nicht ob, mich auf meine ehrliche Überzeugung, für die ich meine guten Gründe zu haben glaubte, zu berufen; als er mich aber mit gutmütigen Herablassung als einen viel jüngeren Mann, welcher Erscheinungen ableugne, von denen er nichts verstehe, einlud, seinen Sitzungen anzuwohnen und Zeuge seiner Kuren zu sein, fühlte sich meine Eigenliebe verletzt und ich glaubte die Erklärung abgeben zu müssen, dass sein Hokuspokus eine zu grobe Versündigung an dem gesunden Menschenverstande sei, um überhaupt eine Untersuchung zu verdienen. Ich verfasste daher über den Gegenstand eine kleine Flugschrift, in welcher ich alle Waffen benützte, welche die Ironie von der Verachtung borgen kann. Doktor Lloyd antwortete darauf; da er aber in der Feder nicht sehr gewandt war, so schadete ihm seine Erwiderung vielleicht mehr als sein Angriff. Ich hatte inzwischen über den moralischen Charakter seiner gefeiertsten Hellseherinnen einige Umfrage gehalten und glaubte genug erfahren zu haben, um sie als abgefeimte Betrügerinnen, ihn selbst aber als das betörte Opfer ihres Betrugs bezeichnen zu dürfen.
Die untere Stadt trat, mit wenigen Ausnahmen, bald auf meine Seite. Der Berg schien anfangs geneigt zu sein, sich um seinen gekränkten Arzt zu scharen und den Streit zu einer Parteifrage zu machen, in welcher er schwer den Kürzeren gezogen haben würde, als plötzlich dieselbe gehietende Dame, welche dem Doktor Lloyd die Gunst der Höhe verschasste, sich gegen ihn erklärte und den Sonnenschein der Huld in Ungnade umwandelte.
»Doktor Lloyd ist ein liebenswürdiger Mann«, sagte die Königin des Berges, »aber in Betreff dieses Gegenstandes entschieden verrückt. Verrückte Dichter verdanken vielleicht dieser Eigenschaft ihren höheren Wert, aber an einem Doktor wird sie gefährlich. Er hatte dem Festhalten am alten Herkommen den Beifall des Berges zu danken; nun er aber demselben untreu geworden ist und überspannte revolutionäre Theorien einführen will, hat er Verrat geübt an den Grundsätzen, welche der Berg als seine gesellschaftlichen Fundamente anerkennt. Doktor Fenwick ist als der Kämpe dieser Grundsätze aufgetreten, und der Berg ist daher verpflichtet, ihn zu unterstützen. So; die Frage ist abgemacht.«
Und sie war abgemacht.
Von dem Augenblick an, als Frau Oberst Poyntz ihren Korpsbefehl erlassen hatte, war Doktor Lloyd vernichtet. Mit seinem Ruf ging seine Praxis zugrunde. Kummer und Verdruss zogen meinem Gegner einen Schlaganfall zu, der ihn lähmte und unserem Streit ein Ende machte. Ein unbekannter Doktor Jones, der Doktor Lloyds Schüler und besonderer Schützling gewesen, trat zwar als Kandidat für die Zungen und Pulse des Berges auf, erhielt aber wenig Ermutigung. Der Berg suspendierte aufs Neue sein Wahlrecht und berief mich einfach, ohne von meiner Seite eine spezielle Bewerbung zu verlangen, so oft seine Gesundheit außer dem des von Haus zu Haus laufenden Apothekers noch eines anderen Rates bedurfte. Ich wurde aufs Neue bisweilen zu einem Diner und sehr oft zum Tee eingeladen. Und abermals gab mir Fräulein Brabazon mit einem Seitenblick zu verstehen, dass die Schuld nicht an ihr liege, wenn ich noch unverheiratet sei.
Ich hatte den wissenschaftlichen Hader, dem ich einen so ausgezeichneten Triumph verdankte, fast vergessen, als ich in einer Winternacht aus dem Schlaf geweckt wurde. Doktor Lloyd war einige Stunden vorher von einem zweiten Schlaganfall betroffen worden und hatte, als er wieder zu sich kam, ungestüm das Verlangen ausgedrückt, den Rival, durch den er so schweren Schaden erlitten, zu beraten. Ich kleidete michs hastig an und eilte nach seinem Hause.
Eine bitter, kalte Februarnacht — unten grauer Dust und oben ein melancholischer, gespenstisch aussehender Mond. Ich hatte den Abteiberg vermittelst einer finsteren, steilen, zwischen hohen Mauern hinführenden Gasse zu ersteigen. Das stattliche Tor stand weit offen, und ich trat in den Garten, der das alte Abthaus umgab. An dem Ende eines kurzen Fahrwegs trat das düstere Gebäude aus den laublosen Baumskeletten hervor; das Mondlicht ruhte hell und kalt auf den vorspringenden Giebeln und den hohen Schornsteinen. Eine alte Magd empfing mich an der Haustüre und führte mich, ohne ein Wort zu sprechen, durch eine lange, niedrige Flur und eine traurige Eichentreppe hinan nach einem breiten Vorplatz, wo sie einen Augenblick horchend stehen blieb. Die Flur, das Stiegenhaus und der Vorplatz — alles war angefüllt mit toten Exemplaren aus der wilden Welt, in deren Sammlung der Naturforscher den Stolz seines Lebens gesetzt hatte. Dicht neben mir sperrte eine scheußliche Riesenschlange ihren Rachen auf; ihre unteren Leibesringe wurden, da sie aus dem unteren Boden auflagen, von den Windungen der massiven Treppe verborgen. An dem dunklen Wandgetäfel waren Glaskästen mit seltsamen, unheimlichen Mumien befestigt, welche von dem durch die Fensterscheiben scheinenden Mond und dem Kerzenlicht in der Hand der alten Frauensperson nur unvollkommen beleuchtet wurden. Letztere wandte sich jetzt gegen mich, winkte mir, ihr zu folgen und ging voran durch einen finsteren Gang, in welchem Reihen von riesigen Vögeln, der Ibis, der Geier und der ungeheure Kondor mit dem falschen Leben ihrer wilden Augen mich anglotzten.
Ich trat in das Krankenzimmer, und der erste Blick belehrte mich, dass hier meine Kunst machtlos war.
Die Kinder des Leidenden standen um das Bett her, das älteste dem Anschein nach etwa vierzehn, das jüngste vierjährig; ein kleines Mädchen, das einzig weibliche Kind, hielt den Hals ihres Vaters umschlungen, drückte ihr Gesicht an seine Brust und erfüllte das sonst totenstille Gemach mit ihrem lauten Schluchzen.
Als ich über die Schwelle trat, erhob Doktor Lloyd sein Antlitz, das über das weinende Kind niedergebeugt gewesen, und in dem Blick, mit dem er mich empfing, lag ein Ausdruck unheimlicher Freude, den ich mir nicht zu deuten wusste. Als ich langsam und leise an seine Seite trat, drückte er seine Lippen auf die langen blonden Flechten, die wirr auf seine Brust niederfielen, bedeutete der zu seinen Häupten stehenden Wartefrau durch einen Wink, das Kind fortzunehmen, und wies dann mit einer Stimme, die weit klarer war, als ich sie von einem Mann erwartet hätte, dessen Stirn das unverkennbare Siegel des Todes trug, die Magd und die übrigen Kinder an, das Zimmer zu verlassen. Seinem Befehl wurde schmerzvoll, aber schweigend Folge geleistet; nur das kleine Mädchen fuhr, als die Wärterin es entfernte, fort zu schluchzen, als wolle ihm das Herz brechen.
Ich war auf keine so ergreifende Szene vorbereitet; sie schnitt mir tief in die Seele. Meine Augen folgten voll Wehmut den Kindern, die sobald Waisen sein sollten, während eines um das andere hinausging in den kalten dunklen Gang mit den blutlosen Formen einer stummen Tierwelt, die vor dem Sterbegemach eines Menschen in unheimlichen Reihen aufgepflanzt war. Und als die letzte Kindergestalt verschwand und die Tür mit einem scharfen Einschnappen der Klinke sich schloss, wanderten meine Blicke noch unstet im Zimmer umher, ehe ich es über mich gewinnen konnte, sie auf die zusammengebrochene Gestalt zu heften, neben der ich jetzt stand in der vollen Glorie der Leibeskraft, die den Stolz meines Geistes genährt hatte.
In dem Moment, der meine wehmütige Umschau in Anspruch nahm, prägte sich das ganze Aussehen des Platzes mit unvertilglichen Zügen für das ganze Leben meiner Erinnerung ein. Durch das hohe, weit herabreichende Fenster das hälftig von einem dünnen vergilbten Vorhang verhüllt wurde, strömte das Mondlicht herein und gab mit seinem weißen Schein dem Boden das Aussehen eines großen Bahrtuches, das bis zu den Schatten unter dem Sterbebette hinreichte. Die Decke war niedrig und wurde es noch mehr — durch das vorspringende starke Balkenwerk, das man mit der erhobenen Hand erreichen konnte. Und die hohe ablaufende Kerze neben dem Bett und das Flackern des Feuers, das sich durch das neu zugelegte Brennmaterial arbeitete, warfen mit einem zitternden schwarzen Rauch, der sich wie eine zürnende Wolke ausnahm, ihren Widerschein unmittelbar über meinem Haupt an die Decke. Plötzlich fasste die linke Hand des Sterbenden (seine rechte war bereits gelähmt) meinen Arm und zog mich näher und näher heran, bis seine Lippen fast mein Ohr berührten. Und mit einer bald festen, bald zischenden oder fast versagenden Stimme sprach er wie folgt:
»Ich habe Sie rufen lassen, damit Sie Ihr eigenes Werk betrachten können. Sie haben einen tödlichen Schlag auf mein Leben geführt in einem Augenblick, als es für meine Kinder und den Dienst der Menschheit vom höchsten Wert war. Hätte ich noch einige Jahre länger gelebt, so wären sie genug herangewachsen gewesen, um nicht den Versuchungen des Mangels ausgesetzt oder auf die Barmherzigkeit von Fremden angewiesen zu sein. Ihnen haben sie es zu danken, dass sie mittellose Waisen sind. Von Krankheiten heimgesuchte Nebenmenschen, an denen Ihr Arzneischatz sie im Stich ließ, kamen sie zu mir um Hilfe und fanden sie. Wirkung der Einbildung, sagen sie. Aber was liegt daran, wenn ich der Einbildung eine Richtung anwies, dass sie heilend wirken musste? Sie haben durch Ihre Hohnreden den Unglücklichen die letzte Aussicht des Lebens geraubt — sie werden ohne Trost dem Grab entgegen gehen. Haben Sie geglaubt, ich sei im Irrtum? Und doch wussten Sie, wie mein Streben nur der Wahrheit galt. Sie haben gegen Ihren Amtsbruder tödliche Arznei und eine vergiftete Sonde gebraucht. Sehen Sie mich an. Sind Sie zufrieden mit ihrem Werk?«
Ich suchte mich zurückzuziehen und meinen Arm dem Griff des Sterbenden zu entwinden; aber es ging nicht ohne Gewalt und diese anzuwenden wäre eine Unmenschlichkeit gewesen. Seine Lippen näherten sich meinem Ohr noch mehr.
»Hochmütiger Tor, rühmen Sie sich nicht, dass Ihr satirisches Talent der Wissenschaft gedient habe. Die Wissenschaft ist mild gegen alle, welche an die Hypothese den Prüfstein des Versuchs anlegen wollen. Sie sind von dem Stoff, aus dem die Inquisitoren geschaffen waren, und schreien über Entweihung der Wahrheit, wenn man ihre Dogmen in Zweifel zieht. Mit seichter Anmaßung haben Sie den Gebieten der Natur ihre Grenzen angewiesen, und wo Ihr Sehvermögen erlahmt, sagen Sie: „Hier muss die Natur aufhören.“ Mit der Bigotterie, welche zu der Anmaßung auch das Verbrechen fügt, würden Sie den Entdecker steinigen, der Ihre Karte mit neuen Gebieten bereichert und Ihre willkürlichen Grenzen umstößt. Aber wahrlich die Vergeltung wird nicht ausbleiben. In denselben Räumen, die sie kennenzulernen verschmäht haben, werden sie irr und unstet umhertasten. Ha, ich sehe sie bereits — schon sammeln sich die zischelnden Gespenster um Sie!«
Die Stimme versagte ihm plötzlich und sein Auge wurde starr; seine Hand erlahmte und er fiel auf sein Kissen zurück. Ich schlich mich aus dem Zimmer und traf draußen auf der Flur die Wartefrau und die alte Magd. Die Kinder waren zum Glück nicht da; aber aus einem nahen Zimmer hörte ich das Schluchzen des Mädchens.
Ich flüsterte der Wärterin hastig zu, dass alles vorbei sei, ging wieder unter dem Rachen der Abgottschlange vorbei, und gelangte hinaus in die dunkle Gasse zwischen den toten Mauern, fort durch die gespenstischen Straßen hin, im geisterhaften Mondlicht, bis ich meine einsame Wohnung erreichte.
3. Kapitel
Es stand lange an bis ich den Eindruck abschütteln konnte, den die Worte und der Blick dieses sterbenden Mannes auf mich gemacht hatten.
Nicht, dass mir mein Gewissen etwas vorwarf. Was hatte ich getan? Eine Sache an den Pranger gestellt, welche den meisten verständigen Menschen, mögen sie nun Ärzte sein oder nicht, als eines von jenen Blendwerken erscheint, durch welche die Marktschreierei aus der Wundersucht der Unwissenheit Vorteil zieht. War ich zu tadeln, wenn ich mich weigerte, die angeblichen Kräfte, welche an die Fabeln aus dem Zauberland erinnern, mit der ernsten Achtung zu behandeln, auf welche die legitimen Entdeckungen der Wissenschaft Anspruch haben? Konnte der Akademiker sich seiner Würde so begeben, dass er sich zu einer Untersuchung herabließ, ob eine schlafende Sibylle imstande sei, in einem ihr auf den Rücken gelegten Buch zu lesen oder mir in L… zu sagen, was in diesem Augenblick ein unter den Antipoden verweilender Freund treibe?
Mochte Doktor Lloyd immerhin ein ehrenwerter und ehrlicher Mann sein, welcher aufrichtig an die Überspanntheiten glaubte, für die er von anderen den gleichen Glauben forderte — kommt es nicht jeden Tag vor, dass ehrliche Leute Gegenstände des Spottes werden, wenn sie sich durch einen Verstoß gegen den gesunden Menschenverstand lächerlich machen? Konnte ich voraussehen, dass eine Satire, die so sehr am Platz war, eine so tödliche Wunde schlagen würde? War ich ein Unmensch, weil mein besiegter Gegner eine krankhafte Empfindlichkeit besaß? Mein Gewissen machte mir daher keine Vorwürfe und das Publikum erwies sich nicht strenger, als mein Gewissen. Das Publikum hatte sich bei dem Kampf auf meine Seite gestellt, erfuhr nichts von der Anklage, die mein Gegner aus dem Sterbebett gegen mich erhob, und wusste nur, dass ich ihm in seinen letzten Augenblicken beigestanden hatte; es sah mich hinter der Bahre hergehen, die ihn zu Grab trug, bewunderte die Achtung, die ich seinem Andenken zollte, indem ich ihm ein einfaches Monument mit einer Inschrift setzen ließ, in welcher ich seiner unbestreitbaren Menschenfreundlichkeit und seinem rechtschaffenen Charakter Gerechtigkeit widerfahren ließ, und rühmte vor allem den Eifer, in dem ich eine Kollekte für seine Waisen betrieb, und meinen Edelmut, weil ich als Erster einen Beitrag unterzeichnet hatte, der in Anbetracht meiner Mittel groß genannt werden konnte. Ich beschränkte allerdings meine Unterstützung nicht auf die unterzeichnete Summe; denn das Schluchzen des armen Mädchens zitterte noch immer in meinem Herzen nach. Da ihr Schmerz größer gewesen war, als der ihrer Brüder, so standen ihr vielleicht auch schwerere Prüfungen bevor, wenn einmal die Zeit kam, dass sie sich selbst durchs Leben eine Bahn brechen musste. Ich legte daher mit einer Vorsicht, welche die Gabe nicht bis auf mich zurück verfolgen ließ, eine Summe für sie an, die bis zu ihrem heiratsfähigen Alter anwachsen sollte und ihr dann als eine kleine Mitgift dienen konnte; blieb sie aber ledig, so hatte sie wenigstens ein Einkommen, das sie über die Versuchungen der völligen Armut erhob und sie vor dem bitteren Joch dienstbarer Abhängigkeit bewahrte.
Dass Doktor Lloyd in solcher Dürftigkeit gestorben war, überraschte anfangs allgemein, denn er hatte in den letzten paar Jahren schöne Einnahmen gehabt und stets ein sehr eingezogenes Leben geführt. Doch unmittelbar vor dem Beginn unseres Streites hatte er sich bewegen lassen, den Bruder seiner verstorbenen Frau, der als untergeordneter Inhaber bei einem Londoner Bankgeschäft beteiligt war, dadurch zu unterstützen, dass er ihm alle seine Ersparnisse anvertraute. Der Mensch war ein schlechter Bursche, der nicht nur diese, sondern auch noch weitere Summen veruntreute und landesflüchtig wurde. Dasselbe Zartgefühl gegen das Andenken seiner verstorbenen Gattin, welches Doktor Lloyd um sein Vermögen brachte, bewog ihn auch, über die Ursache des Verlustes Stillschweigen zu beobachten, und es war erst den Ordnern seines Nachlasses vorbehalten, den Verrat des Schwagers zu entdecken, welchen der arme Mann großmütig vor weiterer Schande schützen wollte.
Der Bürgermeister von L…, ein reicher, von Gemeingeist beseelter Kaufmann, brachte das Kabinett an sich, das Doktor Lloyd in seinem Eifer für die Naturgeschichte gesammelt hatte, und die daraus erlöste Summe nebst dem Ertrag der Kollekte reichte nicht nur zu, alle Schulden des Hingeschiedenen zu tilgen, sondern auch seinen Waisen die Wohltat einer Erziehung zu sichern, damit die Knaben wenigstens gehörig ausgerüstet sich beteiligen konnten an dem Spiel, in welchem die Geschicklichkeit eine höhere Bedeutung hat als der Zufall und Fortuna sich so wenig blind erweist, dass wir bei jeder Umwälzung des Rads die Wahrnehmung machen, wie Reichtum und Ehre fortfliegen aus den Fingern der Unwissenheit und Trägheit, um von der entschlossenen Faust der Arbeit und des Wissens aufgegriffen zu werden.
Inzwischen nahm ein entfernter Verwandter auf dem Land die Obhut über die Waisen auf sich; sie verschwanden von dem Schauplatz und die Fluten des Geschäftslebens wogten bald über den Platz hin, welchen der Verstorbene eingenommen hatte in den Gedanken seiner Mitbürger.
Eine Person in L…, und nur diese einzige, schien den Groll zu teilen und geerbt zu haben, den der arme Arzt auf seinem Sterbebette gegen mich ausströmen ließ. Sie hieß Vigors und war ein entfernter Verwandter des Hingeschiedenen, ein Mann von wenig wissenschaftlicher Bildung, aber schätzbaren Fähigkeiten, welcher in meinem Streit mit Doktor Lloyd die hervorragendste Rolle unter dessen Parteigängern gespielt hatte. Er besaß jenen Einfluss, welchen die Welt bereitwillig einem tüchtigen Mann einräumt, wenn er mit seinen Fähigkeiten einen ernsten Charakter und eine strenge Moralität verbindet. Seine Hauptliebhaberei war, über andere zu richten, und er konnte dieselbe um so mehr betätigen, da er Friedensrichter war, wohl einer der eifrigsten und strengsten, die L… je gehabt hatte.
Vigors zog anfangs mit großer Bitterkeit gegen mich los, indem er mich beschuldigte, ich habe durch die lieblose und unedle Härte, mit welcher ich, wie er sagte, die vorurteilsfreie Prüfung einer einfachen Tatsache behandelte, seinen Freund nicht nur zugrunde gerichtet, sondern auch unter den Boden gebracht. Da er jedoch für seine Anklagen keine Sympathien fand, so ließ er klüglicherweise davon ab, indem er sich, wenn er meinen Namen rühmlich nennen hörte, damit begnügte, feierlich den Kopf zu schütteln und einen oder den anderen orakelhaften Satz, zum Beispiel: »Die Zeit wird es lehren;« »Ende gut, Alles gut, usw.« hinzuwerfen. Vigors unterhielt übrigens nur wenigen geselligen Verkehr mit der Bürgerschaft. Er nannte sich selbst einen eingezogen lebenden Mann, war aber in Wirklichkeit eine sehr unumgängliche steife Person, die sehr viel aus sich selber hielt. Seiner Meinung nach fand die Würde seiner Stellung bei den Kaufleuten der unteren Stadt und seine geistige Überlegenheit bei den Ausschließlichen des Berges nicht die gebührende Anerkennung. Seine Besuche beschränkten sich daher hauptsächlich auf die Häuser der benachbarten Squire, denen er wegen seiner amtlichen Stellung und seines förmlichen Äußeren, als eines von jenen Orakeln imponierte, durch die man sich gern in Respekt erhalten lässt, wenn derselbe nicht allzu oft beansprucht wird. Und obgleich er dreimal in der Woche sein Haus öffnete, war es doch nur wenigen Auserlesenen zugänglich, die er zuerst abfütterte, dann aber mit Vorträgen über die Lehre vom Leben traktierte. Die Elektrobiologie war natürlich eine Hauptunterhaltung für einen Mann, der an keinem Gespräch Gefallen fand, wenn er nicht andere mit seinem Willen beherrschen konnte. Er lud daher nur solche Personen zu Tisch, die sein Blick zu einer völligen Verleugnung ihrer Sinne zu zwingen vermochte, sodass sie ihm dienstwillig gehorchten, wenn er von ihnen verlangte, sie sollen Ochsenfleisch für Lammfleisch oder Branntwein für Kaffee erklären; auch konnten sie sich diese Illusion wohl gefallen lassen, solange wenigstens nicht nur in der Idee, sondern auch in Wirklichkeit das Ochsenfleisch und der Branntwein, das Lammfleisch und der Kaffee vorhanden war. Ich kam also in den Häusern, in denen ich gelegentlich meine Abende zubrachte, nicht oft mit Vigors zusammen, und seine gehässigen Reden wirkten auf mich nur wie der Wind, den man von dem geborgenen Stübchen aus auf dem Feld draußen sausen hört. Wenn wir uns zufällig auf der Straße begegneten, so blickte er mit der Mine des Grolls zu mir auf (er war nämlich ein kleiner Mann, der auf den Zehen einherging), während ich meinerseits von der Höhe meiner Statur auf das unwirsche Männlein ein leutseliges Lächeln erhabener Gleichgültigkeit niederfallen ließ.
4. Kapitel
Ich hatte nun das Alter erreicht, in welchem der ehrgeizige Mann, wohlgefällig hinblickend auf seine Erfolge in der äußeren Welt, die unbefriedigte Sehnsucht des Herzens fühlt, die ihm die Heimat als öde erscheinen lässt. Ich beschloss zu heiraten, und sah mich nach einer Frau um. Bisher hatte ich der Leidenschaft der Liebe keinen Zutritt gestattet, ja von früher Jugend an auf sie sogar mit einer Art stolzer Verachtung als auf eine Krankheit niedergeschaut, die aus weibischem Müßiggang sprosst und aus einer überreizten Einbildungskraft ihre Nahrung zieht.
Ich dachte mir meine künftige Frau als eine vernünftige Gefährtin, als eine liebevolle, zuverlässige Freundin. Keine Heiratsplane konnten weniger romantisch und mehr nüchtern verständig sein als die, mit welchen ich mich trug. Meine Ansprüche waren durchaus nicht anmaßend, da ich weder auf Vermögen noch auf hohe Familienverbindungen sehen wollte. Mein Ehrgeiz galt ausschließlich meinem Beruf und konnte in keiner titelreichen Verwandtschaft, in keiner reichen Mitgift einen Vorschub finden. In der Schönheit sah ich gleichfalls kein Haupterfordernis; auch verlangte ich von einer Frau nicht die vielseitige Bildung, die an der Vorsteherin einer höheren Mädchenschule wünschenswert sein mag.
Sobald ich mit mir darüber einig war, dass es Zeit sei, eine Gefährtin zu suchen, meinte ich, es werde nicht schwer halten, eine Wahl zu treffen, die meine Vernunft billigen könne. Aber es verging Tag um Tag, Woche um Woche, und obgleich es in den Familien, die ich besuchte, viele junge Damen gab, deren Eigenschaften meinen Anforderungen mehr als entsprachen und von denen ich mir schmeichelte, dass sie meine Bewerbung nicht zurückweisen würden, so fand ich doch keine darunter, deren lebenslänglicher Gesellschaft ich nicht die Einsamkeit, die mir so lästig erschien, bei Weitem vorgezogen hätte.
Eines Abends kehrte ich von dem Besuch eines armen kranken Mädchens zurück, das ich unentgeltlich behandelte und deren Zustand mehr Nachdenken erforderte, als der irgendeines anderen Patienten auf meiner Liste; denn obgleich man sie in dem Hospital aufgegeben hatte und sie heimgekommen war, um bei den ihrigen zu sterben, so fühlte sie doch die Überzeugung, dass ich sie werde retten können, wie sie denn auch unter meiner Pflege sich zu bessern schien. An jenem Abend, es war am fünfzehnten Mai, machte ich unwillkürlich vor dem Tore des Hauses Halt, das Doktor Lloyd bewohnt hatte. Es war seit dem Tod desselben nicht wieder vermietet worden, da der Eigentümer seine Ansprüche zu hoch stellte und Scheu oder Stolz die reichem Gewerbsleute das Heiligtum des Berges zu meiden bewog. Das Gartentor stand weit offen, gerade so wie in jener Winternacht, als ich dem Sterbenden den letzten Besuch machte. Die Erinnerung an jenes Sterbebette trat lebhaft vor meine Seele, und die fantastische Drohung des Hinscheidenden dröhnte aufs Neue in meinen Ohren. Ein unwiderstehlicher Drang, den ich mir nicht erklären konnte und auch jetzt noch nicht zu erklären weiß — gerade das Widerspiel von dem, der uns gewöhnlich veranlasst, von einer Stelle fortzueilen, welche peinliche Erinnerungen in uns weckt — bewog mich, durch das offene Tor hineinzutreten auf den vernachlässigten, mit Gras bewachsenen Weg und das Haus, das ich nur im Düstern jener Winternacht und im melancholischen Licht des Mondes näher gesehen, jetzt in der Beleuchtung der untergehenden Frühlingssonne zu betrachten. Als ich des Hauses mit seinen dunkelroten Backsteinen und seiner teilweisen Epenheuüberkleidung ansichtig wurde, bemerkte ich, dass es nicht länger unbewohnt war. Ich sah hinter den offenen Fenstern Gestalten sich hin und her bewegen; ein beladener Möbelwagen stand vor der Haustüre, und ein Diener in Livrée überwachte das Abladen der Gerätschaften. Augenscheinlich war eben eine Familie im Einzug begriffen. Ich fühlte mich etwas beschämt über meine Aufdringlichkeit und wollte mich rasch wieder entfernen, hatte jedoch kaum einige Schritte zurückgelegt, als ich Vigors an der Seite einer Dame von mittlerem Alters in der Nähe des Gartentors bemerkte, während ich zugleich eines Pfads durch das Gesträuch und an dessen Ende eines aus dem Garten führenden Pförtchens ansichtig wurde. Ich mochte der Dame, die ich für die neue Mietsfrau hielt, nicht begegnen, um nicht eine linkische Entschuldigung wegen Betretung fremden Gutes anbringen zu müssen, noch weniger aber dem Herrn Vigors dessen verächtlichem Blick ich mich nicht aussetzen wollte, wenn er mich in einer Lage sah, die meinem Stolz als schief und würdelos erschien. So schlug ich unwillkürlich den Seitenpfad ein, auf dem ich unbemerkt zu entkommen hoffte. Ich hatte ungefähr die Hälfte des Wegs zwischen dem Haus und dem Pförtchen zurückgelegt, als nach der linken Seite hin das Gesträuch plötzlich aufhörte und mich einen von unregelmäßigen Trümmern, eines alten Backsteinbaues umgebenen kreisförmigen freien Platz überschauen ließ, der teilweise mit Farnen, Schlingpflanzen, Unkraut und wilden Blumen überwachsen war; und in der Mitte des Kreises befand sich ein Brunnen, oder vielmehr eine Zisterne, über der auf schwarzen verwitterten normannischen Säulen ein gotisches Schutzdach aufwärts strebte. Eine hohe Tränenweide überhing diese unverkennbare Reliquie der alten Abtei. Der Platz, der so plötzlich zwischen dem zarten Grün des jungen Gesträuchs auftauchte, hatte in seinem altertümlichen Aussehen einen gewissen romantischen, sagenhaften Charakter. Doch war es nicht das verfallene Gemäuer oder das gotische Brunnendach, was meinen Fußtritt fesselte und mein Auge bannte.
Inmitten der melancholischen Trümmer saß eine einsame menschliche Gestalt.
Die Gestalt war so schmächtig, das Antlitz so jugendlich, dass ich bei dem ersten Blick vor mich hin murmelte: »Welch ein liebliches Kind!« Aber als mein Auge länger auf ihr haftete, erkannte ich in der aufwärts gekehrten gedankenvollen Stirne, in dem holden ernsten Ausdruck des Gesichts und in den runden Formen des feinen Baus die unbeschreibliche Würde der Jungfrau.
Auf ihrem Schoß lag ein Buch und zu ihren Füßen ein Körbchen, gefüllt mit Veilchen und Blumen, die augenscheinlich von den die Trümmer überwuchernden Pflanzen herrührten. Hinter ihr fielen wie ein grüner Wasserfall in Bogen die Zweige der Weide bis zu dem Rasen nieder, an dem Gipfel im freundlichen Widerschein der untergehenden Sonne helle Tinten zeigend, die immer tiefer wurden, je mehr sie sich der Erde näherten.
Sie beachtete mich nicht, sah mich nicht. Ihre Augen hafteten an dem Horizont, wo er die Scheidelinie bildete zwischen den Baumwipfeln, den Ruinen und dem endlosen Blau des Himmels — so angelegentlich, dass ich mechanisch mich umwandte, um der Richtung ihres Blickes zu folgen. Es war, als warte sie darauf, dass irgendein vertrautes Zeichen aus den Tiefen des Äthers auftauche, oder als wolle sie vor jeder anderen Person das erste Blinken eines Sternes auffassen.
Die Vögel ließen aus den Zweigen so furchtlos auf den Rasen sich neben ihr nieder, dass einer davon sogar an den Blumen in dem Körbchen zu ihren Füßen pickte. Es gibt ein herrliches deutsches Gedicht, das ich in meiner Jugend gelesen habe, „Das Mädchen aus der Fremde“ betitelt, welches einige Ausleger als eine Allegorie auf den Frühling, andere als eine solche aus die Dichtkunst deuten; mir kam es aber vor, als ob jene schönen Verse auf sie gedichtet worden seien. In der Tat hätte ein Dichter oder Maler in ihr ein teures Bild dieser beiden die Erde verschönernden Genien erkennen können, welche äußerlich die Sinne bezaubern, zugleich aber in uns Gedanken, wenn nicht gerade der Trauer, aber doch der Trauer verwandt, erwecken.
Ich hörte jetzt hinter mir einen Tritt und eine Stimme, in welcher ich die des Herrn Vigors erkannte. Der Zauber, der mich gebannt hatte, war gebrochen, und ich eilte verwirrt fort und auf das Pförtchen zu, das mich vermittelst einer kleinen abwärtsgehenden Treppe auf die Straße hinaus führte. Und da lag das Alltagsleben wieder vor mir. Auf der anderen Seite Häuser, Läden, Kirchtürme, und nach einigen weiteren Schritten das Straßengewühl! Wie unendlich fern und doch wie nah liegt der Welt, in der wir sind und uns bewegen, das Feenland der Romantik, das selbst aus der harten Scholle vor uns auftaucht, wenn sich die Liebe an unsere Seite stiehlt, und wieder in demselben harten Schoß versinkt, sobald lächelnd oder seufzend die Liebe von uns Abschied nimmt!
5. Kapitel
Und am Abend vorher hatte ich auf Vigors mit erhabener Gleichgültigkeit herabgesehen! Welche Wichtigkeit gewann er jetzt in meinen Augen! Die Dame, an deren Seite ich ihn gesehen, war ohne Zweifel die neue Bewohnerin des Hauses, welches augenscheinlich auch dem jungen Mädchen, das einen so wunderbaren Eindruck auf mein Herz gemacht hatte, zur Heimat diente. Vermutlich war das Verhältnis der Frauenzimmer zueinander das einer Mutter und einer Tochter. Vigors, welcher der Freund der einen, vielleicht ein Verwandter von beiden war, konnte sie gegen mich einnehmen — konnte — da sprang ich plötzlich auf und ließ den Faden der Vermutungen fallen, denn unmittelbar vor mir, auf dem Tisch, neben welchem ich mich nach dem Eintritt in mein Zimmer niedergesetzt hatte, lag eine Einladungskarte:
Frau Poyntz
zu Hause,
Dienstag den 15. Mai.
Morgens
Frau Poyntz — Frau Oberst Poyntz! Die Königin des Berges! Da, in ihrem Haus, konnte ich zuverlässig alles erfahren über die neuen Ankömmlinge, welche sich nicht ohne ihre Genehmigung in ihrem Gebiet hätten niederlassen dürfen.
Ich wechselte hastig meinen Anzug und stieg mit klopfendem Herzen den ehrfurchtgebietenden Berg hinauf.
Ich benutzte dazu nicht die Gasse, welche nach dem Abthaus führt (dieses alte Gebäude stand nämlich einsam in einem Garten und ein wenig abseits von der geräumigen Fläche auf dem Hügel, auf welcher die Gesellschaft des Berges zusammengedrängt wohnte), sondern der breiten Straße mit ihren Gaslampen. Die bedeutenderen Läden waren noch nicht geschlossen, und die Flut des Geschäftslebens zog sich nur langsam zurück aus den noch immer bewegten Stadtteilen nach dem freien Platz, in welchem die vier Hauptstraßen zusammenliefen und der die Grenze der unteren Stadt bildete. Ein mächtiger dunkler Bogen, den man nur das Mönchstor nannte, bewachte an einer Ecke des freien Platzes den Zugang zu dem Abteiberg; hatte man diesen hinter sich, so fühlte man mit einem Mal, dass man sich in einer aus den alten Zeiten stammenden Stadt befand. Der gepflasterte Weg war schmal und uneben, und über den kleinen Läden sprangen die oberen Stockwerke der Häuser hervor, die gelegentlich wunderliche arabeskenartige Stuckverzierungen zeigten. Die kurze, aber steile und stark gekrümmte Ansteigung führte nach der alten Abteikirche, die stolz in der Mitte eines weiten Vierecks lag, und um letzteres her standen die finsteren vornehmen Wohnungen der Areopagiten des Bergs. Noch vornehmer aber und weniger finster, als die übrigen — denn man sah Lichter an den Fenstern und Blumen auf dem Balkon — nahm sich, nach beiden Seiten hin mit einer angebauten Gartenmauer versehen, die Wohnung der Frau Oberst Poyntz aus.
Als ich in den Salon trat, hörte ich die Stimme der Wirtin — es war eine klare, entschiedene, metallisch und glockenartig klingende Stimme — die Worte sprechen: »Wer sich im Abthaus eingemietet hat? Das will ich Ihnen sagen.«
6. Kapitel
Frau Poyntz saß auf dem Sofa, zu ihrer Rechten die wohlbeleibte Frau Bruce, die Enkelin eines schottischen Lords, und links von ihr das magere Fräulein Brabazon, die Nichte eines irischen Baronets. Die übrigen Gäste hatten sich, zum Teil sitzend, meist aber stehend, um sie her gruppiert, und nur zwei alte Herren machten hievon eine Ausnahme, indem sie sich mit Herrn Oberst Poyntz in die Nähe des Whisttisches hielten und daselbst zur Vervollständigung ihrer Partie auf einen vierten Herrn warteten, der jedoch in diesem Augenblick sich nicht von dem Zauberkreis losmachen konnte, welchen die Neugierde, dieser mächtigste von allen sozialen Dämonen, um die Wirtin gesammelt hatte.
»Wer sich im Abthaus eingemietet hat? Das will ich Ihnen sagen. — Ah, Doktor Fenwick! Freut mich, Sie zu sehen. Sie wissen, dass das Abthaus endlich Bewohner gefunden hat? Und Sie, Fräulein Brabazon, fragen, wer sich darin einmietete. Ich will es Ihnen sagen — eine besondere Freundin von mir.«
»So? Ach Gott«, versetzte Fräulein Brabazon mit einer etwas verwirrten Miene, »ich hoffe, dass ich doch nichts gesprochen habe, was …«
»Meine Gefühle verletzen könnte? Nein, nicht im Geringsten. Sie sagten, Ihr Onkel, Sir Phelim, habe bei einem Kutschenmacher Namens Ashleigh arbeiten lassen, und Ashleigh sei ein sehr ungewöhnlicher Name, Ashley dagegen sehr häufig; damit deuteten Sie den schrecklichen Argwohn an, dass die Frau Ashleigh, welche den Berg bezogen hat, die Witwe eines Kutschenmachers sein könnte. Ich will Sie in dieser Beziehung beruhigen — es ist nicht so; sie ist die Witwe des Gilbert Ashleigh von Kirby Hall.«
»Gilbert Ashleigh«, ließ sich einer der Gäste, ein Hagestolz vernehmen, der von seinen Eltern für die Kirche bestimmt wurde, aber wie der arme Goldsmith nicht gut genug für dieselbe zu sein meinte — ein Irrtum allzu großer Bescheidenheit, sofern er zu einem sehr harmlosen Geschöpf herangereist war. »Gilbert Ashleigh. Ich war mit ihm in Oxfort — ein Stipendiat des Christchurchkollegiums. Ein recht hübscher Mann — ochste sehr …«
»Ochste — was ist dies? — Ah, studierte. Das hat er sein ganzes Leben lang getan. Er heiratete jung — die Anna Chaloner; wir sind miteinander aufgewachsen und heirateten in dem nämlichen Jahr. Sie bezogen Kirby Hall — ein hübscher Platz, aber langweilig. Poyntz und ich waren einmal über Weihnachten dort. Ashleigh war ganz bezaubert, wenn er sprach, kam aber nicht oft dazu. Anna dagegen schwatzte viel, aber nur alltägliches Zeug. Kein Wunder, das arme Ding war so glücklich. Poyntz und ich brachten nur diese einzige Weihnachten dort zu. Die Freundschaft ist lang, aber das Leben kurz. Gilbert Ashleigh hat es in der Tat recht kurz gemacht, denn er starb im siebenten Jahr seiner Ehe und hinterließ ein einziges Kind, ein Mädchen. Seitdem bin ich nie mehr auf Weihnachten nach Kirby Hall gekommen, obschon ich es hin und wieder auf einen Tag besuchte und mein bestes tat, um Anna aufzuheitern. Das arme Geschöpf war nicht mehr so redselig. Sie lebte nur ihrem Kind, das jetzt zu einem schönen achtzehnjährigen Mädchen herangewachsen ist — solche Augen, ganz die ihres Vaters — das reinste Dunkelblau — selten; ein süßes Wesen, aber zart — ich will nicht hoffen schwindsüchtig, aber zart; still — fehlt am Leben. Meine Hanna ist ganz hingerissen von ihr. Hanna hat Leben genug für zwei.«
»Ist Fräulein Ashleigh die Erbin von Kirby Hall?«, fragte Frau Bruce, die einen unverheirateten Sohn hatte.
»Nein. Kirby Halt fiel an Ashleigh Sumner, den männlichen Erben, ein Geschwisterkind. Und das glücklichste von allen Geschwisterkindern! Gilberts Schwester, eine Prunkdame (in der Tat nichts als Prunk), wusste es einzuleiten, dass ihr Vetter, Sir Walter Ashleigh Houghton, das Haupt der Familie Ashleigh, sie heiratete — dies war ganz der rechte Mann, um ihrem Prunk als Reflektor zu dienen. Er starb vor Jahren und hinterließ einen einzigen Sohn, Sir James, der letzten Winter durch einen Sturz vom Pferd ums Leben kam. Und da war wieder Ashleigh Sumner der gesetzmäßige männliche Erbe. Während der Minderjährigkeit dieses glücklichen jungen Menschen hatte Frau Ashleigh von seinem Vormund Kirby Hall gemietet. Jetzt ist er majorenn und dies der Grund, warum sie abzog. Lilian Ashleigh erhält indes doch ein recht schönes Vermögen und mag deshalb unter uns gentilen armen Leuten wohl als eine Erbin gelten. Will man noch mehr wissen?«
Sprach das magere Fräulein Brabazon, das seine dünne Figur benützte, um in aller Welt Angelegenheiten hineinzuschlüpfen: »Eine sehr interessante Mitteilung. Aber was führte Frau Ashleigh hieher?«
Antwortete Frau Oberst Poyntz mit der militärischen Freimütigkeit, mit welcher sie ihre Gesellschaft sowohl bei guter Laune, als im Respekt erhielt:
»Warum sind wir alle hierhergekommen? Kann mir dies jemand sagen?«
Es trat ein tiefes Schweigen ein, das die Wirtin selbst zuerst wieder unterbrach.
»Niemand von den Anwesenden weiß zu sagen, was uns herführte. Aber ich kann Ihnen mitteilen, warum Frau Ashleigh kam. Unser Nachbar, Herr Vigors ist ein entfernter Verwandter des verstorbenen Gilbert Ashleigh, einer von dessen Testamentsvollstreckern und der Vormund des gesetzmäßigen Erben. Vor zehn Tagen besuchte mich Herr Vigors zum ersten Mal wieder, seit ich es für meine Pflicht gehalten hatte, ihm über die seltsamen Überspanntheiten unseres armen lieben Freundes Doktor Lloyd meine Meinung zu sagen. Nachdem er eben da, wo Sie jetzt sitzen, Doktor Fenwick, Platz genommen hatte, begann er mit einer Grabesstimme, indem er zugleich zwei Finger ausstreckte — so — als sei ich eine von den (wie nennt man sie doch?), die einschlafen, wenn man sie’s heißt: „Madam, Sie kennen die Frau Ashleigh? Sie korrespondieren mit ihr?“ „Ja, Herr Vigors; ist dies ein Verbrechen? Sie machen eine Miene, dass ich dies fast befürchte.“ „Kein Verbrechen, Madam“, versetzte der Mann ganz ernst. „Frau Ashleigh ist eine Dame von sehr liebenswürdigem Wesen, und Sie sind eine Frau von männlichem Verstand.“«
Es fand ein allgemeines Kichern statt. Frau Oberst Poyntz stillte es mit einem Blick strenger Überraschung.