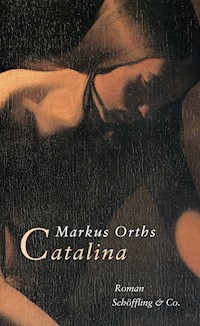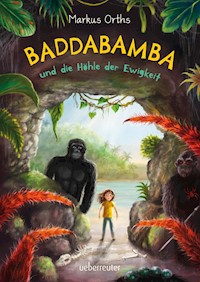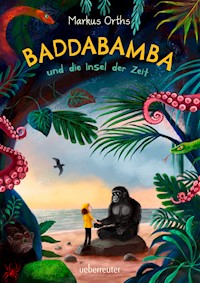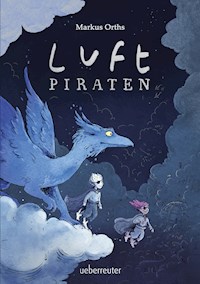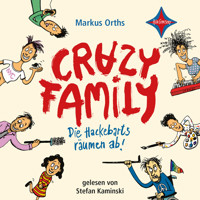Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Panorama einer wahnwitzigen Zeit. Und mittendrin: Max Ernst. Er kämpft gegen die Verrücktheit einer Welt, die aus den Fugen gerät. Er flieht vor dem wilhelminischen Vater, später vor dem Nationalsozialismus. Er sucht die eine Frau, die er lieben kann. In Deutschland, im wilden Paris der Zwanzigerjahre, im Exil in den USA. Viele seiner Freunde und Frauen sind berühmte Menschen dieser Zeit: Pablo Picasso, André Breton, Leonora Carrington, Peggy Guggenheim. Im Spiegel von sechs Frauenleben entfaltet sich ein Roman über das 20. Jahrhundert und einen seiner großen Künstler. Markus Orths erzählt so lebendig und ansteckend, dass man in jeder Zeile die Leidenschaft spürt, mit der dieser Roman geschrieben wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch erzählt von Freiheit, Kunst, Wahnsinn, Heimat – und Max, Max Ernst. Von seiner Rebellion gegen den wilhelminischen Vater über das Treiben durch das wilde Paris der zwanziger Jahre bis zu seinem entbehrungsreichen Leben auf der Flucht und im amerikanischen Exil. Viele seiner Frauen und Freunde sind berühmte Menschen dieser Zeit: Leonora Carrington, Peggy Guggenheim, Pablo Picasso, André Breton. Sie alle sind getrieben von ihrer Verzweiflung, ihrem Rausch, ihrer Lust. Das ist so lebendig wie ansteckend erzählt – in jeder Zeile spürt man die Leidenschaft, mit der dieser Roman geschrieben wurde.
Hanser E-Book
Markus Orths
Max
Roman
Carl Hanser Verlag
Für meinen Vater Hans Orths
Inhalt
Lou
Galapaul
Marie-Berthe
Leonora
Peggy
Dorothea
Prolog
Max schleppte Bilder zum Wagen. Eins nach dem anderen wuchtete er auf den Anhänger. Sein nackter Oberkörper: ölig vom Schweiß. Manchmal hasste er die Sonne in Sedona, Arizona. Dass Bilder so schwer sein konnten. Samt Rahmen und Lattenverschlag. Dass man Bilder so vorsichtig zu behandeln hatte. Sie waren doch fertig, die Bilder, sie trugen das Ende schon in sich, sie hatten nichts Neues zu bieten, das Verfrachten schien mühevoller als das Verfertigen. Max schlug die Persenning über seine und über Dorotheas Werke, zum Schutz vor den Brutalitäten der Natur. Dann kehrte er in die Hütte zurück. Seine Frau lag in ihrem Zimmer, sie fröstelte. Max holte ein Tuch und betupfte Dorotheas Stirn. Er setzte sich an ihr Bett, wollte sie fragen, ob er auch wirklich fahren und sie allein lassen könne, aber Max wusste, dass Dorothea solche Fragen nicht mochte.
»Erhol dich gut«, sagte er.
»Ist nur ’ne Sommergrippe.«
»Man weiß nie.«
»Vielleicht komm ich doch mit?«, fragte Dorothea.
»Du bleibst.«
»Was soll ich hier tun?«
»Liegen. Schlafen. Lesen. Schreiben. Schach spielen.«
»Gegen die Sonne?«
»Gegen dich selbst.«
»Und meine Bilder?«, fragte Dorothea.
Max hätte gern gesagt: Die werden sich eh nicht verkaufen, genauso wenig wie meine. Wenn es gut liefe, würde Max ein einziges Bild an den Mann bringen. Zwei wären sensationell. Aber Dorothea Tanning und Max Ernst brauchten nicht viel zum Leben. Im Grunde genommen brauchten sie nichts. Das Häuschen hatten sie selber erbaut, in der Nähe des Hopi-Reservats, mit eigenen Händen. Eine Küche, eine Badezelle ohne fließendes Wasser anfangs, ein Zimmerchen für Max und eins für Dorothea. Zum Malen zog sich Max in den Schuppen zurück, dort war er ungestört.
Max sagte ein Wort des Abschieds. Dorothea nickte ihm zu. Wieder draußen zog Max die Sandalen und seine kurze Hose aus, nackt stand er vor der Hütte in dem dünnen, zackigen Körper, mit schlohweißen Haaren, braun gebrannt, fast sechzig Jahre alt, und die türkisblauen Augen leuchteten ungebrochen. Max kippte sich einen Eimer lauwarm gewordenes Oak-Creek-Wasser über den Kopf, trocknete sich ab, zog sich an, schulterte die Tasche mit den paar Sachen, die er brauchte, kraulte kurz die beiden Hunde und stieg in den schwarzen Ford. Ehe er losfuhr, sprang Max noch einmal hinaus, eilte in sein Zimmer, wühlte in den Schubladen des Schreibtischs, griff nach einer Streichholzschachtel und schob sie in die Hemdtasche. Schon wieder spürte er Schweiß. Es war hoffnungslos: Die Sonne ließ den Teer auf der Dachpappe schmelzen und brachte die Steinböden zum Glühen.
Zwei Kilometer hinter Sedona stand ein Hopi-Indianer am Wegrand, in Jeans, Hemd und Turnschuhen, er reckte den Daumen in die Luft.
Max hielt an.
»You wanna go – where?«, fragte Max.
»Somewhere?«, sagte der Hopi.
»Hop in«, rief Max.
Der Hopi setzte sich auf den Beifahrersitz, Max fuhr weiter. Eine Stunde lang sagte keiner ein Wort. Sie durchquerten die Kulisse Arizonas. Genau diese Landschaft hatte Max einst gemalt, in Europa, ohne sie zu kennen, ohne sie je gesehen zu haben: Seine inneren Bilder hatten auf beinah magische Weise ihr äußeres Gegenstück gefunden. Das war einer der Gründe, weshalb Max jetzt hier lebte. Beide rauchten schweigend.
»Wie heißt du?«, fragte der Hopi erst kurz vor Flagstaff.
»Loplop«, sagte Max.
Der Hopi nickte bedächtig.
»Das ist der Oberste der Vögel«, fügte Max hinzu. »Und du?«
»Patupha Itamve«, sagte der Hopi.
»Hat das eine Bedeutung?«
Der Hopi schüttelte den Kopf.
Natürlich hat es eine Bedeutung, dachte Max.
»Was hast du geladen?«, fragte Patupha.
»Bilder«, sagte Max.
»Bilder?«
»Selber gemalt.«
»Und kann ich die sehen?«
»In Navajo machen wir Pause.«
Während die beiden – Stunden später – im Stehen Brote aßen und Wasser tranken, betrachtete der Hopi eins der riesigen Bilder, das Max für ihn aus dem Lattenverschlag geschält hatte.
Patupha sagte kein Wort.
Max nagelte das Bild wieder zu.
Zurück im Auto fragte er: »Und?«
»Und was?«
»Das Bild? Wie ist es?«
»Big«, sagte Patupha.
Big, dachte Max. Big ist gut. Big stimmt. Groß, ja, groß waren die Bilder, groß, wuchtig, schwer. Big. Seine Hand zuckte zur Hemdtasche, aber er ließ die Streichholzschachtel, wo sie war, und fuhr weiter.
»Was machst du mit den Bildern?«, fragte Patupha.
»Verkaufen hoffentlich. In New York.«
»Du fährst nach New York? Das ist weit.«
»Zweitausendfünfhundert Meilen.«
Die Luft war staubig. Trotzdem konnte man die Fenster nicht geschlossen halten.
»Also bist du – Künstler?«, fragte Patupha irgendwann.
Max sah zu ihm hinüber. Eigentlich mochte er diese Frage nicht. Jetzt aber schien es, als hätte Patupha Itamve einen Knopf gedrückt: Und Max dachte keine Sekunde lang nach, er legte sofort los, sprach über sich und sein Leben, zunächst langsam, tastend, dann hastiger, und seine Sätze entwickelten sich zum automatischen Sprechen, das ihn mitriss, und Max gab preis, wie genau er hergekommen war, nach Arizona, und was einen sechzigjährigen Menschen antreibt, jede Menge schwere Bilder von einem Ort zum anderen zu karren, ohne große Aussicht darauf, sie verkaufen zu können, und Max erzählte, was es mit dem Malen auf sich hat, mit der Kunst. »Ein Kunstwerk ist ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament«, sagt Émile Zola, und Max ergänzte, dass es für einen Künstler nicht reiche, die äußere Natur zu betrachten, die Welt jenseits des Geistes, nein, er, Max, male immer mit einem offenen Auge und einem geschlossenen, und das offene Auge sehe in die Welt hinaus, das geschlossene dagegen tauche hinab ins eigene, ins innere Meer. »Kein Taucher«, fügte Max hinzu, »weiß vor seinem Sprung, was er zurückbringen wird.«
In diesem Augenblick hielt Max an. Der Ford schnaufte. Die Straße lag vor ihnen wie ein Strich ins Nichts. »Es gibt noch mehr Bilder«, flüsterte Max und deutete auf sein Herz: »Hier drinnen.«
Der Hopi schaute ihn fragend an.
Max zog die Streichholzschachtel aus der Hemdtasche am Herzen, öffnete sie und kippte sieben briefmarkenkleine Schnipsel zu Patupha aufs Armaturenbrett. »Ich habe Farbe auf das Papier gegeben«, sagte Max, »und die Farbe mit einem Glasstreifen abgezogen. Aus dem schmalsten Pinsel habe ich noch ein paar Härchen gezupft und unter der Lupe weitergemalt. SiebenMikroben durch ein Temperament gesehen. Die allerkleinsten Bilder vielleicht, die es je gab.«
Patupha kniff die Augen zusammen. »Willst du die Bilder verkaufen?«, fragte er.
»Nein«, sagte Max. »Noch nicht.«
Behutsam packte er die Mikroben wieder ein.
»Warum hast du sie dabei, wenn du sie nicht verkaufen willst?«, fragte Patupha.
»Sind die einzigen Bilder, die ich mitnehmen kann, ohne Schweiß zu vergießen.«
Max fuhr weiter.
»Und?«, fragte Max nach einer Weile.
»Was ›und‹?«
»Die Bilder? Wie sind sie?«
»Small«, sagte Patupha. »Very small.«
Max blickte hinüber.
Er wollte Patupha ein Lächeln schenken.
Doch der Sitz neben ihm war leer.
Ehe Max die Galerie in New York aufsuchte, fuhr er nach Long Island. Er sprang ins Meer und tauchte mit offenen Augen, lange und ausdauernd. Das Schwimmen: eine lebenslange Leidenschaft. Max verbrachte drei Wochen in New York. Am letzten Tag schlenderte er zur Bibliothek. Dort schlug er ein Buch auf. Patupha Itamve, las er, bedeutet: das Meer in uns. Max klappte das Buch zu und fuhr zurück nach Sedona. Er hatte kein einziges Bild verkauft.
Lou
1
Alles starb hier. Ein loser Vogel floh vor dem Donnern. Keine Krähe, kein Rabe, kein Kakadu: eine Amsel. Max sah ihr nach in die Nacht. Fliegen: fliehen. Stattdessen Granaten, Kanonen, Ducken in den Grabendreck. Jedes Bild ertrank im Jahr 1915. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung, Max? – Sehen! Sehen! Sehen! Seine lebenslange Antwort. Doch gab’s nichts mehr zu sehen jetzt. Das Licht lag im Schlamm.
2
Vater stand vor der Leinwand. Er quetschte Wasserreste aus den Pinseln, ordnete mit geübten Griffen die Farbeimerchen und warf den Kopf in den Nacken. Er murmelte ein paar andächtige Sätze, schloss die Augen und öffnete sie wieder. »Licht«, sagte Vater und hob die Hand zur Sonne, als wolle er sie schärfer stellen. »Zum Malen brauchst du Licht, Max.« Vater tunkte den Pinsel ein. Die Leinwand wurde Strich um Strich ihrer Leere beraubt. Das Weiß duckte sich unter dem Einschlag der Farben. Vaters Blick federte hin und her, vom Garten zur Leinwand und zurück, vom Motiv zum Bild, das nach und nach Kontur annahm, und plötzlich hielt er inne, blinzelte, schüttelte den Kopf. »Der Ast da vorn«, murmelte er und zeigte auf den Kirschbaum, »der ist falsch. Der stört. Der ruiniert die Symmetrie, siehst du, Max?« Der Fünfjährige verstand kein Wort. Für Vater wäre es ein Leichtes gewesen, den Ast beim Malen einfach auszusparen, stattdessen tat er ganz was anderes: Er lief über den Rasen, hin zum Kirschbaum, und er knickte den Ast ab, und er warf ihn ins Gebüsch, und er kehrte zur Leinwand zurück und sagte: »So ist’s besser!« Die dumpfe Wirklichkeit stand der Kunst nicht mehr im Weg.
Max schlich langsam aus Vaters Schatten. Er warf einen scheuen Blick zurück. Vater hatte sich wieder dem Bild gewidmet. Max öffnete das Törchen und verließ den Garten. Er hatte Großes vor. Er wollte nicht wie üblich zu den Nachbarskindern, nein, er wollte diesem Drang in ihm folgen, den er seit kurzem spürte: einfach weglaufen, weit weg. Zu den Drähten? Ja, ja. Zu den Drähten, von denen alle sprachen. Max trug seinen roten Lieblingsumhang, das Punjel, sein Nachthemd. Darunter die Hosen: Max zog sie hoch, fast bis zum Herzen. Er nahm den Stab, der neben dem Törchen lehnte, und stapfte los. Kies knirschte unter den Sandalen. Das Schloss, der Park, der Rasen, die Bäume, die Sonne, die Hitze, die Straße. Max bog um die Ecke und hörte ein Raunen: Gemächlich näherte sich ein lahmer Schwarm Menschen, stockend, Schritt für Schritt. Max blinzelte, legte die Handkante flach an die Stirn. Die Gruppe quälte sich träg über die Straße. Der Mann in der ersten Reihe reckte ein Banner in die Höhe. Das mussten die Pilger sein, auf dem Weg nach Kevelaer. Aus dem Gemurmel der Gebete wuchs ein Lied: Die Sterne verlöschen, die Sonn’, die jetzt brennt, wird einstens verdunkeln, und alles sich end’t. Noch aber blitzte die Sonne bös vom Himmel. Es fehlte der kühlende Wind. Da schnellte ein Arm hoch, ein Finger streckte sich, und jemand rief: »Da! Das Christkind! Dort drüben!« Hälse wurden gereckt, Ordnung verlor sich, das Singen verebbte. Der Pilger zeigte auf Max. Sein roter Umhang, sein langer Stab, die blonden Locken, die blauen Augen, die strahlende Sonne: ein Heiligenschein in seinem Rücken. Zwei der Gläubigen beugten sogar die Knie. Max aber sprang an den Leuten vorbei, trotzte der Sonne und rannte weiter: zum Bahndamm.
An einem riesigen Mast blieb er stehen und schaute hoch zu den Drähten. Endlich. Das Flüstern der Welt weit über ihm, die Telegrafendrähte, mysteriös verknüpft mit Ländern, von denen er keine Vorstellung hatte, nicht mal eine Ahnung, aber er konnte schon einige Namen aufsagen wie eine Litanei: Gegrüßet seist du, England, Spanien, Portugal und Frankreich, Amerika und Schweden. Max ging weiter zur Schranke und zum Bahnwärterhäuschen. Nach ein paar Minuten näherte sich ein Zug und dampfte einfach vorbei. Max sah in den Spiegeln der Abteilfenster die hohen Drähte. Sie lebten, sie bewegten sich heftig in seinem Rücken. Doch wenn er sich umdrehte, standen sie still. Wann hielte ein Zug für ihn? Er würde einsteigen und wegfahren, irgendwohin.
»Wer bist denn du?« Hinter ihm stand ein Polizist, aus dessen Helm eine Speerspitze wuchs. »Was treibst du dich hier rum? So ganz allein?«
»Die Drähte«, sagte Max und deutete nach oben.
»Komm, mein Jung«, sagte der Polizist. »Ich bring dich heim. Wo wohnst du denn?«
»Schlossstraße.«
»Nummer?«
»Einundzwanzig.«
»Und hast du auch einen Namen?«
»Na klar!«, sagte Max. »Den hab ich!«
»Verrätst du ihn mir?«
»Wenn du mich fragst!«
Philipp Ernst schimpfte nicht, als der Polizist ihm seinen Sohn zurückbrachte, nein, er war froh, dass der Kleine wieder heil in der Schlossstraße auftauchte. Und umarmte ihn.
»Sie haben gesagt, ich bin das Christkind!«, rief Max.
»Wer?«, fragte Vater.
»Die Pilger.«
»Die Kevelaer-Pilger?«
Max nickte.
Vaters Blick wölbte sich nach innen, kurz davor, etwas zu finden, es war der Blick nach dem Einschlag einer Idee, gleich würden sie funkeln, die Vateraugen, schon rief er: »Auf geht’s, Max! In den Wald!«
Die schrillen Triller der Vögel, das summende Flirren der Insekten, der Geruch nach Harz und schlafenden Pflanzen, die Schwitzigkeit von Moos und Torf und verrottendem Holz: Max konnte sie noch nicht benennen, seine Eindrücke. Die Düsternis, in der sich sein Auge verlor, mischte sich mit dem Locken aus der Tiefe des Waldes und der Angst, Ungetüme könnten auftauchen und ihn mit sich zerren. Wie nachts, wenn er im Traum aus dem Bett stieg und nach unten lief, Richtung Wohnzimmer, in dem die Eltern vor blakenden Lampen saßen, schwiegen, sprachen oder lasen, ausatmend jedenfalls, geschafft vom Tag. Doch Max kam in seinen Albträumen nie vorbei am Flur, immer packten ihn haarige Klauen von hinten, rissen ihn mit sich, er schreckte auf und schrie, bis Mutter Luise kam, seinen Kopf an ihre Brust presste und leise »Pschtpscht« machte.
Im Wald sperrte der Taubstummenlehrer und Hobbymaler Philipp Ernst seinen Sohn Max in den Käfig der Leinwand. Max musste stehen bleiben, reglos. Er musste sich auf seinen Stab stützen wie auf ein Kreuz, das größer war als er selbst, er musste die Hand nach vorn strecken: wie zur Segnung. Vater malte den Jungen als Christkind. Viel lieber hätte Max dem Vater beim Malen zugesehen, viel lieber hätte Max ihm über die Schulter geschaut, viel lieber wäre er dem magischen Flug der Pinsel gefolgt, wie so oft, aber das war nicht möglich als Christkind-Modell. Wie langweilig. So stehen und nichts tun. Blieb nur die Flucht ins Innere. Das Gequirle im Kopf.
Vater, Vater, Vater
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name
Dein Reich komme
Dein Wille geschehe
Aber wehe, wehe, wehe
Wenn ich auf das Ende sehe
Wie im Himmel so auf Erden
Die Verstorbnen die hienieden
Schon so frühe abgeschieden
Unser täglich Brot gib uns heute
Durch den Schornstein mit Vergnügen
Sehen wir die Hühner liegen
Die schon ohne Kopf und Gurgeln
Lieblich in der Pfanne schmurgeln
Und vergib uns unsere Schuld
Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern
Laut ertönt sein Wehgeschrei
Denn er fühlt sich schuldenfrei
Und führe uns nicht in Versuchung
Wie man’s treibt, mein Kind, so geht’s
Sondern erlöse uns von dem Bösen
Jajaja, rief Meister Böck
Bosheit ist kein Lebenszweck
Denn dein ist das Reich
Und die Kraft
Und die Herrlichkeit
Rickeracke, rickeracke
Geht die Mühle mit Geknacke
Gott sei Dank, nun ists vorbei
Mit der Übeltäterei
In Ewigkeit
Amen
3
Vater brachte Stille ins Haus. Er schwieg gern und ließ lieber die Hände sprechen: Wenn er satt war, knüpfte er eine imaginäre Serviette vom Hals; wenn er Pantoffeln brauchte, presste er Daumen und Zeigefinger zusammen, als hielte er ein Paar Hausschuhe an den Innenseiten; hatte er Durst, machte er eine simple Trinkbewegung. Max musste auf diese Vatergesten lauern, er musste befolgen, was die Hände ihm auftrugen. Das gute Beispiel: Pflicht, Pflicht und wieder Pflicht. Zum Glück gab es Maria. Die ältere Schwester, die Max alles zeigte, was er wissen musste: sich anziehen, waschen, abputzen, die Hände falten, gerade sitzen, den Blick senken beim Beten, den Mund halten in der Kirche, lautes Singen als Spiegel tiefer Inbrunst. Maria half Max, wo immer nötig. Sie sprang ihm bei, nahm ihm Arbeiten ab, warf ein fürsorgendes Auge auf den Bruder. Sie zeigte Max, wie man beim Malen den Stift hält, sie baute mit ihm ein winziges Häuschen aus Brettern im Garten, sie warf eine hellblaue Decke über sich und den Bruder, und unter der Decke klammerten sich die beiden so fest wie möglich aneinander, und Max hatte das Gefühl, sein Bauch fülle sich mit einer besonders warmen, süßen Luft. Als Max fünf Jahre alt war, legte sich Maria ins Bett, gab ihren Geschwistern Küsse, zuletzt auch ihm, Max, und dann starb sie, als wäre das nichts Besonderes und schon ganz in Ordnung so. Max verstand nicht, was geschah, hatte keine Ahnung, wo sie hinging, seine Schwester, der Lichtblick, die Verbündete, deren Tod ihn jetzt zum ältesten Kind machte. Max stellte sich vor, Maria sei den Drähten gefolgt und an einen Ort gelangt, an dem alles in wunderbaren Farben leuchtete.
Weil Worte fehlten, schwieg Vater noch mehr als ohnehin schon. Und Max mochte es nicht, dieses Schweigen.
»Papa?«, sagte Max eines Abends.
Vater sah ihn an.
»Zeigst du mir ein paar von den … Zeichen?«
Vater schwieg.
»Die deine Schüler machen. Mit den Händen.«
»Gebärden«, sagte Vater und nickte müde.
»Wie geht die Gebärde für Vater, Vater?«
Vaters flache, waagerechte Hand wanderte von der Stirn zum Kinn, der suchende Blick-in-die-Ferne wurde zum ängstlichen Das-Wasser-steht-mir-bis-zum-Hals.
»Und Mutter?«
Ein erhobener Finger neben dem Mund, der mahnte und zugleich die Wange streifte, streichelte? Max fing Feuer. Beim Wort krank wandelte sich die Vaterhand zu einer kreisenden, stumm kreischenden Klaue. Aber warum kraulte Vater beim Zeichen für schön ein hässliches Ziegenbärtchen? Die Gebärde für hässlich wirkte dagegen richtig hübsch, wie ein Handkuss, nur vom Kinn statt vom Mund. Und eine lahme Schnecke konnte hoppeln wie ein Hase? Manchmal, schien es Max, stimmten die Handzeichen nicht.
»Und wie geht dein Lieblingswort?«, fragte Max.
Vater zog fragend die Brauen hoch.
»Pflicht!«, rief Max.
Vater lächelte kurz. Dann strebten die Daumen zueinander hin, als wolle jemand Druck ausüben: Daumenschrauben.
»Und Tod?«, flüsterte Max endlich. »Oder darf ich das nicht fragen?«
Vaters Hände schwiegen.
»Ich will es aber wissen«, sagte Max.
Da reckte Vater beide Daumen nach oben, gen Himmel, als wolle er sagen: Alles in Ordnung, alles bestens. Plötzlich aber kippte einer der Daumen um. Max kletterte auf Vaters Schoß und barg die Wange an seiner Schulter. Vater nahm ihn fest in den Arm, und Max wagte kaum zu atmen. Auf seine Stirn tropfte jetzt etwas Nasses: ein seltsamer Regen im Innern des Hauses.
Wenig später lag auch Max krank im Bett: Es waren die Masern. Er hielt die Augen krampfhaft offen, blickte im Fieber auf die Mahagoni-Imitationen der Paneele, auf die Musterungen, die Kerben und Dellen. Alles, was er sah, wandelte sich in innerem Schwitzen zu einer Welt, die auf ihn einstürzte und zugleich aus ihm herausbrach. Eine Welt jenseits des Bekannten. Der kalte, metallische Geschmack des Neuen. Max ließ sich entführen von Gestalten, die gar nicht existierten, die aus Kontur und Schraffierung sprangen, doch diese Gestalten schienen greif-, sicht-, fühl-, fassbarer als alles andere je zuvor bei Licht Gesehene. Die Wahrheit, würde Max später denken, hat nichts zu tun mit Wirklichkeit, sondern mit Intensität, mit der Dichte im Dickicht der Empfindungen. Da spielte ein Teufel mit sieben Hörnern auf einer Blockflöte zum Tanz der geschorenen Schafe, aus denen rotes Fleisch quoll. Und Geier rissen ihnen Fetzen aus den Bäuchen und flogen hinauf zu den Sternen, die von geistgleichen Gnomen an die Stirn des Himmels gekleistert wurden. Doch die gierigen Geier ließen das Fleisch wieder fallen, ein leuchtendes Glühen in der Nacht, und aus dem Fleisch stülpten sich Maden, und die Maden fraßen sich gegenseitig, bis nur noch eine von ihnen übrig blieb, die fetteste, hässlichste Made, die Königin der Maden, deren Krone im Mondlicht lispelte wie die gezackten Augen einer Eishexe namens Nachtigall.
Bald lagen die Masern besiegt im Zimmer. Die Eltern umarmten sich still in der Nacht. Den Verlust eines weiteren Kindes hätten sie kaum verkraftet. Und es kam der Tag, da Max aufstehen durfte, behutsam, gelenkt vom Vater. Schon auf dem Weg die Treppe hinab hörte Max ein krächzendes Geräusch, das neu war im Haus. Als er das Wohnzimmer betrat, sah er sofort den Käfig. Dort drinnen hockte ein Vogel: groß, rosa, göttlich.
»Das ist Hornebom«, sagte der Vater.
»Was … ist das?«, flüsterte Max.
»Ein Kakadu.«
»Für dich!«, sagte die Mutter. »Du warst so tapfer. Wir …«
»Darf ich den behalten?«
Die Eltern nickten im Gleichklang. Max ging auf den Vogel zu. Ohne nachzudenken, öffnete er den Käfig. Es war das Erste, was er tat: den Käfig öffnen. Es war das, was er sein Leben lang tun würde: den Käfig öffnen. Erschrocken sprang der Vogel zurück.
»Keine Angst«, sagte Max, streckte den Zeigefinger aus und hielt ihn vor die Käfigtür.
Der Vogel krähte und gab einen Laut von sich, der sich anhörte wie das Wort einer seltsamen Sprache.
»Ja«, sagte Max.
Hornebom hüpfte auf seinen Finger: scharfe, gewetzte Krallen, die überraschende Schwere des Kakadus, der gelbe Kamm mit drei, vier, sieben, zehn umgeflappten Zacken, der graue Schnabel, die mattschwarzen Augen, zwei Tupfer auf der rosa grundierten Leinwand aus Federn. Hornebom flog nicht fort, er flatterte vom Finger auf die Schulter des Jungen. Das zwickte. Der Kakadu wühlte mit dem Schnabel in seinen Haaren, als wolle er Max etwas vom Kopf zupfen. Der aber roch zum ersten Mal Horneboms klopfende Wärme.
»Wie sehe ich aus?«, fragte er plötzlich und drehte sich mit dem Vogel auf der Schulter einmal um sich selbst.
»Steht dir gut«, sagte Mutter, leise schmunzelnd.
Der Vogel hier lebte. Im Gegensatz zur Puppe Tinchen, zum Soldaten Moritz, zum Steckenpferd Bebe. Der Vogel hier bestand nicht aus Stoff, Holz oder Pflanzenfasern, er hatte keine falschen Augen, nein, Hornebom war ein echtes, ein lebendes Tier aus Atem, Federn, Blut und Herz. Aber Max hatte die Banalität der größten Weisheit noch nicht verstanden: Alles, was lebt, stirbt irgendwann. Auch sein Vogel würde nicht ewig leben. Noch war nicht Schluss mit dem Tod für Max. Noch hatte er seine Lektion nicht gelernt.
4
Zunächst musste er anderes lernen. Lesen zum Beispiel. Die ersten harmlosen Kinderbücher verloren schnell ihren Reiz. Max strebte nach Spannenderem, nach Wilderem, nach Texten, die ihn mitrissen. Er griff zu Karl-May-Büchern, wurde vom Greenhorn zu Old Shatterhand, schlug mit einem einzigen Hieb den Feind zu Boden, erstach den Grizzly mit blankem Messer, fing das schnellstbeste Pferd aus der Horde der Wilden, schoss dem Kiowa-Häuptling Tangua in die Knie, uffuff, in beide Knie, las Fährten wie ein erfahrener Westmann, traf Winnetou, den Apachen, und Max wusste nicht, dass er einst selber in der Nähe von Indianern leben würde.
»Hast du heute deinen Katechismus studiert?«, fragte der Vater den Zehnjährigen.
»Ja«, sagte Max. »Der Heilige Geist. Wie sieht der eigentlich aus?«
»Du sollst dir keine Bilder machen von Gott, dem Herrn.«
»Aber du malst doch selber Bilder, Papa.«
»Ich male, was man sehen kann, die Natur, den Wald, einen Mönch, ein Buch, Schatten, den Fluss, die Vögel. Was man nicht sehen kann, kann man auch nicht malen. Glaubst du an die Auferstehung des Fleisches?«
»Am Tag des Jüngsten Gerichts stehen nicht nur die Seelen auf, sondern auch die Körper der Verstorbenen?«
»Genau. So heißt es im Katechismus. Die Leiber.«
»Und was ist mit dem alten Bolltrup?«, fragte Max. »Der hat doch nur noch sein linkes Bein. Fehlt denn das andere nach der Auferstehung immer noch?«
Der Vater schwieg eine Weile. Dann sagte er: »Na ja. Ich denke schon.«
»Was ist mit den Leuten, denen man den Kopf abgeschlagen hat? Gulli… Gullitinen? Kriechen die dann ohne Kopf aus dem Grab am Tag des Jüngsten Gerichts? Oder tragen sie den Kopf unterm Arm?«
»Max! Das sind gotteslästerliche Fragen.«
»Und das ist keine Antwort.«
»Werd nicht frech.«
»Verzeihung.«
Der Vater schüttelte seine Hände, als wolle er eine Fliege verscheuchen, ein klares Zeichen dafür, dass die Unterredung beendet war.
»Ich habe heute Wörter gelesen«, sagte Max an der Tür. »Im Katechismus. Wörter, die ich nicht kenne. Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens.«
»Das sind Sünden.«
»Augenlust? Wieso?«
»Verstehst du noch nicht. Geh jetzt hoch.«
Max verkroch sich in sein Bett und schlug die Nachtwachen von Bonaventuraauf, und während er las, verlor Max die Buchstaben nach und nach aus den Augen, sah nur noch das, was durch die Wörter zu ihm sprang, unerhörte Bilder, die sich selbständig machten und weiterliefen, immer weiter, und Max merkte nicht, wie seine Mutter Luise ins Zimmer trat und sich zu ihm setzte.
»Max«, sagte Luise.
Max blieb, wo er war.
»Max!«, rief die Mutter.
Wenn Luise ihren kleinen Sohn betrachtete, dachte sie oft: Der wird bald mancher Frau den Kopf verdrehen, so schön, wie er ist, so seeblau, wie seine Augen leuchten. Aber diese Augen kippten manchmal ab und verloren ihren Glanz, so wie jetzt. »Max, wo bist du wieder?«, rief die Mutter dann, wenn sie einen solchen Augenblick erwischte, aus Angst, ihr Sohn könnte eines Tages dort bleiben, wohin er sich mit offenen Augen zurückzog.
»Max! Bitte!« Sie rüttelte ihn leicht und nahm ihm das Buch vom Schoß. »Es ist spät«, sagte Luise.
Max nickte.
»Hast du dich gewaschen?«
Max nickte.
»Den Hals?«
Max nickte.
»Zeig mal her.«
Max schüttelte den Kopf.
»Du sollst nicht lügen.«
Max stand auf, ging ins Badezimmer und wusch den Hals. Wieder im Bett bemerkte er, dass seine Geschwister schon schliefen. Die Mutter saß immer noch mit ballonrundem Bauch, schwer und dick an seinem Bett. In Kürze würde Max einen kleinen Bruder bekommen oder eine kleine Schwester. Die Mutter lief seit einiger Zeit nur noch streichelnd umher, die Hand stets auf dem Nabel. Max bat die Mutter, ihm ein Märchen zu erzählen, Luise nickte, ihre Stimme und der rheinische Singsang beruhigten Max und schickten ihn in ein scheues Schlummern.
Hornebom. Der Kakadu. Ließ Max ihn raus, kam er geflogen, setzte sich auf die Schulter, zwickte Max ins Ohr, stets ins rechte Ohr, Max hatte keine Ahnung, weshalb, die rechte Schulter ein magischer Anziehungspunkt. Max war, als könne er sie verstehen, die Sprache der Vögel. Ein Tschilpen ohne Worte. Der Sinn lag im Klang, nicht in der Bedeutung. Horneboms Flügel waren lebende Tücher, die ab und an wirbelten, sein Schnabel knipste auf und zu. Und Max würde es zeit seines Lebens deutlich vor sich sehen: wie er aufwachte und die Treppen hinuntersteppte, der nächste Tag, Mutter nicht da, nur dieser ewige Reibekuchenduft in der Küche, und auch Vater fehlte, irgendwas stimmte hier nicht. Im Wohnzimmer öffnete Max den Käfig, um Hornebom herauszulassen, und als er ihn herauslassen wollte, den Kakadu, da lag er dort, in der Streu, der Vogel, und die Flügel, die hoben sich nicht mehr, und der Schnabel, der öffnete sich nicht mehr, und die Äuglein, die blinzelten nicht mehr. »Papa!«, rief Max, doch Vater kam nicht. Max nahm den Käfig herunter, der an einer Kette baumelte, öffnete die Gittertür, blies auf den Körper, als wolle er ihm Leben einhauchen, und er rief wieder: »Papa, Papa!« Und: »Hornebom, Hornebom!« Endlich trat Vater ins Zimmer, ohne Augen für Max, für den Schmerz und für den gefallenen Kakadu. Nein, Philipp nahm seinen Sohn in den Arm, und in Vaters Blick funkelte Freude. »Deine Schwester«, sagte er, »deine Schwester, sie ist geboren, sie ist wohlauf.« Max starrte durch die Vaterfreude zurück zu Hornebom. Schwester-geboren-Hornebom-gestorben: ee-eoe-oeo-eoe: ein lebenslanges, untrennbares Echo.
Nachdem Max seine kleine Schwester Loni gesehen hatte, kehrte er zurück ins Zimmer Finsternis. Er barg den Kakadu aus dem Käfig und ließ Tränen freien Lauf, sie fanden einen Ausweg aus dem Kopf, den seine Gedanken nie finden würden, und linderten den Schmerz in der Brust. Draußen schaufelte Max mit den Händen ein Grab, ein Miniaturgrab. Eines Tages würde jemand ein großes Grab für ihn freilegen, in dem zahllose Kakadus Platz hätten oder ein einziger Maxmensch. Er stand dort und bedeckte Horneboms Körper mit Erde. Die Krümel an seinen Händen waren schwarz, Max rieb die Finger aneinander, aber sie wurden nicht sauber, nicht jetzt, nicht heute, nicht für den Rest seines Lebens. Das Malen, würde er viel später merken, ist eine Tätigkeit, bei der die Hände stets dreckig bleiben.
5
Seit einiger Zeit besprang Max mit wohligem Bauchplatzen das Kissen in der Nacht. Er biss sich dabei auf die Lippen, um nicht zu stöhnen und die Geschwister aufzuwecken. Er kannte jetzt die Bedeutung des Wortes Fleischeslust. Auch das Wort Augenlust verlor sein Geheimnis, als ein Freund ihm verklebte Bildchen zeigte. Dieser schwarze Busch in der Mitte einer Frau, ein Busch, der all das verbarg, was Max eigentlich erkunden wollte. Daneben schräge Zahn- und Zungenküsse mit Michaela von der Straße, die fast mit jedem fummelte. Das Betatschen der Rundungen, Sehnsucht nach mehr, eine Sehnsucht, die zur Sucht wurde und sich Erlösung verschaffte Nacht für Nacht, begleitet von inneren Bildern, denen jede Zartheit fehlte. Vom Geschlecht hatten die Eltern nie gesprochen. Alles, was Max darüber wusste, kannte er aus schalen Witzen und üblen Sprüchen. Nachts lag er wach und dachte nach. Über das Leben, über Mädchen, über den Sinn, die Zeit, den Glauben, über all das, was man ihm beigebracht hatte, und über all das, was man ihm nicht beigebracht hatte. Was wollte er eigentlich? Er selbst? So weitermachen wie bisher? Das tun, was man ihm auftrug? Horchen und gehorchen? Nach außen hin kam er seinen Pflichten nach, ohne zu murren. Aber mehr und mehr spürte er inneren Widerwillen. Den Kleinen die Schuhe binden, Einkäufe schleppen, bei den Hausaufgaben helfen, Reparaturen erledigen, Vokabeln abhören: alles schön und gut. Aber er? Wo blieben seine eigenen Wünsche? Das Lesen? Seine Bilder und dieses seltsame Gefühl beim Zeichnen und Malen? Ein Gefühl, das etwas mit Rückzug zu tun hatte, Rückzug von der Welt, von der Schule, vom Alltag, ein Gefühl des Aufatmens. Ja, er liebte seine Geschwister. Es war schon in Ordnung, ihnen zu helfen. Aber wenigstens sonntags hätte er gerne gemalt. Diese verschenkten Morgen, an denen er in der Schlosskirche hocken musste. Die endlose Wiederholung des immer Gleichen, die festgefrorene Ewigkeit: Max wollte das nicht mehr. Wo steckte dieser Gott überhaupt?
Und dann fiel Max ein Buch in den Schoß: Der Einzige und sein Eigentum. Max warf sich förmlich in die Seiten hinein, heimlich, denn Vater durfte nichts davon erfahren. Er flog durch die Sätze seines Namensvetters Max Stirner und konnte kaum glauben, was er da las. Sätze wie Schläge in die Magengrube. Es ging um Gott, Gewissen, Pflicht, Gesetz. Ja, es stand wirklich dort – Max musste es dreimal lesen: Gott, Gewissen, Pflichten und Gesetze könnten nichts weiter sein als Flausen, mit denen man »Kopf und Herz vollgepfropft und verrückt gemacht« habe, ja, das, genau das war es, was Max spürte, die bedrängende Enge, die Zwangsjacke, die Einpferchung. Das Wort vollgepfropft schnürte ihm die Kehle zu, und beinah hätte er geweint. »Lechzt der Geist nicht nach Freiheit?« Jaja, schon, aber was bedeutete das: Freiheit? Max las weiter. Er sammelte Munition. Für den Ausbruch. Für den Tag, an dem er endlich Nein sagen würde. Für den Tag, an dem er seinen Eltern zeigen wollte, dass da etwas in ihm steckte. Obwohl er keine Ahnung hatte, was genau das war. Ja, Max wollte sich nicht mehr »an andere wegwerfen«, weder an die Eltern noch an die Kirche, er wollte kein Schaf mehr sein, das nur zu horchen hatte auf das Gebell des Gebets. Horchen, gehorchen: Schluss damit! »Wer soll denn hier frei werden?« Ich! Und wovon? »Von allem, was nicht ich ist«, nichtig. Fort mit diesen Schalen! Ich will mich selber nicht mehr länger herunterschlucken. Was bleibt denn übrig, wenn ich von allem anderen befreit bin? »Nur ich und nichts als ich.«
An einem Samstagabend stieg Max ins Wohnzimmer hinab, zu den Eltern. Die Geschwister schliefen schon. Max setzte sich auf einen schiefen Stuhl, mit dem Flaum des Sechzehnjährigen über den Lippen, er holte tief Luft und wusste noch nicht, ob er es schaffen würde zu sagen, was er sagen wollte, er schloss kurz die Lider, und dann hörte Max seine eigene, leicht scheppernde Stimme: »Vater. Mutter. Ich glaube wohl nicht mehr an Gott.«
Dieser Satz schlug in die Stube ein wie ein Blitz. Ein solcher Satz war undenkbar im Haus von Luise und Philipp Ernst.
»Was hast du gesagt?«, fragte Philipp Ernst hinter seine Zeitung geduckt, noch ohne Gesicht zu zeigen.
Max zitterte. »Ich glaube nicht mehr an Gott«, flüsterte er. »Ich weiß nicht, ob ich je an ihn geglaubt habe.«
Der Vater legte die Zeitung weg. Er nippte an seinem Glas, setzte es ab, ruckte im Sessel ein Stück nach vorn. »Das will ich nicht gehört haben«, sagte er.
»Morgen bleibe ich hier«, sagte Max. »Ich gehe nicht mehr mit. In die Kirche, meine ich.«
Philipp Ernst zwang sich, ruhig zu bleiben. »Woher kommt das so plötzlich?«, fragte er, gewollt behutsam, aber lauernd.
»Wenn ich in der Kirche sitze. Da ist nichts. Alles leer. Hier drinnen.«
Jetzt stand der Vater auf, trat ans Fenster, legte die Hände auf den Rücken, schaute nach draußen. Dunkelheit auf der staubigen Straße. Ein gebückter Mann eilte vorüber. Der Mond versteckte sich hinter den Wolken. »Du wirst mir das sicherlich erklären können«, sagte Philipp.
»Gott«, rief Max, und seine Stimme überschlug sich kurz. »Wer soll das sein? Ein Wesen über mir? Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich bin der Einzige, der zählt. Ich entscheide, was ich tue. Ich brauche keinen Gott über mir und keinen … Vater, der mir sagt, was ich zu lassen habe. Und zu tun.«
Philipp Ernst fühlte einen Stich im Hals. »Gottes Gesetze«, flüsterte er, »sind die einzige Richtschnur, die es gibt. Woher kommt das so plötzlich, Max? Was hast du gelesen?«
»Max Stirner.«
»Wo ist das Buch?«
»Oben. Unterm Bett.«
»Hol es her!«
»Hol es selber!«
Philipp Ernst atmete laut ein. Er wusste sich nicht mehr zu helfen, trat zu seinem Sohn, holte aus und wollte dem Jungen, der noch auf dem Stuhl saß, mit der flachen Hand ins Gesicht schlagen, aber Max erhob sich langsam, schon ein Stückchen größer als der Vater, er baute sich auf, kerzengerade, schlaksig-schlank, in seiner blauen Hose, dem weißen Hemd, geschlossen bis zum obersten Knopf, er stand da und erwartete die Ohrfeige. Doch Vater Philipp senkte den Arm wieder. Er ging an Max vorbei, eilte hoch ins Zimmer, kniete sich vors Bett, angelte das Buch aus dem staubigen Schummer und klemmte es sich unter die Achsel. Sein zweiter Sohn Carl schlief im Bett nebenan. Philipp zupfte die Decke zurecht und strich dem schlafenden Jungen leise durchs Haar. Er blieb noch ein paar Sekunden lang so stehen, als wolle er sich vorbereiten auf das, was jetzt kommen würde. Dann riss er sich los, stieg mit dem Buch zurück nach unten, ließ seine Miene auf der Treppe wieder steinern werden, setzte sich in den Sessel und begann zu lesen.
Max sagte nichts. Er blieb stehen. Als wäre das Ganze eine Prüfung. Während der Vater blätterte, murmelte die Mutter Luise, das sei alles nicht schlimm, man werde eine Lösung finden, auch sie selber sei schon einmal von Zweifeln geplagt worden, man müsse die Zweifel wie Unkraut tilgen und …
»Was ist denn Unkraut?«, fragte Max.
»Du weißt doch, was Unkraut ist?«, sagte die Mutter.
»Ja. Ich weiß, was Unkraut ist. Unkraut ist das, was der Mensch Unkraut nennt. Aber ich liebe Unkraut, Unkraut wächst und wuchert.«
»Komm her«, sagte Vater irgendwann.
Max gehorchte.
Philipp klappte das Buch zu und stellte sich vor seinen Sohn, Blick an Blick. »Für mich«, sagte Philipp und deutete auf das Buch in seinen Händen, »ist das hier nichts als Unfug.«
»Wie kannst du das sagen nach ein paar Minuten?«
»Max. Hör mir zu. Du willst niemanden anerkennen über dir? Keinen Gott, keinen Vater? Niemanden? Aber diesem Schmierfinken hier überlässt du die Führung? Über dich und dein Leben? Diesem Max Stirner? Der sich erdreistet, unseren Gott in Frage zu stellen? Einen Gott, an den Millionen von Menschen glauben? Wenn du auf eigenen Beinen stehen willst, musst du dich auch von diesem Stirner lösen. Sonst wechselst du nur die Bibeln aus.«
Max starrte den Vater an.
Philipp merkte, dass seine Worte ins Schwarze trafen. Mehr würde nicht nötig sein. Fürs Erste. Dachte er. Und Philipp gab Max sogar das Stirner-Buch zurück. »Geh jetzt schlafen, mein Junge!«, sagte er leise, versöhnlich.
Max nahm das Buch entgegen. Verwirrt blickte er auf den Umschlag. Der Einzige und sein Eigentum. Er dachte kurz nach. Dann schnellte seine Hand vor. Das Stirner-Buch flog am Vater vorbei in den Papierkorb. Und der Papierkorb kippte um. »Da hast du recht, Vater. Ich brauche keinen Max Stirner, um zu wissen, was Max Ernst will.«
Philipp zuckte zusammen. Als sein Sohn ihn jetzt ansah, einfach nur ansah, da spürte der Vater, wie sehr er den Jungen liebte. Ganz egal, was Max auch tat und tun würde. Philipp hätte am liebsten gesagt: Max. Du bist anders. Anders als wir. Von Anfang an anders. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das dulden soll oder nicht. Ich weiß nur, dass ich dir nicht gewachsen bin. Und ich weiß, ich werde dich nicht ändern können. Also musst du wohl deinen Weg gehen. Ob ich will oder nicht. Mir bleibt nur zu hoffen, dass dieser Weg ein gutes Ende nimmt. Geh ihn also, Max, geh ihn, deinen Weg. Doch all diese Worte blieben ungesagt im Kopf des Vaters. Stattdessen senkte Philipp den Blick, traurig, verletzt, er setzte sich wortlos hin, griff nach seiner Zeitung und beachtete den Sohn nicht mehr.
6
Nachdem Max seine Bude in Bonn bezogen hatte, neugierig auf die Welt der Universität, vernahm er bei seinem ersten Ausflug plötzlich Schreie, die aus einem Gebäude mit hohen Mauern drangen: der Universitätsnervenklinik für Geisteskranke. Max lauschte. Nur ein paar Tage später musste Max genau diese Klinik aufsuchen: Er hatte sich unter anderem für Psychologie eingeschrieben, und die angehenden Psychiater mussten hier Kurse belegen, den Patienten begegnen, sich dem stellen, was auf sie zukäme, würden sie ihr Studium beenden. Als die Studenten zum ersten Mal das Gebäude betraten, watschelten allesamt brav hinter dem Dozenten her, nur Max blieb zurück. In der Halle hatte er etwas gesehen: eine Sammlung von Plastiken und Bildern. Einige dieser Plastiken waren aus Brot geformt; die Bilder atmeten den Schwung des Wahnsinns: Kunstwerke dieser sogenannten Geisteskranken. Kunstwerke für Max, für die anderen eher: Erzeugnisse von Irren, Zeichen, die man zu deuten hätte, um der Verrücktheit auf die Schliche zu kommen, ein erster Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Heilung. Max betrachtete die Werke mit mehr als bloßer Neugier. Er hätte die Plastiken gern in die Hand genommen. Aus Brot geformt! Der Drang dieses Menschen, etwas zu gestalten, war so groß gewesen, dass er das Erstbeste und Einzige genommen hatte, was ihm zur Verfügung stand: Brot. Aus Mangel an Material: das eigene Essen. Mit hungrigem Magen ein Werk geformt, um es mit sattem Geist betrachten zu können.
»Guten Tach auch«, hörte Max eine Stimme hinter sich.
Max fuhr herum. Der Mann, den er sah, war etwa vierzig Jahre alt, hatte eine Glatze, aber wuchernde Brauen, darunter rachenschwarze Augen, die Lippen verzogen sich zu einem angeklebt wirkenden Lächeln, und ein Speichelfaden suchte zaghaft den Weg Richtung Kinn.
»Das da«, sagte der Mann, und seine Stimme klang, als würde er beim Sprechen vor einen Kamm blasen, »das da, das da, das habe ich, ich selber, gemamama, es hat noch nie jemand so angeschaut wie du.« Der Mann deutete auf einen Laib Brot, aus dem Brocken gerissen worden waren, sodass zwei Löcher wie Augenhöhlen wirkten und das dritte wie die Öffnung eines Mundes, der unaufhörlich schrie. Die Brot-Innereien bildeten – hart zusammengeklatscht – eine windschiefe Nase, die dem Betrachter entgegenstach. Das Ganze wuchs zu einem Gesicht aus einer anderen Welt, nein: zu einem Gesicht aus der Kehrseite der Welt, die kaum einer beachtete. Der Patient legte seinen Arm um Max und zog ihn sanft zu sich. Der Mann roch stark antiseptisch, als hätte er soeben in einer Lösung aus Desinfektionsmitteln gebadet. Weil Max nicht wusste, was er sagen sollte, fragte er: »Wie heißt du?«
»Hendrik. Und du?«
»Max.«
»Aha. Du bist der König der Zungen, oder?«
Max schwieg.
»Das ist mein Vater«, sagte Hendrik und deutete auf die Brotplastik. »Alles ist mein Vater«, flüsterte Hendrik. »Ich kann nur meinen Vavavater machen, wenn ich Sachen mache, alles, was ich mache, ist mein Vater. Immer. Aber nie ist es richtig.«
Max nickte.
»Kennst du das?«, flüsterte Hendrik plötzlich. »Ich muss allen Möbeln die Beine absägen. Oder abhacken. Oder abschneiden. Mit einer Säge. Mit einer Axt, Max, Maxt, mit einem Beil, mit einem Messer, mit irgendwas Scharfem. Immer exakt an den Kanten. Die Beine vom Bett, vom Tisch, von den Stühlen, vom Sessel, von den Schränken. Alle Beine abschlagen. Erst dann kann ich die Möbelwunden zart und weich schmirgeln. Kennst du das?«
Max nickte.
»In meiner Wohnung liegt ein Haufen amputierter Möbelbeine. Große und kleine, lange und stumpenhafte Beine.« Hendrik hickste. »Ich weiß jetzt: dass mamaman an einem Tisch ohne Beine nicht essen und auf einem Stuhl ohne Beine nicht sitzen kann. Ein Schrank ohne Beine lässt sich nur mühsam öffnen, wenn die Tür direkt über den Parkettboden kratzt.«
Hendrik schwieg jetzt, außer Atem.
Max fragte: »Wie heißt dein Vater denn?«
Hendrik ließ Max sofort los, er trat einen Schritt zurück und hüpfte durch den Raum wie eine Ballerina, rief »Hach! Hach!«, seine Bewegungen bekamen etwas Schwebendes, und Hendrik tanzte durch die Tür, ohne Max weiter zu beachten. Schon war er fort. Und Max blieb allein.
Zurück in seiner Bonner Bude, bombardierte Max sofort eine Kladde mit Notizen: Hendrik. Dieser Blick, die Augen, die Schwärze, diese Werke. Die Menschen da drinnen scheinen tiefer getaucht zu sein als jeder andere von uns. Sie sind nicht mehr zurückgekehrt, sie sitzen immer noch am Grund, aber sie haben etwas gesehen, sie sehen etwas, nur was? Etwas, das auch ich sehen will. Aber ohne das Schicksal der Eingeschlossenen hier zu teilen. Etwas Elementares, etwas, das mit unserem Leben zu tun hat, mit dem, was wir wissen müssen, um die viel zu großen Worte Sinn und Wahrheit endlich zu köpfen. Ich spüre Nähe zu den Patienten, keine Ferne. Ich muss mich von ihren Werken anspringen lassen, ich darf sie nicht begutachten. Sie enthüllen mehr über mich als über den Künstler. Ja, diese Leute sind Künstler, es sind keine Irren, und ich, ich weiß genau, was ich will: Ich will die Grenzen des Wahnsinns ausloten, den Wahnsinn nicht als das sehen, als was die anderen ihn sehen, als Deformation, als Krankheit, als Übel, sondern als das, wovor alle Welt flieht und erschrickt, als das, dem man sich stellen muss, will man das Geheimnis des Menschen ergründen, als das, was in jedem Einzelnen von uns begraben liegt und darauf wartet, angeschaut zu werden: ja: sofort: jetzt: gleich: ein Buch schreiben! Ein Buch über die Menschen in dieser Anstalt, über die Kunst dieser Menschen. Ihre Kunst: Ist das nicht die wahre, die wirkliche Kunst? Ohne jedwede Künstlichkeit? Nicht geboren aus dem Antrieb, gefallen zu wollen oder verkauft werden zu wollen oder etwas zeigen zu wollen oder etwas sagen zu wollen oder sein Können zur Schau stellen zu wollen oder aus sonst einem erbärmlichen Antrieb heraus, nein, ihre Kunst dort ist geboren aus reiner Sinn- und Zweck- und Zielfreiheit, geboren aus nichts als dem Sehen, dem inneren Sehen, sie müssen tun, was sie tun, und sie scheren sich nicht die Spur um den Blick der anderen, sie scheren sich nur um sich selbst, sie scheren sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes, sie scheren ihr Inneres wie wild wuchernde Wolle, der Wille zur Wolle, hehe, ja, ein Buch über die Kunst und den Wawawahnsinn, das wäre es doch, wenn auch ohne Kalauer bitte.
Das Vorhaben scheiterte. Der Neunzehnjährige fand nicht die richtigen Worte. Vielleicht war er kein Schriftsteller. Vielleicht musste er das, was er sah, schlicht und einfach zeichnen oder malen oder modellieren? Vielleicht war er aber auch nur viel zu weit weg von dem, was Hendrik ihm offenbart hatte. Außerdem gab es gerade jetzt jede Menge Neues, das sich zeigte, Dinge, die Max aufsaugte, die ihn ablenkten und umtrieben: Er entdeckte die »Welt der Wunder, der Chimären, Phantome, der Dichter, der Ungeheuer, der Philosophen, Vögel, Frauen, Magier, Bäume, Erotika, Steine, Insekten, Berge, Gifte, Mathematik usw.« Und Max fraß. Max fraß unersättlich: pausenlos kauende, staunende Raupe. Seine Augen stopften sich alles in den Kopf, was sie kriegen konnten. Max legte den Aufschrieb über Kunst und Wahnsinn beiseite und verlor sich tagelang in der Welt der Flechten, wollte herausfinden, was Flechten zu Flechten macht: Erst in der symbiotischen Vereinigung von Pilzen mit Grünalgen oder Bakterien bilden sich die Flechten, und Flechten leben an den unwirtlichsten Orten, in vielfältigen Formen und Farben, und sie nisten sich ein auf Felsen, Rinden, Wegen und Unwegen, bilden mehrfarbige, grandiose Landschaftsmuster. Dann wieder suchte Max Orte auf, um selber der Vereinigung zu frönen: Er hatte herausgefunden, dass da etwas in ihm steckte, dem die Frauen nachgaben. Das lag wohl an der Farbe seiner Augen oder an dem, wer weiß, was hinter diesen Augen flackerte. Und das Malen? Manchmal starrte Max einfach nur in seine Kaffeetasse und fragte sich, was einen Kaffee denn zum Kaffee macht und wieso der Kaffee so nachtschwarz in der Tasse schaukelt und ob Schwarz nicht doch eine Farbe ist, eine alles verschlingende Farbe, die ein Bild bedecken kann, komplett verbergen. Die Möglichkeit eines schwarzen Quadrats streifte seine Ideenwelt, verlor sich aber wie so vieles andere im Chaos seines Kopfes. Max ahnte: Sein Vater Philipp verharrte beim Malen an der Oberfläche. Doch ein Bild eröffnet nicht das, was zu sehen ist, sondern das, was nicht zu sehen ist. Max malte jetzt immer eifriger, aber fast heimlich und mit ungeheurer Unzufriedenheit im Genick. Alles, was er malte, schien falsch. Er warf das meiste wieder fort. Wie ihm die Worte fehlten, so fehlten ihm auch die Bilder. Doch fehlten sie auf andere Weise: Die Worte schienen unerreichbar für ihn. Die Bilder aber lagen greifbar nah, nur bedeckt von Schutt und Kram und Müll alter Vorstellungen. Er musste sich erst durch diesen Berg wühlen. Max ließ nicht locker, er gab alles, und er malte und zeichnete ernsthafter als je zuvor.
Wenn Max das Wort ernsthaft hörte, lächelte er nicht. Zwar mochte er Wortspiele und Kalauer aller Art, zwar konnte er die Menschen in seiner Umgebung gut zum Lachen bringen, aber die abgehalfterten Zweideutigkeiten, die um seinen Nachnamen kreisten, hatte er bald satt. Genauso wie die Wortspiele um den Namen seines neuen Freundes: August Macke. Der alles andere als eine selbige hatte. Nein! Macke war etwa vier Jahre älter als Max. August Macke, der Künstler, der Corinths Malschule in Berlin besucht hatte, der große Bruder, der Max zeigte, wo es langging, und der eine Gruppe von rheinischen Dichtern und Künstlern um sich scharte, Macke, ein geborener Lehrer, der alles gern mit seinen Schülern teilte.
In der Johannisnacht 1912 saß die Gruppe der angehenden Künstler um ein Feuer, ein riesiges Feuer, ein Johannisfeuer, ein Scheiterhaufenfeuer, es wurden Reden geschwungen, es ging um Befreiung und Revolution, um Knechtschaft und Selbstbestimmung, um Liebe und Tod, um Wahrheit und Wahnsinn, der ganz, ganz hohe Ton wurde angeschlagen, alle waren bereit, Baudelaire zu folgen in seinem Aufschrei: »Auf den Boden des Abgrunds stürzen, Himmel oder Hölle, was macht es!«
»Kunst hat mit Geschmack nichts zu tun!«, rief einer.
»Als ob man Kunst schmecken könnte!«
»Alle«, sagte Max, »alle, alle wollen sie was von Kunst verstehen, diese Kunstrichter! Und die ganze Zeit faseln sie was von Können! Können! Und dass wir, die Jungen, dass wir hier gar nichts mehr können!«
»Die glauben, Können heißt: richtig malen und zeichnen.«
»Als wären wir Fotografen!«
»Die Nase nicht zu lang, die Beinchen nicht zu kurz! Aber die haben keine Ahnung«, rief Max, »was Können eigentlich heißt!«
»Und? Max? Was heißt das?«
»Wir brauchen das nicht zu lernen. Wir brauchen keine Kunstschulen! Wir brauchen kein Mal-Diplom! Können heißt Gestaltenkönnen. Das innere Leben der Farben und Linien empfinden. Können heißt: Erlebnisse haben!«
»Was für Erlebnisse?«
»Die einfachsten Dinge, alles kann zum Erlebnis werden.«
»Ist mir zu harmlos!«, wetterte plötzlich ein Junge namens Kalle, ein angehender Dichter, der eine grüne Lederjoppe trug und dessen Haar sich schon in jungen Jahren gelichtet hatte, Kalle, mit Fistelstimme, Nickelbrille und schwarzweißen Schuhen aus Kuhhaut. Der junge Dichter hatte reichlich Bier und Schnaps geladen, und jetzt stand er auf und deklamierte: Es müsse der Kunst gelingen, Feuer zu legen, Brandherde, Kunst müsse aufbegehren gegen den Mief des Biederen. Pfiffe und Hurra. »Mehr noch!«, schrie Kalle in ernstem Eifer. »Nicht nur die Kunst muss Feuer legen, der Künstler selbst muss brennen wie eine Fackel, darf nie erlöschen, er muss lodern, er muss ein Licht sein in der Banausalität, in der Banalausi…« Die anderen wieherten. »Brennen muss man, brennen!«, schrie der Dichter.
»Ja, Mensch, Kalle«, grölte jemand, »dann hüpf doch ins Feuer, wenn du so gern brennen willst!«
Kalle warf seine Flasche weg und sprang, ohne zu zögern, bäuchlings in die hoch aufgetürmten, lodernden Scheite. Sofort kehrte Stille ein.
Die jungen Künstler lauschten kurz dem Knistern der Kleider. Wie gelähmt hockten sie dort, als der entflammte Dichter jetzt schrie. Endlich zogen sie Kalle vom Scheiterhaufen, schlugen das Feuer aus der Jacke, Kalle verlor das Bewusstsein, die Künstler kippten Wasser über den angesengten Körper, und gemeinsam schleppten sie Kalle ins nahe gelegene Bauernhaus, und der Bauer empfing die jungen Männer mit kalter Verachtung: »Kühe melken könnt ihr nicht, aber ins Feuer springen, das könnt ihr.«
Als Max am nächsten Tag den Dichter abholte, taumelte Kalle ihm schon wieder auf eigenen Füßen entgegen, seine Brandwunden notdürftig verbunden, gesalbt, ein wenig mumifiziert sah Kalle aus.
»Komm mit, ich bring dich nach Hause«, sagte Max.
»Aber ich bin gesprungen!«, murmelte Kalle.
»Ja, du bist gesprungen.«
Und dann saß Max allein in seinem Zimmer.
Alles, was er in den letzten zwei Jahren geschluckt hatte, verquirlte in seinem Kopf zu einem Strudel: Kalles Sprung ins Feuer, die Museumsbesuche, die Sonderbund-Ausstellung mit Bildern von Gauguin, van Gogh, Cézanne, Munch, Picasso, Matisse, Kirchner, Nolde, Klee, Kandinsky, Marc und seinem Freund August Macke selbst, dazu Mackes Zuspruch (Ich sehe was in dir, mein Lieber, da ist was, du weißt es selber nicht, aber da ist was, und wenn du dir keine Mühe gibst, werd ich dir zeit meines Lebens in den Hintern treten!), die Klinikbesuche, die Schreie, die Werke der Wahnsinnigen, seine Gedanken zur Kunst, die neue Freiheit in Bonn, das nächtliche Umfangen der Frauen, die Flechten, die aus dem Nichts eine Heimat schufen, seine Selbstporträts, die Bücher, die er sich einverleibte, die eigenen Schreie, die noch in Max steckten, Ideenfilme, die auf weiße Wände drängten, das Bauchschwellen beim Zeichnen und Malen, Ballongefühl, Schwerelosigkeit, als hätte er Körper und Geist abgegeben für die Stunden, in denen er malte und zeichnete, all das und alles mehr, gesehen, gefühlt, geahnt, gedacht, alles geriet in jenen Strudel, wandelte sich zu einer Gewissheit, etwas gefunden zu haben, das ihn und sein Leben tragen würde, hoch hinauf und tief hinab, ja, im Jahr 1912 hielt Max inne in seiner chaotischen Selbst- und Weltentdeckungsfahrt, da saß er still im Zimmer, und zum ersten Mal dachte er mit einer nicht mehr zu löschenden Klarheit: Ich werde malen. Und sonst nichts. Ich werde malen. Und er dachte es mit einem schrägen Lächeln, glücklich und erschrocken zugleich.
7
Die Hutfabrik und Modewarengroßhandlung Löwenstern & Straus, anfangs noch ein einzelner Laden, wuchs nach und nach zu einem Unternehmen heran, das in seiner Blütezeit mehr als hundert Mitarbeiter beschäftigen sollte. Daher zählte Jacob Straus, dem die Hälfte der Firma gehörte, zu den wenigen Kölnern, die alle drei Kriterien erfüllten, um an Wahlen teilnehmen zu dürfen: Er war ein Mann; er war älter als vierundzwanzig; und er zahlte Steuern in ausreichender Höhe. Richtig heimisch wurde seine Familie in Köln aber nicht. Nach der Geburt der ersten Tochter Luise im Jahr 1893 zog man ein paarmal um. Von der Friedrich-Wilhelm-Straße an den gediegenen Hohenstaufenring: Denn in der Nähe der Friedrich-Wilhelm-Straße hatte kurz zuvor noch die Cholera gewütet. Und etwas später dann vom Hohenstaufen- an den Salierring: Denn dort fiel die jüdische Familie Straus unter den übrigen jüdischen Familien nicht weiter auf und entzog sich dem grassierenden Antisemitismus. Judenfeindlichkeit hatte Tradition. Die Juden hier waren stets für alles Mögliche verantwortlich gemacht worden: Ihr Schuldenkatalog reichte von der Pest im Jahr 1349 bis zum Börsenkrach 1873. Die Deutschnationalen zeigten im preußischen Reichstag offen ihren Judenhass; eine Großdeutsche Buchhandlung druckte ein »judenreines Adressbuch«; die vor den Pogromen geflohenen Juden aus dem Osten, hieß es am Stammtisch, nähmen den Deutschen die Arbeitsplätze weg, in Unkenntnis der Zahlen: Von den dreihundertdreißigtausend Kölner Bürgern bekannten sich gut zwei Prozent zum jüdischen Glauben. Eine anonyme Drohung wurde kurz nach Luises Geburt verschickt: Man habe genug von der Judaisierung der Stadt und des Landes, in Deutschland solle »kein Jude mehr gedeih’n«, und der Tag werde kommen, an dem man die Synagoge einfach in die Luft sprenge.
Schon die kleine Luise Straus merkte, dass manche Menschen sie befremdet anschauten. Und sie hatte Angst, man könnte ihr etwas antun. Wie ihrem Nachbarfreund David, dem man ein Loch in den Kopf geworfen hatte. Weil er nach Jude stank. So sangen jedenfalls ein paar andere Kinder. Oder wie dem alten Joppe, der vier Monate im Krankenhaus verbrachte. Weil wildfremde Männer ihn angestochen hatten. Ausgeraubt, die Judensau, wie Luise auf der Straße hörte. Ja, Luises Angst wuchs zu einer Angst vor allem Unbekannten, das sich ihr näherte, denn alles Unbekannte, das sich ihr näherte, konnte etwas Böses wollen. Sie schrie auf, wenn sie die Stimme eines fremden Menschen im Haus hörte. Und klingelte es an der Tür, zuckte sie zusammen, verkroch sich mit einer Puppe unters Bett und flüsterte: »Wird doch wohl der Bäcker sein! Wird doch wohl der Metzger sein!« Denn sie kannte den Bäckerjungen, sie kannte den Metzgerjungen, und die beiden würden nur die Ware abliefern und wieder gehen, weder Bäckerjunge noch Metzgerjunge, wusste Luise genau, kämen hinein ins Haus, zu ihr, die Treppen hoch. Weder Bäcker noch Metzger würden ihr etwas antun.
Luise besuchte die Städtische Studienanstalt und lernte dort Französisch, Latein und Griechisch. Im Deutschunterricht musste sie die deutschen Klassiker lesen, weil von ganz oben verordnet wurde, »Deutsche Art und Deutsches Wesen überall in den Vordergrund« zu stellen. Warum eigentlich?, fragte sich Luise Straus. Sie liebte das Hinterfragen von klein auf. Etwas als unumstößlich anzunehmen fiel ihr schwer. Luise dachte nicht nur gern, sie dachte auch schnell. Während die Mitschüler den Worten der Lehrer noch hinterherackerten, preschte Luise schon voraus. Das Räderwerk hinter ihrer Stirn ratterte pausenlos. Warum fehlt der Nacht die Farbe? Warum liegt in jedem Menschen noch etwas Gutes? Warum habe ich mehr Angst vorm Schutzmann als vorm Schwarzen Mann? Wie kann eine Straßenbahn fahren? Was bedeutet das Wort Blaustrumpf? Wie fühlt es sich an, wenn Geschlechtsteile sich ineinander verhaken? Warum erscheinen mir neun Zimmer für Eltern, Bruder, Schwester und Personal als zu viel, zwei Badezimmer dagegen als zu wenig? Warum finde ich nie etwas, wenn ich alles aufräume? Warum liebe ich das Chaos? Woher kommt die Unordnung? Warum werden Juden gehasst? Und von wem? Meine Eltern sind nicht richtig religiös, ich selber bin nicht richtig religiös, ich halte mich öfter in Kirchen auf als in Synagogen, ich liebe die Höhe des Doms und die Kühle im Innern, ich liebe den Duft nach Weihrauch und Ehrfurcht. Wenn man mich hasst, weil ich Jüdin bin, dann hasst man mich wegen einer Religion, die ich gar nicht richtig ausübe. Der Hass macht also keinen Unterschied zwischen Juden, die ihre Religion ausüben, und denen, die ihre Religion nicht ausüben. Dann aber ist klar: Man hasst uns nicht wegen unserer Religion. Weshalb denn dann? Was ist der Grund dafür? Liegt es wirklich an uns? Oder an denen, die uns hassen?
Rasch war klar, dass Luise studieren wollte, musste, würde. Vater Jacob ließ sie gewähren. Insgeheim war er stolz auf Luise, der alles so müheleicht zuflog und die gestochen scharf schreiben konnte, so scharf, dass der Vater, wenn er eine Arbeit von ihr las, mitunter die Luft durch die Lippen sog, als hätte er sich an ihren Worten geschnitten. Luise studierte Kunstgeschichte. Sie liebte es, stundenlang in Museen vor einem Bild zu stehen und jede Kleinigkeit einzuatmen. Die Farben nicht nur in ihrer Wirkung aufs Auge, sondern auch in ihrer Haptik. Wenn sich eine Nase auf der Leinwand zeigte, eine Unebenheit im Öl, fragte sie sich: Ist das vom Künstler mit Absicht gesetzt oder aus Unaufmerksamkeit entstanden? Und oft hätte sie gern einfach nur eine Hand aufs Bild gelegt. Aber das war verboten.
Ihre erste Liebe kam und ging schnell, ein Mann namens Karl Otten, ein alles zerpflückender, grübelnder Riese, dem Luise zwar atemlose Kuss- und Fummel-Attacken erlaubte, aber sonst nichts. Die studentische Liebelei zerbrach, als Karl beim Saccharin-Schmuggel erwischt und verhaftet wurde. Luise kam schnell über den Verlust hinweg, sie hatte freie Auswahl, zweihundertfünfundfünfzig Studentinnen verteilten sich auf viertausend Studenten. Viele der jungen Männer machten ihr Komplimente. Luise schaute sich die Sache eine Weile ohne große Hektik an. Und ihre Wahl fiel auf den jungen Max Ernst.
Im Seminarraum der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn setzte sich die bald zwanzigjährige Luise im Oktober 1913 neben den jungen Maler. Sie kannte ihn schon seit einem Jahr, wenn auch nur flüchtig. Luise blickte auf seine Hände: die Finger lang, aber weder dünn noch grob, weder zu fleischig noch zu hager, genau richtig, sanft und fein. Die Hände eines Mannes sind wichtiger als sein Gesicht, dachte Luise zeit ihres Lebens, denn Hände werden einen berühren irgendwann, und die Haut hat keine Augen, die man schließen kann.
»Darf ich?«, flüsterte sie.
Sein Kristallblick, eine Mischung aus Nähe und Ferne, aus Unbekümmertheit und Ironie, aus loser Abwesenheit und harter Konzentration, unerreichbar und zugewandt zugleich, unergründliche Gegensätze, aus denen eine kolossale Kraft sprang, dazu blonde Haare, der sportlich schlanke, wohl vom Schwimmen muskulöse Körper, die sehnig-gliedrige Gestalt, die dort hockte, als wäre sie stets auf dem Sprung. Max zeichnete etwas in seinen Block, ein bisschen verlegen, dachte Luise, und sie begutachtete auch sein Profil mit der geschwungenen Nase.
»Ein Stier?«, fragte sie und deutete auf das Blatt.
»Ein Vogel«, sagte Max.
»Sie sind doch Max, oder?«
»Ja. Max Ernst. Und Sie?«
»Luise.«
»Poch. Wie meine Mutter.«
Professor Albert Küppers betrat leicht gebeugt den Raum und begrüßte die paar Studenten, die sich in den Zeichenkurs verloren hatten, gerade mal zwanzig an der Zahl. Hinter ihm erschien eine junge Frau im Bademantel, die sich ohne weitere Erklärung auszog und nackt auf einen Stuhl setzte, während der Professor über die Schwierigkeiten des Aktzeichnens sprach.
Luise hockte reglos da. Ja, sie wollte einfach alles über Kunst erfahren. Aber selber zeichnen? Das konnte sie nicht besonders gut, eigentlich gar nicht. Einmal hatte sie in der Schule – kurz vor dem Abschluss – einen Baum zeichnen sollen, und nachdem sie zehn Minuten vor dem leeren Blatt gesessen hatte, malte sie in schönster Schrift Ich kann keinen Baum zeichnen aufs Papier, und die Worte wuchsen auf dem Blatt zu einem wolkenähnlichen Gebilde, das vage an einen Wipfel erinnerte. Ihr Lehrer hatte betrübt den Kopf geschüttelt und gesagt: »Fangen Sie bloß nicht an mit diesem neumodischen Kram!«
Und jetzt dieses Modell hier! Luise schluckte. Eine wunderschöne Frau, dachte sie, mit einem Körper und einem Gesicht zum Verlieben. Luise spickte auf den Block neben ihr. Max schien in seinem Element. Sein Stift flog wie ein flinker Dieb über den Block und stahl dem Blatt das Weiß. Aber Max schaute nicht hoch zum Modell. Kein einziges Mal. Sein Blick blieb auf dem eigenen Blatt. Für eine Weile sah Luise zu, wie Max aus dem Nichts einen Fluss schuf, einen Wald, einen Vogel, eine flatternde Käfigtür, ein Mondgebilde, Luise kam kaum mit, so schnell ging das, und sie liebte Schnelligkeit. Luise fragte sich, wann Max endlich beginnen würde, das Modell abzuzeichnen. Als er eine kurze Pause machte, stupste Luise ihn an. »Helfen Sie mir?«, fragte sie und deutete auf ihr leeres Blatt.
Seine rechte Hand wanderte sofort hinüber, ohne ein Wort, ohne Nicken. Mit wenigen Strichen warf Max die Konturen einer nackten Frau aufs Papier seiner Nachbarin. Auch jetzt beachtete Max das Modell überhaupt nicht.
»Wollen Sie gar nicht hinsehen?«, fragte Luise leise und deutete flüchtig in Richtung Frau. Max lächelte geheimnisvoll und tippte sich an die Stirn. Luise wusste nicht, was er damit sagen wollte: Spinnst du? Oder: Ich hab sie einmal gesehen, ihr Bild ist hier drinnen. Oder: Ich weiß, wie eine nackte Frau aussieht.