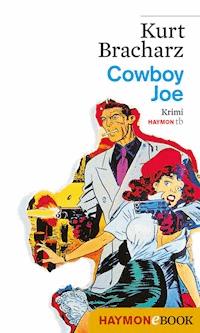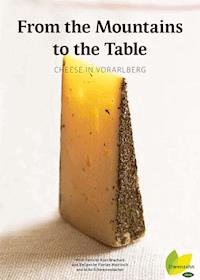Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Haben Sie schon einmal Köstlichkeiten wie Yakgulasch, Maschinrostbraten oder Ostertaube probiert und sich dazu ein Schlückchen "alten Landroten" gegönnt? Der begnadete Gastrosoph und Gastrokritiker Kurt Bracharz hat in seinem ganz persönlichen Appetit-Lexikon ein ABC von Wissenswertem, Nützlichem und Skurrilem rund um alle möglichen und unmöglichen Themen des Kochens, Essens und Genießens zusammengetragen. Aufklärerisch im besten Sinne ist diese kleine, alphabetisch geordnete Warenkunde und von unschätzbarem Nähr- und Mehrwert für jeden kulinarisch Interessierten. Nach seinem Lektüretagebuch "Für reife Leser" sprengt der Essayist, Kinderbuch- und Krimi-Autor erneut alle Gattungsgrenzen, plaudert munter, aber gehaltvoll drauf los und klärt im Vorbeigehen solch folgenschwere Missverständnisse auf wie jene, dass Sushi "roher Fisch" oder Carpaccio "dünn geschnitten" bedeute. Und worum es sich beim ominösen Bregenzerwälder Sig handelt, muss nun ebenso nicht länger ein Geheimnis bleiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HAYMONverlag
Kurt Bracharz
Mein Appetit-Lexikon
Eine Warenkunde für Genießer
© 2010
HAYMON verlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7457-5
Umschlag- und Buchgestaltung:
Kurt Höretzeder, Büro für Grafische Gestaltung, Scheffau/Tirol
Mitarbeit: Ines Graus
Coverfoto: Adolf Bereuter
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Vorwort
Vierzehn Jahre lang, von Januar 1995 bis Dezember 2008, schrieb ich für die Tageszeitung „Vorarlberger Nachrichten“ eine kulinarische Kolumne. Sie hieß „Hafaloab“, und ein solcher Hafaloab ist ein sehr lokales und frugales Nockerl aus Maisgrieß und Weizenmehl, das nichts mit Hafer zu tun hat, sondern in einem Hafen (Häfen, Kochtopf) gekocht wird. Der Name deutete an, dass ich mich vor allem mit der Alltagsküche beschäftigen wollte.
In der ersten Zeit schrieb ich hauptsächlich über Restaurants und Gasthäuser, wobei ich Beschreibungen den Vorzug gab und Bewertungen vermied, aber dann begann ich mich immer mehr für eine spezielle Art von Warenkunde zu interessieren, nämlich eine sozusagen aufklärerische. Erstens gab es da den schlichten Betrug, zum Beispiel, wenn Surimi auch dann noch teuer als „Krabbenfleisch“ verkauft wurde, als die Anbieter längst wissen mussten, dass es sich um gepresstes und aromatisiertes Fischfleisch handelte. Zweitens gibt es zum Beispiel immer noch den merkwürdigen Fall, dass Mini-Grünspargel aus französischem Anbau als „Wildspargel“ verkauft werden darf, obwohl es echten wilden Spargel im Süden ja tatsächlich gibt – nur ähnelt er dem gezüchteten Mini-Grünspargel in keiner Hinsicht. Neulich sah ich ihn in einem Haubenlokal sogar als „Hopfensprossen“ auf der Karte. Drittens gibt es allzu viele Missverständnisse wie jene, dass Sushi „roher Fisch“ bedeutet, Carpaccio „dünn geschnitten“ heißt oder das Ciabatta (zu Deutsch „Pantoffel“) irgendeine Form haben kann.
Bei Fischen und Pilzen hat mich immer interessiert, wie ihre zoologischen bzw. botanischen Namen lauten, um in der Fachliteratur Genaueres nachlesen zu können – den Butterfisch und den Enoki findet man zwar auf dem Wochenmarkt, aber nicht im Fisch- oder Pilzbestimmungsbuch, weil für den „geräucherten Butterfisch“ verschiedene Fischarten verwendet werden, während es sich beim japanischen Enoki um unseren Samtfußrübling handelt, den man auch im Wald sammeln könnte, statt ihn auf dem Markt zu kaufen.
Da viele Kolumnen solchen Detailfragen gewidmet waren, die auch ein gutes Stichwort für ein Lexikon hermachen, habe ich sie für das vorliegende Buch alphabetisch geordnet. Ein Lexikon im eigentlichen Sinne ist es nicht geworden, weil dafür doch Vollständigkeit anzustreben wäre, was aber nie meine Absicht war. Ein paar mögliche Stichwörter „fehlen“ gänzlich, obwohl die Lebensmittel, die sie bezeichnen, in meinem Alltag eine große Rolle spielen, zum Beispiel Banane, Ente oder Parmesan: Es hatte sich da eben nie ein Anlass ergeben, eine Kolumne zu verfassen. Andererseits schrieb ich fast immer nur über das, was mich selbst kulinarisch interessierte, deshalb gibt es einerseits ein paar Stichwörter über Abseitiges (wie Kormoranbraten, Pizzockel oder Quallensalat) und andererseits wenig über Gegrilltes, Limonaden und Süßspeisen, also das, was ich selbst nicht so gerne essen oder trinken mag. Deshalb heißt das Buch ja auch „Mein Appetit-Lexikon“.
Das zweite Wort des Titels ist ein Hinweis auf das „Appetitlexikon“ von Rudolf Habs und Leopold Rosner, das im 19. Jahrhundert erschienen ist und im 20. mehrmals neu aufgelegt wurde, weil es durch seinen feuilletonistischen Stil literarisch nicht veraltet. Der Text zum Stichwort „Schwein“ beispielsweise beginnt so: „Schwein, schon als Wappentier des heiligen Antonius allen Wohlgesinnten achtenswert und dazu denkwürdig durch die Tatsache, daß es bereits vor Erschaffung der Welt, so ums Jahr 5000 v. Chr. Geb., von den Chinesen gezähmt wurde, gehört ohne Widerrede zu den kostbarsten und unersetzlichsten Perlen in der Krone der Kultur. Nicht bloß verdienstvoll, sondern wie ein Prinz von Gottes Gnaden ganz und gar aus Verdiensten zusammengesetzt, schwitzt das Schwein greifbarsten Segen aus allen Poren.“
So witzig konnte ich in meiner Kolumne nur selten formulieren, ich hatte nicht den Platz dazu, und dann hätte das Publikum auch nicht ernst genommen, was ich doch Warenkundliches mitteilen wollte. Ich habe die Kolumnen mit ihrem Erscheinungsdatum in der Zeitung versehen. Dadurch wird deutlich, wie schnell sich in den letzten Jahren unsere Einstellung zu manchen Lebensmitteln verändert hat. In einigen Fällen habe ich „Updates“ hinzugefügt, die alle im Herbst 2009 geschrieben wurden.
Für drei Buchstaben hatte sich keine einzige Eintragung ergeben – für I eher zufällig, für X und Y aus dem bekannten Grund. Da ich das Alphabet vollständig haben wollte, habe ich in diesen drei Fällen jeweils ein im Herbst 2009 verfasstes Stichwort eingesetzt. Für I lag Ingwer nahe, beim Y entschied ich mich nach dem Verzehr eines Gulaschs aus Yakfleisch in der Bregenzer Gaststätte „Kornmesser“ gegen Yam, Yquem und Ysop, beim X fand ich in alten Büchern eine elegantere Lösung als xerophil, Ximenia oder XO.
Geografisch war der „Hafaloab“ in Vorarlberg, Süddeutschland und der Ostschweiz verankert, es ging also immer um Lebensmittel und Wirtshausgerichte, die man in diesem Umkreis bekommen konnte. Da der Viktualienmarkt in München und die Märkte in St. Gallen und Zürich dazugehören, gibt es kaum Einschränkungen, man kann in dieser Region Bottarga ebenso auftreiben wie Wagyu, Périgord-Trüffel wie Beluga, Maluns wie Milzwurst, japanischen Schattentee wie Jamaica Blue Mountain Kaffee. In den 1970er-Jahren gab es in Bregenz ein Feinkostgeschäft mit Schwalbennestersuppe, gerösteten Ameisen in Dosen und Périgord-Trüffeln. Ginsengwurzeln, Tausendjahreier, Quallen und Raupenpilze kaufe ich seit geraumer Zeit in einem chinesischen Supermarkt in der 13.000-Seelen-Nachbargemeinde Hard. Und wenn ich etwas Bizarres essen will, dann ist Bregenzerwälder Sig (oder G’sig) einer meiner Favoriten.
Wenn Ihnen das wenig bis nichts sagt: Das alles und noch viel mehr können Sie auf den folgenden Seiten nachschlagen.
Bregenz, Dezember 2009
A
Aale
Was wir Japan voraus haben
Auf dem Bregenzer Wochenmarkt gibt es manchmal frischen Aal, ein Fisch, der selten im Angebot ist, weil es viele Leute vor ihm graust und noch mehr nichts mit ihm anzufangen wissen. Dabei kann man Aale dünsten, kochen, backen, grillen oder räuchern.
Der Aal vom Markt ist tot und ausgenommen, aber immer noch sprichwörtlich glitschig. Ich bestreue ihn mit grobem Meersalz, nehme eine Doppellage Küchenpapier in eine Hand, umfasse mit der anderen den Fisch am Kopf und streife mit einer Bewegung den ganzen Aal entlang, dessen Haut danach völlig trocken ist. In vielen Rezepten heißt es dann, die Haut müsse abgezogen werden, man kann Aale aber durchaus mit der Haut zubereiten und diese erst beim Essen entfernen (was dann viel einfacher ist). Nur zum Beispiel für eine Aalpastete schneide ich hinter dem Kopf ringförmig die Haut auf und löse sie so weit, dass ich sie oben in der Mitte mit einer Flachzange fassen kann; dann lässt sich die ganze Haut mit einer einzigen Bewegung umgestülpt abziehen. Es gibt übrigens Kleider, Schuhe und Brieftaschen aus Aalleder.
Für „Aal grün“ brät man Aalstücke und Zwiebeln in Butter, gibt eine Handvoll frische gemischte Kräuter hinzu, gießt mit Weißwein auf und fügt nach zehn Minuten Simmern Eier, Sahne und Zitronensaft bei. Noch einfacher ist eine Matelote, in der die Aalstücke mit Lorbeer, Thymian, Knoblauch, Chili usw. in Rotwein geschmort werden.
Die größten Aalliebhaber weltweit, die Japaner, grillen den entgräteten, enthäuteten Aal im Ganzen und glasieren ihn dabei mit einer Tamari-Mirin-Zucker-Sauce. Bei uns könnte man Aalstücke in Zitronensaft, Öl und Gemüse marinieren und mit Küchengarn in Weinblätter verschnürt auf den Holzkohlengrill legen. Dabei hätten wir den japanischen Feinschmeckern einmal etwas voraus: Ihr Bedarf kann schon lange nur durch Zuchtaale gedeckt werden, unsere Aale sind noch Wildfänge mit wesentlich mehr Geschmack.
[24.7.2007]
Update
Der Aal war zwar „Fisch des Jahres 2009“, wurde aber auch in diesem Jahr nicht für koscher erklärt. Aale sind das Musterbeispiel für einen trejfenen Fisch, seit der frühere sephardische Oberrabbiner Israels, Rabbi Bakshi Doron, das Kaschrut-Problem hinsichtlich der Aale so zusammengefasst hat, dass alle Aalarten als trejfe gelten sollten, weil es viel mehr nichtkoschere Arten von Aalen gebe als koschere. Das ist deshalb interessant, weil die Juden durchaus bereit sind, für den Kaschrut wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Zum Beispiel wird der südafrikanische Kingklip (Genypterus capensis), der hinsichtlich Flossensaum und Winzigkeit seiner wenigen Schuppen große Ähnlichkeit mit dem Aal hat, seit 2007 als koscher betrachtet, nachdem ein Fischexperte seine Schuppen für Ctenoidschuppen erklärt hatte. Diese gehören nämlich zu den beiden koscheren Arten von Fischschuppen (die andere sind Cykloidschuppen), während Ganoidschuppen teilweise und Placoidschuppen immer trejfe sind. Der Kingklip sieht aber von der Kontur her eben doch mehr wie ein „richtiger Fisch“ als wie ein Aal aus, und die Schlangenähnlichkeit der Aale dürfte mehr zu ihrem Verbot beigetragen haben als die Schuppen-Spitzfindigkeiten.
Absinth
Die Rückkehr der „Grünen Fee“
Absinth ist wieder in Mode. Das grüne Getränk erfreut sich derzeit in London größter Beliebtheit bei Popstars und Medienleuten. Ein Rockmusiker namens John Moore (früher bei „Jesus and the Mary Chain“, jetzt bei „Black Box Recorder“) hatte 1992 mit seiner damaligen Band „Revolution 9“ in Prag gastiert und von einem Barmann kommentarlos ein großes Glas Absinth vorgesetzt bekommen, dessen Inhalt er kippte. Er fiel beinahe vom Stuhl, weil „Hill’s Absinth“ 70 % Alkoholgehalt hat, beschloss aber sofort, das Zeug nach England zu importieren. Das erwies sich als machbar, obwohl die „Grüne Fee“ (wie man das Wermutgetränk gern nennt) in nahezu allen Staaten Europas ebenso wie in den USA seit den zwanziger Jahren verboten ist. Die Begründung dafür lautet, dass der aus dem Wermut stammende Inhaltsstoff Thujon ein schweres Nervengift sei.
Moore gründete mit einigen bald gefundenen Mitstreitern eine Gesellschaft namens Green Bohemia und importierte also „Hill’s Absinth“, den seit 1920 von Radomil Hill aus dem Dorf Jindrichuv Hradec erzeugten Wermutlikör. Seit Berühmtheiten wie Damian Hirst sich damit öffentlich volllaufen ließen, wird Absinth in vierzig Londoner Bars serviert und sind in sechs Monaten 10.000 Flaschen über den Tresen gegangen.
Beim klassischen Absinth-Ritual gießt man kaltes Wasser über ein auf einen Absinthlöffel (ein flaches silbernes Sieb) gelegtes Zuckerstück in das Absinthglas. Nach 1870/71 war die „heure verte“, die grüne Stunde, zur Standardeinrichtung in Pariser Clubs, Cafés und Privatwohnungen geworden. Toulouse-Lautrec, Manet, Degas, Daumier, Raffaelli und Picasso haben Absinthtrinker oder -szenen dargestellt, van Gogh, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire und Jarry haben Absinth getrunken.
In Spanien und Portugal war Absinth nie verboten, Mampe produziert in Portugal einen farblosen 50 %igen „Absinto“, der freilich im Blindversuch von einem wässrigen Raki oder Ouzo kaum zu unterscheiden ist. Im Schweizer Jura kann man unter der Hand ohne große Umstände Absinth von ähnlicher Qualität kriegen. Dort wurde vor Jahren in einem Lokalparlament der Antrag, Absinth wieder zu legalisieren, mit der Bemerkung abgeschmettert, dann kaufe ihn doch kein einziger Tourist mehr. Wirklich bemerkenswert sind hingegen die nordafrikanischen Varianten der grünen Fee in Tunesien, Algerien oder Marokko, die man freilich nur in den Ursprungsländern versuchen kann, weil der Zoll sie einem wegnimmt, wenn man sie als Souvenir mitnehmen will. Sie enthalten möglicherweise auch noch andere Kräuter als die üblichen (nämlich Anis, Fenchel, Zitronenmelisse, Engelwurz, Kretischer Diptam, Ehrenpreis, Ysop, Wacholder, Muskat, Sternanis und eben Wermut) sowie Spanische Fliege. Und dagegen haben eben nicht nur die Mullahs etwas.
[26.8.1999]
Feenreigen im MQ
Im August 1905 erschoss ein 31-jähriger Schweizer Landarbeiter namens Jean Lanfray mit seinem alten Armeegewehr zuerst seine schwangere Frau, danach seine beiden kleinen Töchter (zwei und vier Jahre alt), scheiterte dann beim Versuch, sich selbst zu töten, und schlief, die Arme um den Leichnam seiner Frau geschlungen, ein. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf diese Familientragödie im Jura war außergewöhnlich: Binnen weniger Wochen unterschrieben 82.450 Personen eine Petition, dass das alkoholische Getränk Absinth verboten werden solle, was 1906 in der Schweiz auch geschah. Die meisten Staaten Europas folgten dem Schweizer Beispiel in den nächsten Jahren. Jean Lanfray hatte am Vortag (!) der Mordtat zwei Gläser Absinth getrunken, und alle waren sich einig, dass dieses Getränk die Wahnsinnstat ausgelöst habe. Aus heutiger Sicht ist daran allerdings bemerkenswert, dass Lanfray ein notorischer Alkoholiker war, der täglich bis zu fünf Liter Wein trank und laut Polizeiprotokoll am Vortag des Verbrechens außer den beiden Gläsern Absinth am Morgen der Reihe nach Crème de menthe, Cognac, sechs Gläser Wein zum Mittagessen, ein Glas Wein und einen Kaffee mit Schnaps während der Nachmittagsarbeit, einen Liter Wein auf dem Heimweg und einen Kaffee mit Tresterbrand daheim getrunken hatte. Aber der Absinth hatte damals schon einen solchen Ruf als Mörderdroge, dass offenbar niemand bezweifelte, dass diese zwei Gläser die Hauptschuld an dem Verbrechen trugen.
Bei einer Vernissage von Paul Renner und Gottfried Bechtold im Wiener MuseumsQuartier (MQ) gab es Absinth zu trinken; von darauf folgenden Ausschreitungen und Dramen ist nichts bekannt. Das lag wohl nicht nur daran, dass das von Renner aus einem französischen Absinth- Museum herbeigeschaffte Getränk so schmeckte wie alle Absinthe, die ich bislang probiert habe, nämlich wie Raki, Ouzo oder Pernod, so dass man also vom Geschmackserlebnis her kaum nach einem zweiten oder gar dritten Glas verlangt. „The Dedalus Book of Absinthe“ von Phil Baker unterscheidet zwei Geschmacksrichtungen bei den jetzt erhältlichen Marken: die im französisch-spanischen Stil, die grünlich sind, sich trüben, wenn man Wasser hineingießt, und wie Pernod schmecken, und die osteuropäischen (vor allem die böhmischen), die bläulich schimmern, sich nicht trüben und wie Fensterputzmittel schmecken (laut Baker; mir fehlt die Vergleichsbasis, weil ich bisher einen Bogen um Drinks auf Fensterputzmittelbasis gemacht habe). Bakers bestbewerteter Absinth ist der, den Renner kredenzen ließ: „La Fée“ von „Mrs. Absinth“ persönlich, also von Marie-Claude Delahaye, der Direktorin des Absinth-Museums. Da „La Fée“ stolze 68 Volumprozent Alkohol enthält, die auch in Eis, Wasser und anderen Zusätzen (Zitrone) nicht völlig untergehen, ist es schwer zu sagen, was nun Alkoholwirkung ist und was vom Thujon aus der Wermutpflanze kommen soll. Was Renner nicht wusste: Er hätte auch in Wien einen lokalen Absinth auftreiben können, im Schnapsmuseum wird einer mit viel Thujon und ohne Aniszusatz gebraut, der allerdings vom Geschmack her nicht mit „La Fée“ zu vergleichen ist.
[7.3.2002]
Apropos Absinth
Ein deutscher Spirituosenhändler sagte mir neulich, die Hauptnachfrage nach Absinth käme von „Kiddies“, die er aus dem Laden scheuchen müsse, weil er ihnen keinen Alkohol verkaufen dürfe und schon gar keinen mit 60 Volumprozent. Aber Absinth steht mittlerweile auch im Supermarkt im Schnapsregal, seine Beschaffung wird auch Jugendlichen gelingen. Sie mixen ihn am liebsten mit „Red Bull“, das Ergebnis heißt „Rote Fee“ (der Absinth selbst ist ja als „Grüne Fee“ bekannt) und bringt alles zusammen, was man dem Stoffwechsel höchstens unvermischt zumuten kann, viel Alkohol, eine Menge Zucker, das im Ingrediens Wermut enthaltene Nervengift Thujon und die Aufputschmittel Taurin und Coffein. „Klassisch“ ist dabei nur die Verwendung von Zucker. Da der um die Jahrhundertwende übliche Absinth sehr bitter schmeckte, träufelte man ihn über ein auf den durchlöcherten Absinthlöffel gelegtes Stück Würfelzucker in ein Glas Wasser. Das Wasser verfärbte sich dann milchig, wie man es auch von Pernod oder Ouzo kennt. Verändert hat sich allerdings der springende Punkt der ganzen Absinth-Angelegenheit, das Thujon. Man schätzt, dass die Absinthe vor 100 Jahren es in Dosierungen von 60 bis maximal 260 Milligramm pro Liter enthielten, und der Schnitt etwa bei 100 Milligramm lag. In der EU sind derzeit zehn Milligramm Thujon pro Liter bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von über 25 Prozent erlaubt. Ein Schnapsglas voll „Grüner Fee“ enthält etwa 0,4 Milligramm des giftigen Stoffes, der allerdings kumulativ wirken soll, so dass nach geraumer Zeit fortgesetzten Genusses dieselbe Wirkung einsetzt wie bei einer großen Ration. Vielleicht nannte Hildegard von Bingen deshalb den Wermut den „wichtigsten Meister gegen alle Erschöpfungen“. Der Ethnopharmakologe Christian Rätsch wies 1996 auf eine weitere Wirkung hin: „So köstlich der Rausch am Abend war, so schmerzvoll ist der Kopf leider am nächsten Morgen. Ich hatte niemals zuvor einen derart brutalen Kater.“ Er empfiehlt deshalb, Wermutkraut lieber zu rauchen.
Mittlerweile sind schon über 35 Absinthmarken auf dem Markt, die vom Alkoholgehalt (bis zu 70 %!) über den Thujongehalt (manche erwiesen sich bei Tests als völlig thujonfrei) bis hin zur Farbe erheblich differieren. Die nach französischer Tradition erzeugten Absinthe schmecken nach Anis, sind gelb-grünlich und färben das Wasser milchig, die anderen schmecken nach Pfefferminz, sind meistens bläulich und färben das Wasser nicht. Was den Geschmack des Modegetränks insgesamt betrifft, kann man im Großen und Ganzen einem deutschen Tester zustimmen, dessen Fazit lautete: „Abgesehen von den typischen fuseligen Alkoholwirkungen ist mir persönlich bei verschiedenen Absinthproben nichts Interessantes oder Angenehmes aufgefallen. Rein geschmacklich liegt man meines Erachtens mit den entschärften Traditionsgetränken Pernod und Ricard immer noch Meilen vor den meisten der neuen spanischen, tschechischen, schweizer, deutschen oder britischen Absinthe. Aber allein der Name auf dem Flaschenetikett scheint bei manch einem (bezahlten?) Testtrinker schon Halluzinationen auszulösen und ihn in Oden an die Grüne Fee ausbrechen zu lassen.“
[30.5.2002]
Die grüne Fee, ganz in Rot
Wenn sich die Nebel von Märchen, Mythen und Marketing für einen Augenblick lichten, erkennt man, dass Absinth eigentlich ein Schweizer Kräuterbitter ist, dessen Hauptbestandteil (neben bis zu 70 % Alkohol) Wermut tatsächlich magenberuhigende Wirkungen hat. Die weiteren Kräuterzusätze können dem Absinth eine Raffinesse verleihen, die ihn auch vom Geschmack her als Getränk interessant macht.
Allerdings nur im günstigen Falle der korrekten Destillation. Da das Wort „Absinth“ nicht geschützt ist (die Schweizer arbeiten an einem Rechtsschutz für den authentischen Absinth aus dem Jura), kann man auch statt mühsamem Destillieren einfach Wermutessenz und andere Fertigprodukte mit Alkohol verrühren und das Ergebnis als Absinth verkaufen. Offensichtlich tun das manche, denn unter den über 100 Absinthmarken, die derzeit – zum Teil nur im Internet – auf dem Markt sind, sind gar nicht so wenige, die man nicht einmal zum Einreiben der Füße verwenden mag.
Da Absinth nach Wodka und Tequila die drittliebste Spirituose deutscher Jugendlicher ist, handelt es sich bei den miesen Qualitäten nicht um ein ganz bedeutungsloses Randproblem. Um das Nervengift Thujon aus der Wermutpflanze geht es dabei allerdings kaum, Tests haben gezeigt, dass viele Produkte, die mit hohem Thujongehalt werben, in Wirklichkeit einen sehr geringen haben, also diesbezüglich harmlos sind.
Die beste Methode, guten von schlechtem Absinth unterscheiden zu lernen, ist, guten zu trinken. Solchen aus dem Val de Travers, wo der Absinth herkommt und man bewusst die Tradition hochhält. Oder den bei der „Spirit 2006“ mit Gold prämierten Absinthe Duplais (72 Volumprozent) der Matter-Luginbühl AG in Kallnach. In Vorarlberg die Lustenauer „Rote Fee“ (55 Volumprozent), die ihren Namen zwar dem Zusatz einer Lebensmittelfarbe verdankt, geschmacklich aber mit den Schweizern mithalten kann. Man erhält sie in der Galerie K12 in der Bregenzer Kirchstraße.
[15.1.2008]
Update
Der Absinth ist zwar in Frankreich berühmt geworden, aber eigentlich ist er ein Schweizer. Zu den vielen, die das nicht wussten oder bedachten, gehörte offensichtlich Orson Welles, der als Harry Lime in „Der dritte Mann“ anscheinend erst bei den Dreharbeiten eine später oft zitierte Stelle in den Dialog einfügte: „In Italien unter den Borgias, da hatten sie dreißig Jahre lang Krieg, Terror, Mord und Blutvergießen, aber sie brachten Michelangelo hervor, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz, da hatten sie Bruderliebe, hatten fünfhundert Jahre lang Demokratie und Frieden. Und was hat das hervorgebracht? Die Kuckucksuhr.“
Das „Guggerzytli“ heißt zwar auf Französisch „coucou suisse“, stammt aber trotzdem unzweifelhaft aus dem deutschen Schwarzwald. Der Absinth hingegen kommt aus dem Val de Travers im schweizerischen Jura, hätte aber Welles nicht in die Argumentation gepasst, weil er jahrzehntelang mit Krieg, Mord und Blutvergießen in Zusammenhang gebracht wurde.
Zum Beispiel in Alexandre Dumas’ „Grand dictionnaire de cuisine“ (1872), wo man unter dem Stichwort „Absinth“ unter anderem erfährt: „Obwohl man in den Pflegeanstalten für arme Leute viel vom Absinthlikör hält und ihn als Magenstärker und Verdauungsförderer einsetzt und die Salerno-Schule ihn als Vorbeugung gegen Seekrankheit empfiehlt, kann man nicht umhin, die furchtbaren Schäden zu beklagen, die der Absinth seit vierzig Jahren bei unseren Soldaten und unseren Dichtern angerichtet hat, und es gibt keinen Regimentsarzt, der nicht bestätigen würde, dass der Absinth in Afrika mehr Franzosen umgebracht hat als die Flitta, der Yatagan oder das arabische Gewehr.“
Dumas nennt auch gleich ein paar berühmte Absinthisten beim Namen: „Von unseren Bohémien-Dichtern wird Absinth die grüne Muse genannt und viele, leider nicht die schlechtesten, starben in ihren giftigen Armen. Hégésippe Moreau, Amédée Roland, Alfred de Musset, unser größter Dichter nach Victor Hugo und Lamartine, alle diese sind der zerstörerischen Wirkung dieses Likörs zum Opfer gefallen.“ Über Musset lässt sich Dumas noch weiter aus, bevor er ein Rezept für eine „Crème d’absinthe au candi“ angibt, damit auch seine Leser ihre Nerven zerrütten können.
Die in diesem Zusammenhang notorischen Maler kommen in seinem kulinarischen Wörterbuch noch nicht vor. Alexandre Dumas starb 1870, die Absinthwelle in Frankreich schwoll in den darauffolgenden Jahrzehnten bis zur staatlichen Kontingentierung 1815 und dem schließlichen Verbot noch stark an. „Der Absinthtrinker“ von Édouard Manet wurde zwar schon 1859 ausgestellt, aber das Bild „Die Absinthtrinker“ von Jean-François Raffaelli wurde erst 1881 gezeigt, Henri de Toulouse-Lautrecs „Absinthtrinker“ 1888, sein Pastell, das Vincent van Gogh vor einem Glas Absinth zeigt, 1887, sein „Monsieur Boileau im Café“ 1893. Van Gogh, der von Toulouse-Lautrec 1886 in Paris in den Absinthgebrauch eingeführt worden war, verfertigte 1888 ein Stillleben mit Absinthglas und Karaffe, und sowohl er als auch Paul Gauguin malten 1888 Bilder des Nachtcafés in Arles. Edvard Munch zeichnete 1890 Absinthtrinker, Picasso malte 1901 eine „Frau beim Absinthtrinken“. Die Liste ließe sich noch erheblich verlängern.
Jahrzehntelang galt Vincent van Gogh als das prototypische Absinthopfer. Seine Exzentrizitäten, von den immer wieder auftretenden „psychotischen Symptomen“ über die berüchtigte Angelegenheit mit dem Ohr bis zum Suizid, fanden damit die scheinbar einfachste Erklärung, und seine Bevorzugung der Farbe Gelb passte zumindest sprachlich gut zur grünen Fee. Seit der Studie „Vincent van Gogh – Chemicals, Crises and Creativity“ (Boston 1992) des australischen Biochemikers und Molekularbiologen Wilfred Niels Arnold wäre es aber wohl ein laienpsychiatrischer Kunstfehler, weiterhin zu glauben, van Goghs Absinthkonsum sei eine bessere Erklärung für sein Verhalten (und das seines Bruders Theo) als die AIP, die akute intermittierende Porphyrie, eine seltene Stoffwechselkrankheit, die ein Jahr vor Vincent van Goghs Tod zum ersten Mal beschrieben wurde, also seinen Ärzten nicht einmal als Konzept bekannt sein konnte.
Sonst gibt es auch noch die Theorie, dass es eigentlich Gauguin war, der van Gogh am Ohr verletzte (es war ja tatsächlich nur das Ohrläppchen abgetrennt worden).
In Baz Luhrmanns Film „Moulin Rouge“ erscheint die grüne Fee höchstpersönlich dem Trinker, als Ewan McGregor zum ersten Mal Absinth probiert. Kylie Minogue erinnert in dieser Szene allerdings eher an die Elfe in Walt Disneys „Peter Pan“ als an eine Absinth-Vision, sie schwebt umher, verstreut Feenstaub (!) und singt ein Liedchen. Zuletzt werden plötzlich ihre Augen rot und der Gesang geht in einen Schrei über; dieser Schrei wurde aber nicht von Minogue, sondern von „Black Sabbath“-Sänger Ozzy Osbourne ausgestoßen.
Adzukibohnen
Süße Bohnen mit Winterhimmel
In Asia-Läden vergewissert sich das Personal manchmal, ob ich auch wirklich weiß, was ich kaufe. Bei Tausendjahreiern oder Schwalbennestern wundert mich das nicht, bei den Süßigkeiten aus Adzukibohnen aber schon. Die kommen mir nicht exotisch vor, scheinen aber von Nicht-Japanern wenig geschätzt zu werden.
Die rote oder schwarze, nähr- und ballaststoffreiche Adzuki oder Azuki (Vigna angularis) ist in Japan die wichtigste Bohne nach der Sojabohne und findet vielseitige Verwendung, vom Sprossengemüse über die Bohnensuppe bis zum Teig und als Reisbeilage. Und sie wird gerne zu Süßspeisen verarbeitet.
Die Japaner kandieren übrigens auch Saubohnen, aber die Rote-Bohnen-Paste ist viel typischer. Man gart dazu die über Nacht eingeweichten Adzuki sechs Stunden lang immer knapp unter dem Siedepunkt und muss darauf achten, dass das Wasser die Bohnen im zugedeckten Topf stets bedeckt. Danach gibt man braunen Zucker (350 g auf ein halbes Kilo Bohnen) und etwas Puderzucker zu den abgegossenen Adzuki und lässt diese Mischung noch eine halbe Stunde bei schwacher Hitze ziehen. Dann wird püriert und durch ein Sieb gedrückt. Diese Paste wird kalt mit einem Grünteesorbet serviert.
Einfacher ist es natürlich, man kauft im Geschäft eine Dose Bohnenpaste (Yude Azuki) oder eine Packung Mini Youkan, kleine weiche Quader mit einer Konsistenz ungefähr wie Quittenkäse, deren Zutatenliste lautet: Zucker, süßes Bohnenmus, sirupartige Bonbonmasse, Winterhimmel, Weichgekochte, Sorbitol, Grüner Pulvertee, Gardenie Farbstoff. Die Packung, deren Zettel ich gerade abgeschrieben habe, enthält grün, braun und blau gekennzeichnete, einzeln verpackte Stückchen. Grün wird Tee sein (es sind auch stilisierte Teezweige aufgedruckt), braun vielleicht Gardenie (aber da sind Baumblätter drauf), und blau der „Winterhimmel“ (mit der Andeutung einer Landschaft – oder Wellen?), was auch immer damit gemeint ist.
[8.8.2006]
Aflatoxine
Das tägliche Risiko
Eine „unsichtbare Gefahr“ ortete eine Titelgeschichte des Schweizer Konsumentenmagazins „Saldo“ im Essen: die geruch-, farb- und geschmacklosen Aflatoxine, die auch durch Hitze nicht zerstört werden. Es handelt sich dabei um die Stoffwechselprodukte des Schimmelpilzes Aspergillus flavus, eines Köpfchenschimmels, der vor allem unter tropischen Bedingungen auf Getreide, Mais, Nüssen und Paprikaschoten gedeiht, aber natürlich auch bei uns, wenn es genügend warm und feucht ist. Der Test in dem Magazin spürte Aflatoxine dort auf, wo viele Konsumenten sie vielleicht nicht vermutet hätten, nämlich in 8 von 15 Proben von Gewürzen wie Paprika, Chili und Muskatnuss. In die Zeitung gelangen Aflatoxine sonst ja meist in Zusammenhang mit anderen Lebensmitteln, zum Beispiel, als im Herbst 2000 vom St. Galler Kantonslabor 13.000 Kilo Feigen beschlagnahmt wurden. Das deutsche Bundesamt für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin rät seit Jahren generell von Verzehr von Pistazien ab. (Liebhaber von Pistazieneis müssen sich deshalb wenig Sorgen machen, es wird in den meisten Fällen nicht wirklich aus Pistazien erzeugt.) Wohl am bekanntesten ist die Anfälligkeit von Erdnüssen für den Pilz, vor allem, weil auch schon in der deutschen Milch Aflatoxine gefunden wurden, wenn zuvor Erdnussschrot an die Kühe verfüttert worden war.
Entdeckt wurde die extreme Giftigkeit von Aflatoxinen schon in den sechziger Jahren in Großbritannien, als Tausende mit Erdnussmehl gefütterte Truthähne an Lebererkrankungen eingingen. Bei Experimenten mit Ratten bekommen weit über 90 Prozent dieser Tiere Leberkrebs, wenn man ihnen Aflatoxin-belastetes Futter gibt. „Saldo“ schreibt, dass auch bei Menschen in Kenya, Thailand oder Moçambique, wo viele Lebensmittel mit Aflatoxinen belastet sind, Leberkrebs häufiger auftrete als anderswo. An der Giftigkeit von Aflatoxinen besteht also kein Zweifel. Aber wie kann man sich vor einem so verbreiteten und mit den Sinnen nicht wahrnehmbaren Gift, das auch beim Kochen nicht abgebaut wird, schützen? Zunächst bleibt einem nichts anderes übrig, als auf die Hersteller und den Gesetzgeber und seine Kontrollorgane zu vertrauen, die ja alle das Problem kennen. Bei Gewürzen gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit, weil etwa Muskatnusspulver, Chilis oder Paprikapulver ja meist nur in sehr geringen Dosen verwendet werden und auch dann nicht verschimmelt schmecken, wenn sie es sind. Bei größeren Objekten wie Erdnüssen, Haselnüssen oder Mandeln kann man zwar beim Verzehr die Aflatoxine nicht schmecken, wohl aber andere Stoffwechselprodukte der Schimmelpilze (wenn man nicht ohnehin die Pilzfäden sieht). Bei Nussstückchen in Schokoladen, Kuchen, Riegeln usw. bleibt nur das Vertrauen auf die Hersteller, die normalerweise strengstens kontrollieren. Was das eigene Gewürzregal betrifft, sollte man vor allem eine Unsitte bleiben lassen, nämlich zum Beispiel das Glas mit dem Muskatnusspulver über der heißen Suppe zu stippen und es dann zurückzustellen. Dabei wird ja ganz sicher die oberste Pulverschicht im Glas feucht.
[6.9.2001]
Angostura
Dr. Siegerts Elixier
Angeblich kennen auf der ganzen Welt nur fünf Menschen die Rezeptur für Angostura und haben den Schlüssel zum Secret Room, dem Lagerraum für die Zutaten im Firmensitz House of Angostura in Port of Spain auf Trinidad; und nicht einmal zwei von ihnen dürfen in dasselbe Auto steigen oder gleichzeitig dasselbe Flugzeug benützen. Das Rezept liegt auch noch in einem Safe, ist aber verschlüsselt (wie viele Personen den Schlüssel kennen, wird nirgendwo erwähnt). Angeblich wissen auch weder der Zoll (in Trinidad ist das vorstellbar) noch die Manager der Firma, woher die Zutaten kommen bzw. welche Pflanzen und Pflanzenbestandteile im Secret Room sind, alle eingehenden Lieferungen sind codiert. Besucher berichten, es röche im House of Angostura meist nach Gewürznelken und Muskat. Die Fabrik ist abgesichert wie ein Hoch- sicherheitsgefängnis, mit Wächtern, Zäunen, Kameras, schusssicherem Glas. Man könnte meinen, Angostura sei mehr als eine beiläufige Zutat zu einer Serie von klassischen Cocktails.
Ursprünglich war der „Bitter“ ja auch mehr. Ein in Berlin ausgebildeter Arzt namens Johann G. B. Siegert führte 1824 ein Militärspital für die Truppen von Simón Bolívar, dem General, nach dem Bolivien benannt ist. Die Truppe litt unter heftigen Magenkrämpfen. Dr. Siegert werkelte vier Jahre an einem Tonikum herum, das diese Magenkrämpfe beseitigen sollte, und mixte ein Gebräu aus Rinden, tropischen Kräutern, Alkohol und Wasser zusammen, das die Mägen der Soldaten tatsächlich zu beruhigen schien. Zunächst hieß das Elixier „Dr. Siegert’s Aromatic Bitters“, aber als er später eine Privatpraxis in Angostura, einer Stadt am Orinoco, die heute Ciudad Bolívar heißt, eröffnete, benannte er es auf „Angostura Aromatic Bitters“ um, und so steht es jetzt noch auf dem Papier, das um die braune Flasche mit dem gelben Plastikverschluss gewickelt ist und den Angostura so unverkennbar macht. Siegert teilte vor seinem Tod im Jahre 1870 seinen Söhnen Carlos und Alfredo die Geheimformel mit, die 1875 von Venezuela nach Trinidad übersiedelten. Sie stürzten sich dort ins Geschäft mit Rum und ihre Nachfahren blieben bis 1990 im Geschäft mit Angostura Aromatic Bitters, als Siegerts Ur-Ur-Enkel Gordon sich auf das Altenteil zurückzog. Die Angostura Ltd. produziert außer Angostura auch Rum (Old Oak und Royal Oak) und Saucen.
Die geheimnisvollen Bestandteile (deren Anzahl auf etwas über vierzig geschätzt wird) werden in Alkohol etwa 20 Stunden mazeriert, danach mit Zucker und „Extrakten“ (woraus auch immer) gemischt und in großen Stahltanks einige Wochen lang gelagert. Anschließend wird mit Wasser verdünnt und in die Flaschen abgefüllt. „Angostura Bitters“ mit seinen 45 Volumprozent wird an sich nicht pur getrunken, feine Zungen glauben aber bei solchen gelegentlichen Versuchen neben den schon erwähnten Nelken und Macis noch Orangenschalen herauszuschmecken. Meine weniger feine Zunge kann da nicht mithalten, der extreme Geschmack nach Gewürznelken übertönt für mich alles andere (und erinnert an den Einsatz von Nelkenöl beim Zahnarzt). Ein Spritzer gehört jedenfalls in jeden Manhattan oder Old Fashioned, aber für raffiniertere Gaumen auch aufs Speiseeis.
[28.3.2002]
Apfel
Die ultimative Superfrucht
Als ich letzthin über die Goji-Beeren schrieb, stellte ich beim Googeln fest, dass ein Buch über diese Frucht des Chinesischen Bocksdorns den Untertitel „Die ultimative Superfrucht“ trägt. Interessant ist das nur, weil ich in den Tagen zuvor in Buchhandlungen in zwei anderen Büchern geblättert hatte, die zwar nicht exakt so heißen, deren Klappentexte aber sinngemäß dasselbe versprechen; hier handelt es sich bei der ultimativen Superfrucht allerdings um Granatapfel bzw. Mangostane. Und es ist ja noch nicht lange her, dass man uns Noni als die ultimative Superfrucht einreden wollte. Davor Acerola. Davor …
Es handelt sich dabei meistens um den Versuch der Markteinführung noch wenig bekannter Früchte. Man schaltet keine Werbung, weil sich das noch nicht lohnen würde, sondern lässt Artikel in Zeitschriften erscheinen (ein paar Seiten weiter hinten steht dann allerdings stets doch das Inserat zum Beispiel für den Granatapfelsaft, um dessen Verkauf es eigentlich geht; manche Erzeuger, die befürchten, der Leser übersähe die Anzeige, lassen sie aber auch gleich neben den „recherchierten Artikel“ drucken) oder bringt eine wissenschaftlich daherkommende Broschüre in den Buchhandel. Die Argumente sind immer dieselben, ein hoher Vitamin C-Gehalt (wobei die meisten Konsumenten täglich so viel Vitamin C aufnehmen, dass sie es größtenteils gleich wieder ausscheiden), andere Vitamine, die man auch nicht zusätzlich braucht, Mineralstoffe, die, so allgemein ausgedrückt, in allem Essbaren enthalten sind, manchmal auch Enzyme (in Ananas, Papaya, Mango), die angeblich die Verdauung fördern oder sonst wie sensationell im Stoffwechsel wirkten, wenn sie nicht von der Magensäure zerstört würden.
Unsere Vorfahren kannten ohne merkantilen Hintergrund auch schon eine ultimative Superfrucht, den Apfel. Die Briten brachten diese Erkenntnis auf die bekannte Formel „An apple a day keeps the doctor away“.
[23.9.2008]
Arganöl
Arganien und Ziegen
Migros bietet neuerdings Arganöl an, für gute Qualität spricht der Preis (14,80 Franken für 1 dl). Da das schwer zu gewinnende Öl selbst in seiner Heimat Marokko um die 20 Euro pro Viertelliter kostet, kann viel billigere Ware bei uns nicht unverschnitten sein.
„Saisonküche“ brachte dazu einen Artikel, in dem mir ein Satz auffiel: „Dass die Berber ihre Ziegen als Erntehelfer in die Baumkronen schicken und anschließend die Nüsse aus dem Ziegenkot lesen, ist allerdings eine zählebige Anekdote.“
Da ich diese Geschichte kannte und bislang nicht unbedingt für ein Märchen gehalten hatte, blätterte ich in Bibliothek und Internet. Ein Foto mit Ziegen auf einer Arganie in einem Marokko-Bildband besagt ja nicht mehr, als dass Ziegen freiwillig auf die Bäume steigen und die Früchte fressen. Von Hand pflücken geht wegen der Stacheln an den Zweigen kaum und Herabschlagen ist wie bei Oliven schwer qualitätsmindernd. Dass also niemand die extrem harten „Nüsse“ (in denen die ölhaltigen Samen eingeschlossen sind) aus dem Ziegenkot herausklaubt, kommt mir unwahrscheinlich vor. Dem Endkunden in der hygienehysterischen EU würde man das wohl nicht auf die Nase binden.
Im Internet schreibt Dr. Rachida Nouaim: „Es sind eigentlich alte Niederschriften von Reisenden, die Einzelfälle verallgemeinert haben, die das Gerücht verbreiten. Das Arganöl, das aus den Kernen, die den Verdauungstrakt einer Ziege passiert haben, gewonnen wird, hält sich nicht lange, hat einen typischen Geruch und schmeckt nicht gut.“
Da frage ich mich aber doch: Wenn es solches Öl ja eigentlich gar nicht gibt, woher weiß Dr. Nouaim dann, wie es schmeckt?
Zur Klarstellung: Ich glaube nicht, dass die Kerne für das heute teilweise maschinell erzeugte, für den Export bestimmte Arganöl durch Berberziegendärme gegangen sind; aber früher, bei Handarbeit und für den Eigenbedarf, ob’s da wirklich nur eine „zählebige Anekdote“ war?
[12.12.2006]
Asia-Suppen
Kunstschwein und Glutamat
Asiatische Tütensuppen sind Fastest Food für den Hausgebrauch. Die Zubereitung dauert die Kochzeit des Wassers plus zwei oder drei Minuten, dann hat man eine Schale warme Nudeln in einer mehr oder minder „asiatisch“ schmeckenden Suppe. Wenn es das ist, was man haben will, also einen warmen Schnellimbiss, der einfach zuzubereiten ist, liegt man damit richtig. Der Nährwert ist minimal, aber als Diät empfehlen sich Tütensuppen nicht, weil die meisten jede Menge Salz, Glutamat, Geschmacksverstärker und gehärtete Pflanzenfette enthalten. Überhaupt sind Rind, Huhn, Schwein, Pilze oder Garnelen zwar auf den Verpackungen abgebildet, aber in den meisten Produkten nicht einmal in Spuren enthalten, die Aromen sind vollkommen künstlich. Die Zutatenliste der japanischen „Demae Ramen“ von Nissin mit Meeresfrüchte-Geschmack beispielsweise enthält kein einziges Meerestier, die koreanische „Shin Ramyun“ von Nong Shim („beefy and spicy“) immerhin ein wenig Rindfleischextraktpulver, die thailändische „Mama Oriental Style Noodles Pork Flavour“ kann auch von Vegetariern gegessen werden, denn ihr Bestandteil „Schweinefleischaroma“ stammt garantiert nicht von echten Schweinen.
Auch die Nudeln sind auf besondere Art produziert, damit sie in drei Minuten fertig sein können. Die meisten sind vorgebraten, weil das ihr „Mundgefühl“ fördert. Die Nudeln der oben erwähnten „Demae Ramen“ enthalten unter anderem drei „Mehlbehandlungsmittel“ (E501, E500, E452).
Es gibt aber auch Ausnahmen von der Regel, dass Tütensuppen komplett künstlich sind: „Ramen Shiitake“ von der holländischen Firma Terrasana enthält nur Bioprodukte wie Weizenvollkornmehl, Vollreismehl, roten und weißen Miso, Meersalz, Soja, getrocknetes Gemüse und Shiitake. Allerdings müssen diese Nudeln sieben Minuten lang kochen und die Packung (für einen halben Liter Wasser) kostet nicht wie andere zwischen 50 Cent und einem Euro, sondern drei Euro.
[11.7.2006]
Austern
Ihr Anteil am Ozean
Die Regel, Austern und andere Muscheln nur in den Monaten mit einem „r“ zu verzehren, hat historische Gründe. Heute wäre die Kühlung auch im Sommer kein Problem mehr, die Hochsaison für Austern ist aber nach wie vor um Weihnachten herum. Mit dem Preis hat das nichts zu tun, denn Austern sind nicht sehr teuer, und mehr als sechs isst bei uns kaum jemand. Manche fürchten sich dabei vor einem Eiweißschock, während beispielsweise Casanova bis zu 50 Stück verzehrte und Ludwig XIV. am Tag seiner Hochzeit 400 Austern vertilgt haben soll (worin sich möglicherweise weniger sein Gusto als vielmehr sein Glaube an die Kraft der Muschel als Aphrodisiakum widerspiegelte).
Eine richtige Austernbar gibt es hierzulande natürlich nicht, aber bei „Nordsee“ im Dornbirner Messepark kann man Austern schlürfen und dazu Chablis trinken (oder Soave oder Grünen Veltliner). Es gibt meistens bretonische Austern. In der Gastronomie, beispielsweise im Deuring Schlössle, kommt eher die Sylter Royal auf den Tisch, die ursprünglich eine Pazifische Felsenauster ist und vom Erzeuger Dittmeyer mit einem Gewicht von 60 bis 90 g zum Einheitspreis angeboten wird – eine Markenauster sozusagen. Die meisten Liebhaber sind sich einig – den besten Geschmack hat die Europäische Auster, die heute vorwiegend in England und Irland angeboten, aber auch exportiert wird. Auch Frankreich kennt diese Art als Belons, Marennes oder Gravettes d’Arcachon, und wer als erste Auster seines Lebens eine solche probiert, wird eher zum Fan werden als einer, der diese Bekanntschaft mit einer Portugaise aus Dänemark macht, und mehr Interesse an seinem „Anteil am Meer“ haben. Dies ist eine Anspielung auf Carl Friedrich von Rumohrs Beschreibung des Tieres: „Die Auster ist eine Welt für sich, kühl, tief, gedankenvoll, eine harmonische, ungegliederte, gegensatzlose Einheit. (…) Mit jeder Auster, die du schlürfst, schlürfst du auch deinen Anteil am Ozean.“
Schlürfen ist genau das, was viele Gäste nicht in der Öffentlichkeit tun wollen, nachdem man ihnen schon als Kind beigebracht hat, dass man geräuschlos isst. Nun, es gibt auch keinen Grund, sich die Auster mit anhaltender Geräuschentwicklung reinzuziehen, man kann sie sich auch lautlos in den Mund gleiten lassen, nachdem man den „Fuß“ mit der Gabel abgetrennt hat. Austernessen ist extrem einfach: Die Tiere werden geöffnet serviert, man führt die Schale zum Mund, schnappt oder schlürft, kaut und schluckt; alle wahren Aficionados sind sich einig: Man braucht weder Zitrone noch Sauce dazu, höchstens ein bisschen dunkles Brot zwischendurch …
Austern bestehen zu über 80 % aus Wasser, etwa 9 % leichtverdaulichem Eiweiß und nicht ganz 5 % Kohlehydraten, enthalten so gut wie kein Fett (1,2 %), dafür aber eine Reihe von Vitaminen und Mineralstoffen, darunter besonders viel Zink. Dieser Stoff spielt in der menschlichen Sexualchemie eine große Rolle, so dass schon etwas am Mythos der Austern dran sein mag.
[16.11.1995]
B
Ballaststoffe
Über Ballaststoffe
Ballaststoffe dehnen sich im Darm durch Wasseraufnahme aus und erzeugen durch diese Druckzunahme jenen Reiz, der den Peristaltikreflex auslöst, also den Darm seinen Inhalt schneller weiterschieben lässt. Ganz so einfach ist der Mechanismus in der Realität freilich nicht. Als Ballaststoffe bezeichnet man die Bestandteile von Pflanzenfasern, die nach der Wasseraufnahme mit menschlichen Verdauungsenzymen nicht abgebaut werden können, nämlich Pektine, Lignin, Zellulose und unverdauliche Polysaccharide, weiters die von der Lebensmittelindustrie als Zusatzstoffe verwendeten Alginate, Gummi, Carrageene und Wachse. Ernährungsberater empfehlen ballaststoffreiche Kost mit pflanzlichen Nahrungsmitteln, die bei gleichem Volumen eine geringere Energiedichte als fett- und cholesterinreiche Speisen aufweisen. Und so sollen Ballaststoffe in detaillierterer Darstellung wirken: Die teilweise hohe Wasserbindungsfähigkeit führt zu einer verzögerten Magenentleerung. Die Transitzeit durch den Darm verkürzt sich bis auf ein Drittel, lösliche Ballaststoffe verdicken die ruhende Flüssigkeitsschicht zwischen Darmwand und Darminhalt, wodurch weniger Fette aufgenommen werden. Die erhöhte Gallensäureausscheidung durch den Darm wird durch Neusynthese kompensiert, was den Serumcholesterinspiegel senkt. Die Pankreaslipasesynthese wird vermindert, was eine vermehrte Ausscheidung von Fett im Stuhl zur Folge hat. Beim Abbau löslicher Ballaststoffe im Dickdarm entstehen kurzkettige Fettsäuren, die die Cholesterinsynthese in der Leber hemmen. Insgesamt sollen sich also drei Effekte verknüpfen: kürzere Verweildauer im Darm, geringere Fettaufnahme durch den Darm und Veränderungen der hormonellen Reaktionen.
Das alles ist hauptsächlich Theorie. In der Praxis glaubt so mancher Diätbemühte beispielsweise, die „Unverdaulichkeit“ der Ballaststoffe sei wörtlich zu nehmen und bedeute, dass sie keinerlei Nährwert und keine Kalorien hätten. Aber manche Stoffe, zu deren Aufschließung der Mensch selbst keine Enzyme hat, können immer noch von seinen Darmbakterien genutzt werden. Zum Beispiel wird das Pektin, ein vor allem in Äpfeln enthaltener Ballaststoff, dessen hohe Quellfähigkeit die Darmpassage durchaus verkürzt, von der Dickdarmflora zerlegt, was sowohl zu Gärgasen als auch zur (vielleicht unerwünschten) Kalorienaufnahme führt. Guaran quillt fast doppelt so gut wie Pektin und viermal stärker als Weizenkleie, regt die Darmperistaltik also noch kräftiger an, aber wer anfängt, zusätzlich Ballaststoffe zu den in der Nahrung bereits enthaltenen einzunehmen, sollte auch bedenken, dass die verkürzte Verweildauer des Nahrungsbreis im Darm ja nicht nur die physikalisch-chemischen Möglichkeiten und die Zeit für die Aufnahme von Fett vermindert, sondern auch die von den durchaus erwünschten Bestandteilen der Nahrung. Außerdem treten bei Überdosierungen zum Beispiel von Weizenkleie unerfreuliche Effekte wie Übelkeit, Völlegefühl und teils heftige Flatulenzen auf. „An apple a day keeps the doctor away“, heißt ein altes englisches Sprichwort, und die Betonung sollte dabei auf „an“ liegen.
[9.8.2001]
Balsamico
Das Balsamico-Missverständnis
Neulich erhielt ich in einem Restaurant einen Antipasti-Teller, auf dem mal wieder der Essig aus dem zentralen Rucola-Häufchen auf die Salami, den Prosciutto und auch sonst alles geronnen war. Das dachte ich jedenfalls, aber als ich es bemängelte, erfuhr ich, das sei Absicht, man tue das so, den guten Balsamico eben nicht nur in den Salat, sondern auch auf Käse und Fleisch.
Leider ist Balsamico nicht Balsamico. Am einen Ende des Spektrums steht der echte Aceto Balsamico Tradizionale, der weniger als ein Prozent des weltweiten Balsamico-Umsatzes ausmacht. Das genormte 1-dl-Fläschchen mit D. O. C.-Etikette aus Modena oder Reggio Emilia kostet über 100 Euro; der dickflüssige Essig darin ist mindestens zwölf Jahre, besser aber über 25 Jahre alt. Dieses flüssige Gewürz setzt man mit der Pipette zum Beispiel auf besten Parmesan, wo die Tropfen als Halbkugeln stehen bleiben, so viskös ist dieser Essig. In den Salat würden ihn sich höchstens russische Bisnismen gießen.
Am anderen Ende des Spektrums steht irgendwelcher mit Karamellsirup braun gefärbter Essig, über den wir hier gar nicht reden wollen. Dazwischen gibt es dann durchaus passable oder sogar sehr gute süße Essige mit kürzerer Reifezeit, an denen nur ärgerlich ist, dass sie sich eben auch legal „Balsamico“ nennen dürfen. Es gibt sogar einen weißen, mit Traubenmost gesüßten „Balsamico“ aus der Trebbiano-Traube, der mit dem echten eigentlich gar nichts mehr gemeinsam hat außer diesem Wort.
Süße dunkle Essige aus Obst machen unter anderem die Österreicher Alois Gölles (bekannt für seinen Apfelbalsamico) und Erwin Gegenbauer (der Ducasse und Adrià beliefert). Der Deutsche Georg Heinrich Wiedemann (Weinessiggut Doktorenhof) ist einer der Promotoren des Trinkessigs. Wer süßen Salatessig mag, ist übrigens mit solchem aus Trockenbeerenauslesen oft besser bedient als mit Balsamico.
[25.1.2006]
Bärlauch
Bärlauchzeit
Bärlauchzeit wär’ eigentlich im Frühjahr, aber das Wetter spielt oft nicht so richtig mit: Wenn es zu kalt ist, mangelt es nämlich der Pflanze so ziemlich an Geschmack und Geruch. Das ist auch die einzige Zeit, in der ein Sammler sie mit dem Maiglöckchen, das giftig und geruchlos ist, verwechseln könnte.
Laubwälder mit Humusböden sind dann voll mit den grünen Blättern von Allium ursinum, wie der Bärlauch botanisch heißt. Feucht und schattig muss es sein, dann wächst er in Massen. Die Verwendung der Blätter ist allgemein verbreitet, man könnte aber auch im Herbst die Zwiebelchen sammeln und wie Knoblauchknollen verwenden.
Die einfachste Art, den Bärlauch zu verwenden, ist als Salatbestandteil oder als Suppeneinlage. Man säubert ihn und gibt ihn geschnitten bei; sein kräftiger Geschmack passt gut in Wildkräutersalate mit bitteren und säuerlichen Blättern. Da seine Blätter denselben Wirkstoff wie der Knoblauch enthalten, nämlich Allicin, werden sie auch als ebenso gesund eingeschätzt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!