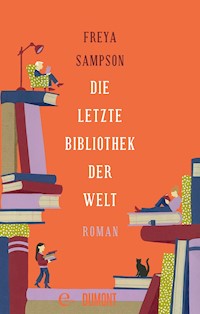Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
»Die Charaktere sind sympathisch und liebenswert, die Geschichte spendet Hoffnung, ist voller Emotionen und Herz und feiert die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen.« Ali Hazelwood Frisch getrennt und ziemlich durch den Wind kommt Libby Nicholls nach London, um bei ihrer Schwester Unterschlupf zu suchen. Der erste Mensch, den sie im Bus auf dem Weg dorthin trifft, ist Frank, ein älterer Herr. Ehe sie sichs versieht, erzählt er ihr seine Lebensgeschichte – und von einer Frau, die er vor Jahrzehnten im Bus derselben Linie kennengelernt hat: eine Frau, die ihn mit ihrem Mut, zu sich selbst zu stehen, beeindruckt hat, eine Frau, die er nie wiedersah. In den letzten sechzig Jahren ist er immer wieder mit dem Bus durch die Stadt gefahren, nur um sie zu finden. Libby macht es sich gemeinsam mit Dylan, Franks Pfleger, zur Aufgabe, ihm zu helfen. Doch mit Franks fortschreitender Demenz schwinden die Chancen, die Unbekannte aufzuspüren. Mehr als alles andere möchte Libby, dass Frank diese Frau, die ihn für immer verändert hat, noch einmal sieht. Aber ihre Suche zeigt Libby auch, wie wichtig es ist, ihre eigene Chance auf das Glück zu ergreifen – bevor es zu spät ist. Langsam beginnt sie, wieder Menschen in ihr Leben zu lassen, und stellt dabei fest, dass nicht immer der geradeste Weg der interessanteste ist.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frisch getrennt und ziemlich durch den Wind kommt Libby Nicholls nach London, um bei ihrer Schwester Unterschlupf zu suchen. Der erste Mensch, den sie im Bus auf dem Weg dorthin trifft, ist Frank, ein älterer Herr. Ehe sie sichs versieht, erzählt er ihr seine Lebensgeschichte – und von einer Frau, die er vor Jahrzehnten im Bus derselben Linie kennengelernt hat: eine Frau, die ihn mit ihrem Mut, zu sich selbst zu stehen, beeindruckt hat, eine Frau, die er nie wiedersah. In den letzten sechzig Jahren ist er immer wieder mit dem Bus durch die Stadt gefahren, nur um sie zu finden.
Libby macht es sich gemeinsam mit Dylan, Franks Pfleger, zur Aufgabe, ihm zu helfen. Doch mit Franks fortschreitender Demenz schwinden die Chancen, die Unbekannte aufzuspüren. Mehr als alles andere möchte Libby, dass Frank diese Frau, die ihn für immer verändert hat, noch einmal sieht. Aber ihre Suche zeigt Libby auch, wie wichtig es ist, ihre eigene Chance auf das Glück zu ergreifen – bevor es zu spät ist. Langsam beginnt sie, wieder Menschen in ihr Leben zu lassen, und stellt dabei fest, dass nicht immer der geradeste Weg der interessanteste ist.
FREYA SAMPSON ist Fernsehproduzentin und war unter anderem an zwei Dokumentationen über die britischen Royals beteiligt. Sie hat in Cambridge Geschichte studiert und stand 2018 auf der Shortlist für den Exeter Prize. Bei DuMont erschien 2021 ihr Debütroman ›Die letzte Bibliothek der Welt‹. Freya Sampson lebt mit ihrer Familie in London.
SUSANNE HÖBEL lebt in Südengland und arbeitet seit fast dreißig Jahren als Übersetzerin englischer und amerikanischer Literatur. Sie wurde vielfach ausgezeichnet. Zu den von ihr übersetzten Autor*innen gehören Miranda Cowley Heller, Min Jin Lee, John Updike und Graham Swift.
Freya Sampson
MENSCHEN, DIE WIR NOCH NICHT KENNEN
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Höbel
Von Freya Sampson ist bei DuMont außerdem erschienen:
Die letzte Bibliothek der Welt
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel ›The Girl on the 88Bus‹ bei Bonnier Zaffre, London.
Copyright © 2022 Freya Kocen
eBook 2023
© 2023 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Susanne Höbel
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
nach einem Entwurf von Anna Morrison
Copyright © Bonnier Books UK
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Verarbeitung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8281-6
www.dumont-buchverlag.de
PROLOG
APRIL 1962
Frank sah sie vom Fenster, als der Bus am Clapham Common hielt.
Sie stand an der Bushaltestelle. Ihre Kleidung – weit geschnittene Hosen und ein Männerjackett aus Tweed, dazu eine schwarze Baskenmütze, die sie schräg auf dem Kopf und einer Masse roter Haare trug – unterschied sich von dem, was er von anderen Mädchen kannte, und war jungenhaft und weiblich zugleich. Unter der Baskenmütze bemerkte Frank ein Paar grüner Augen, und sein Herz schlug höher.
Der 88er-Bus hielt an, das Mädchen stieg ein und verschwand aus Franks Blickfeld. Von seinem Platz auf dem Oberdeck hörte er, wie unten der Schaffner die Fahrgäste begrüßte und ihnen Fahrkarten verkaufte, und er stellte sich vor, wie das Mädchen ihren Fahrschein entgegennahm und sich hinten im Bus einen Platz suchte. Sollte er nach unten gehen? Er war unentschlossen und blieb sitzen. Dann spürte er hinter sich eine Bewegung und erspähte rechts einen Streifen Tweed. Frank blieb still sitzen, den Kopf nach vorn gerichtet, aber aus den Augenwinkeln nahm er wahr, dass sich das Mädchen auf der anderen Seite des Ganges in die erste Reihe setzte. Sie stellte ihre Tasche auf den Fußboden, schloss die Augen und stieß einen tiefen Seufzer aus.
Der Bus fuhr los, die Clapham High Street entlang. Das Mädchen bewegte sich nicht, öffnete auch nicht die Augen, und so konnte Frank sie verstohlen betrachten. Er schätzte, dass sie ein bisschen jünger war als er selbst, vielleicht achtzehn oder neunzehn, obwohl sie ein solches Selbstbewusstsein ausstrahlte, dass sie gut doppelt so alt sein konnte. Sie war überraschend groß, hatte einen langen, schlanken Hals und ein klar konturiertes Kinn. Ihre Haut war blass, zart wie Porzellan, und aus der Nähe besehen hatte ihr Haar dieselbe Farbe wie die Orangenmarmelade, die seine Eltern in ihrem Laden verkauften. Als der Bus Stockwell erreichte, hatte sie sich immer noch nicht bewegt, und Frank fragte sich, ob sie eingeschlafen war, aber in dem Moment schlug sie die Augen auf und wandte ihm den Kopf zu.
»Machst du das immer, dass du Mädchen im Bus anstarrst?«
Frank erschrak und spürte, dass er rot wurde.
»Äh, ich … äh …«, stotterte er und kam sich vor wie ein Schuljunge. »E-es tut mir leid.«
Sie betrachtete ihn aus ihren olivgrünen Augen, und Frank sah ein amüsiertes Flackern über ihr Gesicht ziehen. Mist, sie lachte ihn aus. »Das ist nämlich unhöflich. Hat deine Mutter dir keine Manieren beigebracht?«
»Es tut mir leid«, sagte Frank wieder. Sein Herz klopfte wild, und in seiner Verlegenheit, und um dem peinlichen Moment ein Ende zu bereiten, zog er sein Buch aus der Jackentasche. Er spürte, dass nun sie ihn beobachtete, deshalb schlug er das Buch irgendwo auf und tat so, als läse er darin.
»Was liest du da?«, fragte sie.
»Eh … On the Road. Von Jack …« Er zögerte, weil er nicht wusste, wie man den Namen richtig aussprach. »Ker-oo-ack.«
»Ist es gut?«
Sofort hatte Frank das brennende Gefühl, dass alles davon abhing, wie er diese Frage beantwortete. Hier wurde ihm die Chance gegeben, den verpatzten ersten Eindruck, den er gemacht hatte, wiedergutzumachen. Das Problem war nur, dass ihm das Buch nicht gefiel. Er hatte es von einem Freund geliehen bekommen, der alles Amerikanische liebte und das Buch in New York bestellt hatte. Sein Freund hatte von dem modernen Stil geschwärmt und die Beat Poets erwähnt, aber Frank kam mit der chaotischen Erzählstruktur nicht zurecht und war bisher kaum über die ersten zehn Seiten hinausgekommen.
»Ja, es ist toll. Es ist ein amerikanischer Roman. Der Autor gehört zur Beat Generation.« Frank hoffte, dass der Satz erwachsen und gebildet klang, aber in ihrer Miene sah er immer noch den leicht amüsierten Ausdruck.
»Worum geht es denn?«
»Oh. Also, es geht um eine Reise. Sie sind unterwegs.«
»Ja. Das sieht man ja schon am Titel. Und dann?«
»Er lernt Leute kennen und geht auf Partys und … äh …«
Frank versuchte, sich an das zu erinnern, was sein Freund ihm über das Buch erzählt hatte, aber dieses Mädchen bewirkte, dass sein Gehirn zu Mus wurde. Sie sah ihn schweigend an und machte keine Anstalten, ihn von seinen Qualen zu erlösen.
»Ehrlich gesagt bin ich noch nicht sehr weit«, räumte er die eigene Niederlage ein.
Das Mädchen sagte nichts, sondern griff in ihre Tasche, holte ein großes Heft und einen Bleistift heraus und fing an zu kritzeln. Niedergeschlagen wartete Frank, dass sie etwas sagen würde, begriff aber dann, dass er sie langweilte und sie das Gespräch beendet hatte.
Der Bus fuhr die South Lambeth Road entlang zur Vauxhall Station. Frank wollte sie unbedingt weiter ansehen, aber immer wenn er den Kopf zu ihr hinwandte, schien sie das zu merken und sah ihn ebenfalls an, deshalb begnügte er sich damit, aus dem Fenster vor sich zu gucken. Ihm war natürlich klar, dass sie jeden Moment aussteigen konnte, und bei jeder Haltestelle wartete er beklommen, ob es jetzt so weit war. Aber sie blieb sitzen, und das einzige Geräusch war das Kratzen ihres Bleistifts auf dem Papier.
Endlich, als Frank es nicht länger aushielt, drehte er sich zu ihr hin.
»Was schreibst du da?«
»Was sagst du?«, fragte sie, ohne von dem Blatt aufzusehen.
»Ich habe gefragt, was du da schreibst.«
»Ich schreibe nicht.«
»Aber …«
»Hier.« Mit Schwung riss sie das Blatt aus dem Heft und hielt es ihm hin. Frank nahm es entgegen und drehte es vorsichtig um, gespannt, was er zu sehen bekommen würde.
Es war eine Zeichnung, die einen jungen Mann darstellte. Ihn selbst. Frank war wie vom Donner gerührt. Seine Tolle, die er mit Haarwachs über der Stirn formte, war perfekt wiedergegeben, und da waren seine viel zu großen Ohren und die knochige Nase, die er von seiner Mutter geerbt hatte. Sie hatte all seine merkwürdigen Züge gezeichnet und ihn trotzdem … also, attraktiv gemacht.
»Das ist …«, sagte er kieksend, was ihm so peinlich war, dass er sich wand.
»Es ist sehr grob«, sagte sie, zog eine Packung Zigaretten aus der Tasche und nahm eine heraus.
»Es ist unglaublich, wie schnell du das gemacht hast.«
»Ich zeichne gern im Bus.« Sie entzündete ein Streichholz, steckte sich ihre Zigarette an und inhalierte. »Es gibt immer interessante Modelle, und dazu kommt der Nervenkitzel, weil man nie weiß, wann sie abhauen.«
»Es ist großartig.«
»Nicht unbedingt eins meiner Besten«, sagte sie und wedelte das Kompliment mit der Zigarette weg. »Magst du Kunst?«
Auch diesmal schien es wichtig zu sein, was er antwortete. Frank wollte erst bluffen, dann bremste er sich. »Ich weiß leider kaum etwas über Kunst. In meiner Familie interessiert sich keiner dafür.«
Er wartete auf eine spöttische Entgegnung von ihr und war überrascht, als sie lächelte, diesmal voller Wärme. »Mein Alter ist genauso. Für ihn sind die Cartoons im Daily Mirror Kunst. Er wollte nicht, dass ich auf die Kunstakademie gehe.«
»Ich interessiere mich schon für Kunst, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist alles ein bisschen … überwältigend.«
»Ich weiß, so kommt es einem manchmal vor, aber eigentlich ist es gar nicht so. Kunst ist für jeden da, deshalb ist sie ja so aufregend.«
Frank war sich nicht sicher, ob er dem zustimmte. Seine Eltern dachten über Kunst wie über Kino und Theater, nämlich dass all das frivol war und nur zum Vergnügen für die mit zu viel Zeit oder zu viel Geld. »Wie hast du dann zeichnen gelernt, wenn du nicht zur Kunstakademie gehst?«
»Aber ich bin ja auf der Kunstakademie.«
»Hast du nicht gesagt, dein Vater hat das verboten?«
»Das wollte er, aber ich bin von zu Hause weg«, sagte das Mädchen. »Ich bin zu einer Freundin in Clapham gezogen und habe einen Teilzeitjob in einer Boutique angenommen, damit ich die Miete bezahlen kann. Gerade jetzt bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Meine Familie hat mich mehr oder weniger verstoßen.«
Sie warf den Zigarettenstummel auf den Fußboden und drückte ihn mit dem Absatz aus. Frank sah ihr ehrfürchtig zu. Obwohl er schon zweiundzwanzig war, konnte er sich nicht vorstellen, seinen Eltern solchen Widerstand entgegenzusetzen. Sein Vater würde ihn umbringen.
»Du bist viel mutiger als ich«, sagte er. Sie zuckte die Achseln.
»Es ist keine Frage von Mut. Ich konnte nicht anders. Ich wollte einfach immer nur malen.«
»Und was machst du, wenn du mit der Kunstakademie fertig bist?«
»Dann bin ich Künstlerin.« Frank durchfuhr ein erregtes Zittern, als sie das sagte. Er hatte noch nie eine Künstlerin getroffen, und das Mädchen erschien ihm noch exotischer und wunderbarer als zuvor.
Der Bus umfuhr Parliament Square, und Frank blickte aus dem Fenster zur Westminster Abbey. Als er dreizehn war, hatten seine Eltern ihn hierhergebracht, wo sie anlässlich der Krönung von Königin Elizabeth mit den jubelnden Massen gefeiert hatten. Es war einer der seltenen Tage gewesen, an dem ihr Geschäft geschlossen blieb. Was würde geschehen, wenn er zu seinen Eltern sagte, er wolle nicht mehr in ihrem Laden arbeiten? Er habe hochfliegende Pläne und wolle sein Leben nicht hinter der Theke verbringen? Er warf einen Blick auf das Mädchen, das sich jetzt wieder eine Zigarette anzündete. Wie es wohl war, von einem so starken inneren Drang beseelt zu sein, dass man sich gegen die Familie stellte? Er wollte sie am Arm berühren und etwas von ihrer unermesslichen Zuversicht in sich aufnehmen.
»Und du?«, fragte sie, als der Bus in Whitehall einbog.
»Ach, ich arbeite im Geschäft meiner Eltern.«
»Machst du das gern?«
»Überhaupt nicht. Ich finde es schrecklich. Aber sie wollen, dass ich den Laden übernehme.«
»Und was möchtest du gern machen?«
»Versprich, dass du nicht lachst.«
»Großes Ehrenwort«, sagte sie mit so feierlichem Gesicht, dass er lächeln musste.
»Ich würde gern Schauspieler werden.« Als Frank das sagte, wurde ihm bewusst, dass er den Satz zum ersten Mal laut aussprach.
»Bestimmt wärst du ein toller Schauspieler«, sagte das Mädchen. Frank musterte sie, um zu sehen, ob sie sich über ihn lustig machte, aber ihre Miene war immer noch ernst. »Du hast ein bisschen Ähnlichkeit mit Rock Hudson in Pillow Talk.«
»Oh, das war ein toller Film! Ich habe ihn mir zweimal angesehen.«
Das erste Mal war er mit Rosamund Green gegangen, und beim zweiten Mal hatte er sich verstohlen ins Kino geschlichen, weil er nicht ohne Begleitung eines Mädchens in einem Liebesfilm gesehen werden wollte.
»Ich gehe so oft wie möglich ins Kino«, sagte er. »Ich sehe fast alle Filme, die im Electric Palace gespielt werden.«
»Na bitte, dann hast du mit deiner Ausbildung ja schon angefangen«, sagte sie. »Jetzt musst du es nur noch deinen Eltern sagen.«
»Wenn das mal so leicht wäre.«
»Das ist es nicht, aber ich versichere dir, du wirst es nicht bereuen. Schließlich hast du nur das eine Leben.«
Der Bus erreichte das Ende von Whitehall, vor ihnen lag Trafalgar Square.
»Wenn du ernsthaft etwas über Kunst lernen willst, kannst du gleich hier anfangen«, sagte das Mädchen, als der Bus an der Nelson Column nach links abbog.
»Am Trafalgar Square?«
»Nein, in der National Gallery.« Sie zeigte auf das zweistöckige Gebäude mit der Kuppel in der Mitte, das sich über die Längsseite des Platzes erstreckte. Frank hatte es Dutzende von Malen gesehen, es aber nie weiter beachtet. »Da drin sind über zweitausend Gemälde aus der ganzen Welt.«
»Zweitausend? Wie soll man sich die denn bei einem einzigen Besuch ansehen?«
»Soll man ja gar nicht«, sagte sie. »Der Eintritt ist frei, du kannst so oft reingehen, wie du willst. Ich könnte Stunden dadrin verbringen, vor einem einzigen Bild.«
»Stunden vor einem einzigen Bild? Wird das nicht langweilig?«
»Niemals. Es gibt ein Bild von dem Maler Tizian, Bacchus und Ariadne heißt es. Vor dem habe ich bestimmt schon mehrere Tage verbracht. Jedes Mal sehe ich etwas Neues.«
»Meine Güte«, sagte Frank.
»Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt zur Akademie gehe. Die Zeit in der National Gallery ist wie Kunstunterricht mit den größten Künstlern der Welt als Lehrer.«
»Vielleicht sollte ich mal reingehen.« Frank konnte nicht glauben, dass er sein Leben lang in London gelebt hatte, ohne zu wissen, was es in der National Gallery zu sehen gab. Plötzlich kam ihm seine Welt sehr klein vor.
Jetzt waren sie am Piccadilly Circus und fuhren unter den riesigen Werbetafeln von Coca-Cola und Cinzano entlang. Das Mädchen packte ihre Sachen ein, und Frank begriff, dass sie gleich aussteigen würde. Überwältigt von seinen heftigen Gefühlen verschlug es ihm einen Moment lang die Sprache. Er hatte schon manchmal ein Mädchen gefragt, ob es sich mit ihm treffen würde, und gelegentlich hatte eins eingewilligt, warum war er dann plötzlich so nervös?
»Ähm, es ist vielleicht ein bisschen direkt, aber …« Er verstummte, als sie ihn aus ihren bezaubernden Augen ansah. »Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht nächsten Sonntag in die National Gallery gehen möchtest? M-mit mir? Du könntest mir dieses Gemälde, Bacchus und Adrian, zeigen, dass du so gern magst.«
Sie hatte ihre Augen schmal gemacht, und Frank stellte sich darauf ein, abgewiesen zu werden.
»Warum nicht?«, sagte sie.
Frank glaubte, sein Herz würde zerspringen. »Das ist wunderbar! Also … danke!«
»Du kannst mich anrufen, wenn du magst«, sagte sie. »In unserem Haus gibt es ein Telefon, du kannst einem der Mädchen etwas ausrichten.«
»Das mache ich.« Er griff in seine Tasche und stellte fest, dass er weder Stift noch Papier bei sich trug.
»Hier.« Sie kramte einen Bleistift hervor, kritzelte ihre Nummer unten auf den Busfahrschein und hielt ihn ihm hin. Dann stutzte sie und sagte: »Oder bist du einer von diesen Typen, die sich von Mädchen ihre Telefonnummern geben lassen und dann nicht anrufen?«
»Nein, natürlich nicht«, sagte Frank. »Wirklich, ich rufe dich heute Abend an – und an allen anderen Tagen, wenn du möchtest.«
»Einmal reicht«, sagte sie, aber sie lächelte und gab ihm den Fahrschein. Als in dem Moment ihr Daumen den von Frank streifte, hatte er das Gefühl, versengt zu werden.
Er steckte den Fahrschein in seine Jackentasche und gab ihr die Zeichnung zurück. »Danke, dass du mir die Zeichnung gezeigt hast. Sie gefällt mir sehr.«
»Du kannst sie behalten, wenn du magst.«
»Wirklich? Ist das dein Ernst?«
»Klar. Ist nur eine flüchtige Skizze.«
»Dann sollte ich dir auch etwas von mir geben.« Er fühlte in seinen Jackentaschen, fand aber nur das Buch von seinem Freund, On the Road. »Du kannst es haben, wenn du magst. Ich glaube nicht, dass es das Richtige für mich ist.«
»Danke. Ich bin schon ganz neugierig auf Mr.Kerouac.«
Sie sprach den Namen ganz anders aus, als er das getan hatte, und Frank wurde wieder rot.
»Ich gebe es dir zurück, wenn wir uns treffen«, sagte sie und nahm das Buch.
Der Bus war jetzt fast am Oxford Circus, und das Mädchen stand auf. Frank sog jede kleinste Einzelheit in sich auf, damit er sich bis zu ihrem Wiedersehen an sie erinnern konnte. Er wollte etwas Tiefsinniges oder Witziges sagen, etwas, das sie zum Lächeln brachte, wenn sie später an ihn dachte. Etwas, worüber sie in künftigen Jahren sprechen konnten.
»Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen«, sagte er und kam sich wieder wie der dumme Schuljunge vor.
»Ganz meinerseits, Rock Hudson. Bis bald.«
Sie drehte sich um und ging ohne einen Blick zurück den Gang entlang zur Treppe.
1
APRIL 2022
»Bus Nummer 88 nach Parliament Hill Fields.«
Die elektronische Ansage erklang im Bus, als Libby, schwer beladen mit ihren beiden Rucksäcken, einstieg. Hinter ihr war eine Schlange, und sie hörte ein ungeduldiges Tut, tut, als sie in ihrer Handtasche nach dem Portemonnaie suchte. Sie fand es und hielt ihre EC-Karte zum Bezahlen auf das Gerät, während hinter ihr jemand murmelte: »Blöde Touristen!« Libby steuerte mit ihrem Gepäck den einzigen freien Platz auf dem Unterdeck an, aber in dem Moment schob sich ein Teenager an ihr vorbei und hätte sie beinahe einer älteren Frau in den Schoß gestoßen, bevor er sich auf den Sitz fallen ließ.
Libby warf dem Jungen ihren besten Vernichtungsblick zu, drehte sich um und stieg die enge Treppe zum Oberdeck hinauf. Sie hielt sich am Handlauf fest, um nicht zu stürzen, während der Bus von der Vauxhall Station losfuhr. Oben angekommen, sah sie erleichtert, dass die Plätze vorn im Bus gleich neben der Treppe frei waren, und strebte darauf zu.
Der Bus fädelte sich in den Londoner Verkehr, und Libby blickte aus dem Vorderfenster. Offenbar waren alle Menschen in Eile: Auf den Bürgersteigen wimmelte es von Fußgängern, Autos hupten wie verrückt, ein Fahrradfahrer beschimpfte wild gestikulierend einen Taxifahrer. Auf der Vauxhall Bridge wandte Libby sich nach rechts und sah flussabwärts die Themse entlang. Sie erkannte die Tate Britain Art Gallery und weiter östlich das London Eye, dessen Kabinen in der Aprilsonne funkelten. Simon hatte sie einmal an ihrem Geburtstag zu einer Fahrt eingeladen, das war drei oder vier Jahre her. Während das Rad über der Stadt einen Kreis beschrieb, hatten sie Prosecco getrunken, anschließend hatten sie Hotdogs gegessen und waren Hand in Hand auf der South Bank entlanggeschlendert. Das war einer ihrer seltenen Ausflüge nach London gewesen, und Libby erinnerte sich, wie glücklich sie gewesen war. Und jetzt …
»O Gott, du bist es, oder?«
Beim Klang der Stimme von links blickte Libby zur Seite, wo ein älterer Mann saß, dessen weinrotes Samtjackett schon bessere Tage gesehen hatte. Über sein Gesicht breitete sich ein Lächeln, als er sich zu ihr umdrehte.
»Du bist es wirklich, stimmts?«
Himmel. Sie war noch keine zehn Minuten in London, und schon war da der erste Verrückte.
»Es tut mir leid, aber ich glaube, Sie verwechseln mich«, sagte Libby und wandte sich ab.
»Oh! Oh, entschuldigen Sie bitte.«
Libby holte ihr Smartphone aus der Tasche. Normalerweise, wenn ein Fremder sie in ein Gespräch verwickeln wollte, rief sie einfach jemanden an. Aber wen sollte sie jetzt anrufen? Mit Sicherheit nicht ihre Eltern. Und alle ihre Freunde waren auch Simons Freunde oder Ehefrauen und Lebensgefährtinnen dieser Freunde, und ganz bestimmt war niemand darunter, mit dem sie jetzt sprechen wollte. Libby steckte ihr Smartphone wieder ein.
»Es tut mir leid, wenn ich aufdringlich war«, sagte der Mann mit unsicherer Stimme. »Manchmal bin ich dieser Tage ein wenig verwirrt.«
Etwas in seiner Stimme bewirkte, dass Libby sich wieder zu ihm hinwandte. Er hatte den Blick gesenkt und wirkte so niedergeschlagen, dass sie spontan den Wunsch hatte, ihn aufzuheitern.
»Machen Sie sich nichts draus, viele Menschen verwechseln mich. Es muss an meinem Gesicht liegen. Offenbar sehe ich sehr durchschnittlich aus.«
»Durchschnittlich?« Sein Kopf schoss hoch. »Sie sehen nicht durchschnittlich aus. Mit diesem herrlichen Haar sehen Sie aus wie die Venus von Botticelli!«
Libby fuhr sich durch die langen dichten Locken. Ihr Haar war im Laufe der Jahre mit allem Möglichen verglichen worden – Kupfer, Karotten, Ron Weasley –, aber bisher nicht mit einem Gemälde aus der Renaissance, und das amüsierte sie.
»Entschuldigung, Sie müssen mich für einen merkwürdigen Kerl halten«, sagte der Mann. »Ich habe eigentlich nicht die Angewohnheit, junge Frauen im Bus anzusprechen und ihnen zu sagen, dass ich ihr Haar bewundere, das kann ich Ihnen versichern.«
»Ist schon in Ordnung. Das Kompliment hat mir heute gutgetan, ich danke Ihnen.«
»Kein guter Tag?«
»Könnte man sagen.«
»Ich höre gern zu, wenn das hilft?« Er fuhr sich mit der Hand durch seine eigenen Haare, die schneeweiß waren und wild und ungezähmt von seinem Kopf abstanden. »Die Menschen erzählen mir oft ihre Probleme, besonders im Nachtbus. Wenn die Leute ein bisschen was getrunken haben, vertrauen sie einem alles Mögliche an. Sie können sich nicht vorstellen, was ich hier oben schon alles gehört habe.«
Einen kleinen Moment lang erwog Libby, diesem Fremden ihre traurige Geschichte zu erzählen, aber wo sollte sie anfangen? »Das ist freundlich von Ihnen, aber es geht schon, danke.«
Der Mann nickte und drehte sich wieder zum Fenster, und Libby tat das auch. Der Bus fuhr hinter der Tate Britain zum Parliament Square. Dort war an diesem Tag viel los, Touristen standen vor der Westminster Abbey an, Demonstranten hielten vor dem Parlamentsgebäude Plakate hoch und wurden von ein paar gelangweilt wirkenden Polizisten bewacht. Libby sah wieder auf ihr Smartphone – es war Viertel nach zwei, laut Google Maps würde sie gegen drei Uhr bei ihrer Schwester ankommen.
Bei dem Gedanken überlief Libby ein Schauder. Am späten Abend hatte sie, noch unter Schock, bei ihren Eltern geklingelt in der Hoffnung, sie könnte ein paar Tage bei ihnen unterkommen, bis sie sich ihre nächsten Schritte überlegt hatte. Aber am Frühstückstisch erklärte ihre Mutter – während ihr Vater jeden Blickkontakt mied –, sie habe Rebecca angerufen, und die habe Libby ihr Gästezimmer angeboten. Libby war überrascht, denn sie verstand sich mit ihrer Schwester nicht besonders gut, aber ihre Mutter ließ keine Einwände gelten. Und jetzt saß sie hier, ein paar Stunden später, in einem Bus, der sie auf ihr fremden Straßen durch eine ihr fremde Stadt fuhr, und trug ihr Leben, verpackt in zwei Rucksäcken, bei sich.
»Entschuldigung.« Der alte Mann auf der anderen Seite des Ganges sah sie wieder an.
»Ja?«
»Es geht mich nichts an, aber mir fiel es einfach auf. Sind Sie Künstlerin?«
Er deutete auf einen alten Skizzenblock, der in der Seitentasche des Rucksacks steckte. Ihr war gar nicht bewusst gewesen, dass sie ihn noch hatte – ein klares Zeichen, wie lange sie den Rucksack nicht benutzt hatte.
»Nein, das bin ich nicht. Der Skizzenblock ist uralt, noch aus Schulzeiten.«
»Haben Sie da gezeichnet?«
»Ja, schon, aber das tue ich seitdem nicht mehr.«
»Und warum nicht?«
Libby hob zu einer Antwort an, dann hielt sie inne. Der alte Mann hatte recht – von ihm ging etwas aus, das andere ermunterte, ihm ihre Geheimnisse zu eröffnen. Aber sie war dazu nicht in der Stimmung.
»Ich hatte keine Zeit«, sagte sie deshalb.
»Unsinn, Zeit zum Zeichnen hat man immer. Zum Beispiel könnten Sie mich jetzt zeichnen, wenn Sie wollten.«
»Nein danke. Ich glaube, meine kreativen Tage sind lange vorbei.«
Der Bus hielt kurz vor der Downing Street, neue Passagiere stiegen ein, ihre Stimmen ein buntes Sprachengemisch, das von unten heraufdrang.
»Es ist nie zu spät, wieder anzufangen«, sagte der Mann. »Haben Sie in der Schule Kunstunterricht gehabt?«
»Ja, und ich wollte sogar auf die Kunstakademie gehen, aber …« Jetzt fing sie doch an, ihm ihr Leben zu erzählen. »Stattdessen habe ich Medizin studiert.«
»Medizin? Darauf hätte ich nicht unbedingt getippt. Wenn ich mir vorstelle, Sie würden meine kaputte Hüfte operieren …«
Libby sah ihn überrascht an, aber der Mann zwinkerte ihr zu.
»Das war ein Witz. Bestimmt sind Sie eine sehr gute Ärztin.«
»Nein, Sie haben recht, es hat sich herausgestellt, dass ich nicht zur Ärztin tauge. Ich habe das Studium gehasst und bin ausgestiegen, bevor ich irgendeine Hüfte komplett ruinieren konnte.«
Der Mann schmunzelte, und Libby lächelte gegen ihren Willen.
»Und was machen Sie jetzt, wenn es weder Medizin noch Kunst ist?«
Sie antwortete nicht, weil sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Bis gestern hatte sie in Simons Gartenbetrieb die Buchhaltung und Ablage gemacht. Aber jetzt – was wusste sie schon, wie es weitergehen würde?
Der Bus näherte sich dem Trafalgar Square, und Libby sah die vier majestätischen Löwen, die wie abweisende Wachen dasaßen und von einem Schwarm fetter Tauben umschwirrt wurden. Die Nelson-Säule erhob sich über Touristenscharen und Straßenmusikern, obenauf stand Admiral Nelson, der wie ein missbilligender Vater auf London herunterblickte. Hinter ihm waren die imposanten Säulen und die Kuppel der National Gallery zu sehen. Bei dem Anblick regte sich in Libby eine Erinnerung. Sie war einmal in dem Museum gewesen, bei einem Schulausflug. Die meisten in ihrer Klasse langweilten sich nach kurzer Zeit und wollten lieber zu Madame Tussauds, Libby hingegen war ehrfurchtsvoll durch das Gebäude mit den schmuckvollen Decken und den vielen Räumen voller außergewöhnlicher Bilder gegangen. Aber das war damals gewesen, als sie noch die Hoffnung hatte, eines Tages an der Kunstakademie zu studieren, und bevor ihre Eltern darauf bestanden, dass sie sich für ein »ordentliches« Studium mit Aussicht auf einen »vernünftigen« Beruf einschrieb.
Libby wandte sich wieder dem alten Mann zu und bemerkte, dass auch er in Gedanken versunken war und mit verhangenem Ausdruck aus dem Fenster sah. Offenbar hatte er ihren Blick gespürt, denn er schüttelte den Kopf, als erwachte er aus einem Traum.
»Wissen Sie, jemand hat mir mal gesagt, man müsse nicht auf die Kunstakademie gehen, wenn man Zeichnen lernen wolle. Sie sagte, man könnte einfach in die National Gallery gehen, das sei, als würde man bei den größten Künstlern der Welt lernen.«
»Im Ernst?«
»Sie selbst hat im Bus geübt. Sie sagte, da könne man gut zeichnen lernen, weil es immer interessante Modelle gebe.«
»Ich glaube, das könnte ich nicht. Viel zu holprig.«
Der Mann sah Libby an. »Waren Sie mal in der National Gallery?«
»Einmal, als Teenager. Ich hatte immer vor, wieder hinzugehen.«
»Warum gehen wir nicht jetzt? Wir können auf der Stelle mit Ihrer Kunstausbildung anfangen.« Er drehte sich zu dem Halteknopf um und drückte ihn fest.
»Das geht leider nicht«, sagte Libby und sah, dass er die Schultern sinken ließ.
»Sicher. Das war dumm von mir.«
»Ich bin verabredet. Außerdem habe ich diese Ungeheuer bei mir.« Sie zeigte auf ihre Rucksäcke.
»Es tut mir leid, keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin. Weiß der Himmel, was heute mit mir los ist.«
»Ist doch nicht schlimm. Ich gehe ein andermal, versprochen.«
Aber der Mann hörte ihr nicht länger zu, sondern hatte den Blick auf das Museum gerichtet. Der Bus hielt, und die Türen öffneten sich mit einem lauten Seufzer. Der Mann sah immer noch aus dem Fenster.
»Ich glaube, ich steige trotzdem aus«, sagte er und zog sich an der Stange hoch. »Da ist ein Bild, das ich mir mal wieder anschauen muss.«
Libby beobachtete, wie er mühsam aufstand und sich abstützte. Es sah aus, als würde er jeden Moment stürzen.
»Soll ich Ihnen mit der Treppe helfen?«
»Nein, vielen Dank, das geht schon.« Der Mann blickte sie an. »Ich heiße übrigens Frank.«
»Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Frank. Ich heiße Libby.«
»Libby.« Er lächelte, als er ihren Namen sagte. »Vielleicht sollten Sie es mal versuchen, mit dem Zeichnen im Bus. Ich denke, es könnte Ihnen gefallen.« Und dann drehte er sich um und ging langsam die Treppe hinunter.
2
Libby stand vor dem Haus ihrer Schwester und sah an der imposanten georgianischen Fassade nach oben, dann atmete sie tief ein und stieg die steilen Stufen hinauf. Im nächsten Moment öffnete sich die Tür, und da stand ihre ältere Schwester in Yogahose und teuer aussehendem Sportoberteil und musterte Libby von Kopf bis Fuß.
»Mann, du siehst ganz schön geschafft aus.« Rebecca beugte sich vor und schloss Libby in eine knochige Umarmung.
»Ja, es kam alles etwas plötzlich.« Libby wollte Rebecca einen ihrer Rucksäcke geben, aber die hatte sich schon wieder umgedreht und verschwand im Haus.
»Zieh dir bitte die Schuhe aus, ja?«, rief sie Libby zu, die sich durch den Eingang mühte.
Libby setzte die Rucksäcke ab und zog sich die Schuhe aus, dann ging sie den Flur entlang, der im hinteren Teil des Hauses in einer großen Küche endete. Hier war alles glänzend weiß, einschließlich der Reihe identischer Porzellanbecher an Haken und des frischen weißen Geschirrtuchs, das sorgfältig gefaltet über dem Griff des Backofens hing. Libby war überrascht, dass Rebecca die Bananen in der Obstschale duldete, obwohl sie das strenge Farbsystem sprengten.
Libby hockte sich an der Mittelinsel auf einen Barhocker und machte sich auf die unvermeidbare Frage gefasst.
»Also, was ist passiert?«, fragte Rebecca. »Mum hat mir die Geschichte in groben Zügen erzählt, aber ich will sie noch mal von dir hören.«
»Also gut.« Libby schluckte. »Gestern schlug Simon vor, dass wir zum Essen ausgehen, es gibt da ein neues italienisches Restaurant. Ich fand es seltsam, weil wir uns freitags normalerweise etwas kommen lassen und seit Ewigkeiten nicht mehr zusammen essen waren. Aber er hatte einen Tisch reserviert, und ich habe mich schick gemacht, und dann sind wir los.«
»Und?«
»Das Essen war gut, aber Simon war die ganze Zeit abgelenkt – er hat immer wieder auf sein Smartphone geguckt und ist dreimal zur Toilette gegangen. Und ich dachte …« Sie verstummte, weil es ihr peinlich war, es laut zu sagen.
»Was?«
Libby schloss die Augen und sah sich wieder im Restaurant sitzen, an dem Tisch mit den Kerzen, Simon gegenüber, der am Daumennagel kaute, wie immer, wenn er nervös war. Sie dachte daran, wie aufgeregt sie gewesen war, als sie seine Absicht zu durchschauen meinte.
»Lib?«
»Ich dachte, er wollte mir einen Heiratsantrag machen«, sagte sie leise.
»Ach du liebe Zeit!«
»Ich weiß.« Libby spürte ihre Gefühle wieder hochkommen, aber sie atmete tief ein und verdrängte sie. »Dann stellte sich heraus, er wollte mir keinen Heiratsantrag machen, sondern unsere Beziehung beenden.«
»So ein Arschloch«, sagte Rebecca mit leicht übertriebener Empörung. »Was hat er gesagt?«
»Er hat gesagt, er würde mich immer noch lieben, aber er sei schon seit einer Weile unglücklich, unsere Beziehung sei langweilig, und er wüsste nicht, ob er weiter daran festhalten wolle. Er sagte, er wollte lieber ehrlich zu mir sein und mir sagen, wie es ihm geht, statt – wie hat er es ausgedrückt? – ›länger stumm zu leiden‹.«
»Und warum hat er dich in ein schickes Restaurant ausgeführt, um das zu sagen?«
»Er sagte, so wäre es leichter gewesen. Zu Hause hätte ich vielleicht angefangen zu weinen, aber er wusste, dass ich vor anderen niemals eine Szene machen würde.«
»Das muss man ihm lassen, er hat alles genau durchdacht«, sagte Rebecca und schüttelte bewundernd den Kopf. »Und du hast wirklich geglaubt, er würde dir einen Antrag machen?«
»Wir hatten immer gesagt, dass wir uns verloben würden, wenn wir dreißig sind. Und mein Geburtstag ist doch bald, und deshalb …«
»Du weißt, was das ist, oder?«, sagte Rebecca. »Die klassische Midlife-Crisis.«
»Er ist doch gerade erst dreißig geworden!«
»Männer kommen um runde Geburtstage herum auf lauter komische Ideen. Als Tom vierzig wurde, wollte er sich ein Motorrad kaufen. Ich habe ihm das nicht erlaubt, natürlich nicht. Das hier ist genau dasselbe. Sie ertragen es nicht, dass sie älter werden, sie fühlen sich weniger männlich und haben das Bedürfnis, etwas Radikales zu tun.«
»Er schien es ziemlich ernst zu meinen«, sagte Libby.
Es tut mir leid, hatte Simon beim Tiramisu gemurmelt und ihren Blick gemieden. Ich denke die ganze Zeit, eine Beziehung sollte mehr sein als das, was wir haben … Unser Leben ist so durchgeplant und vorhersehbar … Mir fehlt die Spontaneität.
»Und was hast du jetzt vor?« Rebecca stand auf und ging zum Wasserkessel.
»Simon hat gesagt, er braucht Zeit, um herauszufinden, was er will … eine Pause von der Beziehung, hat er gesagt. Und ich war so überrumpelt, dass ich eingewilligt habe, eine Zeit lang auszuziehen, damit er einen klaren Kopf kriegen kann. Aber jetzt denke ich, vielleicht war das eine schlechte Idee.«
»Nein, ich finde, das ist ein guter Plan. Soll Simon mal eine Woche lang allein sein, dann sieht er schon, was für einen Fehler er da gemacht hat.«
»Und wenn nicht? Wenn er jetzt …«
Libby wurde von dem Aufheulen der elektrischen Kaffeemühle übertönt. Nescafé gab es in diesem Haus nicht, jede Tasse Kaffee wurde frisch aufgebrüht, und das dauerte ewig. Simon hatte es immer sehr lustig gefunden, welchen Aufwand Rebecca und Tom betrieben, um sich einen Kaffee zu machen, und versucht, auch Libby damit zum Lachen zu bringen. Bei der Erinnerung spürte Libby einen Stich in der Brust. Sie waren ein Team, sie und Simon, sie hielten zusammen, besonders da, wo es um ihre verrückten Familien ging. Wie konnte er sich von ihr trennen wollen?
»Was hattest du gesagt?«, fragte Rebecca, als die Kaffeemühle fertig war.
»Ich hatte gesagt, was, wenn er es ernst meint? Wenn es nicht nur eine Midlife-Crisis ist, sondern er die Beziehung wirklich beenden will?«
»Jetzt komm, ihr seid seit acht Jahren zusammen, das wird er nicht einfach wegwerfen. Er wird Vernunft annehmen, bestimmt.«
»Und wenn das so ist, meinst du, ich sollte zu ihm zurückgehen? Ich meine, wenn er es wieder tut, in ein paar Jahren – wie kann ich ihm je wieder vertrauen?«
»Natürlich kannst du ihm vertrauen. Dein Simon ist doch nun wirklich kein Casanova. Ich bin mir sicher, es ist nur eine kurze Funkstille, und in ein paar Wochen seid ihr wieder zusammen und sitzt in eurem kleinen Haus vor dem Fernseher wie die alten Langweiler, die ihr nun mal seid.«
Bevor Libby darauf antworten konnte, war im Flur lautes Fußgetrappel zu hören.
»Auntie Lib!« Rebeccas Sohn Hector kam in die Küche gelaufen, die Arme weit ausgestreckt, und warf sich Libby entgegen. Sie fing ihn auf und steckte ihr Gesicht in sein Haar, das so tröstlich nach Apfelshampoo und Reiskeksen roch.
»Es ist unglaublich, wie du gewachsen bist«, sagte sie und ließ ihn los. »Wie alt bist du? Achtzehn?«
»Du weißt doch, dass ich erst vier bin«, sagte er und sah sie stirnrunzelnd an. »Mummy hat gesagt, du passt für den Rest der Osterferien auf mich auf.«
»Wirklich?« Libby sah zu Rebecca hinüber, die damit beschäftigt war, tropfenweise heißes Wasser über das Kaffeepulver zu gießen.
»Können wir ins Naturkundemuseum gehen? Ich will nämlich die Dinosaurier sehen.«
»Hector, warum malst du nicht das Bild für Granny fertig, dann kannst du es mir und Auntie Libby zeigen, ja?«
Der Junge rannte aus der Küche. Es folgte ein langes Schweigen, und Rebecca konzentrierte sich auf das Aufbrühen des Kaffees.
»Deshalb hast du also angeboten, dass ich bei euch wohnen kann«, sagte Libby nach einer Weile. »Du möchtest, dass ich für dich auf Hector aufpasse.«
»Nein! Ich habe dir angeboten, hier zu wohnen, weil ich eine gute Schwester bin und dir helfen möchte.« Rebeccas Stimme drückte Empörung aus, aber ihre Ohrmuscheln hatten sich ein klein wenig rosa verfärbt.
»Also, du willst nicht, dass ich auf Hector aufpasse?«
»Nicht, wenn du das nicht willst. Aber ich dachte, vielleicht findest du es ja schön, Zeit mit deinem Neffen zu verbringen – du siehst ihn ja normalerweise kaum.«
»Ich dachte, ihr hättet ein Kindermädchen, das bei euch wohnt?«
»Das stimmt, aber sie musste nach Hause zurück, ein Notfall in der Familie, völlig unpassend. Du kannst ihr Zimmer haben.«
Darum ging es also. Libby hatte gleich gewusst, dass ihre Schwester sie nicht grundlos zu sich einlud. Rebecca tat nichts, was ihr nicht selbst einen Nutzen brachte.
»Wie lange brauchst du Hilfe?«
»Eine Woche, vielleicht zwei. Bis Rosalita zurück ist. Zeitlich passt es doch genau, denn bis dahin habt ihr beide den ganzen Unsinn bestimmt überstanden, und du bist wieder zu Hause.« Rebecca gab Libby eine Tasse mit sehr stark duftendem Kaffee.
»Ich weiß nicht, Bex. Klar, ich würde mich gern um Hector kümmern, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich in der richtigen Verfassung dafür bin. Ich meine, guck mich an, mir gehts ganz schön dreckig.«
Ihre Schwester seufzte lang und schwer. »Wie oft habe ich dich um Hilfe gebeten, seit Hector auf der Welt ist?«
»Nie, aber …«
»Und hast du jetzt Zeit, oder hast du keine? Ich nehme an, dass du während dieser Beziehungspause nicht für Simon arbeiten wirst.«
»Ja, aber …«
»Also, da hast du es. Außerdem wird es dir guttun. Hector wird dich ablenken, und du jammerst nicht die ganze Zeit hinter Simon her.«
Rebecca war schon immer gut darin gewesen, Libby zu überreden, seit ihrer Kindheit war das so. Kein Wunder, dass sie als Firmenanwältin so erfolgreich war. Libby gab sich geschlagen und trank von dem Kaffee. »Hm, schmeckt köstlich.«
»Kopi Luwak, aus Indonesien. Die Bohnen werden von Schleichkatzen gefressen und ausgeschieden, wobei sie fermentiert werden. Der Kaffee kostet ein Vermögen. Wir kaufen natürlich nur Bohnen von frei lebenden Schleichkatzen.«
Libby verzog das Gesicht und setzte den Kaffeebecher ab.
»Also, du machst das mit Hector, ja?«, fragte Rebecca.
Libby zögerte einen Moment, bevor sie antwortete. Vielleicht war es keine so schlechte Idee. Es wäre schön, etwas zu tun zu haben, außerdem hatte sie Hector sehr lieb, er war der Einzige in der Familie, der sie nicht wie eine Idiotin behandelte. »Also gut.«
»Hervorragend.« Rebecca nahm ein Blatt, das auf der Theke lag, und gab es Libby. »Ich habe dir einen Plan gemacht. Er geht jeden Morgen in den Fußballclub, und nachmittags stehen verschiedene Aktivitäten an. Am Dienstag kommt sein Hauslehrer, am Mittwoch ist Klavierunterricht, und für Freitag haben wir Karten für eine Ausstellung im Wissenschaftsmuseum.«
»Meine Güte!«
»Was ist?«
»Na, du weißt, ich bin durchaus für Planung, aber Hectors Terminkalender ist ganz schön vollgestopft.«
»Nicht vollgestopft, wir fördern ihn«, sagte Rebecca. »Außerdem muss Hector sich ranhalten, wenn wir für ihn einen Platz in der richtigen Pre-Prep-School bekommen wollen.«
»Also gut. Ich werde mich bemühen.«
»Tom und ich kommen immer erst um sechs nach Hause, du musst also für Hector auch kochen. Ich kaufe immer online ein, du brauchst nur dem Speiseplan zu folgen. Und denk daran, dass er kein Rindfleisch bekommt und keine Molkereiprodukte und Sachen mit weißem Zucker nur am Wochenende.«
»Aha.« Libby bedauerte Hector von Minute zu Minute mehr.
»Ich weiß, was du denkst, Libby, aber komm nicht auf die Idee, mit ihm zu McDonald’s zu gehen und Chicken Nuggets oder Milkshakes zu kaufen. Dir ist dein Körper vielleicht egal, aber in diesem Haushalt behandeln wir unsere mit Respekt.«
»Keine Big Macs, versprochen.«
Rebeccas Smartphone summte, und sie nahm es in die Hand. »Ach, und kein Fernsehen«, sagte sie, nachdem sie die Nachricht gelesen hatte. »Neulich habe ich eine Sendung gesehen über die Schäden, die Fernsehen bei der Entwicklung des Gehirns verursachen kann.«
Libby verdrehte spontan die Augen, und genau in dem Moment hob Rebecca den Blick und sah sie an.
»Was hast du?«
»Nichts.«
»Das Augenverdrehen bedeutet doch, dass du mir nicht zustimmst.«
»Das meinte ich nicht. Aber als wir klein waren, haben wir jede Menge ferngesehen, und ich glaube nicht, dass es unserem Gehirn geschadet hat.«
Rebecca sah ihre Schwester mit einem Blick an, den Libby aus ihrer Kindheit kannte und in dem Langeweile und Geringschätzung lagen. »Sag doch noch mal, Libby, wie viele Kinder hast du?«
Die Nummer kannte sie.
»Genau«, sagte Rebecca mit Schärfe. »Wenn du eigene Kinder hast, kannst du sie gern den ganzen Tag fernsehen und ungesundes Zeug essen lassen. Aber solange du auf meinen Sohn aufpasst, bitte ich dich, dass du dich an meine Regeln hältst. Okay?«
Libby wollte gerade antworten, aber da war Rebecca schon aus der Küche gerauscht, und Libby saß mit offenem Mund vor dem Kaffee aus Schleichkatzenscheiße.
3
Die Woche danach war anstrengender als alles andere, was Libby je erlebt hatte – jeden Morgen um Viertel vor sieben kam Hector in ihr Schlafzimmer gestürmt und sprang aufs Bett, und von da an bis zu dem Moment zwölf Stunden später, wenn er schlafen ging, befeuerte er sie fast ununterbrochen mit Fragen: Wie heißt die Hauptstadt von der Mongolei? Warum haben ältere Mädchen Brüste und Jungen nicht? Was ist das Gegenteil von Hamster? Wenn Rebecca und Tom abends von der Arbeit nach Hause kamen, sprühte Hector immer noch vor Energie, aber Libby war am Ende ihrer Kräfte.
Das Gute daran war, dass Libbys Tage ausgefüllt waren und sie keine Zeit hatte, an Simon zu denken. Erst wenn sie erschöpft und hundemüde ins Bett fiel, wurde ihr ihre Situation wieder schlagartig bewusst. Zwei Tage waren vergangen … drei Tage … vier, und immer noch keine Nachricht. Das Gespräch vom Freitagabend lief in Libbys Kopf immer wieder ab wie ein schlechter Popsong auf Dauerschlaufe. Ich liebe dich immer noch, aber ich habe das Gefühl, wir haben uns auseinandergelebt. … Wir leben eher wie in einer WG und nicht wie ein Paar. … Früher hat es mit dir solchen Spaß gemacht, aber inzwischen ist unsere Beziehung langweilig. Jedes Mal hatte Libby das Gefühl, als würde ihr, wie bei einem Schlag in die Magengrube, die Luft abgeschnitten. Wie konnte es sein, dass ihr all das nicht aufgefallen war? Die ganze Zeit war sie mit ihrem gemeinsamen Leben glücklich gewesen – mit dem Essen, dass sie sich am Freitagabend kommen ließen, mit dem Sex am Sonntagmorgen, mit den Träumen von ihrer Zukunft, die sie sich gemeinsam ausgemalt hatten – und hatte nicht die leiseste Ahnung gehabt, dass der Mann, den sie liebte, zutiefst unglücklich war.
Am Samstagmorgen ließ Hector Libby schlafen und weckte stattdessen seine Eltern, und Libby wachte erst um neun auf. Als sie sich im Bett aufrichtete, tat ihr alles weh, und sie hatte einen harten Klumpen in der Brust. Sie nahm ihr Smartphone und ging auf Instagram. Die ganze vorige Woche hatte sie das vermieden, weil sie sich nicht mit Simons Feed quälen wollte. Jetzt tippte sie mit angehaltenem Atem auf seinen Namen, gespannt auf das, was sie finden würde. Zum Glück hatte Simon nur ein Foto gepostet, seit sie das letzte Mal geguckt hatte, und das war vom Joggen. Libby sah es sich genau an. Seine Haut war gerötet, sein Haar wirr, und er blickte mit zusammengekniffenen Augen in die Sonne und lächelte. Er sah so attraktiv aus, ein bisschen wild, dass Libby ganz schwach zumute wurde. War er jetzt schon zu der Überzeugung gekommen, dass sein Leben glücklicher war ohne sie?
Libby sprang aus dem Bett, duschte und zog sich an, dann verließ sie leise das Haus, bevor ihre Schwester sie mit Aufgaben überschütten konnte. Sie hatte nichts Besonderes vor, sondern wusste nur, dass sie nicht im Bett bleiben wollte, wo sie sich Simons Instagram angucken und immer mehr in Panik geraten würde. Auf der Straße ging sie an ein paar Geschäften vorbei, betrat ein Café und kaufte sich einen Cappuccino und ein Schokoladencroissant. Als sie herauskam, hielt gerade ein Bus vor dem Café, und die Türen gingen auf. Libby sah zu, wie die Passagiere ausstiegen. Sie wusste nicht, welcher Bus es war, noch, wohin er fuhr, und hatte weder Mantel noch Schirm dabei, falls es Regen gab. Gerade wollte sie weitergehen, als ihr etwas einfiel, das Simon gesagt hatte. Unser Leben ist so durchgeplant und vorhersehbar geworden. Libby atmete tief ein und sprang mit einem Satz in den Bus.
Im hinteren Bereich des Unterdecks fand sie einen Platz und setzte sich. Wenn das nicht spontan war, dachte sie zufrieden und biss von ihrem Croissant ab. Im gleichen Moment sah sie auf der elektronischen Anzeigetafel, dass sie im 88er-Bus zum Clapham Common saß. Meinetwegen, dachte sie, fahren wir zum Clapham Common!
Der Bus setzte sich in Bewegung, und Libby musterte die anderen Passagiere. Vor ihr steckten zwei Teenager die Köpfe zusammen. Sie teilten sich ein Paar Ohrstöpsel, aus denen blechern die Musik heraussickerte. Auf der anderen Seite des Ganges saß eine alte Dame, die eine Klarsichtregenhaube auf dem silbergrauen Haar trug und den Griff ihres Einkaufswägelchens fest umklammert hielt. Dahinter, ein paar Plätze weiter rechts, beugte sich eine junge Frau mit einem Haarknoten konzentriert über ein zerlesenes Exemplar von Stolz und Vorurteil. Ihre Lippen bewegten sich beim Lesen, sie war völlig in die Geschichte vertieft und drehte beim Lesen unbewusst an einem Knopf ihrer Strickjacke. Als Libby sie beobachtete, fiel ihr plötzlich Frank ein, der alte Mann, den sie am Samstag zuvor im Bus getroffen hatte. Was hatte er noch einmal gesagt? Im Bus kann man gut zeichnen lernen, da gibt es immer interessante Modelle.
»Camden Town Station, Camden Street«, verkündete die automatische Stimme. Die Frau mit dem Buch stand auf und ging zur Tür, ohne den Blick von der Seite zu heben. Sie stieg aus und sah auch nicht auf, als sie ihren Weg fortsetzte, wie Libby beeindruckt bemerkte.
Neue Passagiere stiegen ein, und Libby staunte nicht schlecht bei dem Anblick, der sich ihr jetzt bot. Ein großer, dünner Mann, dessen zu Spitzen gedrehte Haare einen Irokesenkamm bildeten, kam mit langen Schritten durch den Gang. Er war vielleicht Mitte dreißig und trug eine schwarze Lederjacke, Röhrenjeans und Doc Martens. An seinem Gürtel hing eine Kette, die beim Gehen klirrte. War das ein Punk? Gab es überhaupt noch welche? Libby war sich nicht sicher. Die beiden Jungen vor ihr stießen sich gegenseitig an und starrten den Mann an, aber der schien nicht zu bemerken, welches Aufsehen er erregte. Er setzte sich auf den Platz, den die Frau mit dem Buch frei gemacht hatte, und streckte seine langen Beine aus.
Wieder gingen ihr Franks Worte durch den Kopf. Hier war jemand, den zu zeichnen sich eindeutig lohnte, aber war sie dazu imstande? Seit Jahren hatte sie nicht gezeichnet, außerdem hatte sie gar kein Skizzenbuch bei sich und …
Spontan …
Libby machte ihre Tasche auf und kramte darin herum. Gewöhnlich hielt sie Ordnung, aber nach einer Woche mit Hector hatten mehrere Spielzeugautos, ein halb leeres Päckchen Rosinen, ein kleiner Notizblock und ein Päckchen Buntstifte hineingefunden. Libby nahm den Block und einen schwarzen Buntstift heraus und sah den Mann an.
Weil er auf der anderen Seite des Ganges saß, konnte sie nur sein Profil von der linken Seite sehen. Er hatte einen starken, kantigen Kiefer und dunkle Augen, und sein Ohrläppchen war mit kleinen Silberringen durchstochen. Aus dem Kragen seiner Lederjacke kroch eine Tätowierung den Hals hoch, aber Libby konnte nicht erkennen, was sie darstellte. Abgesehen von dem Iro war sein Kopf glatt rasiert, und die Haut sah ganz zart aus. Während Libby es sich möglichst bequem gemacht hatte, saß der Mann aufrecht auf seinem Platz und strömte das Selbstvertrauen von jemandem aus, dem es gleichgültig war, was andere von ihm dachten. Er sah wirklich außergewöhnlich aus. Libby blickte auf das weiße Blatt vor sich, dann nahm sie den Stift und fing an.
Als Libby das nächste Mal den Blick hob, sah sie mit Erstaunen, dass sie eine Einkaufsstraße entlangfuhren; es wimmelte von Fußgängern, und ein U-Bahn-Schild kündigte Oxford Circus an. Sie sah auf die Zeichnung vor sich und stöhnte stumm. Sie hatte dem Mann einen merkwürdig geformten Körper verpasst, sein Haar sah aus, als wäre es angeklebt, und quer über sein Kinn verlief eine kräftige Linie, weil der Bus im falschen Moment über eine Unebenheit gefahren war und ihr der Stift ausgerutscht war. Die Zeichnung hätte von Hector sein können, und der war erst vier. Libby riss das Blatt vom Block und wollte es schon zerknüllen, als sie das Profil noch einmal genauer betrachtete. Es war nicht gerade gelungen, aber die Form des Schädels, den kantigen Kiefer und die tief liegenden Augen hatte sie gut eingefangen. Die Skizze war sehr grob, aber wenn sie mehr Zeit darauf verwendete, könnte sie manches verbessern. Während der ganzen Fahrt hatte sich der Mann kaum bewegt. Er starrte vor sich hin, als wäre er in einer Trance. Aber er konnte jeden Moment aussteigen, und dann hätte sie keine Möglichkeit, die Zeichnung fertigzustellen. Wenn sie ihn fotografierte, dann könnte sie zu Hause weiter daran arbeiten.
Libby sah sich um. Alle Passagiere waren mit sich selbst beschäftigt und sahen aus dem Fenster oder auf ihre Smartphones. Sie zog ihres aus der Tasche, richtete es so diskret wie möglich auf das Gesicht des Mannes und machte ein Foto.
»Was soll der Scheiß?«
Beim Klicken des Auslösers war der Mann herumgefahren und starrte jetzt Libby an. Libby steckte ihr Smartphone schnell wieder in die Tasche.
»Hast du mich fotografiert?« Er sah sie aus dunklen Augen an, und Libby spürte, wie die anderen Passagiere sich zu ihr umdrehten.
»Nein … Ich meine, ja, es tut mir leid.«
Der Mann sah sie finster an. »Glaubst du, ich bin so was wie eine Touristenattraktion?«
»Nein, i-ich wollte …« Libby spürte, wie ihr die Farbe aus dem Gesicht wich. »E-es tut mir leid. Ich lösche es.«
»Stell dir vor, es wäre andersrum, und irgendein Typ fotografiert dich im Bus! Wie würde dir das gefallen?«
Die alte Frau, die vor dem Punk saß, drehte sich kopfschüttelnd zu Libby um. Libby wand sich innerlich vor Scham, sie nahm ihre Tasche und stand auf. In dem Moment glitt ihr das Blatt mit der Zeichnung vom Schoß, trudelte wie in Zeitlupe auf den Boden und landete mitten im Gang.
Scheiße! Libby sah zu, wie der Punk sich vorbeugte und es aufhob. Sie schloss die Augen und wartete auf seinen Zornesausbruch. Aber sie hörte nichts außer der fernen Musik aus den Ohrstöpseln der beiden Jungen vor sich. Als sie die Augen aufmachte, war der Mann mit einem angewiderten Ausdruck in die Betrachtung der Zeichnung vertieft. Das Schweigen zog sich in die Länge.
»Es tut mir leid«, sagte Libby, und sie hörte das Zittern in ihrer Stimme.
Er sagte nichts und studierte weiter das Blatt. Libby spürte, wie die anderen Passagiere die Luft anhielten und auf seine Reaktion warteten.
»Die Zeichnung ist sehr schlecht geworden«, sagte Libby ganz leise.
Der Mann hob den Kopf und sah Libby in die Augen. Einen Moment lang erwiderte sie seinen Blick, unschlüssig, was sie tun sollte. Dann sprang sie auf und hastete, von einem Gefühl der Erniedrigung überwältigt, zur Tür.
4
PEGGY
Nichts liebe ich mehr als eine dramatische Einlage im Bus.
Habe ich dir mal erzählt, dass ich in den Sechzigerjahren auf dem Oberdeck eines 74er eine echte Schlägerei miterlebt habe? Ein paar Mods saßen im Bus, und am Earl’s Court stieg eine Gruppe von Rockern ein. Erst flogen nur ein paar Beschimpfungen hin und her, aber im nächsten Moment griffen die Jungs sich gegenseitig an und warfen leere Bierdosen über die Sitze. Die meisten Passagiere suchten bei den ersten Anzeichen der Schlägerei das Weite, aber du kennst mich, ich bin geblieben und habe mir das Schauspiel angesehen, bis die Polizei kam und die Jungen aus dem Bus schaffte.
Und weißt du noch damals, als wir im 205er saßen und miterlebt haben, wie ein junger Mann – er war ganz dünn und hatte einen billigen Anzug an – sich vor seiner Freundin hinkniete und ihr einen Heiratsantrag machte? Ich erinnere mich noch, dass wir alle mit angehaltenem Atem auf ihre Antwort warteten, und als sie Nein sagte, war das für den armen Kerl so peinlich, dass er an der nächsten Haltestelle ausstieg.
Also, jetzt erzähle ich dir von dem Drama, das sich gestern ereignete. Der Anfang war äußerst vielversprechend. Als ich eine laute Stimme hörte, wusste ich sofort, dass es der junge Mann hinter mir war. Er war mir gleich aufgefallen, als er in den Bus stieg. Früher waren in London jede Menge Punks unterwegs, aber das ist Jahre her, jetzt habe ich lange keinen mehr gesehen, außer den freundlichen Mann, der in der Oxford Circus Station arbeitet und mir damals so nett geholfen hat, als mein Einkaufswägelchen in der elektronischen Sperre stecken geblieben war. Dieser Junge gestern im Bus, der war viel zu jung, um ein Originalpunk zu sein, aber er sah überzeugend aus mit seiner Irokesenfrisur und den schwarzen Klamotten und dem zornigen Gesicht. Er war sauer auf ein Mädchen auf der anderen Seite des Ganges, das ein Stück Papier in der Hand hielt und wie Espenlaub zitterte.
Im ersten Moment dachte ich, der Punk hätte sich an das Mädchen rangemacht, und wollte ihm schon gehörig die Meinung sagen, aber da fing er an zu sprechen, und ich hielt mich zurück. Es stellte sich nämlich heraus, dass es andersherum war: Das Mädchen hatte mit ihrem Smartphone ein Foto von dem Mann gemacht. Bitte schön, nur wenn eine so dumm ist, dass sie sich bei so was erwischen lässt, muss sie die Folgen in Kauf nehmen. Das Mädchen sah aus, als würde es gleich in Tränen ausbrechen, und es tut mir leid, aber ich habe missbilligend den Kopf geschüttelt. Mal ehrlich, die jungen Leute heute sind so empfindlich, da ist es kein Wunder, dass die Welt vor die Hunde geht.
Jedenfalls, das Mädchen stand auf und wollte aussteigen, und dabei fiel ihr ein Blatt Papier vom Schoß auf den Boden. Ich wollte es aufheben, nur war der junge Mann schneller und hatte es schon in der Hand. Trotzdem gelang es mir, einen kleinen Blick zu erhaschen, und du ahnst nicht, was auf dem Blatt war. Das Mädchen hatte eine Bleistiftskizze von dem jungen Mann gemacht, einfach so, während der Fahrt!
Stell dir das mal vor. Was für ein Zufall ist das?
Und dann passierte etwas ganz Merkwürdiges. Als ich die Zeichnung sah – sie war übrigens keinesfalls schlecht –, kam mir plötzlich diese Erinnerung. Ich konnte fast den Bleistift in meiner Hand spüren, wie er über das raue Skizzenpapier fuhr, während der Bus holpernd und schaukelnd durch die Stadt fuhr. Und es war mir, als wäre es damals, vor all den Jahren, und ich saß auf meinem Platz und die Erinnerungen rauschten über mich hinweg. Dann zerstoben sie, und ich war wieder die alte Frau und saß im 88er-Bus auf dem Weg zum Piccadilly Circus.
Inzwischen war das Mädchen ausgestiegen, und ich drehte mich zu dem jungen Mann um. Er starrte immer noch auf die Zeichnung, und ich wartete darauf, dass er sie zerknüllen und auf den Boden werfen würde. Aber stattdessen faltete er sie ganz sorgfältig zusammen und steckte sie in seine Jackentasche. Erst dann hob er den Blick, und ich musste mich schnell umdrehen, damit er nicht auf die Idee kam, ich hätte ihn beobachtet.