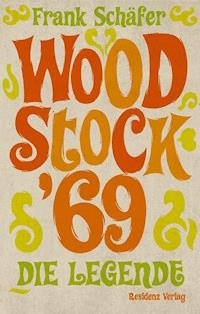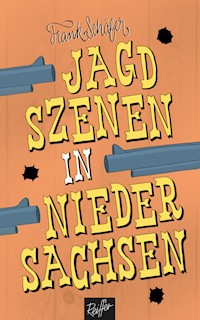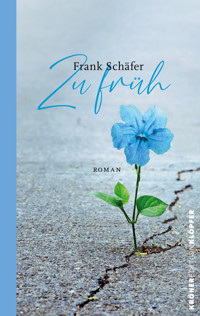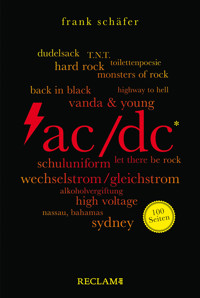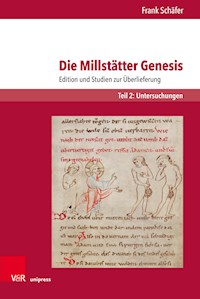9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Keine Frage, Heavy Metal ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das schlägt sich auch in dem wachsenden Interesse der Mainstream-Medien nieder. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hebt eine Vielzahl Konzertmitschnitte und Dokumentationen ins Programm. Die ARD hat das Wacken Open Air entdeckt und mit einer täglichen Berichterstattung geadelt. Und die Wissenschaft überlegt schon seit einer Weile, mit den 'Metal Studies' ein eigenes Fach einzurichten und so dem Genre eine nie gekannte Würde zu verleihen. Der gemeine Metalhead reagiert auf diese Entwicklung eher argwöhnisch, weil etwas von seiner geliebten Dissidenz abhandenzukommen droht. Er hat schon immer ein feines Gespür gehabt für kommerzielle Vereinnahmungsversuche und seine Abneigung dagegen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. 'Posertum', 'False Metal', 'Commercial Fuck' heißen die Vorwürfe, die sofort zum Liebesentzug seitens der Szene führen. Frank Schäfer ist Metal-Fan der ersten Stunde, also 'true', wie es 'truer' nicht geht. In seiner METAL ANTHOLÖGY stimmt alles, bis hin zu den Punkten auf dem Ö. Es sind wahre Geschichten, die der Autor hier erzählt. Gelegentlich satirisch angeschrägt, aber immer selbst erlebt (oder gehört). Er holt Tony Jasper aus der Versenkung, den Mann, der mit der HM Show Pionierarbeit im Radio geleistet hat, sucht nach unterschätzten Meisterwerken im Plattenschrank, besucht die einschlägigen Festivals, erinnert sich an die goldenen Jahre des Genres und findet sich schließlich auf einer abenteuerlichen Schwermetall-Kreuzfahrt wieder. METAL ANTHOLÖGY ist ein kurzweiliger, reich illustrierter Reiseführer durchs Eisenland. In der abwechslungsreichen Text-Bild-Collage erfährt der Leser viel Wissens- und Liebenswertes über die Rituale, Gründungsmythen, Trinkgewohnheiten, Sprüche und nicht zuletzt das erstaunliche Liebesleben seiner Bewohner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Frank Schäfer
METAL ANTHOLÖGY
Ansichten und Meinungen eines Schwermetallsüchtigen
Statt eines Vorworts
Zwei Polizisten stehen mit ihrem Hund vor einer Konzerthalle. Sie sollen aufpassen, dass nichts passiert. Drinnen spielen Motörhead. Kommt ein Kuttenträger raus, geht zielgerichtet zum Hund, hebt den Schwanz an, mustert interessiert das Darunterliegende und verschwindet dann wieder in der Halle, als wäre nichts geschehen. Die Polizisten wundern sich.
Ein paar Minuten später kommt ein weiterer Metalhead heraus, geht schnurstracks zum Hund, hebt den Schwanz an, schaut nach und verschwindet dann ebenfalls wieder nach drinnen. Die Polizisten wundern sich entschiedener.
Ein dritter Metaller verlässt die Halle. Alles wie zuvor. Aber ihn stellen die Polizisten zur Rede.
»Was soll ’n das? Du bist schon der Dritte …«
»Eben am Merchandise-Stand meinte einer: ›Draußen steht ein Hund mit zwei Arschlöchern.‹«
Der Mann im Motörhead-Shirt verabschiedet sich.
Die Polizisten schauen nun ebenfalls nach.
1
Blindgänger
I
Andreas und ich sahen uns regelmäßig auf Partys und in den Kneipen und Läden, die man aufsuchen musste, wenn man hier wohnte, im Plattland. Man konnte sie an einer Hand abzählen. Selbst das örtliche Müsli-Café avancierte trotz all der Vollkornschädel und linksdrehenden Milchgesichter zu einer ernst zu nehmenden abendlichen Begegnungsstätte. Und man ahnte wohl, dass da noch was sein musste, dass da was fehlte zum großen Leben, aber was das sein sollte, wusste niemand. Andreas war 20, drei Jahre älter als ich, selbstständiger Zimmermann und fuhr einen silbernen Golf. Der war allerdings Gold wert in diesen Breiten, und vielleicht kannte ich ihn auch nur deshalb so gut, weil man eine Mitfahrgelegenheit immer gebrauchen konnte.
Aber seit einer guten Woche verband uns noch etwas. Wir hatten auf einer Party Frauen kennengelernt, und diese beiden Grazien waren gute Freundinnen, beste Freundinnen. Petra war groß und laut, ihr Haar sehr blond, lang und sanft gewellt. Sie betrank sich gern, trug stonewashed Jeans, und ihre griffige Opulenz gab mir zu denken. Fast wie im Widerspruch dazu war sie ziemlich gut in Mathe. Angelika war überall gut, dünn, flachbrüstig, besaß aber einen sehr weiblichen Hintern, ließ sich von ihren Eltern sehr feine Kleidung aus Italien bezahlen, immer wieder Hosenanzüge, und sah schon im zwölften Jahrgang aus wie die unabhängige, vollemanzipierte Geschäftsfrau, die sie mal werden wollte. Die Farbe ihres Haares glich der eines wertvollen antiken Möbelstücks. Irgendwas mit Braun.
Die beiden waren im Grunde so gegensätzlich wie Andreas und ich, nur schien dieser Umstand ihre Freundschaft im Innersten zusammenzuhalten, während wir einfach aneinander vorbeiredeten. Aber als er sich ein paar Tage nach dieser Feier telefonisch bei mir meldete, war ich kaum überrascht.
»Coole Feier, letzte Woche.«
»Ganz nett.«
»Nett? Ich meine, was ihr da hinter der Garage getrieben habt, sah wirklich nicht aus wie ›ganz nett‹. Das sah eher aus wie …«
»Ziemlich nett!«
»Schon eher.«
»Aber du kannst dich wohl kaum beschweren«, sagte ich mit einem schlecht gespielten Lachen. Dieses Gespräch unter Männern war mir peinlich.
»Deshalb rufe ich auch an.«
»Wegen Angelika?«
»Wegen Angelika und Petra«, sagte er, und man hörte seiner Stimme das schmierige Grinsen an. »Am Wochenende hat Petra sturmfrei, ihre Eltern sind auf Sylt. Angelika leistet ihr Gesellschaft. Na, jedenfalls rief sie gestern bei mir an. Rat mal, wer noch kommen soll.«
»Und wann soll unsere kleine Party stattfinden?«
»Morgen Abend! Sei dabei oder sei ein faules Ei!«
»Na, dann bin ich wohl besser dabei.«
»Um acht hol ich dich ab!«
II
»Hattest du nicht acht gesagt?« Ich hatte schon seit einer guten halben Stunde auf Andreas gewartet, an den Jägerzaun meiner Eltern gelehnt, der mir langsam peinlich zu werden begann, und stieg nun in seinen verquanzten silbernen Golf. Ich hatte Angst, meine nagelneue 501 dreckig zu machen, weil der Beifahrersitz von einer Streu aus Asche und Tabakkrümeln übersät war. Dunkle Flecken auf dem Polster. Cola, Bier, Sekret. Ich setzte mich immer gern nach hinten, wenn Andreas uns chauffierte. Heute hätte es komisch ausgesehen.
»Profis kommen immer etwas zu spät!«
»Profis?« Im Abholen?
»Nur ’n Spruch.«
Andreas drehte jetzt die Musik lauter, wohl um sich nicht weiter erklären zu müssen.
»I’M BLIND IN TEXAS … TEXAS …«
Ich erkannte W.A.S.P. an der Raspelzunge von Blackie Lawless. Er werkte gerade am Chorus herum. Radau und Rumpeldipumpel, das war die passende musikalische Untermalung für Massey Ferguson und Zuckerrüben bis zum Stacheldraht. Im Schatten der Grenztürme gedeiht das Echte Eisenkraut.
»Wo fährst du denn lang?«
Einen Umweg offenbar. Zwei Dörfer und ein schmaler vom Löwenzahn ausgebeulter Wirtschaftsweg mehr.
»Mensch, liest du keine Zeitung? Kam sogar durchs Radio … Die Brücke ist gesperrt, weil so ein paar Schatzsucher, diese Typen mit Metallsuchgeräten, in der Nähe einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ausgegraben haben. Der wird jetzt wohl gerade entschärft. Würde ich gern mal sehen, so ein Ding. Meine Mutter kann sich noch erinnern, dass damals in der Nähe ein Tommy runtergekommen ist, und der hat dann wohl vorher noch seine Eier abgeworfen. Witzigerweise genau an dem Ufer, wo wir auch schon mal gegrillt haben.«
»Und wo wir die zwei aus der Dreizehnten beim Vögeln gestört haben«, sagte ich. Wir waren durch das Unterholz zum Ufer hinuntergestiegen und hatten gerade noch gesehen, wie zwei Nacktärsche, jeder mit einem Bündel Klamotten im Arm, vor uns davonrannten.
Andreas dachte einen Augenblick nach.
»Stell dir mal vor, die hätten es auf der Bombe getrieben, genau da drüber, meine ich … Und wenn die beiden dann so richtig in Fahrt gekommen wären, die Vibrationen …«
»Du meinst, wir haben denen eigentlich das Leben gerettet? So habe ich das bisher noch gar nicht gesehen.«
Andreas winkte lachend ab.
Wir fuhren an Spargelfeldern vorbei, auf denen, obwohl es bereits so spät am Abend war, noch Menschen die Reihen abgingen, auf der Suche nach der leicht aufgeworfenen Erde, die ein untrügliches Zeichen für den kalten weißen Stängel war, der darunter wuchs und zur wärmenden Sonne drängte. Wie wir alle.
Andreas ging in die Eisen. Ich hatte nicht bemerkt warum. Er stieg aus und hockte sich vor dem Wagen hin. Ich folgte ihm und sah den zusammengerollten Igel. Er holte seine Arbeitshandschuhe aus dem Heck des Wagens, hob das Tier sanft auf und trug es über den Grünstreifen hinweg ein paar Meter hinaus aufs Feld.
»Hast du gut gemacht!«, sagte ich und nickte ihm zu.
Andreas wurde fast wütend.
»Ich will die Kiste nächsten Monat verkaufen, hab keine Lust, dass mir so ein kleines Scheißviech die Schürze verbeult.«
III
Wir wurden von zwei leicht angeschickerten Mädchen empfangen. Ich hatte Petra seit dem Wochenende nicht gesehen, und da waren wir beide ziemlich betrunken gewesen; sie durchbrach diese kurze Peinlichkeit, indem sie kumpelhaft mein Haar zerzauste, kam dann aber doch näher, um mir einen weinsauren Kuss auf den Mund zu hauchen, der direkt in den Unterleib ging.
Andreas und Angelika machten ebenfalls ein bisschen an sich herum. Sie quietschte bereits mit zurückgeworfenem Kopf, während er an ihrem Hals saugte.
Petra nahm mich bei der Hand und zog mich ins Wohnzimmer. Die anderen beiden folgten uns.
»Wollt ihr was trinken?«, fragte Petra.
Ich bejahte.
Andreas überlegte etwas länger, nickte dann aber auch.
»Und was?«
»Bier?«, fragte Andreas.
»Bier, na klar«, sagte Petra und eilte schon aus dem Raum.
»Für mich auch, bitte«, rief ich ihr hinterher.
»Ich weiß.« Sie wandte den Kopf leicht und lächelte verschlagen.
Petra kehrte mit den Getränken zurück, hielt mir eine der Jever-Flaschen hin und beugte sich zu mir herüber, legte ihre Stirn an meine. Ich roch ihr Parfüm. Und schon entzog sie sich wieder, stellte Andreas das Bier auf den Tisch. Er lag mittlerweile halb auf dem Sofa, Angelika über sich.
»Na, wenigstens kein Warsteiner«, grinste er, während er sich mühsam aufrichtete.
Angelika huschte zur aufgeklappten Bar, holte den kalifornischen Rotwein und schenkte sich das Glas so voll, wie es sich gerade noch gehört, dann reichte sie den Wein weiter, und Petra kümmerte sich gar nicht erst um Etikette. Sie musste erst mal vorsichtig einen großen Schluck abtrinken, sonst wäre möglicherweise Wein auf ihr hellblaues T-Shirt geschwappt, in das man sie nackt eingenäht hatte.
»Einen Toast«, sagte Angelika nun und hob das Glas auf Augenhöhe, als wollte sie das Getränk auf seine Farbe überprüfen.
»Jetzt was essen?«, sagte Andreas.
Petra verschluckte sich und wurde knallrot, ihr blondes Haar fegte durch die Luft, während sie sich vor Lachen schüttelte. Ich fühlte mich auf einmal wohl. Wie früher, samstags nach dem Baden, wenn das ganze Fernsehprogramm vor einem lag, und mein Vater und ich uns wie an jedem Wochenende verständigt hatten, nach dem Aktuellen Sportstudio ausnahmsweise noch den Spätwestern zu schauen.
Petra setzte sich zu mir auf die Sessellehne.
»Warum kommt ihr eigentlich jetzt erst?«
»Weil Andreas ein Profi ist.«
»Wie kommst du eigentlich nach Hause?«, sagte Andreas.
Ich lachte.
»Wir mussten über die Dörfer«, sagte er. »Die haben doch die Brücke gesperrt wegen der Bombenentschärfung.«
»Ach ja, lief im Radio.«
Sie wandte sich an Angelika. »Das muss da gewesen sein, wo wir schon mal gegrillt haben. Komischer Gedanke, oder? Auf einer Bombe gesessen zu haben.«
»Gibt’s eigentlich was Langweiliges im Fernsehen?«, fragte Andreas und grinste Angelika zudringlich an.
Sie reagierte sofort, schenkte sich noch mal ihr Weinglas voll bis zum gedachten Eichstrich, der die guten von den schlechten Manieren trennte, und setzte dann ein Lächeln auf, das verführerisch sein sollte.
»Kommst du mal mit«, ihr Zeigefinger rollte sich mehrmals ein und wieder aus wie eine Jux-Tröte beim Fasching, »ich möchte dir was zeigen.«
Die beiden Frauen warfen sich Blicke zu, und Petra schien diese Schmierenkomödie ein wenig peinlich zu sein.
Angelika nahm Andreas bei der Hand, und sie schloss ganz leise die Tür hinter sich, wie um uns nicht aufzuwecken.
»Was zeigt sie ihm denn? Das Schlafzimmer deiner Eltern?«
Petra lachte nervös, und es tat mir gleich leid. Sie stand auf und stürzte den Rest des Kaliforniers ins Glas und die Pfütze genauso schnell hinunter.
Jetzt musste ich lachen.
Sie fuhr erschreckt herum, sah mich an und lachte dann mit. Dann ging sie zum Fenster, zog die langen Vorhänge zu, und noch während sie mir den Rücken zukehrte, pellte sie sich ihr T-Shirt vom Leib. Jetzt wusste ich, warum sie so angespannt wirkte. Sie drehte sich um. Ihre Haut schimmerte in der künstlichen Dämmerung, die untergehende Sonne drang nur noch gedämpft ins Zimmer. Sie lächelte etwas verlegen, was ich ziemlich umwerfend fand.
Ich sprang auf und blieb unschlüssig stehen. Ihre nackten Schultern weckten einen alten Beschützerinstinkt in mir, dabei hatte sie das alles hier arrangiert. Sie seufzte ironisch. Ich ging ihr entgegen, umarmte ihre Hüften, legte meinen Mund auf die sanfte Beugung zwischen Hals und Schulter. Sie seufzte wieder, immer noch ironisch. Sie zog mir mein T-Shirt über den Kopf. Ich spürte ihre Brüste. Und der Einäugige machte Männchen.
Wir taten das, was Menschen tun. Wir waren wirklich nichts Besonderes, und trotzdem kam es mir so vor. Ich leckte ihren Bauchnabel aus, als hätte ich das gerade erfunden, und Petra wand und krümmte sich, und dann lagen wir übereinander auf dem Ledersofa wie vorher Andreas und Angelika, nur ohne Klamotten, bis auf meine albernen Boxershorts mit Stopp-Schildern drauf und ihren ausgewaschenen Frottee-Slip, lutschten und rieben einander ab.
»Scheiße …«, sagte ich, gedemütigt von meinem eigenen Körper.
»Oooh«, lachte sie, ganz ohne Häme. Sie lachte für mich. »Ach, kein Problem, das geht wieder raus …«
»Das meine ich nicht.«
»Ich weiß.«
Ich schmollte, weil es mir nicht gelang, ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben. Sie schwang sich behend vom Sofa, ging zum elterlichen Phonoturm, ich sah ihrem divinatorischen Herzarsch hinterher, und in meinem feuchten Schritt begann es zu jucken. Sie beugte sich nach unten, um in den CDs zu kramen, sodass immer mehr Stoff in die Spiegelachse rutschte und eine Backe fast freilegte. Sie zog ihren Slip zurecht und ächzte, vermutlich über den Trash, den sie da vorfand, schien dann aber doch auf etwas gestoßen zu sein.
I met a devil woman,
She took my heart away.
She said I had it comin’ to me,
But I wanted it that way.
Sie schlich zurück zu mir, sie schien tatsächlich auf Zehenspitzen zu gehen, legte sich dann halb auf mich drauf und lehnte ihren Kopf an mein Kinn.
I think that any love is good lovin’.
So I took what I could get ooh … ooh …
She looked at me with big brown eyes and said …
»Hey, du musst nicht sauer sein … Ich sehe das jetzt mal als Kompliment.«
Sie stützte sich mit dem Unterarm auf meiner Brust ab und lachte mir schamlos ins Gesicht, und da lag wieder diese Offenheit und Wärme in ihrem Lachen, die ihm jede Schärfe nahm. Und Randy Bachman, der alte Zausel, protokollierte auch noch mal, was sein Mädchen damals zu ihm gesagt hatte, als ob das nötig gewesen wäre.
You ain’t seen nothin’ yet.
B-B-B-B-B-Baby you just ain’t seen nothin’ yet.
Here’s something you’re never gonna forget.
B-B-B-B-B-Baby you just ain’t seen n-n-nothin’ yet
(you ain’t been around) …
IV
»Mach mal das Radio an, Alter!« Wir fuhren jetzt bereits fünf Minuten, und noch hatte keiner von uns ein Wort gesagt. Andreas sah ziemlich kaputt aus. Er hatte den ganzen Tag auf dem Dach gearbeitet.
»Mach selber«, sagte er, »aber nicht schon wieder Kassette. Ich kann W.A.S.P. nicht mehr hören.«
Kurz nach Mitternacht hatte Angelika sanft an die Wohnzimmertür geklopft und gefragt, ob wir »so weit seien«, Andreas wolle jetzt fahren. Ihre Stimme klang anders als sonst. Wir schlüpften eilig in unsere Sachen, und als wir schließlich an der Haustür standen, wartete Andreas schon im Auto. Angelika saß auf dem Klo. Man hörte ihr leises Pieseln durch die Tür. Unsere Zungen verabschiedeten sich zum wiederholten Mal, und wir versicherten uns gegenseitig, dass es trotz allem ein schöner Abend gewesen war, und genierten uns beide etwas, als wir es aussprachen, aber offenbar wollten wir auch beide, dass es gesagt wurde. Morgen würden wir telefonieren. Ja, morgen! Gegen Abend. Ja, gegen Abend.
»Mann, Mann, Mann.« Andreas stöhnte und schüttelte genervt den Kopf.
»Was denn?«
Im Radio lief Love Is A Battlefield. Ich drehte weiter zum Kultursender.
»Hör mir auf.« Er stöhnte noch einmal laut auf. Man spürte seine Abgespanntheit.
»Muss ja ein wilder Abend gewesen sein …«
»Das kann man wohl sagen, aber nicht, wie du denkst. Aber erzähl du erst mal. Wie war’s bei euch?«
»Gut … was denn sonst?«
»Ich frage ja nur.«
»Das volle Programm«, sagte ich und hielt mich einmal mehr für einen Idioten.
»Na, dann ist ja alles in Butter.«
Das lokale Kulturradio brachte jetzt ein Interview mit dem Mann, der die Bombe entschärft hatte. Vermutlich war diese Sensation jede Stunde wiederholt worden, den ganzen Abend lang. So machten die das immer. Dass er danach noch ein Interview geben konnte, nahmen wir als Indiz dafür, dass er seinen Job akkurat erledigt hatte.
»War da wirklich Gefahr im Verzug?«, fragte der Interviewer, ein Student, der hier seine ersten journalistischen Gehversuche machte, die Frage klang wie schlecht abgelesen. »Oder hätte die Bombe da noch Jahre liegen können, ohne dass etwas passiert wäre? Unter Jugendlichen ist dieser Platz ja ein beliebter Treffpunkt.«
»Dann leg lieber W.A.S.P. ein!«
»Warte mal«, beruhigte ich ihn, denn ich wollte den Helden des Tages hören.
»Gefährlich sind diese alten Schachteln immer … Wir nennen diese WK-II-Relikte alte Schachteln … Jede ist anders, jede hat ihre Macken, man muss sich voll auf sie einstellen, sonst werden sie böse.«
Andreas drückte die Kassette rein.
»Deshalb ist der im Radio und nicht sein Kollege, der den Zünder in Wirklichkeit rausgeschraubt hat«, sagte ich. »Weil der dieses kleine bisschen Story am besten verkauft.«
»Meinst du?«
»Klar, so läuft das doch überall …«
Andreas war den kürzeren Weg über die Brücke gefahren. Wir gingen einfach davon aus, dass sie noch stand. Und während wir uns ihr näherten, fiel mir etwas ein.
»Halt doch mal an!«
Andreas nickte nur, weil er offensichtlich ebenfalls daran gedacht hatte, und parkte den Golf am Straßenrand, 100 Meter vor der Brücke. Als wir ausstiegen, wehte Musik vom Flussufer herüber. Andreas ging voran, den schmalen stockdunklen Trampelpfad entlang, der durch ein kleines Waldstück und dann zu einem deichartigen Abhang führte, der wiederum in eine schmale Wiese auslief, die schließlich vom Fluss begrenzt wurde. Bereits im Wald sahen wir den Feuerschein über der Senke. Als wir am Rand des Abhangs anlangten, tanzten, standen, saßen gut 40 Menschen in einiger Entfernung von einem Feuer. Es war immer noch sehr warm draußen. Auch hier hörte man Oldies, Blinded By The Light von Manfred Mann schickte diese Versammlung zurück in die 70er. Der wahllos aufgestapelte, offenbar gerade erst angesteckte Holzstoß brannte in der Mitte einer frisch ausgehobenen Erdmulde. Sie sah aus wie ein kleiner Krater.
»Wenn die hochgegangen wäre, hätte es ein größeres Loch gegeben«, sagte Andreas.
»Wollen wir runter?«
Ich hatte ein paar der Gestalten identifiziert. Um ein paar Bier abzustauben, kannten wir sie gut genug.
»Ich bleibe hier oben«, sagte Andreas entschlossen und setzte sich ins Gras. Es war noch warm. Wir saßen den Blicken entzogen in einem kleinen dunklen Nirgendwo, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig abliefen.
»Du wolltest im Auto noch was erzählen?«
Andreas stöhnte schon wieder, als ob das alles über seine Kräfte ging. »Das war ein Abend …« Er schüttelte den Kopf. »Kaum waren wir oben in Petras Zimmer, geht sie mir an die Hose, wie das ja irgendwie zu erwarten war, oder?«
»Kann man sagen.«
»Hört dann aber plötzlich auf und sieht mich lächelnd an. Sie will unheimlich gern mit mir schlafen, aber da ist noch etwas, was sie mir vorher sagen muss. Sie hat einen Typen, und den will sie nicht verlassen, der darf also von der ganzen Sache nichts erfahren. Wir können uns ruhig gelegentlich treffen, aber mehr ist nicht drin.«
Ich sah ihn an.
»Und wo ist dein Problem?«
»Mann, du Blindgänger … das ist mein Problem. Ich komme mit so ’ner Scheiße nicht klar.«
»Ja, du hast recht.«
Ich wusste eigentlich nicht, warum ich ihm zustimmte, aber ich hatte ein gutes Gefühl dabei.
Ein paar mit ungutem Feedbackgekreisch eingeleitete Moll-Akkorde kündigten einen alten Song von Black Sabbath an.
»War Pigs oder Children Of The Grave«, sagte Andreas.
»Nee«, ich schüttelte den Kopf, »Snowblind.«
2
Metal & Lyrik
»Schon das neue Metallica-Album gehört? Lulu?«»Ja! Da musste ich ganz doll lulu und hinterher kackkack und kotzkotz auch noch.«
Bei einem Jubiläumskonzert der Rock and Roll Hall of Fame in New York standen Metallica und Lou Reed erstmals gemeinsam auf der Bühne. Im Oktober 2009 war das. Die selbst nicht mehr ganz so jungen Wilden halfen dem lebenden Avantgarde-Fossil damals, seine Standards Sweet Jane und White Light/White Heat noch einmal richtig aufzubürsten. Das scheint nicht nur live gut harmoniert zu haben, das entspricht auch so recht der feudalistischen Machtpolitik des Pop – Arrondierung des Herrschaftsterritoriums durch Vermählung. Also hat man den One-Night-Stand nachträglich noch mit einem richtigen Album legitimiert: Lulu. Und tatsächlich scheint es sich hier für beide Seiten um eine echte Zugewinngemeinschaft zu handeln. Lou Reed lässt sich von der lauten Backing Band mal wieder so richtig den Staub aus den Falten pusten. Und Metallica, die kommerziell längst alles erreicht haben, was im Heavy Metal möglich ist, schöpfen nun endlich symbolischen Mehrwert ab, partizipieren am Kunst-Nimbus der Legende.
Metallica mögen also strategisch wieder einmal alles richtig gemacht haben, musikalisch konnten sie nicht falscher liegen. Zunächst fühlt man sich vielleicht ein bisschen an ihre Garage Inc.-Werkabteilung erinnert, in der sie immer mal wieder Einflussforschung in eigener Sache betrieben, nämlich ihre frühen Lieblingssongs gecovert haben. Hier spielen sie (sich) auf als Wiedergänger von Velvet Underground, die nun aber ganz sicher nicht in ihren Traditionszusammenhang gehören. Deren klabauterndes Kunst-Dilettantentum nimmt man ihnen an keiner Stelle dieses mit über 85 Minuten sehr langen, viel zu langen Albums ab.
Es sind bei der Kollaboration auch keine eigentlichen Songs entstanden, sondern Lyrik-Deklamationen mit betont reduziertem, irgendwie artifiziell klingendem Hintergrund-Krach. Ein paar klassische Streicher da und dort betonen noch die überlebensgroße Prätention. Der Musik kommt hier ausschließlich illustrative Funktion zu. Reeds phlegmatischer Sprechgesang wird kaum einmal melodisch eingebunden, er schlingert gleich einer verunglückten Karaoke-Performance enervierend lustlos und uninspiriert vor diesen teilweise wohl auch improvisierten Metal-Songskizzen. Das vorab ausgekoppelte The View klingt da mit seinem von Hetfield hübsch gebelferten Chorus-Rudiment, das Reed dann später noch einmal aufnimmt, fast schon untypisch eingängig. Wie wenig das alles zusammenpasst, offenbart sich am deutlichsten in Mistress Dread, einer einzigen Riff-Endlosschleife, in dem sich Metallica mal auf ihre Thrash-Provenienz besinnen – da hängen sie den Alten einfach ab. Jazz & Lyrik war meistens ein Missverständnis. Metal & Lyrik ist es nicht minder.
Dabei machen Lou Reeds expressive bis hermetische Gedichte, ursprünglich geschrieben für Robert Wilsons Inszenierung der Lulu-Dramen von Frank Wedekind, noch den meisten Effekt. Lulu ist »das wilde, schöne Tier«, die ganz natürlich triebhafte Femme fatale, für die sich die Männer reihenweise umbringen. Die durch sie personifizierte Emanzipation und Entgrenzung der weiblichen Sexualität wird am Ende vom entfesselten Puritanismus in Gestalt des Hurenmörders Jack the Ripper wieder in die Schranken gewiesen, weil sie dem Bürgertum einfach zu bedrohlich erscheint. Ein gefundenes Fressen für den ewigen Renegaten Lou Reed, der sich hier einmal mehr der expressionistischen Lust am Hässlichen, Abseitigen, Outrierten hingeben darf, dem »aristokratischen Vergnügen, zu missfallen« (Baudelaire). Das schon bei Wedekind ziemlich widerwärtige Ende Lulus durch den Frauenmörder lässt er sich da naturgemäß nicht entgehen, deutet es aber, in dem expliziten Splatter-Song Pumping Blood, um zu einer letzten totalen, alles verzehrenden Liebe. »As I pump more blood / And it seeps through my skin / Will you adore the river / The stream, the trickle / The tributary of my heart.«
Am schönsten ist das Präludium Brandenburg Gate, in dem Lou Reed in die Rolle eines »small town girls« schlüpft, einer Gegenwarts-Lulu sozusagen, die sich im Halbschlaf, von Drogen und dem morbiden Charme der nächtlichen Berliner Stadtszenerie affiziert, in eine Film-Noir-Kulisse aus dem frühen 20. Jahrhundert hineinträumt. »I would cut my legs and tits off / When I think of Boris Karloff and Kinski / In the dark of the moon / It made me dream of Nosferatu / Trapped on the isle of Doctor Moreau / Oh wouldn’t it be lovely.« Reed wäre wohl am liebsten selbst dort. »Straight up to illusion and fantasy’s fusion / Of reality mixed with drink / I’m just a small town girl who’s gonna give life a whirl / Looking at the Brandenburg Gate.«
Als Lyrikbändchen hätte Lulu also unter Umständen funktionieren können. Als Album ist es kläglich gescheitert. Als Metallica-Album nicht mal der Rede wert.
3
Kein Eis
Der Eisverkäufer in meinem Lieblingskino war ein echter Buddhist. Der Weg ist das Ziel, sagte er sich jeden Abend aufs Neue, wartete die Langnese-Pause ab, kam ruhigen, fast gemessenen Schrittes mit seiner Kühltasche durch die Seitentür und stellte dem unruhigen, nach den vielen miesen Werbefilmchen schon ziemlich an den Nägeln kauenden Publikum lächelnd seine Frage: »Möchte vielleicht jemand ein Eis?«
Er hätte eigentlich auch fragen können: »Möchte vielleicht jemand einen nicht sehr intelligenten Spruch auf meine Kosten machen, der eigentlich nur einen Zweck hat, nämlich den, mich zu erniedrigen?« Niemals hätte er so gefragt, denn er ruhte tief in seinem Glauben, aber er hätte es tun können, und keiner hätte ihm einen Strick daraus drehen dürfen, denn eins stand ja fest: Ein Eis wollte nie jemand!
Dann kam das Kinosterben. Sein Chef bat ihn in sein Büro.
»Sorry, Schorse, ich muss dich entlassen, es will einfach keiner dein Scheißeis!«
Der Eisverkäufer aber bat um eine letzte Chance. Er bettelte nicht, er bat ruhig, fast gemessen um eine Chance. Er hatte nämlich schon eine ganze Weile eine Idee mit sich herumgeschleppt.
»Na gut, Schorse, weißte, ich bin ja kein Unmensch, und es geht ja auch gar nicht gegen dein Eis oder so was. Ich bin auch gewisse Verpflichtungen eingegangen, wennde verstehst, was ich meine, ich muss sehen, dass der Laden hier rund läuft.«
Ein paar Wochen später ging es mal wieder mit den Jungs vom Heavy-Metal-Club Iron Balls Braunschweig in das Lieblingskino. Godzilla oder Dark Knight oder so was. Und es folgte nach viel zu vielen kleinen miesen Werbefilmchen immer noch unausweichlich, als hätte das Gespräch der beiden gar nicht stattgefunden, die Langnese-Pause.
Der Eisverkäufer kam ruhigen, fast gravitätischen Schrittes mit seiner Kühltasche durch die Seitentür und stellte uns Nägelkauern lächelnd seine Frage: »Möchte vielleicht jemand – ein Bier?«
Für einen Moment kehrte Stille ein in meinem Lieblingskino. Aber dann ging auch dieser Moment der Einkehr vorüber – und Knüppel fragte: »Haste kein Eis?«
Für einen Augenblick dachte ich, jetzt fällt er vom Glauben ab. Aber da kannte ich Schorse schlecht. Mit einer Leichtigkeit, als wären Federn drin, nahm er seine Kühltasche und schwebte hinweg – durch die Seitentür –, hinein in dieses unglaublich helle, warme, wunderschöne Licht.
4
Lieblingssongs
Was die Connaisseurs nie wahrhaben wollen: Ein Song wird erst deshalb zum guten Song, weil ihn Hörer dazu machen. Und Hörer machen ihn dazu, weil sie nun mal so sind, wie sie sind. Insofern kann man sich auf Geschmack genauso etwas einbilden wie auf Sommersprossen, eine Stupsnase oder wohlgeformte Kniescheiben. Borniert, das zu tun.
Auch ein Lieblingssong hat also nicht per se herausragende Qualitäten, sondern irgendwas daran geht mit Kopf, Körper und Vita eines Hörers eine glückliche und haltbare Verbindung ein und macht ihn dadurch unvergesslich. Was da passiert, lässt sich nicht erklären und schon gar nicht vermitteln, jedenfalls nicht ohne entscheidende Verluste. Man kann zwar nachträglich zu rationalisieren versuchen, was die Anklangsnerven immer wieder zum Tremolieren bringt, aber dem Mysterium wird man damit nicht wirklich auf die Schliche kommen. Andererseits erklärt man sich sogar in einer »exakten Wissenschaft« wie der Astronomie schwarze Löcher notgedrungen aus ihrer Umgebung, also gewissermaßen mittelbar, anhand der Begleitumstände.
Ich habe Renegade zum ersten Mal gehört, da bin ich gerade versetzt worden in Klasse 11. Oberstufe! Man hatte uns zuvor einiges versprochen auf diesem kleinstädtischen niedersächsischen Gymnasium. Höfliche Anrede, annähernd freie Kurswahl, Eigenverantwortlichkeit. Irgend so was. Aber es änderte sich nicht viel. »Frank, was Sie hier übersetzen, das ist nicht Sallust, das ist Verlust!« Nicht mal die Witze wurden besser.
Und dann änderte sich doch noch etwas. Ich war verzaubert von einer 14-jährigen dunkelhaarigen Schönheit, drei Jahrgänge unter mir …
Das alles hat vermutlich was mit Renegade zu tun. Einer dieser herzzerreißenden Elegien, für die Thin Lizzy seit Still In Love With You und Dancing In The Moonlight berühmt waren, für die Phil Lynott nicht nur das Gespür, sondern auch die richtige Stimme besaß. Dieses immer etwas heisere, zwischen irischer Whiskeyrüpeligkeit und fragilem tiefschwarzen Soul schwankende Sehnsuchtsorgan.
Lynott hatte schon für das Vorgängeralbum Chinatown den Peter-Green-Adepten Snowy White in die Band geholt, um neben Scott Gorham, dem Mann der gröberen Keile, auch einen adäquaten Sparringspartner für die bluesigen, melancholischen, eben für die Nicht-Hardrock-Piecen zu haben. Ein fulminanter Fehlgriff. Der kopfhängerische White passte nicht zur Band, jedenfalls nicht auf der Bühne. Er vergeigte die Twin Leads regelmäßig durch pure Lustlosigkeit und sein Posing war schlicht erbärmlich. Er spielte den harten Rocker, und das sah man ihm jederzeit an. Aber als Lynotts Kollaborateur beim Songwriting hat er ein paar feine, wenn auch Lizzy-untypische Songs mizuverantworten, nicht zuletzt den Geniestreich Renegade.
Es beginnt mit einem leicht eckigen, von sanftem Gitarrenpicking fundierten, sich sofort in die Hirnrinde einfräsenden Basslauf. Der reinste Kitsch, aber die grobe Körnung der jetzt anhebenden Stimme treibt dieser kleinen Schmonzette sofort die Larmoyanz aus, schleift sie um zu einer authentischen Passionsgeschichte. Ein Außenseiter tritt auf, verloren, gefallen, von der Gesellschaft verlacht. Ein Archetyp. Aber Lynott haucht ihm nicht nur individuelles Leben ein, er schenkt ihm seine ganze Empathie.
He’s just a boy, that has lost his way,
He’s a rebel that has fallen down.
He’s a fool that’s blown away,
To you and me he’s a renegade.
So ganz freiwillig, das offenbart noch einmal die zweite Strophe, scheint er nicht so geworden zu sein.
He’s a clown that we put down,
He’s a man that doesn’t fit.
Es folgt, was folgen muss. Zunächst die kompensatorischen Ausbruchsversuche.
But he is a king when he’s on his own,
He’s got a bike and that’s his throne.
And when he rides he’s like the wind,
To you and me he’s a renegade.
Und langsam lässt nun auch »the one and only Brian Downey on drums« die Zügel los und den Rhythmus laufen. Danach werfen die beiden Gitarristen ihre schweren Maschinen an. Die Gesellschaft bekommt endlich zurück, was sie ihm angetan hat.
He’s just a boy that has lost his sights,
He’s a stranger that prowls the night.
He’s a devil that’s right …
Lynott ist weiterhin auf seiner Seite. In der Live-Fassung (Lif/ve, 1983) nimmt er sein Verdikt sogar halb wieder zurück: »a devil and angel …« Und jetzt stellen sich die Leadgitarren breitbeinig vor die Worte und singen ihr zweistimmiges Klagelied. Es braucht eine Weile, eine eigene Bridge, um mühsam wieder herunterzukommen. Aber dann fängt der Song noch einmal von vorn an, auf einer höheren Ebene, steigert sich zu einer gospelartigen Anrufung des Höchsten, als würde hier ein Vater um Gnade für seinen Sohn flehen.
Oh please, I’m on my begged, bended knees,
Oh please, please heed my call.
He’s just a boy that has lost his way,
He’s just a boy, that’s all.
Und spätestens hier, begleitet von Snowy Whites tieftraurigen Blueslicks halb aus dem Off, offenbart sich, was der Song eigentlich ist: eine Trauerrede!
Dass dann noch einmal die Gitarren losbraten müssen, hat eher kathartische Wirkung. Das Fell wird versoffen. Eigentlich ist dieser große Song hier vorbei. Und man fragte sich später, wen Phil Lynott eigentlich gemeint haben mochte. Vielleicht am Ende sich selbst? War Renegade sein eigener Nachruf zu Lebzeiten?
Als Oberstufenschüler auf einem kleinstädtischen niedersächsischen Gymnasium, verzaubert von einer viel jüngeren dunkelhaarigen Schönheit, fragte ich mich gar nichts. Ich wusste einfach, dass er auch mich meinte.
Ich hatte D-A-D etwas aus den Augen verloren, fand Helpyourselfish dann auch nicht mehr ganz so großartig. Selbst schuld, kann ich meinem vergangenen Ich nur zurufen. Verdammt noch mal selbst schuld! Egal. Mit dem Album Soft Dogs (2002) waren sie wieder voll da und klangen so melancholisch, als hätten wir uns gegenseitig vermisst. Ich schwor ihnen und mir, dass so etwas nie wieder vorkommen würde.
Der schwelgerisch bluesige Titelsong fasst unsere nostalgische Stimmung am offensichtlichsten musikalisch zusammen. Hier geben die ewig lustigen Country-Hardrocker sich plötzlich verzagt, demütig, werfen sich der Geliebten wie ein zahmes Hündchen vor die Füße, um wieder gestreichelt zu werden.
Es sind böse Worte gefallen, und die möchte Jesper Binzer gern ungeschehen machen, denn er weiß nur zu gut, es geht hier um den Inhalt seines Fressnapfs. »Yeah, I risk losing / The flesh you wear so well«. Und Bruder Jacobs Leadgitarre schmeißt sich richtig ran, jölt und winselt. Natürlich wird’s Frauchen da wieder weich. Und ich auch.
Metallicas Orion ist eine opulente Klangmalerei, ein Hörspiel ohne Worte. Zunächst braucht es rohe Gewalt, Schubkraft, um die Rakete in den Orbit zu befördern. Schwere Riffs bringen sie langsam in Fahrt, zwischendurch klingt das heroische Pathos an, das mit einer solchen Mission notwendig verbunden ist. Schließlich erreicht man die Schwerelosigkeit.
Die Band scheint tatsächlich zu schweben. Hetfield und Hammett ziehen alle Register melodischer Schönfärberei. Das ist der reine metaphysische Klang. Sphärenmusik. Worte wären hier nicht nur überflüssig, sondern nachgerade störend. Dann kommt Cliff Burton auf seinem Astralbass angerauscht aus den psychedelischen Weiten, und wie dieser tragische Metal-Hippie, der seine Schlaghosen nie verleugnet hat und hier seinen Schwanengesang zelebriert, sein Instrument verzaubert, ist dann wirklich nicht mehr von dieser Welt.
Chuck Klosterman hat in Fargo Rock City geschrieben, die letzten zweieinhalb Minuten von Guns N’ Roses’ Rocket Queen seien die besten zweieinhalb Minuten der 80er-Jahre. Und Klosterman könnte recht haben. W. Axl Rose hat über die Hälfte des Songs Mackerphrasen aus der Hüfte geschossen, um seine Herzdame von seinen enormen Qualitäten zu überzeugen. Ganz gelingt es nicht. Ein viel zu abgekartetes Spiel, und so klingt auch die Band, fast ein bisschen unbeteiligt, business as usual. Slashs zerfahrenes Slide-Solo muss sogar von Orgasmusgestöhne umspielt werden, damit es nicht so auffällt. Aber dann finden plötzlich alle in einem neuen Riff zusammen. Die Stimmung ändert sich völlig. Der Appendix klingt wie ein neuer Song, und das nicht ohne Grund. Jetzt schreit Axl der Große seine ganze Sehnsucht, seinen Liebesschmerz heraus, jetzt erst verzehrt er sich wirklich nach der Gunst dieser Frau. Und auch Slashs Finger wissen auf einmal genau, wie dieses Bekenntnis in Töne zu verwandeln ist. Es rührt einen geradezu, wenn man hört, wie sich Slash und Axl hier aneinander aufrichten und gegenseitig hochschaukeln, wie der eine auf den anderen musikalisch reagiert. Napoleon-Komplex, Fehde, schmutzige Wäsche, all das ist noch in weiter Ferne. Hier ziehen zwei Kumpels sauber an einem Strang.
Schau nicht zurück, nutze den Tag, hic Rhodos, hic salta usw. Die Botschaft in Wasted Years von Iron Maiden ist so alt wie simpel. Und so ist auch dieser Song, den Adrian Smith ganz ohne kompositorische Unterstützung von Mastermind Steve Harris ins Werk setzte. Keine komplexe Metal-Suite dieses Mal, kein Monumentalepos wie so oft, sondern eine straighter Pop-Metaller mit erstaunlicherweise auch nach Jahrzehnten immer noch betörendem Hook und einem Gitarrensolo von Smith, das zwischen Gefrickel und Kindermelodie geschmackvoll, souverän austariert ist. Dass er hier die neuen Synth-Gitarren ausprobieren durfte, ist insofern von Belang, als man ihm das in der Gemeinde – anders als Judas Priest – ohne Weiteres durchgehen ließ.
Mercyful Fate waren eine der komplettesten Metal-Bands der frühen 80er. Die konnten alles und steckten das Gekonnte in einen beziehungsweise in jeden Song. King Diamond ließ durchaus gewöhnungsbedürftiges Eierschneiderfalsett neben traditionellem Rockshouting hören, die Gitarristen Hank Shermann und Michael Denner lieferten sich furiose atonale Duelle und fanden dann doch immer wieder zusammen für harmonische Twin Leads in guter Lizzy-Tradition, und kompositorisch verquickte die Band Seventies-Prog mit der Agilität des Proto-Speed-Metal. Evil war so etwas wie ihr erster Hit, jedenfalls in den richtig gebildeten Ständen, eine ingeniöse Riff-Bastelarbeit und böse, böse. »I was born on the cemetery / Under the sign of the moon / Raised from my grave by the dead / I was made a mercenary / In the legions of hell / Now I’m king of pain, I’m insane …«
1988 waren Trust fast nur noch eine Erinnerung. Eine dieser frühen New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Bands, immerhin aus Frankreich, was ihnen einen gewissen Exotenbonus sicherte. Aber dann spielten Anthrax auf dem »Monsters of Rock«-Festival 1988 nach vielen Thrash-Knüppeln plötzlich dieses gänsehautcoole Picking-Intro und dann das Herzstück, eine »Vorwärts!«-Parole in Form eines aufgeregt-energetischen Riffs, und auf eimal war