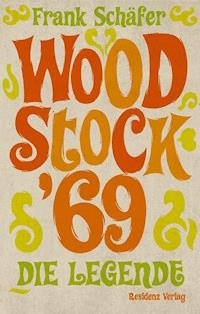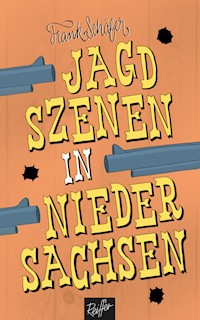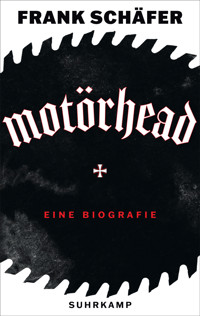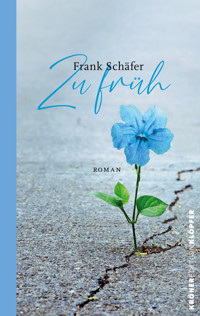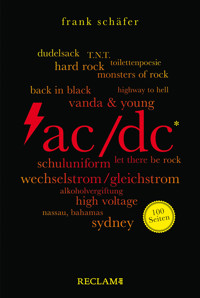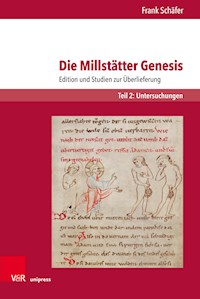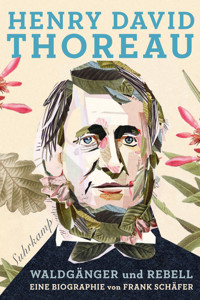10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Andreas Reiffer
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: edition kopfkiosk
- Sprache: Deutsch
Ein Literaturkanon hat seine Funktion – man weiß hinterher, was alles fehlt. Es fehlt einiges, weil im Prozess der Kanonbildung der auf Krawall gebürstete, konsequent hedonistische, leicht gelangweilte und triebgesteuerte Lustleser bei der Auswahl kein großes Mitspracherecht hat. Jeder macht irgendwann die Erfahrung, dass einem Lektüren, die sich in die eigene Biografie einmischen, meistens abseits der Institutionen Deutschunterricht oder Proseminar passieren. In spannend erzählten, persönlichen Essays skizziert Frank Schäfer einen Gegenkanon. In den Hauptrollen: Heino Jaeger, Jörg Fauser, Rolf Dieter Brinkmann, Uli Becker, Bernward Vesper, F. W. Bernstein, Michael Schulte, Jörg Schröder, Ror Wolf, Otto Jägersberg, Helmut Salzinger, Harry Rowohlt, Wolfgang Welt, Silvia Bovenschen, Fanny Müller, Wenzel Storch, Studio Braun und viele mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das wilde Lesen
Deutsche Literaturgeschichte(n)
Von Frank Schäfer
1. Auflage 2023 © Verlag Andreas Reiffer, edition kopfkiosk Bd. 08
ISBN 978-3-910335-42-4, identisch mit der Printausgabe
Verlag Andreas Reiffer, Hauptstr. 16b, D-38527 Meine, verlag-reiffer.de
»Kritiker zu sein ist ein dummer Beruf, wenn man nichts ist, was darüber hinausgeht.«
Alfred Kerr
»Die höchste Form der Kritik betrachtet das Kunstwerk als Ausgangspunkt für eine neue Schöpfung.«
Oscar Wilde
»Kritiker haben den sichersten Beruf, den man sich vorstellen kann. Sie müssen nicht mal hinausgehen und sich dem Risiko aussetzen, vom Auto überfahren zu werden. Sie schreiben über ihre Post.«
Chuck Klosterman
Plädoyer für einen Gegenkanon
Eine Art Vorwort
Der von den Kultusministerien der Länder verantwortete Lesekanon ist eine notwendige Voraussetzung pädagogischer Curricula. Es gibt nur ein Problem: Wenn ein Buch erst mal kanonisiert ist, schleppt man es durch – und so werden Schulkinder auch noch in zwanzig Jahren mit Heinrich Böll Vorlieb nehmen müssen, obwohl sich selbst die Germanistik, die auch gern ausschläft, mittlerweile ziemlich einig ist, dass Arno Schmidt nicht nur literarisch, sondern auch dokumentarisch schlicht mehr zu bieten hat.
Aber grundsätzlich hat so ein Kanon seine Berechtigung – und sei es nur, um immer mal wieder darauf hinzuweisen, was alles fehlt, und aus welchen Gründen es fehlt. Es fehlt auch deshalb so einiges, weil im Prozess der Kanonbildung das auf Krawall gebürstete, konsequent hedonistische, leicht gelangweilte und triebgesteuerte Es bei der Auswahl kein großes Mitspracherecht hat.
Jeder Lustleser macht irgendwann die Erfahrung, dass die im Deutschunterricht oder Proseminar behandelten Bücher meistens ganz okay, bestenfalls sogar interessant sind, aber die Lektüren, die sich in die eigene Biografie einmischen, passieren einem meistens abseits der Institutionen. Wenn man in einem Antiquariat das Gesuchte mal wieder nicht findet und schließlich den eigentlichen Anlass vergisst, weil man auf Uli Beckers »Alles kurz und klein« gestoßen ist. Oder wenn einem der große Bruder ein zerknicktes Paperback von »Peggy Sue« aufs Bett wirft, ohne Worte, die aber einen unmissverständlichen Lesebefehl enthalten.
Ich spreche hier von diesen Büchern, die Leser mit bildungsbürgerlicher Erwartungshaltung als zweit- oder drittrangig oder, noch schlimmer, als degoutant abtun. Es gibt bestimmte Kriterien, die sie durchs Raster fallen lassen, die aber umgekehrt gerade die Qualität und den ästhetischen Reiz, wenn nicht Rang dieser Elaborate ausmachen. Bei der Profilierung eines Gegenkanons hätte man also gleichsam den Spieß umzudrehen und die Ausschlussparameter zu Schibboleths umzuwidmen. Ich komme auf fünf für die Konstitution eines Gegenkanons relevante Kriterien.
Das sind erstens Bücher mit einem antibürgerlichen, rebellischen, den gesellschaftlichen Konsens in Frage stellenden Impetus. Eine Gesellschaft muss sich vor denen schützen, die ihren Wertekatalog mit einem Molli oder auch nur verbal angreifen, insofern findet man in den Leselisten derlei naturgemäß nicht. Sollte man aber, weil es ein Lesevergnügen und zugleich lehrreich ist, der Verwandlung eines unpolitischen Proleten zum Stadtguerillero beizuwohnen – cf. Bommi Baumanns »Wie alles anfing«. Man lernt dabei einiges. Wer weiß, wann man das mal gebrauchen kann.
Zweitens meine ich Bücher, die in Milieus spielen, für die sich die bürgerliche Literatur zu fein ist oder in die sie sich gar nicht erst hineintraut – das heißt in die halbseidenen, verruchten, angeschmuddelten, gefährlichen oder auch nur tristen plebejischen Parallelwelten. Das Großfeuilleton nimmt sich dem gar nicht so ungern an, wie einmal mehr die enthusiastischen Besprechungen von Heinz Strunks Roman »Der goldene Handschuh« bewiesen haben. Strunk suhlt sich hier im Siff der frühen siebziger Jahre. Ort der Handlung ist die Absteige »Zum Goldenen Handschuh« auf St. Pauli, der »Laufsteg der Entstellten«, wo auch der Serienmörder Fritz Honka seine »Verblendschnäpse« einnimmt. Hier können Kritiker nachlesen, was sie kaum selbst erleben möchten, aber es folgt nichts daraus, der Zugang zu den Leselisten bleibt Strunk dennoch verwehrt, weil Bildungsbürger das Gute, Wahre, Schöne und damit Relevante nur in ihrem Milieu verwirklicht sehen.
Drittens gilt kurioserweise auch das Komische immer noch als minderwertiges Merkmal von Literatur. Wann hat eigentlich jemals ein ausgewiesen satirischer Autor den Büchner-Preis, den Deutschen Buchpreis oder den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen? Dabei sollte es eigentlich egal sein, wie man ästhetische Levitation erzeugt, wie man sich via Sprache der Erdenschwere entledigt – im Ernst oder im Spaß. Entsprechend wird dann auch allenfalls Robert Gernhardt von den Kultusministerien für lesenswert befunden, nicht einmal Eckhard Henscheid oder F. W. Bernstein genießen ihre Gunst. Eine Unterlassungssünde.
Die vierte Kategorie betrifft die vermeintliche Irrelevanz oder doch zumindest geringe Reputation bestimmter Genres und Gattungen. Der Schriftsteller Reinhard Lettau begann seine Creative-Writing-Seminare an der Universität in San Diego mit einer Falle. »Wer von Ihnen interessiert sich für Kriminalromane oder für Science-Fiction?« Einige heben ihre Hände. »Alle, die sich gemeldet haben, verlassen sofort den Saal, denn ich unterrichte nur Literatur!« Es ist diese Borniertheit, die sich im zeitgenössischen Lesekanon manifestiert. Populäre Genres wie Science-Fiction, Horror, Krimi, aber eben auch ganze Literaturgattungen wie Briefe, Interviews oder Comics spielen darin so gut wie keine Rolle. Dabei bekommt man in Mawils »Kinderland« eine DDR-Kindheit in den 80er Jahren gezeigt, wie sie plastischer noch kein Roman geliefert hat.
Und schließlich, fünftens, hasst der Bildungsphilister nichts so sehr wie das Unfertige, Kaputte, scheinbar Missglückte und lässt dabei außer Acht, dass sich Größe, auch ästhetische Größe, nicht zuletzt im Scheitern offenbart. Ein Buch wie »Die Reise«, in dem Bernward Vesper mit seinem Vater, dem einstigen Blubo-Dichter Will Vesper, abrechnet und zugleich die eigene Indoktrination mitprotokolliert, kann wahrscheinlich gar nicht fertig werden. Womöglich manifestiert sich gerade im Versagen eine literarische Wahrhaftigkeit, die anders nicht zu haben ist.
Es wuchern bemerkenswert bunte, pittoresk stachelige, bisweilen auch giftige Gewächse abseits der begradigten, flurbereinigten Lesewege. Querfeldeinlektüren lohnen sich, sie erhöhen die literarhistorische Ortskenntnis. Und Lustleser können ohnehin nicht auf sie verzichten. Vielleicht kommt dem Gegenkanon gerade in Zeiten schwindender Leserzahlen als Motivationshilfe, Anfütterungsmaßnahme respektive Suchtbeschleuniger sogar eine besondere Bedeutung zu.
Mit anderen Worten, wir brauchen einen Gegenkanon.
Der erste Klatschreporter
Weimar im ausgehenden 18. Jahrhundert – der Dichterolymp, das Bonsai-Städtchen, in dem sich die Musen gute Nacht sagen: »Einmal (bei Bertuchs Schwiegervater) machte man Einsiedeln, der gern lang im Bett liegen blieb, aus geriebenen u. eingerührten Pfefferkuchen eine Sauce unter den Hintern ins Bettuch, weckte ihn nun, u. schrie auf ihn, als einen Bettverunreiniger, los. Er sprang auf, zog das besudelte Hemde aus, und verfolgte damit neckend alle Leute im Hause. Göthe warf unterdessen das Bettuch durch ein Loch in die Unterstube, u. brüllte: seht die Sau!«
Diese kleine Burleske notiert sich ein gewisser Karl August Böttiger, Altphilologe, angesehener Altertumskenner und bei der Niederschrift 1796 wohl schon einer der bekanntesten literarischen Journalisten seiner Zeit, auf dass sie der Nachwelt nicht verlorengehe. 1791 von Herder zum Rektor des Weimarer Gymnasiums berufen, und dann sogleich als Oberkonsistorialrat bestallt, eine recht ehrenvolle und gut dotierte Stellung damals, sorgte Böttiger bald für Unruhe auf dem Parnass. Ein Sturm im Weimarer Weinkelch. Dass der spätaufklärerische Libertin bei seinen Primanern einen recht freizügigen Umgang mit den klassischen Autoren pflegte, mochte ja noch angehen. Auch dass er in seinen Studien zum antiken Alltagsleben versteckte Sozialkritik übte und vermeintliche Schlüpfrigkeiten verbreitete – in »Sabina, oder Morgenscenen im Putzzimmer einer reichen Röhmerin« zumal, wo er gut aufklärerisch die Antike als liederlich-wollüstige Dekadenzveranstaltung und also das klassische Idealbild als Hirngespinst entlarvt –, war nicht mal so arg. Übel nahm man ihm seine Geschwätzigkeit, die selten vor Indiskretionen zurückschreckte. Das ließ die Beteiligten nicht nur ärger-, sondern vor allem bänglich werden, denn Böttiger unterhielt die ausgedehnteste und weitverzweigteste Korrespondenz seiner Zeit, gab zeitweise selbst drei Zeitschschriften heraus und schrieb regelmäßig für die namhaftesten Journale. Böttiger hatte Öffentlichkeit.
Verständlich, dass Goethe aufatmet und sich »in Weimar wie im Himmel« fühlt, als »der Böttigersche Kobold« nicht ohne seine tätige Mithilfe endlich »weggebannt« ist – und ihm also nicht mehr auf die umtriebigen Finger sehen kann. Für Ärger sorgten aber auch immer wieder Böttigers polemische Ausfälle, die sich gegen Goethes Theaterpraxis, die Sakralisierung der Antike oder gleich gegen das ganze »Weimarsche Geniewesen« richteten. Kurzum, als pragmatischer Aufklärer, der weder die kraftgenialische Großsprecherei noch die klassische, viel weniger noch romantische Mode mitzumachen gedachte, war er hier denkbar fehl am Platze.
Einerseits. Andererseits erwies sich seine Anwesenheit als Glücksfall, jedenfalls für die Literarhistorie. Denn durch ihn komplettiert sich das Bild des klassischen Weimar, weil er mit Vorliebe und voyeuristischem Gespür das mitteilt, was die Musensöhne gern verschwiegen hätten. Während seines dreizehnjährigen Aufenthalts in der Stadt hat er beständig die großen und oftmals eben auch ganz banalen Ereignisse mitstenografiert, um daraus später ein Erinnerungsbuch zu kompilieren, das aber nicht zustande kam, weil sich ob des skandalösen Inhalts kein Verleger fand. Erst sein Sohn gab, um Böttiger vor der Nachwelt zu rehabilitieren, eine sprachlich geglättete, von allzu Anstößigem bereinigte, also arg entschärfte Fassung der »Literarischen Zustände und Zeitgenossen« heraus (die zum Beispiel auch nicht die oben zitierte Sauerei enthält). Vor einigen Jahren haben Klaus Gerlach und René Sternke erstmals das Original rekonstruiert.
Diese Ausgabe nach der Handschrift liest sich recht urwüchsig und frisch, weil Böttiger auf Stilisierung hier noch weitgehend verzichtet und erst mal Material sammelt. Das vermeintlich Wesentliche ist vom vermeintlich Unerheblichen noch nicht geschieden, und so bekommen wir Bruchstücke Weimarer Alltagsgeschichte mitgeteilt: Böttiger referiert Tischgespräche, in denen solche drängenden Fragen geklärt werden wie die, »warum man in hiesiger Gegend so wenig erträgliche Gesichter unter den Bauernmädchen fände«; er berichtet von Schlägereien, in denen sich der Olympier bisweilen eine blutige Nase holt, schildert die ganz erbärmlichen Machenschaften des Geheimen Rats gegen Wieland, dessen Wohnung er sich unter den Nagel reißen will, skizziert die Physiognomien und Charakter der Großdichter und gibt Einblicke in ihre poetische Praxis. Unter seiner derben Feder werden die Astralleiber wieder zu Fleisch und Blut. Und aus seinem kritisch-distanzierten Blickwinkel sieht er manches Peinliche und Lächerliche der genialischen Geister eben doch schärfer als ihre vielen zeitgenössischen Verehrer und Apologeten. Etwa das rabiate Renommiergehabe des Sturm-und-Drang-Dramatikers Klinger: »Fast zur gleichen Zeit mit Lenzen wanderte auch das Kraftgenie Klinger ein, ein roher, ungeschlachter Naturmensch. Einst sah er beim Rath Krause zum Fenster heraus auf eine gleich unten befindliche Fleischbude. Auf einmal fing er beim Anblick der schönen Schöpskeulen gewaltig über die Ausartung des Menschengeschlechts zu wehklagen an, und prieß das Zeitalter, wo die Menschen das Fleisch noch roh verzehrt hätten. R[at] Krause fragte: ob er nicht Lust habe, zur Ehre jener Heroen ein Stück rohes Fleisch sogleich auf der Stelle zu verschmausen. Warum nicht? sagte Klinger. Man wettet, u. Krause läßt augenblicklich durch seine Bediente ein Pfund Fleisch in seiner natürlichen Sauce heraufholen. Diesen Ernst hatte Klinger nicht vermuthet, er fing an Ausflüchte zu machen, und sagte endlich, da Krause immer dringender wurde: er habe die Sache gar nicht so gemeint. Es sei bloß eine poetische Phantasie geweßen.«
Böttigers Interesse gilt aber neben Wieland, dem großen alten Mann der deutschen Literatur jener Jahre, dessen »Sämmtliche Werke« ab 1794 in vier verschiedenen 36- beziehungsweise 39-bändigen Ausgaben erscheinen, vor allem Goethe. Und obschon er dem Menschen eher reserviert gegenübersteht, seine Egozentrik und Eitelkeit, seinen maßlosen mit Intriganz gepaarten Ehrgeiz verachtet und geradezu beckmesserisch über dessen moralische Verfehlungen Strichliste führt – vom literarischen Genie Goethes ist er überzeugt und zutiefst beeindruckt. Als dieser ihm aus dem reaktionären Spießbürger-Epos »Hermann und Dorothea« vorliest, gibt’s für Böttiger kein Halten mehr – da helfen dann nur mehr Vergleiche mit der homerischen »Odyssee«.
Seine ins literarische Detail gehenden Notate kommen ohnedies etwas langatmig und schal daher, sind noch dazu nicht sonderlich substanziell. Da gab es bessere Literaturkritiker in dieser Zeit – Johann Heinrich Merck etwa, den Böttiger als wahren Teufel in Menschengestalt darstellt, weshalb ihn dann auch »Göthe zum Original des Mephistopheles in seinem Faust (dieß ist Göthe selbst) genommen« habe. Am gelungensten sind wohl jene Passagen, die einfach den kursierenden Weimarer Klatsch kolportieren, und nicht zuletzt die vielen Gesprächsprotokolle, die augenscheinlich unmittelbar nach den Unterhaltungen mit den Dichter-Stars entstanden sind. Derlei macht nun auch den größten Teil des Buches aus – die Kaffeeschwester in uns allen findet hier also reichliche Nahrung.
Die Erfindung einer neuen Dichtungsart
Ernst Dronke stammt aus bildungsbürgerlichem Elternhaus und lässt sich während seines Studiums Anfang der 1840er Jahre anfixen vom »Wahren Sozialismus«. Die Anhänger dieser Theorie glauben das soziale Elend der beginnenden Industriegesellschaft verringern und dadurch eine gewalttätige proletarische Revolution verhindern zu können, indem sie dem Bürgertum eindringlich und ungeschönt das Leid der anderen vor Augen führen und an sein Mitleid appellieren. Die entsprechenden Reformen folgen dann schon auf dem Fuß. Marx und Engels haben diesen bürgerlich-idealistischen Sozialismus im »Kommunistischen Manifest« als »Gewand, gewirkt aus spekulativem Spinnweb, überstickt mit schöngeistigen Redeblumen, durchtränkt von liebesschwülem Gemütstau« sehr hübsch desavouiert, sein späteres Fortleben in der Sozialdemokratie konnten sie dennoch nicht verhindern. Auch in der Literatur und im Journalismus hat er einige Spuren hinterlassen.
Im Gefolge des »Wahren Sozialismus« entsteht eine sozialkritische Literatur, die sich durch ihre realistische Härte bewusst absetzt von der gerade geläufigen Mode des Feuilletonromans, der nach dem Vorbild von Eugène Sues »Die Geheimnisse von Paris« die Absteigen und Gossen der wachsenden Großstädte als verrucht-exotische Abenteuerspielplätze schönfärbt. Es erscheinen Bücher wie Ernst Willkomms Fabrikarbeiterroman »Weiße Sklaven« (1845), Wilhelm Wolffs Armenhausreportage »Die Kasematten« (1843) oder Ernst Dronkes kaustische Großstadtdokumentation »Berlin« (1846), die ihm wegen Majestätsbeleidigung und ungehöriger Kritik am Polizeipräsidenten und an den Landesgesetzen zwei Jahre Festungshaft einbringt.
Aber bald darauf ist Revolution in Deutschland. Dronke kann nach Brüssel, später nach Paris fliehen, macht Bekanntschaft mit Engels und schließlich auch Marx. Er schließt sich den Kommunisten an, kehrt mit ihnen nach Köln zurück und arbeitet eine Weile für die wichtigste Agitationsplattform der Linken, die »Neue Rheinische Zeitung«. Aber sein publizistischer Kampf währt nicht lange, Dronke wird verfolgt, muss 1849 in die Schweiz emigrieren, später dann nach England, wo er sich bald aus dem politischen Geschäft zurückzieht und dafür von Marx und Engels als Kleinbürger geschmäht wird.
Seine produktivste schriftstellerische Zeit sind die Jahre vor der Märzrevolution, 1846 erscheinen neben seinem zweibändigen »Berlin«-Report vier weitere Bücher, darunter die mehrfach wiederaufgelegten »Polizei-Geschichten«, die sogar Friedrich Engels bei aller Kritik an Dronkes moralinsaurer Weinerlichkeit halbwegs wohlwollend aufnahm. »Herr Ernst Dronke hat sich durch die Erfindung einer neuen Dichtungsart dauernde Verdienste um die deutsche Literatur erworben«, schreibt Engels in seinem unvollendeten Essay »Die wahren Sozialisten«. Dronke habe darin die »ringelnde Riesenschlange der Polizeigesetzgebung« zu einer »Reihe der interessantesten Novellen« verarbeitet. »In jedem Paragraphen steckt ein Roman, in jedem Reglement eine Tragödie. Herr Dronke, der als Berliner Literat selbst gewaltige Kämpfe mit dem Polizeipräsidio bestanden, konnte hier aus eigner Erfahrung sprechen.«
Tatsächlich hat Dronke diese frühen True-Crime-Storys in Korrespondenzblättern recherchiert oder sich erzählen lassen, jedenfalls gibt er immer wieder kleine lektüreleitende Hinweise, die klarmachen sollen, dass sie keine Fiktion sind. »Diese Blätter haben eine ›Tendenz‹ zu Grunde: die der Wahrheit«, schreibt er in der programmatischen Vorrede zur Erzählsammlung »Aus dem Volk«, die auch vor den »Polizei-Geschichten« stehen könnte. »Ich habe diese Novellen nicht geschrieben, um ›Novellen zu schreiben‹: ich geize nicht nach der Ehre ›Belletrist‹ zu sein.« Er habe seinen Stoff »nur deshalb in das Gewand der Novelle gekleidet, weil in dieser Form der Nachzeichnung des wirklichen Lebens die Wahrheit jener Verhältnisse am deutlichsten und sprechendsten vor die Augen tritt und dadurch weiter als abstrakte Abhandlungen wirkt.«
Das ist eine frühe Poetik des literarischen Journalismus. Die Wahrheit muss ans Tageslicht, aber damit sie dort auch richtig funkelt, braucht der Reporter die Kunst als Mittel zum Zweck. In den besten Geschichten dieses Bandes weiß Dronke dieses Mittel nicht uneben zu handhaben. In »Armuth und Verbrechen« etwa schildert er den quälend langsamen Abstieg des Tischlergesellen Fritz Schenk, der von einem Unfall bleibende körperliche Schäden zurückbehält, arbeitslos wird und schließlich nach verschiedenen Versuchen, wieder auf die Beine zu kommen, einen Überfall begeht, weil er Frau und Kind anders nicht mehr ernähren kann. Perfiderweise stiftet ihn ein Polizeispitzel zu der Tat an. Dronkes sanft melancholischer Ton ist das adäquate Medium für die tragische Unvermeidlichkeit dieser Geschichte. Nah an der Sozialreportage pinselt er das bittere Schicksal der Familie in düsteren Farben aus. Am Ende geht Schenks Frau mit ihrem Kind ins Wasser und der untröstliche Verbrecher wider Willen erhängt sich in seiner Zelle. Immerhin gibt der Autor dem Unglücksraben zuvor noch Gelegenheit, seinen Groll auf Gott und die Welt mit »wilder Bitterkeit« auszuspucken. »Wie im Himmel sieht’s bei uns aus«, spricht der arme Schenk, »wir essen nicht und trinken nicht. Es ist ein herrliches Leben, man genießt die ganze Schöpfung, man hört die Vögel singen, man hat im Sommer die schöne Natur, im Winter das prächtige Eis, und braucht für Alles das gar nichts zu bezahlen. Ich erinnere mich, dass der Pfaffe mir früher sagte, es sei eine Gnade Gottes, dass wir geschaffen würden und leben dürften. Ich wollte das lange nicht einsehen, aber es ist doch wahr, es liegt nur an dem Einzelnen selbst, wenn er das Leben verkümmert. Das Leben ist doch umsonst, wozu sich da plagen und Sorgen machen? Es kömmt am Ende doch auf Eins heraus, ob man auf seidenen Kissen oder allmählig Hungers gestorben ist.«
Mindestens so scharf ist Dronkes Erzählung »Die Sünderin«. Ein Dienstmädchen bekommt ein uneheliches Kind, findet danach keine ehrbare Anstellung mehr und wird schließlich zur Prostitution gezwungen. Dronke schreibt an gegen die bigotte bürgerliche Sexualmoral einer Gesellschaft, die eine »siebzehnjährige, verlassene Mutter« aus ihrer Mitte verstößt, und nicht zuletzt gegen einen Staat, der den Armen karitative Unterstützung fast gänzlich versagt. Gemeinsam treiben sie die vermeintliche Sünderin schließlich in den Tod. »Für der Art Leute ist der Tod das Beste«, kommentiert ein stumpfer Leichenwärter am Ende die Tragödie, »denn im Leben nimmt sich Keiner ihrer an, und solch Leben, – nun, sie hat’s auch selbst wohl eingesehen!«
Nicht alle Geschichten haben diese zumindest wirkungsästhetische Qualität. Einige zeigen eine behagliche Teerunde, in der die intellektuelle Elite ganz unter sich – »überstickt mit schöngeistigen Redeblumen«, wie gesagt – über Polizeiwillkür und allerlei Repressalien der Behörden räsoniert. Hier zeigt sich deutlich, wen Dronke als Adressaten seiner »Novellen« vor allem im Auge hat – nicht die proletarischen Massen, um sie zum revolutionären Kampf zu ermuntern, sondern das aufgeklärte Bürgertum. Ihm soll die Aufgabe zukommen, das Staatswesen wie auch immer zu einem »harmonisch organisirten Ganzen« umzumodeln, sodass ein Kampf letztlich überflüssig wird. Dronke hat bald selbst nicht mehr dran geglaubt.
Ungelüftete, schweißige, unreinliche Situationen
Als Hermann Ungar am 28. Oktober 1929 in einem Prager Krankenhaus an akuter Blinddarmentzündung starb, sechsunddreißigjährig, da war er gerade dabei, sich als Dramatiker einen Namen zu machen; Alfred Kerrs Kritik zur postumen Uraufführung des Lustspiels »Die Gartenlaube« im Dezember des Jahres schlug denn auch einen Ton an, den man bei ihm nur selten hörte, wenn er die jüngere Dramatiker-Generation verarztete: »Geht hinein – und seht, was wir verloren haben!«
Verloren hatte das tschechoslowakische Außenministerium auch einen tüchtigen Legationssekretär – und die Literatur den neben Kafka wohl bedeutendsten Erzähler des deutschsprachigen Prags. Ungar, ein in Mähren aufgewachsener Jude, publiziert im Laufe der zwanziger Jahre ein schmales, aber originäres Werk mit Erzählungen (»Knaben und Mörder«, 1920) und zwei Romanen (»Die Verstümmelten«, 1923; »Die Klasse«, 1927), das in der literarischen Öffentlichkeit seinerzeit durchaus für Beachtung sorgt, aber wegen der besonderen Exponiertheit des Sexuellen und der scheinbar erbarmungslosen Schilderung psychopathologischer Zustände durchaus kontrovers diskutiert wird. Thomas Mann etwa gehört schon früh zu dessen Bewunderern und widmet Ungar einen freundlichen, wenn auch etwas verdrucksten Nachruf, der viel von der »Sakramentalität der Sinnlichkeit« und der »geschlechtlichen Melancholie« redet, weil der Verdrängungserotiker nicht zugeben mag, was ihm wirklich an diesen Texten liegt, die durchgehende homoerotische Unterströmung nämlich, vor allem in Ungars erstem Roman (aber dazu gleich noch). Stefan Zweig hingegen zeigt sich abgestoßen von dem Buch, macht hier »eine furchtbare Vorliebe … für schlechten Geruch, für die Miasmen der Seele, für ungelüftete, schweißige, unreinliche Situationen« aus, gibt dann aber auch zu, dass man »mit Grauen in ihm verharren« müsse.
Zweig hat ganz recht, es ist der Ekel am Organischen, den Ungar in »Die Verstümmelten« evoziert, und dies in einer kargen, sachgemäßen, geradezu klinischen, metaphernarmen, aber nicht kunstlosen Beschreibungsprosa, die man leicht für unbarmherzig halten könnte, die aber nichts weiter ist als die formale Entsprechung der Ausweglosigkeit, schicksalhaften Determiniertheit, der prästabilierten Disharmonie menschlicher Existenz, wie Ungar sie inhaltlich vorführt. Seine Protagonisten handeln nicht aus freien Stücken, sie handeln eigentlich überhaupt nicht, ihnen stößt etwas zu. Sie sind Opfer.
Zum Beispiel Karl Fanta, der reiche libertinäre Jude und ehemalige Lebemann, der bei lebendigem Leibe verfault, den man schon zwei Beine abgenommen hat und im Laufe des Romans noch einen Arm amputiert, und der seine Angehörigen mit zügellosem Hass auf sich und die Welt quält. »Er hat kein Herz mehr. Sein Herz ist auch von Geschwüren zerfressen. Darum ist er so grausam zu mir«, erklärt seine Frau dem einzigen Freund, der ihm noch geblieben ist: Franz Polzer, die Hauptperson des Romans. Aus dessen Perspektive wird erzählt, und dessen Erfahrungshorizont überschreitet der Erzähler an keiner Stelle. Polzer, ein kleiner Bankangestellter, ein Verwandter Josef K.s und Wiedergänger Woyzecks, ein Ordnungsfetischist, »autoritärer Zwangscharakter«, wie ihn Wilhelm Reich wohl bezeichntet hätte, gerät immer mehr in den Einfluss seiner Vermieterin, der Witwe Porges, die ihn schließlich gegen seinen Willen und durchaus handgreiflich zu ihrem Geliebten macht. Polzer kann sich nicht wehren beziehungsweise will es wohl nicht, wie er sich auch als Kind den Schlägen des Vaters und seiner Tante – die Mutter ist bei seiner Geburt gestorben – ausgesetzt hat, ja, sie gesucht hat, um seinem Hass auf die beiden einen Grund zu geben. Ausgelöst hat diese masochistische Manie, von der er nicht loszukommen scheint, ein frühkindlicher Schock. Er erfährt von dem inzestuösen Verhältnis seines Vaters mit der Tante. Weibliche Sexualität löst bei ihm in der Folge nur mehr Ekel aus (»der entsetzliche Gedanke, dass dieser nackte Körper nicht verschlossen sei. dass er in grauenvollem Schlitz bodenlos klaffte. Wie offenes Fleisch, wie die Schnittlappen einer zerrissenen Wunde«) und nicht zuletzt die Wahnvorstellung, dass er den Inzest seines Vaters wiederhole. So kommt es auch ihm nach der ersten Nacht mit Klara Porges vor, »als habe er seiner Schwester beigewohnt«. Und dieses neurotische Schuldgefühl, so will es seine masochistische Disposition, muss ebenfalls immer wieder neu durchlitten werden!
Ungar ergänzt seine komplexe psychopathologische Fallstudie recht subtil, indem er Polzers Misogynie, literarisch verschlüsselt, eine uneingestandene Homosexualität zur Seite stellt. So scheint die Jugendfreundschaft von Polzer und Fanta möglicherweise auch erotisch konnotiert gewesen zu sein (»oft umarmten und küßten einander die beiden Knaben unter Tränen«), und Polzer sehnt sich auch späterhin nach »einer kleinen Zärtlichkeit, einer Wiederholung jener Knabenküsse«.
Vor allem aber begibt er sich jeden Sonntag in ein kleines Billard-Café (und man beachte die subkutane Sexualisierung dieser Szene, in der sich Ungars erzählerische Meisterschaft zeigt): »Er sah den Billardspielern zu. Dieses Zusehen versetzte ihn in eine gehobene Stimmung. Er verfolgte das Rollen der glatten Kugeln über das grüne Tuch und freute sich des hellen Klangs des Zusammenstoßes. Zugleich beobachtete er die Bewegungen der Spieler, wie sie sich weit über das Brett bogen und zum Stoß ansetzten.« Einige Zeilen später dann: »Seine Sehnsucht war, selbst Billard zu spielen. Sie erfüllte sich ihm nie. Polzer schrak davor zurück, seine Bewegungen öffentlich allen Augen preiszugeben.«
Die offensichtliche Angst vor dem Coming-out, die dann gleich im Anschluß noch einmal allegorisiert und somit chiffriert wird: »Polzer hatte das Queue schon in der Hand und war sich bewußt, dass er es nun sorgfältig kreiden müsse. Da entsann er sich, dass er einmal schon ein Queue in der Hand gehalten habe. Es schien ihm, als seien Leute dabei gewesen. Er wußte im Augenblick nicht, ob es im Traum gewesen sei. Aber es konnte nicht gut anderswo gewesen sein. Als er zu kreiden begann, war es gewachsen und schwer geworden, und er hatte das Gleichgewicht verloren.«
Was diese homoerotische Latenz des Romans für die Autorpsychologie bedeutet, ob sie überhaupt etwas bedeutet, kann uns wohl egal sein, für den Text hingegen ist sie nur einmal mehr Bestätigung seiner hochgradig artifiziellen Struktur, die Thomas Mann offenbar eher zu goutieren, vielleicht auch eher zu deuten vermochte als Stefan Zweig.
Diese alberne Räuberspielerei
Gestatten, Dr. Walter Serner: Jurist und zum Katholizismus konvertierter Jude, Kritiker, Essayist, Autor von an die hundert Kriminalgeschichten, die das Genre auf den Kopf stellen, vor allem aber Dadaist. Serner war in gewisser Hinsicht der kompromissloseste Exponent der Dada-Bewegung, weil sein Avantgardismus am weitesten über die Ränder der Literatur hinauslappte, ja erst im Leben sich eigentlich erfüllte. Ein Bohemien und Radikalanarchist, mit jeglicher Autorität im Clinch, aus dem Koffer lebend und Europa bereisend. Bis heute weiß niemand, wovon er sein Dandytum bestritt (von dem Verkauf seiner Bücher jedenfalls nicht). Er machte Dada manifest mit »Letzte Lockerung, Manifest Dada«, diesem scharfen Brühwürfel, aus dem Tristan Tzara dann seine Wassersuppe kochte, die ihn zum Küchenchef der Gruppe aufsteigen ließ. 1927 zieht er sich zurück aus dem literarischen Leben, wird sesshaft, heiratet, wohl auch, weil ihm immer häufiger die Polizei nachstellt. Wer sich so gut auskennt im Ganovenmilieu, mit dem kann ja irgendwas nicht stimmen. Zuletzt arbeitet er als »Sprachenlehrer« im Prager Ghetto. Bis ihn Anfang August 1942 die Nazis aufspüren, nach Theresienstadt verbringen, von dort in den »Osten«, zu den fahrbaren Gaskammern bei Minsk – den »Seelenvertilgern«, wie die Russen sagten.
Serners längster und (mit »Letzte Lockerung«) auch wohl raffiniertester Text, »Die Tigerin«, erschien 1925, auf der Höhe seines »Ruhms«. Bichette ist die Tigerin, denn sie nimmt die Männer, wie es ihr gefällt, und was sie von ihnen übrig lässt, ist oft genug nicht mehr als ein lebloser Balg. Bichette ist die ungekrönte Königin der Montmartre-Cafés, in denen sich die Pariser Halb- und Dreiviertelwelt Anfang der 20er Jahre ein Stelldichein gibt: ruchlos, brutal, bar jeden Anstands und Mitgefühls, eine Überlebensvirtuosin, ein weibliches Frontschwein in diesem Krieg aller gegen alle – etwas gelangweilt nur, weil längst alle Cocktails getrunken, alle Tänze getanzt und alle interessanten Kerls vernascht worden sind.
Aber dann begegnet sie dem berüchtigten Hochstapler Fec alias Henri Rilcer. Der ist noch abgefeimter und perfider als sie und hadert nach all seinen kleinkriminellen Abenteuern etwas mit seiner Existenz, stellt sich denn auch immer öfter die Sinnfrage, ja, entwickelt sich im Laufe des Romans zum durchaus nicht unbelesenen nihilistischen Existenzphilosophen. Fec wird ihr Liebhaber, und gemeinsam beschließen sie nun, ihrem »Leerlaufen« ein Ende zu setzen, ein letztes großes Abenteuer zu wagen: »Fec, wir machen uns.« Das heißt zunächst einmal, sie spielen das unsterblich verliebte Paar und benutzen diese Fiktion, um in den mondänen Kreisen Nizzas für Aufsehen zu sorgen und anschließend zwei eitlen schwerreichen gallischen Gockeln die Francs abzujagen.
Aber sie spielen ihre Liebe nicht nur vor der Welt, sondern auch vor sich selbst. Fec und Bichette wollen sie erschaffen durch einen puren Willensakt – ein Gemisch aus viel Schein und ein bisschen wohl auch Sein. Wie ein Kunstwerk. Und entsprechend doppelbödig sind denn auch ihre Dialoge. Während Fec und Bichette ihre »absonderliche Liebesgeschichte« fort und fort besprechen, redet Walter Serner vom Schreiben dieses Romans. Besonders im langen Schlussdialog, wo die beiden ihre Geschichte wieder und wieder neu erfinden, umdeuten und die Motivation ihrer Handlungen nachträglich modifizieren, bis der Leser nicht mehr weiß, was er glauben soll und was nicht, spätestens hier wird dieser Palimpsest offensichtlich: »Nun aber Schluß! Endgültig! Überdies ist jetzt alles so ausgezeichnet verwirrt, dass es ganz unmöglich wäre, es jemals mit Erfolg zu entwirren«.
So spricht nur ein zufriedener Autor. Das war das Ziel, und das hat Serner erreicht – indem er die Erzählstrategien des Kriminalromans einfach umdreht: Zunächst skizziert er den Tathergang – wie sich die beiden kriminellen Subjekte kennenlernen, zusammentun und die »Verbrechen«, durchaus ja auch richtige Verbrechen, begehen –, die anschließenden Gespräche darüber tragen aber eben nicht wie sonst üblich zur Klärung des Falls bei, sondern verschleiern ihre Motive und selbst die Handlung mehr und mehr, verschmelzen das Sein unauflöslich mit dem Schein. Am Ende steht das Rätsel, oder wenn man so will: die Rettung der banalen Realität in der Poesie.
Dem Prinzip der Verflüchtigung gehorcht auch die fulminante Sprache, zumal der Tigerin Bichette. Dieses polyfone Sampling aus ein paar englischen Brocken, aus Gallizismen, wirklichem und vermeintlichem Argot ist eben kein trivialer Exotismus und auch nicht bloß soziolinguistisches Konterfei der Pariser Demimonde, sondern poetisch genau kalkuliert. Eine eigene Kunstsprache, die das Unwägbare, Unabsehbare der Erzählung noch verstärkt, weil man Bichette letztlich nicht genau versteht.
Nehmen wir zum Beispiel ihren Entscheidungsmonolog, der legitimieren soll, warum sie diese Liebe mit Fec »machen« will: »Eben weil ich nicht mehr leer laufen kann. Und du, das weiß ich ganz genau, du läufst ja auch leer. So wie du lebst, das ist doch Blödsinn. Schlaß ist das. Absolut schlaß. (…) Ich sage ja nicht, dass wir uns irgendwas vortrillern sollen, irgend so was wie diese zuckrigen Claqueweiber da mit ihren Marlous. Das ist von hinten herum ja doch wieder louche, diese alberne Räuberspielerei, dieses ekelhafte Liebesgeteue und Blickgetürm und diese verlogenen Roheiten, diese Gewerbetreibenden mit Herz und Hintern und … Schlingue! Ich hab den ganzen Jus bis dorthinaus!« Bichettes rotwelsche Rede klingt in ihrer Grobschlächtigkeit und asphaltharten Unsentimentalität beinahe wie eine frühe gallig-gallische Ouvertüre zu den Zukunftsgrobianismen von Alex und seinen Droogs in Anthony Burgess’ »Clockwork Orange«.
Die expressive Gauner- und Gossensprache nebst ein paar anrüchigen, aber doch eher dezent gezeichneten Beischlafszenen sorgen denn auch einige Jahre nach Erscheinen des Buches, als sich die teutsche Kulturnation schon langsam, aber stetig auf ihre arische Bestimmung einschoss, für einen kleinen Literaturskandal. Das in Anbetracht des erwarteten goldenen Zeitalters schon mal beflissen vormuckende Landesjugendamt der Rheinprovinz beantragte, »Die Tigerin« wegen Schund- und Schmutzverdacht zu verbieten, und Serners Verleger Paul Steegemann hatte seine liebe Not, ein paar positive Gutachten aufzutreiben. Die meisten der Angesprochenen (darunter Max Brod, Alfred Kerr und Heinrich Mann) reagieren erst gar nicht, und drei derjenigen, die sich bereit erklärten, Manfred Georg, Max Herrmann-Neiße und Kasimir Edschmid, wiesen den Antrag zwar zurück, glaubten allerdings auf eine stilistische und moralische Mängelliste nun auch nicht verzichten zu können. Nur der einmal mehr tadellose Alfred Döblin empört sich uneingeschränkt und nachhaltig über das Ansinnen des Jugendamtes, attestiert dem Roman einen »floretthurtig eleganten, scharfen, schneidigen knappen Stil« und kommt zu dem Ergebnis: »Der Roman ›Die Tigerin‹ ist ein ausgezeichnetes Kunstwerk.« Folglich wird dieser Antrag noch abgelehnt. Aber schon im Jahr darauf betreibt das Münchener Jugendamt die Indizierung aller Schriften Serners, und diesmal, Adolf Hitler hat sich just zum Reichskanzler wählen lassen, wird dem Antrag stattgegeben. Walter Serner kommt auf die Liste. Neun Jahre später steht er noch auf einer anderen.
Menschen aus dem neuesten Deutschland
»Ich denke, dass es gut ist, wenn ich alles beschreibe, weil ich ein ungewöhnlicher Mensch bin. Ich denke nicht an Tagebuch – das ist lächerlich für ein Mädchen von achtzehn und auch sonst auf der Höhe. Aber ich will schreiben wie Film, denn so ist mein Leben und wird noch mehr so sein … Und wenn ich später lese, ist alles wie Kino – ich sehe mich in Bildern. Und jetzt sitze ich in meinem Zimmer im Nachthemd, das mir über meine anerkannte Schulter gerutscht ist, und alles ist erstklassig an mir – nur mein linkes Bein ist dicker als mein rechtes. Aber kaum. Es ist sehr kalt, aber im Nachthemd ist schöner – sonst würde ich den Mantel anziehen. Und es wird mir eine Wohltat sein, mal für mich ohne Kommas zu schreiben und richtiges Deutsch – nicht alles so unnatürlich wie im Büro.«
Richtiges Deutsch! Die Qualität dieser hemmungslosen und ungestümen Selbstaussprache der Stenotypistin Doris in Irmgard Keuns »Das kunstseidene Mädchen« ist mit Duden-Maßstäben gar nicht zu bemessen. Das strotzt von Ellipsen, Aposiopesen, merkwürdigen Inversionen, ihre Interpunktion ist zum Weglaufen, ihre Metaphern manchmal mehr als gewagt, bei den Sprichwörtern ist sie ebenfalls nicht immer sattelfest, aber das hat eine packend-atemlose Verve und ist in seiner artifiziellen Zügellosigkeit ein treffsicheres Abbild der aufgeregten Seelenlage der Protagonistin und auch der Zeit, der ganz frühen 30er Jahre. Keun schlachtet diese Sprache der Einfalt satirisch-parodistisch aus, wo es nur geht, aber sie lacht eben nicht in erster Linie über das Dummchen Doris. Die nämlich – und das entspricht der klassischen Entlarvungsstruktur des Schelmenromans – zeigt in ihrer Naivität viel Reife, sagt in ihrer forcierten Ungebildetheit sehr viel Kluges und karikiert auf diese Weise – wenn auch eher unfreiwillig – die bürgerliche Scheinheiligkeit, den Bildungssnobismus, den politischen Dogmatismus der Zeit und liefert nicht zuletzt ein detailscharfes Porträt der dem Faschismus gerade in die Arme laufenden Weimarer Gesellschaft. In einer wunderschönen Episode decouvriert sie etwa den Rassen-Kokolores, der kurz davor stand, zur Staatsdoktrin zu avancieren. Doris hat eine Verabredung mit einem Geldsack (»die Großindustrie«).
»Fragt mich die Großindustrie, ob ich auch ein Jude bin. Gott, ich bin’s nicht – aber ich dachte: wenn er das gern will, tu ihm den gefallen – und sag: ›Natürlich – erst vorige Woche hat sich mein Vater in der Synagoge den Fuß verstaucht.‹