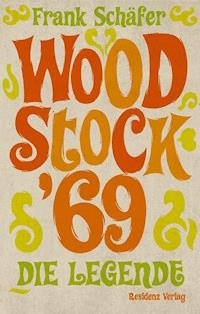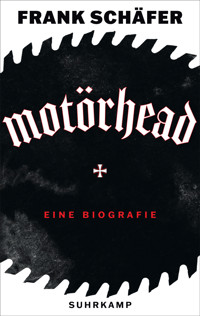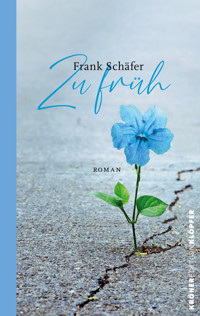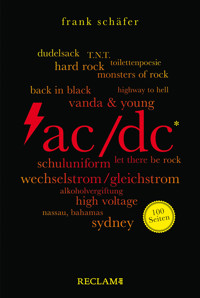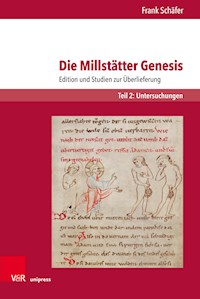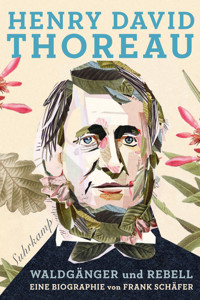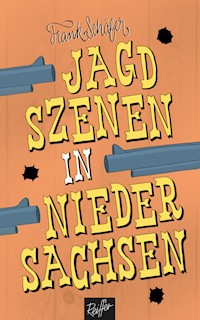
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Andreas Reiffer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Frank Schäfer durchstreift die niedersächsische "Metropolregion", ihn zieht es von Hannover nach Wolfsburg, von Göttingen nach Bargfeld, um in Braunschweig eine Heimstatt zu finden. Er besucht die heiligen Stätten der Ausgehkultur, das "Deutz" und das "Nörgelbuff", erlebt die legendären Derbys zwischen Eintracht Braunschweig und den anderen, aber auch die brutale Schönheit der dritten Kreisklasse. Er ist live dabei, als Landesvater Gerhard Schröder sich von seiner Super-Hillu trennt und AC/DC das Expo-Gelände erleuchten. Er gibt wertvolle Tipps, wie man als Neubürger in einem Heidedorf seine Überlebenschancen erhöht, weiß von einem Beinahe-Amoklauf in der ältesten Gesamtschule Braunschweigs, Niedersachsens, vielleicht sogar der Welt und beobachtet mit großem Wohlgefallen die gelungene Integration von Neubürgern aus Afrika. Wenn ihm das Land tatsächlich mal zu platt und die Menschen zu maulfaul sind, trinkt er halt für zwei – oder schifft sich als Bordschreiber bei der Full Metal Cruise ein und schippert mit hunderten niedersächsischen Headbangern durchs Mittelmeer. Aber er kehrt immer wieder zurück, weil ihn die Mühen der Ebene nicht schrecken. Im Gegenteil, hier gibt es sie noch, die wahren Genies und Knasterköppe. Hinter all seinen hundertprozent wahren Geschichten lauert die tröstende Erkenntnis: Niedersachsen, du hast es besser! Plus 19 Fotografien von Oscar Schäfer mit niedersächsischer Bushaltestellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jagdszenen in Niedersachsen
von Frank Schäfer
Umschlaggestaltung: Marcel Pollex
Fotos: Oscar Schäfer
Satz/Layout: Andreas Reiffer
1. Auflage 2019, identisch mit der Printversion
© Verlag Andreas Reiffer
ISBN 978-3-945715-64-2 (E-Book)
Verlag Andreas Reiffer, Hauptstr. 16 b, D-38527 Meine
www.verlag-reiffer.de
www.facebook.com/verlagreiffer
Für meine Eltern, Niedersachsen durch und durch
Das ist das menschliche Epos, das sind die wirklichen Sachen: die Leute stehen an der Bushaltestelle – der Bus hält ein bißchen zu weit vorn –, und die Wartenden gehen ihm nach und steigen ein, Tag für Tag, im Inland und im Ausland, in diesem System und in jenem, im »Feindes«land und im »Freundes«land
Peter Handke, »Die Geschichte des Bleistifts«
Das Fiasko von Peine
Als ich einmal fast Yellow-Press-Reporter geworden wäre
... trug es sich folgendermaßen zu: An einem trübtassigen Sonntag im März vor mehr als 20 Jahren, promenierte ich in weiblicher Begleitung an den Gestaden des Hannoverschen Maschsees entlang, um hernach dem Sprengel Museum einen Besuch abzustatten. Es war einer dieser Sonntage, arschkalt und zutiefst niedersächsisch, wie gemacht, um a) eine Schachtel »Edle Tropfen in Nuss« zu verkosten und danach mit der Familienplanung voranzuschreiten oder eben b) sich die aktuelle Ausstellung »Sex & Crime« anzuschauen.
Ich war für a), musste aber mit ins Museum. Als wir, nach einstündiger Maschsee-Tristesse reif für ein paar warme Gedanken, am Sprengel-Restaurant bell’ARTE vorbei zum Haupteingang lustwandelten, saß da am Fenster mein von Ferne geliebter Landesvater, Genosse Gerhard Schröder. Knapp zwei Jahre später war er Kanzler und spülte den Sozialstaat schneller im Klo runter, als du Agenda 2010 sagen konntest. Damals aber galt er als einzige Alternative, um den Dicken abzulösen, und nötigte einem Proleten wie mir insofern Respekt ab, als er beinahe schon glaubhaft versichern konnte, er habe als Kind »jahrelang Fensterkitt gefressen«. Man wird also vielleicht verstehen, dass ich für einen Moment meine sprichwörtliche Nonchalance verlor.
»Schau mal«, rief ich aufgeregt, »da ist ja mein von Ferne geliebter Landesvater.«
Meine Begleitung blieb ganz cool. »Na klar isser das. Und wo er ist, da ist auch Super-Hillu nicht weit.«
Tatsächlich saß sie ihm gleich gegenüber. Bei einem Pharisäer. Oder was man damals eben so trank in Politikergattinenkreisen.
»Na, die kucken aber!«, sagte die Frau an meiner Seite erschrocken. Und hatte recht. Das hier war nicht mein leutseliger Ministerpräsi, nein, so kannte ich ihn ja gar nicht. Sein Gesicht verhärtet, wie ein komplett heruntergelassener eiserner Vorhang, und er hatte diesen verschlagenen, zugleich ultrabrutalen, KGB-mäßigen Blick drauf. Er sah aus wie ein lupenreiner russischer Demokrat.
Und seine Gattin Hiltrud?
»Die hat doch geheult«, schoss es meiner Begleitung in einer Mischung aus Erstaunen und robuster Erbarmungslosigkeit heraus.
Etwas mehr Empathie hätte ich gut gefunden, aber ich schwieg. Plan a) war noch nicht vom Tisch.
Wir wollten beide nicht aufdringlich erscheinen und lösten nach einer Weile unsere plattgedrückten Nasen von der Scheibe, um uns etwas Kunst anzusehen oder zumindest »Sex & Crime«, aber die Gedanken wanderten immer wieder zurück zu dieser Szene. Am Abend lösten die Lokalnachrichten das Rätsel auf. Es gab nun ein niedersächsisches Traumpaar weniger.
Im Wahlkampf, auf einer verregneten SPD-Fahrradtour verschwanden sie das erste Mal hinterm Busch. An einem geisttötenden Märzwochenende in der Sprengel-Schmuratze war die Liebe verduftet. Und ich war sozusagen live dabei. Ich witterte meine Chance und begann schon im Geiste einen schamlosen Schmodder-Artikel für die »Bunte« runterzutippen. Aber dann sah ich aus dem Augenwinkel, wie zierliche Frauenhände zärtlich »Edle Tropfen in Nuss« vom Cellophan befreiten.
Braunschweiger Schule
Die »Wilhelm Bracke« ist die älteste Gesamtschule Braunschweigs, Niedersachsens, ja vermutlich sogar der ganzen Welt. Sie öffnete jedenfalls in den Siebzigern ihre Flügeltüren – und man weiß, was in den Siebzigern gebaut wurde, wurde auf Treibsand gebaut. Schon seit längerem drohte das Gebäude wie von einer gewaltigen Klosettspülung in den Abgrund gerissen zu werden, und als dann neulich auch noch die Feuerwehr ihre Jahresinspektion veranstaltete und überall Abfalleimer vorfand mit hochentzündlichem »Papier«, da war es beschlossene Sache, man zog die Spülung und baute eine neue feuerfeste Schule, gleich nebenan. Noch heller, noch schöner, nur leider kleiner. Die Schüler greinten zwei Tage um ihre alte Verwahranstalt. Die langen Flure, die vielen dunklen Eckchen, die zum ungestörten Verweilen und Drogenverkaufen einluden. Hach, schön war die Zeit und kommt nie mehr zurück.
Nach einer halben Woche Eingewöhnung jedoch rüttelte sich alles zurecht. Neue Distributionsformen etablierten sich. Die zunächst deftig anziehenden Dope-Preise pegelten sich wieder ein auf Weltmarktniveau. Die Natur findet immer einen Weg.
Mit kleineren Eingewöhnungsschwierigkeiten kämpfte allein das Servicepersonal. Wenn etwa die Pommes-Mamsell nur ein Ideechen zu spät von ihrer Zigarrenpause kam und die Fritten verbruzzelten, sah die etwas übernervöse Rauchmeldeanlage gleich rot und klingelte die gesamte Belegschaft nach draußen auf den Schulhof. Bei den mit Calvados flambierten Schweinelendchen das gleiche Spiel. Als die Lehrkräfte Crème brûlée auf der Speisekarte lasen, schüttelten sie bedenklich die Köpfe. Zu Recht! Aber auch nach der fünften Evakuierungsübung innerhalb einer Woche ließen sie es nicht an Professionalität mangeln. Im Gegenteil, sie wurden besser und besser. Selbst die Bläserklasse unterbot bald spielend, nämlich den Radetzky-Marsch schmetternd, die magische Ein-Minuten-Grenze.
Man war also bereits in Übung, aber doch nicht wirklich darauf vorbereitet, als sich ein feister »Handwerker«, so lautete die offizielle Erklärung, seine Büffelhüfte auf den »Amokalarm«-Knopf pflanzte und das in solchen Fällen übliche Procedere in Gang setzte. Der Schulleiter verlas sogleich eine Erklärung über die Hausanlage, derzufolge ein gefährlicher Eindringling sich im Gebäude aufhalte, und man jetzt besser auf Wagenburg-Modus umschalte. Da schlug die Stunde des Kollegen S., zufällig ist er der Klassenlehrer meines Sohnes.
»Schande«, sagte er unbeeindruckt, teilte die Klasse blitzschnell in kleinere Operationseinheiten, befestigte flugs den Eingang mit einer uneinnehmbaren Barrikade aus Tischen und Stühlen, tröstete ein paar verängstigte Kinder mit aufmunternden Worten »Reißt euch zusammen, wir sind im Krieg!« und griff zum Feuerlöscher.
»Das wird dem Arschloch – Schuldigung, Kinder! – gleich sehr wehtun ...«
Der Amokläufer konnte von Glück reden, dass es ihn gar nicht gab. Als mir mein Sohn mit leuchtenden Augen die Geschichte erzählte, wusste ich wieder einmal, dass wir bei der Wahl der Schule alles richtig gemacht hatten.
Schöne Augen
Das Wappentier Niedersachsens ist das Pferd. Ich hätte eher die Kuh genommen. Eventuell auch das Schwein. Aber das ist angesichts seiner Gier, die sich nicht zuletzt in dem alptraumhaften Quieken kurz vor der Fütterung bemerkbar macht, seiner die eigenen Ferkel erdrückenden Rücksichtslosigkeit und auch seiner Physiogonomie, der Hautfarbe zumal, viel zu menschenähnlich, um wirklich als Sympathieträger zu taugen. Außerdem enthält das Fleisch zu viel Fett.
Die im norddeutschen Raum überwiegend anzutreffenden »Schwarzbunten« allerdings, Arno Schmidts »Kühe in Halbtrauer«, sind durch und durch liebenswert. Auf eine nicht mal unaparte Weise schwerfällig, stoisch, ein bisschen naiv, zutraulich, ohne Arglist. Wer mit dem Gedanken an Vegetarismus spielt und sich noch nicht recht entschließen kann, der muss einer Kuh in die schönen braunen Augen sehen – die Konversion wird einem dann sicher leichter fallen.
Man sollte sie auch mal in Aktion erlebt haben. Wenn der Bauer auf die Weide kommt, um ihnen frisches Wasser zu geben oder den Zaun zu überprüfen, erkennen sie schon von weitem den Trecker oder Benz und trotten ihm entgegen. Und wenn er ihnen nach kurzer Begrüßung den Rücken zuwendet, weil er seinen Verrichtungen nachgehen muss, stupsen sie ihn sanft an, als wollten sie ihn auffordern, sich wieder um sie kümmern. Und das tut er dann ja auch, wenn nicht gleich, dann später.
Ich habe meine eigenen Erfahrungen mit Kühen gemacht. Im Frühling, wenn es warm genug ist draußen, um die Rinder nach den langen Wochen im Stall wieder auf die Weide zu treiben, ruft mich regelmäßig ein befreundeter Bauer hinzu. Denn die kopflosen, von ihrer neuen Freiheit berauschten Tiere springen mit erstaunlicher Gewandtheit herum, nach hinten ausschlagend, und rennen danach mit einer solchen Lebenslust und angestauten Agilität drauflos, einer Bisonstampede gar nicht so unähnlich, dass jedes Paar Beine gebraucht wird, um sie auf dem rechten Pfad zu halten. Meistens büxen dann doch ein paar Jungtiere aus, die zum ersten Mal den Stall verlasssen dürfen, und müssen in einem umliegenden Waldstück gesucht werden, wo sie dann von der vielen Aufregung ermattet und hungrig herumstehen, um sich an saftigen Schößlingen gütlich zu tun.
Früher hatten die Tiere sogar Namen. Bei einem anderen Bauern fingen alle Milchkühe mit H an. Irgendwann fiel mir auf, dass auch bei ihm Vor- und Nachname mit diesem Buchstaben begannen. Und weil alles so hübsch rund lief mit der Besamung und Benamsung schuf er eine lange H-Tradition, in die sich dann irgendwann auch seine drei Kinder Heike, Helga und Harald trefflich einreihten. Man sieht hier noch einen letzten Reflex des einstigen Stellenwerts, den die Kuh im alten bäuerlichen Sozialgefüge besaß.
Das heißt nicht, dass man sich auf einem niedersächsischen Bauernhof jemals Sentimentalitäten geleistet hätte. Wenn den heranwachsenden Hoferben nach der Scheunenfete der Hafer sticht und er sich zuvor mit einem halben Dutzend Jollen Mai-Ur-Bock gewisse höhere Zerebralfunktionen wie das Empfinden von Mitleid ausgeschaltet hat, schreitet er des nachts im Kreise seiner Neanderthaler-Horde auf die Weide, um die dösenden Tiere umzuschubsen. Man hat immer wieder Skepsis an der Glaubwürdigkeit solcher Geschichten geäußert. Das sei nichts weiter als Provinzlerlatein, so wie das Aufblasen der Frösche, das man gern Städtern erzähle, um ihre Ressentiments zu füttern. Ich habe es nie mit eigenen Augen gesehen, wohl aber eine männliche Dorfjugend unter dem Einfluss von Mai-Ur-Bock – und zweifle nicht eine Sekunde daran.
Für Sentimentalitäten und dergleichen »Fisimatenten« und »Meckenken« hat ein niedersächsischer Bauer keine Zeit und wohl auch kein Sensorium. Andererseits weiß die Melkerfachliteratur durchaus davon, dass die Kuh schonend, sanft und freundlich behandelt werden müsse, weil Zuwiderhandlungen sogleich den Ertrag empfindlich schmälern. Ein überaus sensibles Tier also.
Das kann mein alter Bauernfreund bestätigen. Ihm werde immer ganz anders, wenn der Viehtransporter komme, um die todgeweihten Kühe zum nächsten Schlachthof zu bringen, erzählt er mir mit einem traurigen Kopfschütteln. Wenn man sie zum Wagen führt, schwimmen ihre schönen Augen. Sie weinen.
Umtauschen, was sich noch umtauschen lässt
Neulich lernte ich im Bildungsfunk, dass weibliche Wildgänse erstmal ein paar männliche Partner innerhalb ihres Schwarms ausprobieren, mit ihnen eine Weile umherflattern, einander die Bürzel zupfen oder die Schwingenmauser zusammen begackern, bevor sie sich für den stressfreiesten Partner entscheiden. Ein ganz ähnliches Verhalten legt von Alters her der gemeine niedersächsische Dorfbewohner an den Tag.
Schon als kleiner Junge kam es mir nicht richtig, geradezu amoralisch vor, wenn ich bei meinen Schlüssellochvisiten bemerken musste, dass meines Bruders Kfz-Mechaniker-Griffel unter dem weiten Batik-Shirt von Roswitha herumschraubten, obwohl die noch in der Woche zuvor seinem besten Freund Tony mit einigem Engagement ihre Natternzunge in den Hals gesteckt hatte. Und was tat Christine, die grazile, papierweiße Dorfqueen, deren nackte Schultern dem kleinen Spanner hinter der Tür, geradezu Tränen der Rührung in die Augen trieben? Die ließ mittlerweile den fulminanten Ernst, einen Braungurt-Karateka, der die Gang schon zweimal in Unterzahl rausgehauen hatte, nach ihrer Pfeife tanzen.
Das war alles ziemlich verwirrend für einen Viertklässler. Als ich meine Mutter daraufhin befragte, ob das nicht komisch sei, wenn jede mal mit jedem dürfe und das auch noch alle wüssten, und ob es da keinen Streit gebe, weil die Jungs oder Mädchen untereinander ja vielleicht auch mal Sachen erzählten, die keinem was angingen. »Und so ...«
Meine Mutter sah mich überrascht an, vielleicht auch ein bisschen besorgt darüber, was für einen lebensuntüchtigen Romantiker sie da großzog, und winkte schließlich ab. Das habe es immer gegeben.
»Umetüschen« hätte schon ihre Mutter das genannt. Man komme eben nicht so leicht weg hier.
»Aber das Nachbardorf?«, wagte ich einen Einwand.
»Nicht so einfach«, schüttelte sie bedenklich den Kopf, »frag mal Opa!«
Und ich erinnerte mich an seine blutigen Geschichten von historischen Schützenfesten, in denen Nachbardörflern schon wegen weit geringerer Verfehlungen als einem »Frauenraub« das Fell über die Ohren gezogen wurde.
Man blieb also lieber im Dorf, tauschte um, was sich noch umtauschen ließ, und wer es sodann vermochte, mehrete sich redlich.
Damit sind wir aber noch einem anderen Rätsel hart auf der Spur, den vielen Beinamen in niedersächsischen Dörfern. Sie sind eine direkte Folge daraus – entstanden aus purer Unterscheidungsnot. Weil es, nur mal als Beispiel, fünf Familien mit dem Namen Hinze gibt, die alle irgendwie inzüchtig miteinander in Verbindung stehen, braucht es zusätzliche Attribute. Hinze neun ist der mit der Hausnummer neun, Schnellen-Hinze einer, der nicht lange fackelt, und Sarg-Hinze der lokale Tischler (die noch übrigen beiden werden immer verwechselt). Auf diese Weise entsteht der wunderbarste, noch gänzlich voremanzipatorische Doppelnamenirrsinn à la Zwetschgen-Pahl, Hammer-Schmidt, Knickknack-Fricke und Suff-Schäfer, und nicht immer ist ganz klar, was diese zwischen übler Lästermäuligkeit und herzlichem Spott changierenden Necknamen eigentlich bedeuten sollen.
Mach Kopfwurst draus
Der kleine Nachbarjunge rollert mir entgegen, gesenkten Kopfes und mit einem Gesicht, in dem sich Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit tief eingegraben haben und bei dessen Anblick man ihm auf der Stelle ein Eis schenken will.
Warum er heute allein von der Schule komme, frage ich ihn. »Normalerweise seid ihr doch immer mit der ganzen Gang unterwegs.«
Seine Freunde hätten ihn heute nicht dabeihaben wollen. Er wisse nicht mal, warum. Um nicht loszuheulen, stratzt er schnell weiter.
Da weiß ich plötzlich, wie ich ausgesehen haben muss, damals, als die anderen mir sagten, wir würden Verstecken spielen, und ich eine gute halbe Stunde brauchte, bis ich dahinter kam, dass mich niemand suchte.