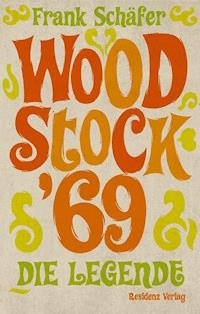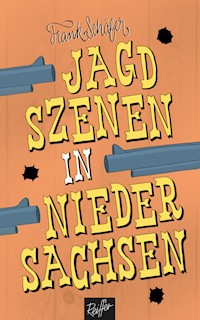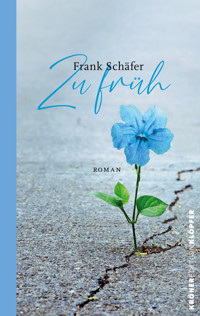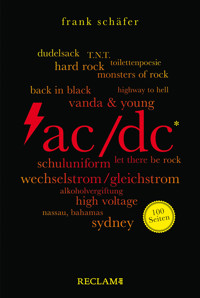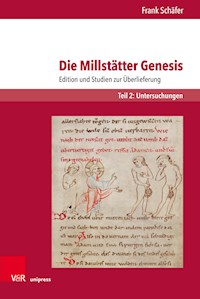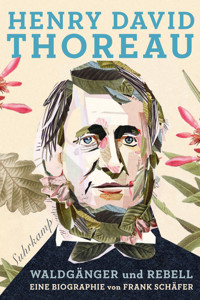Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Satyr Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frank Schäfer nimmt uns mit auf seine Tauchgänge in die kuttenbehangene, nietenbewehrte, splissgeschädigte Hardrock-Szene und lässt uns teilhaben an dieser herrlich schwarz-weißen und trotzdem hochkomplexen, martialischen und doch so friedlichen Unterwelt. Er kriecht ganz tief hinein in die Boxen seiner Anlage, um seiner Musik noch eine letzte lebensphilosophische Maxime abzugewinnen – oder wenigstens einen guten Witz. Trotz fortgeschrittener Dienstzeit am Metal geht er noch immer dorthin, wo es wehtut: in den Moshpit, in die Untiefen des Schlamms von Wacken oder in die Jugendkirche, wo junge Konvertiten eine schwarze Messe improvisieren. Der Autor hat schon die Erfindung des Heavy Metal hautnah miterlebt und so schwingt manchmal auch ein bisschen Wehmut mit, wenn er noch einmal die frühen, aber ganz und gar nicht unschuldigen Tage des Genres heraufbeschwört. »Qualitativ bessere Genre-Literatur wird schwer zu finden sein.« FFM Rock »Schäfer gelingt es durch seine Schreibe, das Gefühl des Rock 'n' Rolls astrein zu transportieren.« Metal.de »Metal-Musik hat mich nie besonders interessiert – aber schon lange alles, was Frank Schäfer schreibt. Er könnte ein Buch über ›Die aktuellen Ergebnisse der sekundären Kunststoffchemie in Luxemburg‹ schreiben und ich würde es lesen.« Franz Dobler
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANK SCHÄFER
NÖTES OF A DIRTY OLD FAN
METAL STORYS
Frank Schäfer
(geboren 1966, Dr. phil.) lebt als Gonzo-Kritiker, Metallarbeiterdichter und ewiger Leadgitarrist von Salem’s Law in Braunschweig Rock City.
Er ist seit vielen Jahren als Literatur- und Musikkritiker für taz, NZZ, Zeit Online und andere Medien tätig, insbesondere als Spezialist für Hardrock und Heavy Metal. Im Rolling Stone und im Rock Hard betreut er eine ständige Kolumne zum Thema.
Neben Romanen und Erzählungen erschienen von ihm diverse Sachbücher und Essaybände zur Literatur- und Kulturgeschichte, zuletzt Krachgeschichten (Zweitausendeins), Heavy Kraut (Verlag Andreas Reiffer) und AC/DC. 100 Seiten (Reclam).
E-Book-Ausgabe November 2024
© Satyr Verlag Volker Surmann, Berlin 2024
www.satyr-verlag.de
Grafik: Jussi Jääskeläinen, kobaia-design.com
Korrektorat: Matthias Höhne
Printed in Germany
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über: http://dnb.d-nb.de
Die Marke »Satyr Verlag« ist eingetragen auf den Verlagsgründer Peter Maassen.
E-Book-ISBN: 978-3-910775-23-7
Inhalt
Ooo–ooo–whee!
Auge um Auge
Fast eine Freundschaft
Wir waren zu billig
Dann kam die Nacht
Gefahrensucher
Die Quadratur des Kreises
Keule als Symptom
Kühe in Halbtrauer
36 Mägde und Knechte
Romantisches Schwermetallwochenende
Der wahre Hund von Baskerville
Die ewige Wiederkehr des Ozzy Osbourne
Sanfte Verhackstückungen
Der zwölfte Mann
Der Seuchenvogel
Ach & Krach
Kirchweih
Schlechteste Band der Welt
Schorse der Coach
Chuck Berry mit Raketentechnik
Duggedaggeduggedagge
Die drei Amigos
Dolche zwischen den Zähnen
Schlechte Nachrichten
Heiliger Rauch
Der Heintje–Effekt
Kutten sieht man nicht
Hilfe ist unterwegs
Überall ist Uhlenbusch
Gegniedel and the Damage Done
Tattoos & Metal
Noch ein verschwendeter Abend
Im Grrr–Land
Was ich von Obituary hörte
Der Woodstock–Effekt
Kissology
Nicht weitererzählen
Headshot hauen einen raus
Marshall–Empowerment
Ein besserer Ort
Ein Haufen Schnittchen
Ehrloses Pack
Eine dysfunktionale Familie
Auf links krempeln
Eine andere Gesellschaft
Schmutziges Geschäft
Dank
Ooo–ooo–whee!
Als Heavy Metal sich als Genre und bald darauf auch als Gegenkultur und Kirche konstituierte, brauchte man einen Namen für all die Glaubensgenossen, die fettzöpfigen, splissgeschädigten, kuttentragenden Vollspacken. Also uns. Und das Kollektiv einigte sich auf »Headbanger«. Sagte man unter Soziologen. Ich hab mich nämlich gar nicht geeinigt, ich hatte das irgendwo gelesen und nachgeplappert und dann war es eben so.
Mittlerweile ist der Begriff auch schon wieder vom Tisch, ausgetauscht durch den objektiveren »Metalhead«. Ich habe mich hin und wieder gefragt, wann dieser Tausch vollzogen wurde und wer verantwortlich dafür war, und kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es Anfang der Neunziger geschehen sein muss, als so vielen Heavy Metal plötzlich peinlich zu werden begann. Man wollte offenbar nicht nur die obsolete Musik loswerden, sondern die ollen Kuttenträger gleich mit.
Auch deshalb fand ich die Bezeichnung »Headbanger« immer angemessener. Verschwitzter, ungewaschener, subkultureller. Sie trug noch die Verachtung in sich, die man seitens der Konsensgesellschaft für den frühen Fan dieses Krachs übrighatte: eine Menge Verachtung. Und sie zeigte auch, dass Heavy Metal eben doch was mit Punk zu tun hatte, was viele anfangs gar nicht gerne hörten, schon gar nicht die Musiker selbst.
Der erste tatsächlich so genannte Headbanger ist nämlich meines Wissens eine Sie, heißt Suzy und lebt in einem Ramones-Song vom 1977er Album »Leave Home«. »Can’t stop, stop that girl / There she goes again / I really, really love to watch her / Watch her headbangin’ / Suzy is a headbanger / Her mother is a geek / Do it one more time for me / Ooo-ooo-whee!«
Auch der zeitlich nächste Fund, und ich habe lange gesucht, gehört noch zum Punk, wie nicht nur die Huronenpeitsche auf dem Cover des 1981er Plasmatics-Albums »Beyond the Valley of 1984« beweist. Hier ist der »Headbanger« keine lustige Gesellin mehr, mit der man Spaß haben kann, im Gegenteil. »Headbanger / You got your brains french fried / Headbanger / You’re gonna burst inside / Headbanger / You got a special skill / Headbanger / You live for overkill.« Das ist doch schon ein anderer Schnack.
So richtig infiltriert hat er die Metal-Szene aber erst ein Jahr später. Zumindest die Tätigkeit wird schon mal besungen im Titelsong des 1982er Anvil-Albums »Metal on Metal«: »Metal on metal / Heads start to bang / Denim and leathers / Chains that clang.« Reim dich oder ich bang dich. Voll durchgesetzt ist er dann im Jahr darauf. »Bang your head«, forderten Quite Riot und sprachen im Beipackzettel auch gleich von den Nebenwirkungen, »Metal health will drive you mad«. Manowar drückten es mal wieder etwas poetelnder aus, in »Gloves of Metal« von »Into Glory Ride«. »Off with the lights, hear the screams / See the banging heads awaken to their dreams.« Und in Metallicas Backcover-Sinnspruch »Bang that head that doesn’t bang!« vom Debüt »Kill ’Em All« bekommt das ewige Kopfgedängel schon seine typische Doppelfunktion, es soll die Gruppe nach innen konsolidieren und nach außen abschotten. Wir gegen die!
Aber die Tätigkeit selbst gab es natürlich lange vorher. Schlagzeuger haben immer schon gern mit dem Kopf den Beat begleitet und bei Ozzy Osbourne und Geezer Butler bestimmte es schon früh die Performance, wie ein Sabbath-Live-Dokument aus Paris des Jahres 1970 zeigt. Wann es aber von der Bühne runterschwappte ins Publikum, zu einer kollektiven Handlung und dann zu einer subkulturellen Insignie wurde, ist schwer zu sagen! Der erste, zumindest mündlich überlieferte Beleg stammt aus dem Jahr 1969. Led Zeppelin spielten in der Bostoner Tea-Party-Halle, das Konzert nahm kein Ende, Zugabe folgte auf Zugabe, Phrenesie, Ekstase, schließlich ballerte die erste Reihe im Takt zu »How Many More Times« manisch ihre Köpfe gegen die Bühne. Da war er offenbar geboren, jener Headbanger, den auch Exodus im Sinn hat, der seine Zugehörigkeit zur Gruppe notfalls mit Blut besiegelt. »Murder in the front row / Crowd begins to bang / And there’s blood upon the stage / Bang your head against the stage / And metal takes its price / Bonded by blood!« Richtig so!
Auge um Auge
Der Chef der Kreisvolkshochschule Freudenstadt lud mich zu einer Metal-Lesung ein. Freudenstadt? Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Hin da! Die Veranstaltung sollte dann aber in Horb am Neckar stattfinden, dem Tor zum Schwarzwald, noch dazu im Kulturhaus Kloster. Horb klang nach einem halb unterdrückten Bäuerchen und auch wenn es mir ein gewisses diebisches Vergnügen bereiten würde, das lokale Kloster mit Heavy-Metal-Blasphemien zu entweihen, zu versaubeuteln, ja nach allen Regeln der heidnischen Kunst abzufackeln, zumindest verbal, hatte ich meine Bedenken.
»Da kommt doch keine Sau!«
»Doch«, meinte der KVH-Direx überzeugt und erklärte sich dann ausführlich. Das Kloster sei längst säkularisiert, das Kulturhaus als Veranstaltungsort eingeführt, außerdem hätten diverse Bands in den weitläufigen Weinkellern und Katakomben ihre Übungsräume. »Nur Metal«, seufzte der Mann, also nicht gerade ein Fan, aber doch einer, der sein Kulturverweseramt ernst nahm. Der nachvollziehbare Gedanke war nämlich, dass die »jungen Leute«, da sie ja ohnehin vor Ort waren, nach der Übungssession für ein paar Texte in den Lesesaal vorbeischauen könnten. Ich zierte mich noch ein bisschen, aber nur um das Honorar zu verdoppeln.
Ein paar Wochen später saß ich im pittoresken Andachtsraum des Klosters und wartete auf die Kuttenträger. Die kamen dann auch aus ihren Klausen gekrochen, grüßten freundlich – und fuhren stracks nach Hause. Mutti hatte offenbar was Gutes gekocht. Oder am nächsten Tag stand Mathe an. Hinterher hörte ich, sie hätten mit dem Veranstaltungsmodell Lesung nicht viel anfangen können. »Da kommt einer und liest was vor? Aus seinen eigenen Büchern? Aber warum?«
Es füllte sich dann doch ganz leidlich. Mit einem kulturbeflissenen Ehepaar, das »auch ein bisschen schreibt«, einer Gruppe aus dem Altersheim, die sich in der Lokalität geirrt hatte und sich nun wunderte, wo die Dias aus Tibet blieben, und einer jungen Frau, deren Einsamkeit in jedem ihrer Blicke mich ins Mark traf.
Und dann war da eben noch Walle Sayer, der Lyriker, der in der angeschlossenen Schankwirtschaft hinter der Theke stand und bei einer Auftragsflaute immer mal wieder reinschaute. Ich kannte ihn dem Namen nach, dachte aber immer, er käme aus Südafrika und hieße entsprechend »Wolli Säja« oder so ähnlich. Nichts da, er kam aus der Gegend, sprach ein wohlklingendes Schwarzwälder-Kirsch-Deutsch und war einfach der Walle Sayer. Ein Pfundskerl, der den desillusionierten Veranstalter und mich anschließend mit Bier und Gebranntem wieder aufmöbelte, irgendwann dann selber mitzechte und mich am Ende sogar ins Hotel fuhr. Bei Blitzeis übrigens. »Huijuijui«, lachte Walle, wenn er mal wieder eine Kurve unterschätzte und sein Wagen ins Pirouettieren kam.
Bevor dieser Abend allerdings so ein gütliches Ende nahm, holte ich mein Notizbuch heraus. »Jetzt nennt ihr mir bitte noch mal den Namen jeder Band, die ihren Übungsraum im Kloster hat!«, sagte ich. Die beiden lachten zunächst, weil sie dachten, ich scherze. Tat ich nicht. Jeder Kritiker hat eine schwarze Liste, meine wurde gerade wieder um ein paar Namen länger.
Fast eine Freundschaft
Schicht, Hitte, Pohlmann und die anderen waren eine Gang vom konkurrierenden Otto-Hahn-Gymnasium. Hier gingen die Schlauberger der Kreisstadt zur Schule. Für das ganze Kroppzeuch aus der niedersächsischen Steppe drum herum, also uns, wurde eine eigene Verwahranstalt in den Suburbs gegründet, das Humboldt-Gymnasium. Wer das OHG besuchte, durfte sich also urbaner vorkommen und war es auch. Zwar schien Gifhorn mit Begriffen wie Metropole oder Moloch nicht wirklich treffend beschrieben, aber in den analogen Achtzigern kamen hier Neuigkeiten trotzdem ein paar Monate früher an als bei uns auf den Dörfern.
Und so saßen wir vermutlich in irgendeiner Bushaltestelle und arbeiteten uns voller Elan an der letzten Viererreihe Mai-Urbock ab, damals im September 1987, während Schicht, Hitte, Pohlmann und die anderen auf dem Weg in die Hamburger Markthalle waren, wo im Verlauf des Abends zwei enervierend ehrgeizige, vor Lebensgier dampfende Garagenbands die Hütte abfackelten. Dass sie etwas wirklich Historisches erlebt hatten, wurde den Konzertgängern allerdings auch erst im Jahr darauf ganz klar, als MTV das Video zu »Sweet Child o’ Mine« einmal pro Stunde sendete. Und zwar wochenlang.
Damals im September 1987 hatte man gar nicht unbedingt Guns N’ Roses, sondern ihre Vorgruppe Faster Pussycat zur originelleren Aerosmith-Kopie und also zum Gewinner des Abends gekürt. Die Geschichte war eben noch im Fluss und die Markthalle gerade mal halb gefüllt. Weil die Plattenverkäufe so schleppend anliefen, hatte sich das Geffen-Label für den kurzen Europa-Trip seiner Band außerdem noch eine kleine Schikane ausgedacht und an den Roadies gespart. Die Musiker mussten ihre Marshalls selber schleppen.
Da Schicht, Hitte, Pohlmann und die anderen ohnehin nicht wussten, was sie mit dem angebrochenen Abend anfangen sollten, sprangen sie kurzerhand auf die Bühne und halfen mit. Einträchtig buckelten jetzt also Jungs aus Gifhorn und Los Angeles Verstärkertürme in den Laster. Und weil das alles so harmonisch Hand in Hand ging, dehnte man die Zusammenarbeit auf die Alkvorräte im Backstage-Raum aus. Das hätte der Beginn einer wunderbaren deutsch-amerikanischen Freundschaft sein können, aber irgendwann ließ sich die Putztruppe der Markthalle nicht mehr abwimmeln. Sie war zum Feudeln bestellt. Also kam es zu fast schon rührseligen Abschiedsszenen. High Fives, Rubbelnüsse, Ohrläppchengezupfe, alles dabei. Pohlmann, aus dem später mal ein bekannter Anderthalb-Sterne-Koch in einer Pufferschmiede im Hannoverschen werden sollte, witterte seine Chance. Er zeigte auf Slashs schwarzen Nasenquetscher, den der schon damals nie absetzte, und fragte mit akkurat südkalifornischem Zungenschlag: »Can I have your brill?«
Der später sehr berühmte Slash verzog keine Miene und antwortete mit einer sonnigen Gelassenheit, die man nur am Sunset Strip erlernen kann und die keiner der Anwesenden jemals vergessen wird: »No.«
Wir waren zu billig
Ich bin viel zu früh dran. Steamhammer-Chef Olly Hahn öffnet die Tür und versucht, seine Genervtheit hinter forcierter Fröhlichkeit zu verbergen. Ich hatte einen zeitlichen Puffer für die A2 und die hannoversche Innenstadt eingeplant, aber ich wollte dem Mann natürlich auch die Gelegenheit geben, das zu tun, was Labelchefs im Vorfeld eines wichtigen Interviews mit der Spartenpresse stets tun sollten: fröhlich sein und den Vertreter der Spartenpresse mit kleinen Geschenken gefügig machen.
»Wo du schon mal da bist ...« Ein verheißungsvoller Start. »Beliefern wir dich eigentlich vernünftig mit Promomaterial?«
»Besser geht ja bekanntlich immer!«, sage ich mit konspirativem Augenzwinkern.
»Na, dann schauen wir doch mal, was dir so fehlt.«
Olly öffnet seine Schatztruhen und zieht allerlei Vinyl-Kostbarkeiten heraus von Night Demon, Magnum, Dead Daisies, Molly Hatchet, Raven und so weiter. Langsam türmt sich ein recht ansehnlicher Stapel auf und damit es gar nicht erst so aussieht, als könne er mich bestechen, lehne ich auch mal was ab. Gut, ich lehne nichts ab, aber ich nehme es nur, weil verdammt noch mal nichts umkommen soll. Das anschließende Interview läuft dann wie geschmiert.
Mein erster Besuch des Steamhammer-Kontrollzentrums vor über dreißig Jahren war nicht ganz so ergebnisorientiert. Der legendäre Artist-&-Repertoire-Manager CD Hartdegen hatte uns einbestellt. CD Hartdegen, schon dieser Name war Heavy Metal. Unser Trupp aus musikalischen Poltergeistern hatte ihm ein Demo geschickt, mit dem wir beim NDR-Hörfest landen konnten. Der Umstand, es in die Endrunde eines Talentwettbewerbs geschafft zu haben, sicherte uns seine Aufmerksamkeit. Heute müssen alle Beteiligten lachen bei dem Wort »Talent«, damals aber fanden wir es nur gerecht, dass Hartdegen uns ganz groß rausbringen wollte. Er ließ uns in seinem Büro Platz nehmen. Ein cooler, aber freundlicher Typ, der unsere Sprache verstand. Wir tauschten Faves aus, klopften Präferenzen ab, gingen Neuigkeiten durch, die ganz normale Nerdkontrolle, die das befriedigende Ergebnis zeitigte, zur selben Szene zu gehören. Nach einer guten Viertelstunde kam er zur Sache und schrieb den Namen unserer Band auf, »SALEM’S LAW«, um ihn danach zweimal zu unterstreichen. Mir wurde ganz warm ums Herz. Noch nie hatte uns jemand zweimal unterstrichen! Der Vertrag war in Sack und Tüten.
Jetzt ging es nur noch um die groben Feinheiten. Wir hatten ein vollständiges Album eingespielt im Whiteline-Studio zu Braunschweig. Unsere Herzen hatten volle zwei Wochen auf Magnetband geblutet und anschließend hörten sie gar nicht wieder auf, als wir die Studiorechnung sahen. Wir schufteten bei VW im Rohbau, was musikalisch nur adäquat erschien, besuchten mal wieder unsere Großeltern und fuhren in die Spielbank, um Hartdegen schließlich den Rough Mix aushändigen zu können. Er tippte gleich beim ersten Song den Rhythmus mit. »Geht ja ganz gut zur Sache«, sagte er wohlwollend und wir schmolzen dahin. Ich erklärte ihm, was wir uns vorstellten. Einen Bandabnahmevertrag nämlich. Bequeme Sache für ein Label, das nur das Geld für das Tape abschmücken, eventuell ein neues Master anfertigen musste und schon konnte die Pressmaschine lospulvern. Hartdegen sah das genauso.
»Was soll der Spaß kosten?«
Tja. Hmmmm. So dumm es klingt, aber wir saßen hier im Zimmer eines der relevanten deutschen Metal-Labels und hatten uns darüber noch keine Gedanken gemacht. Räuspern, Rumdrucksen, Schulterzucken. Ein paar Provinzpfosten wurden sich auf einmal klar, dass sie nicht annähernd darauf vorbereitet waren, was sie erwarten würde. Nur um dieses peinliche Schweigen zu unterbrechen, meldete ich mich schließlich zu Wort.
»Die Aufnahmen haben 6.000 Mark gekostet, die wollen wir gern wieder reinbekommen«, sagte ich, ganz der Wahrheit verpflichtet.
Hartdegen machte ein drolliges Gesicht, als wolle er einem kleinen Racker einen Lutscher schenken, schrieb sich eine »6.000« auf den Zettel und kreiste die Zahl dick ein.
Wir hörten noch eine Weile ins Demo hinein, unterhielten uns und Hartdegen machte sich Notizen, keine Ahnung, was er da noch alles zu protokollieren hatte, sein Stift jedenfalls war ständig in Bewegung.
Schließlich räusperte er sich, wie das nur Manager können, um dem Fußvolk deutlich zu machen, dass die Audienz vorbei ist. Wir standen auf und ich erhaschte einen Blick auf das Blatt vor ihm. Hartdegen hatte die 6.000 mit kleinen Arabesken, Jugendstilranken und Schnörkeln verziert. Es standen nur zwei Infos auf dem Blatt: unser Name und unser Preis.
Wir waren kaum draußen und atmeten die süßlich schwere, kohlenmonoxidgeschwängerte Luft des Molochs Hannover, da platzte es auch schon aus uns heraus.
»Wir waren zu billig!«
»Ja, verdammt ...«
Alle waren sich einig. Zum ersten Mal. Wir rechneten jetzt ganze vier Wochen täglich damit, dass Hartdegen uns glucksend anrief oder gleich einen Vertrag schickte, aber nichts passierte. Nie. Selbst halb geschenkt waren wir noch zu teuer.
Dann kam die Nacht
Nach gut anderthalb Jahren Pandemie mal wieder ein richtiges Open Air mit meinen Braunschweiger Lieblingsdräschern Headshot. Ich war spät dran, aber die Krokoszinski Sicherheitsdienst GmbH & Co. KG ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, kontrollierte skrupulös den Perso, meinen Impfausweis und fragte schließlich auch noch, ob Mami mir genügend Geld mitgegeben hätte. Woher weiß er das?, überlegte ich, drohte aber spielerisch mit dem Zeigefinger. »Mein lieber Krokoszinski.«
»Schnutenpulli!«, befahl er. »Bei einem Open Air?« Er hob messianisch die Hände: »Es sei denn, du hast gleich ein Wolters vorm Hals und hörst am besten gar nicht wieder auf.«
Als ich das Gelände betrat, sah ich, dass er das allen anderen vor mir auch schon geraten hatte. Die gut 200 Festivalgäste zeigten sich sehr gelehrig. Zwei lagen schon lang, mit dem Kopf nach unten, der Rest arbeitete dran. Endlich wieder zu Hause.
Die Veranstalter hatten freundlicherweise Klappstühle aufgestellt. Man ist die Rumsteherei auf Festivals nicht mehr gewohnt. Ich ging direkt zur Bühne und rief meinen Headshot-Buddys Till und Olaf ein paar aufmunternde Worte zu. »Kann losgehen, bin da!«
»Das gibt Sicherheit«, nickte Till und rödelte gleich darauf los mit der perfiden Grazie eines Abbruchhammers. »Es ist mir ein inneres Blumenpflücken«, ließ Shouterin Dani zur Begrüßung vernehmen, sang aber den Rest des Abends, als wollte sie uns fressen.
»Dani, ich will ein Rind von dir!«, schrie ein Irrer aus der vierten Sitzreihe. Die gekrümmte Haltung verriet seine Angst. Startposition. Falls sie runterkam von der Bühne, um ihn zu holen, wäre er längst auf der Flucht. In ihrer Langmut aber brüllte sie ihn bloß nieder. »DU SCHWEIN!« Er war gewarnt.
Headshot brachten die Sitzreihen ausgelassen zum Schunkeln. Wer noch Haare hatte, ließ sie kreisen. Zwei besonders frenetische Fans falteten Papierflieger mit Songvorschlägen und ließen sie gen Bühne segeln. Die Krokoszinskis steckten die Köpfe zusammen und beratschlagten, ob sie eingreifen mussten. Einem Metalhead standen dicke Kullertränen in den Augen, weil er endlich mal wieder eine richtige Packung bekam. Und er nutzte eine Pause zwischen den Songs, um sein Lebensglück hinauszuschreien: »UNTENRUM!«
Dann kam die Nacht. Die Lightshow sorgte für ein bisschen Muckeligkeit, Headshot legten ein paar Klafter Holz nach und das Festivalvolk strömte zur Bühne, um sich die Beine und Hälse zu vertreten. In meinem Überschwang riss ein Gummi, die Maske schlabberte wild im Schallwind. Aber die aufmerksamen Herren vom lokalen Metalclub Hotel 666 sind bekannt für ihr ausgeprägtes Helfersyndrom. Sie kamen gleich angelaufen und ehe ich mich’s versah, hatten sie mir mit extrabreitem Panzerband die Maske am Ohr festgetaped. »So!«, schrien sie, begleitet von Olafs trügerisch einschmeichelnder Leadgitarre: »Die hält erst mal ’ne Weile!« Sie freuten sich außerordentlich. Der Segen, der im Helfen liegt, ich glaubte, ihn in ihren Augen lesen zu können. Bis ich die Maske später wieder abnehmen wollte.
Gefahrensucher
Vier Metalheads fahren früh los, gen Hamburg. Exodus und Testament machen Halt in der Markthalle. Die Vorbereitungen beginnen schon während der Fahrt. Halbliterdosen müssen geschossen und die letzten Alben der avisierten Bands aufgefrischt werden. Das wohlerprobte Zusammenspiel aus Bier und Gebolze lässt den Geist Rex Kramers in sie fahren. Es unterdrückt nicht nur die natürlichen Instinkte – etwa wegzulaufen, wenn Gefahr droht –, nein, es lässt die inneren Alarm- wie liebreizende Freiheitsglocken klingen. Und so macht die Wagenbesatzung einen kleinen Abstecher zum hiesigen Motorradclub.
Wie durch ein Wunder ist noch keiner vor Ort, also wischen sie die große Tafel vorm Eingang sauber, auf der die »Rocker« ihre Verlautbarungen machen, denn sie haben gleichfalls etwas mitzuteilen – in feinster Sonntagsausgehschrift: »Heute 18 Uhr: Töpfern mit Klaus!«
Es musste danach alles sehr schnell gehen. Wie in der Markthalle übrigens – bei Exodus und Testament.
Die Quadratur des Kreises
Wir hatten ja nichts! Im Steckrübenwinter 83/84. Jüngeren Metalheads kann man nur mit viel Mühe erklären, was damals alles fehlte. Es gab nicht einmal Metalheads. Headbanger hießen die bekanntlich und bei manch einem Dorftroll mit Fünf in Englisch sogar »Hietbääändscha«. Kein einschlägiges Poster an die Wand hängen konnte man, an so etwas verschwendete die sich gerade konsolidierende Szene noch keine Gedanken. Folglich war der Proberaum unserer frisch formierten Nahkampfeinheit mit dem sprechenden Namen Adrenalin orange-braun tapeziert, in einem Muster, das sich die Quadratur des Kreises vorgenommen hatte. Eine niedersächsische Bauernkalenderversion von Acid Art.
Onkel Adolf hatte beim Bau seiner Ponderosa einen Partyraum vorgesehen und nicht bedacht, dass Partys nicht seine Stärke waren, also durften wir dort unsere Instrumente reinstellen und mit ihnen bestialische Dinge anstellen. Unter einer Bedingung: »Wenn ihr Chaoten mir nicht mein Dortmunder Export wegsauft!«
»Geht in Ordnung, sowieso, genau!« Ich kreuzte Zeige- und Mittelfinger hinterm Rücken.
Irgendwann nach einem zergniedelten Übungsabend mit ordentlich Gejaller beschwerte sich Knüppel über das unmetallische Interieur und pinnte einen angeketteten David Lee Roth an die Wand, die Beilage zu »Women and Children First«. Der Anfang war gemacht. Bald darauf brachte er ein Heft mit, bei dem unsere erzenen Herzen sofort einen kollektiven Sprung taten – »Aardshok«. Zunächst lernten wir es auswendig, danach nahm ich vorsichtig das Venom-Poster heraus und hängte es hin. Viel Feuer war hier zu sehen, Cronos drohte ernsthaft, einem Totenschädel in die leeren Augenhöhlen zu pieken, und Mantas schwang ein Samuraischwert, ausgerechnet dieser motorisch stark benachteiligte Mensch. Unverantwortlich!