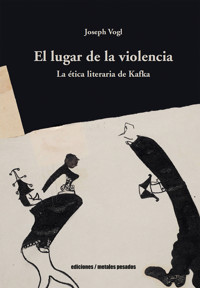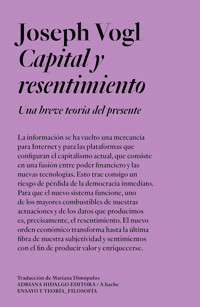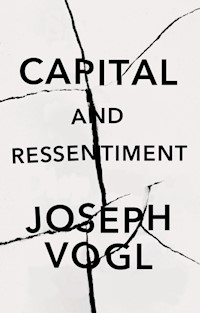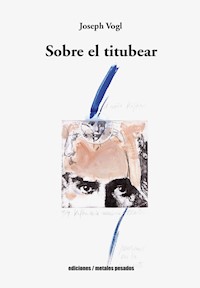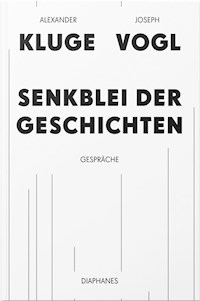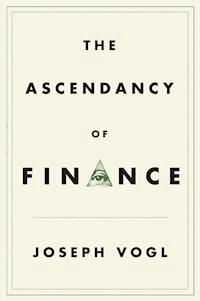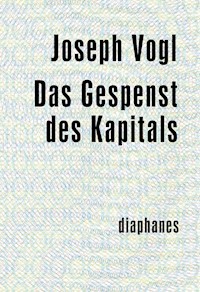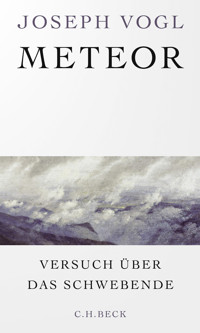
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am Anfang war der Blick in den Himmel. «Meteor» bezeichnet altgriechisch ein weit gefächertes Gebiet schwebender Gegenstände, zu dem atmosphärische Erscheinungen wie Wolken und Wetter, aber auch die Bahnen und Bewegungen der Gestirne gehörten. Doch das Unfeste und Flüchtige begegnet nicht nur in der Wolkenkunde. Joseph Vogl erkundet in seinem brillanten Essay unterschiedliche Schauplätze – von der Literatur über die Philosophie bis zur Naturwissenschaft – des Schwebenden, Ephemeren und (wieder) Leichtwerdens, an denen das Gewicht der Welt schwindet und neue Möglichkeitsräume freigibt. Das Schwebende ist eine Herausforderung für unsere Wahrnehmungsprozesse, weil es sich im «nicht mehr und noch nicht» eingerichtet hat und damit gängigen Wissensformen, Begriffsbildungen und Ordnungsgedanken entzieht. Am Beispiel prominenter Texte – von Kafka und Musil, Goethe und Galilei, Italo Calvino und Jorge Luis Borges – geht Joseph Vogl, einer der außergewöhnlichsten Philologen der Gegenwart, den Verhältnissen von Schwere und Leichtigkeit nach, in denen sich unsere Erkenntnisprozesse mit Machtordnungen und die Weltverhältnisse mit Seelenverfassungen überkreuzen. Angesichts einer Gegenwart, die immer massiver von Gravitationskräften ökonomischer, ideologischer und militärischer Gewalten heimgesucht wird, ist Vogls Text, hervorgegangen aus seiner viel beachteten Berliner Abschiedsvorlesung, eine Hommage an das Leichtwerden und die Momente des Fluiden, in denen aus scheinbar versteinerten Weltlagen die Frische eines Anfangs hervorzubrechen vermag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Joseph Vogl
Meteor
Versuch über das Schwebende
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Erstes Kapitel: Leicht werden
Exkurs I: Jenseits des Triebprinzips
Zweites Kapitel: Das Meteorische
Drittes Kapitel: Wolkenbotschaft
Viertes Kapitel: Empirismus des Flüchtigen
Exkurs II: Unfertige Gegend
Fünftes Kapitel: Das Flimmern des Einzelfalls
Nachbemerkung
Anmerkungen
Erstes Kapitel
Leicht werden
Exkurs I
Jenseits des Triebprinzips
Zweites Kapitel
Das Meteorische
Drittes Kapitel
Wolkenbotschaft
Viertes Kapitel
Empirismus des Flüchtigen
Exkurs II
Unfertige Gegend
Fünftes Kapitel
Das Flimmern des Einzelfalls
Bildnachweis
Literaturverzeichnis
Zum Buch
Vita
Impressum
Erstes Kapitel
Leicht werden
Es gehört vielleicht zu den besonderen Verfahren einer Unterscheidungskunst, die man Literatur nennen mag, dass die damit dargestellten Dinge und Wesen, die erzählten Erscheinungen und Ereignisse nach ihrem spezifischen Gewicht und ihren jeweiligen Aggregatzuständen auseinander gehalten werden. In seinem Bemühen, Vorschläge für eine Literatur des nächsten Jahrtausends – also für die Jetztzeit – zu formulieren, hat dies etwa Italo Calvino im Jahr 1985, kurz vor seinem Tod, versucht. Diese Vorschläge, die als Vorlesungen an der Harvard University geplant waren und nicht mehr vorgetragen werden konnten, sollten nicht von ungefähr mit der Sache der «Leichtigkeit» (lightness, leggerezza) beginnen und sich dem Gegensatz zwischen Gravitation und Levitation widmen, dem Angriff auf die Trägheit der Welt, dem Besinnen auf das eigene Schreiben und der Absicht, den Figuren, den Himmelskörpern oder Städten, der Erzählweise und der Sprache selbst Gewicht und Schwere zu nehmen. Mit dem Blick auf eine Abdrift von Falllinien und auf einen Widerstand gegen Versteinerungsprozesse hat Italo Calvino seine Bibliothek wie seine Vorlieben durchmustert und einige prominente Exemplare einer Literatur des Leichten oder Schwerelosen präsentiert, die sich schwebenden Bedeutungen, vorsichtigen Abstraktionen oder Bildern der Beweglichkeit verschrieben hatten. Dazu zählte etwa das Lehrgedicht De rerum natura des Lukrez, dessen Atomismus die Kompaktheit der Welt schwinden lässt, Wirklichkeiten zerstäubt, in das Gestöber des unendlich Kleinen, Mobilen und Leichten hinein führt, mit der Materie auch die Leere dazwischen vorstellt und den Atomen die Abweichung von der geraden Linie, also Freiheiten und unvorhersehbare Möglichkeiten gestattet. Ebenso die Metamorphosen des Ovid, die sich – wie Calvino bemerkt – auf eine Gleichwertigkeit alles Seienden, gegen eine Hierarchie von Wesen, Werten und Mächten, auf einen fließenden Übergang von einer Form zur anderen hin bewegen und einmal einen geflügelten Perseus dem petrifizierenden Gorgonen-Blick entkommen und in die Lüfte steigen ließen. Einen besonderen Raum nehmen dabei die Verse von Guido Cavalcanti ein, die Calvino gegen das Gefüge literarischer Machtarchitekturen von dessen Zeitgenossen und Freund Dante setzt – Landschaften, die in eine Atmosphäre schwebender Gestaltlosigkeit aufgelöst werden, wie etwa: «klare Luft, wenn der Morgen graut/und weißer Schnee, der bei Windstille fällt».
Seit den 1950er Jahren und im Zeichen zunehmender politischer Enttäuschungen, die mit der Niederschlagung der ungarischen Revolutionsbewegung 1956 begannen, war Italo Calvinos Programm der Leichtigkeit nicht nur gegen den Zwangscharakter historischer Sachlagen gerichtet und an Abwandlungen, Geschichtsvarianten und Möglichkeitsreserven orientiert; es hat ihn auch in den Umkreis literarischer Experimente, etwa in die Nähe der Pariser Gruppe Oulipo (die berühmte «Werkstatt für potentielle Literatur», Ouvroir de Littérature Potentielle), und auf die Zusammenhänge zwischen Zufallspoetik und Lukrez’scher Physik, auf den Widerstand winzigster und subtilster Elemente gegen massive Strukturen gebracht. Hiervon ausgehend könnte man mit Calvino folgern, dass zwei entgegengesetzte Neigungen über die Jahrhunderte hinweg das Feld der Literatur durchziehen (und man möchte hinzufügen: wahrscheinlich auch das Feld des Denkens überhaupt): «Die eine sucht aus der Sprache ein gewichtloses Element zu machen, das über den Dingen schwebt wie eine Wolke oder besser gesagt wie ein feiner Staub oder noch besser wie ein Feld von Magnetimpulsen; die andere ist darauf aus, der Sprache das Gewicht und die Konkretheit der Dinge zu geben, die Konsistenz der Körper und der Empfindungen.»[1] Und natürlich lässt sich Calvinos Reihe ganz unschwer und auf unterschiedliche Weise im Kanon deutscher Literatur fortsetzen: etwa mit Märchen wie Hans im Glück, in dem die Verwandlungskunst des Tauschens vom unbequemen Gewicht eines kopfgroßen Goldklumpens zu einer von aller Last befreiten Herzensbewegung führt; oder mit Goethes Faust. Zweiter Teil, wo der Stich- und Schlagfertigkeit der imperialen Gewaltfiguren namens Raufebold, Habebald und Haltefest die aufstrebenden Bewegungen der Luft-, Wolken- oder Lichterscheinungen von Euphorion und Helena gegenübertreten; oder mit Nietzsches Zarathustra, der einmal davon träumt, die Welt neu zu wiegen, sich gegen den «Geist der Schwere» im Leichtmachen und Davonfliegen versucht und – schwebend in «tiefen Licht-Fernen» – zu sich selbst sagt: «Siehe, es gibt kein Oben, kein Unten! Wirf Dich umher, hinaus, zurück, du Leichter!»[2]; oder auch mit dem eigentümlichen «Gerichtsorganismus» in Franz Kafkas Proceß-Roman, der anders als es ordentliche Rechtslagen verlangen, nicht fest gefügt, beharrlich und gründlich gesetzt ist, sondern «gewissermaßen ewig in Schwebe bleibt».[3]
In all diesen – endlos erweiterbaren – Beispielen steht allerdings nicht nur das Verhältnis zwischen Literatur und dem Gewicht irdischer Geschehnisse und Zwangslagen auf dem Spiel. Mit den Fragen nach Schwere und Leichtigkeit reichen literarische und ästhetische Sondierungen vielmehr in Bezirke hinein, wo sich Erkenntnisprozesse mit Machtordnungen, Weltverhältnisse mit Seelenverfassungen überkreuzen – Verflechtungen, um die es in den folgenden Überlegungen gehen wird. Dieser Versuch über das Schwebende widmet sich einigen Problemfeldern, in denen flüchtige Erscheinungen, unfeste Sachverhalte und unfassbare, in den Lüften oder am Himmel entschwindende Objekte eine Herausforderung für Wahrnehmungsprozesse, Wissensformen, Begriffsbildungen und Ordnungsgedanken darstellen. Dabei werden verschiedene Schauplätze durchmustert. Sie reichen von einer eigentümlichen Schwebeszene moderner Erzählliteratur zu einem bemerkenswerten Gedankenexperiment in der mittelalterlichen Philosophie, von wundersamen Phänomenen in der Meteorologie der Antike bis zum Verwirrspiel neuzeitlicher Himmelsereignisse, von den Levitationsversuchen literarischer Sprache bis hin zu einer Wissenschaft des Ephemeren und Immateriellen. Als immer wiederkehrender Wegweiser für diese Spurensuche über die verschiedensten Szenen, Versuchsanordnungen und Epochen hinweg wird sich ein großer Roman des 20. Jahrhunderts bewähren, der wie kaum ein anderer die Darstellung von Weltverhältnissen mit Fragen der Schwerkraft verknüpfte und sich dabei um eine Verflechtungsintensität, um die Frage nach den Überschneidungen, Spannungen und Konkurrenzen zwischen literarischen und wissenschaftlichen Erkenntnisweisen bemühte.
Auch wenn man mit Robert Musil wohl eingestehen muss, dass «immer schon ein gewisser Größenunterschied zwischen dem Gewicht dichterischer Äußerungen und dem Gewicht der ungerührt von ihnen durch den Weltraum rasenden zweitausendsiebenhundert Millionen Kubikmeter Erde» bestand, ein Unterschied, den man in Rechnung stellen und «irgendwie in Kauf» nehmen muss[4], laden solche Gewichtsprobleme doch zu einer genaueren und wegweisenden, vielleicht auch systematischen Befragung ein. Mit seinem Der Mann ohne Eigenschaften hat Musil dies dann auch auf exemplarische Weise versucht. So wurde dieses Romanprojekt um ein Spektrum von Erscheinungen herum gruppiert, das von der Schwere der Tatsachen zum Hauch der Möglichkeiten, von versteinerten Weltlagen zu einem Dunst aus Ahnungen und Ideen, von der festen Materie der Gegebenheiten zu einem feineren Gespinst aus «Einbildung, Träumerei und Konjunktiven» reicht. Das Erzählprogramm changiert zwischen der Statik von stoßfesten Ordnungsgefügen und einem Schwarm von Begebenheiten, der eher statistisch, als Molekulargeschehen kinetischer Gastheorie zu fassen ist und den Lauf der Geschichte selbst ins Sich-Verlaufen und in Wolkenbahnen verlegt. Der Wechsel von harten Geschäftsgrundlagen, Festkörperphysik und den Gesetzen der Gravitation zu den Hebungen eines unbestimmten Schwebens prägt einen mehrfach gebrochenen, also ikonoklastischen Realismus, der Welt und Wirklichkeit eben nicht an Bildern und Formen, sondern an Unschärferändern und Werdensprozessen untersucht und dabei zwangsläufig in ein Feld dynamischer und gegenstrebiger Kräfte gerät.
Die einen davon hat der Roman mit einem «Seinesgleichen geschieht» umschrieben und damit jene sozialen, politischen und ökonomischen Gravitationslinien gemeint, die vor Beginn des Ersten Weltkriegs über die Köpfe der Einzelmenschen hinweg Handlungen mit Handlungsfolgen verknüpfen, Ereignisketten ausrichten und die Verantwortung für das Gesamtgeschehen in die Effektivität von Sachzusammenhängen verschieben. Die hierin wirkende Schwerkraft verpasst dem Geschehen einen gleichsam ballistischen Charakter; sie nimmt mit der Trajektorie eines verunglückten «schweren» Last- bzw. Kraftwagens im Anfangskapitel jene Einschläge vorweg, die jenseits der Horizontlinie des Romans von Artilleriegeschossen, von Schwerindustrie und ‹schweren Waffen› nach Kriegsausbruch 1914 verantwortet wurden. Mit Blick auf hindeutende Geschichtszeichen – und einem gleichsam ideographischen Verfahren verpflichtet – identifiziert der Romantext gerade solche Dynamiken in der Vorkriegszeit, die von unmerklichen Luftveränderungen bis zum Erwachen der Schlafwandler beim Zusammenprall führten und von kultureller Selbstvergiftung, von einer Wucherung von Feindseligkeiten geleitet waren: sei es ein «atmosph[ärischer] Hass», der für die «gegenwärtige Zivilis[ation] so kennzeichnend ist» und die «Zufriedenheit mit dem eigenen Tun durch die Unzufriedenheit mit dem anderer ersetzt»; sei es eine «Abneigung jedes Menschen gegen die Bestrebungen jedes anderen Menschen» oder schlicht eine «universelle Abneigung», eine «Abneigung gegen den Mitbürger», eine «Abneigung aller gegen alle», die sich zu einem neuen «Gemeinschaftsgefühl» steigerte; seien es affektive Mobilisierung, die Wechselerregung ideologischer Gegensätze und das Ressentiment als Geschmacksverstärker für jene Ichgefühle, die in der Organisation von Funktionssystemen längst ausgedünnt wurden; sei es schließlich ein nationalistischer und völkischer Lärm oder die Apparatur eines Kapitalismus, der – wie es in einer Nachlassaufzeichnung heißt – das «Entstehen der größten Verbrechen durch Gewährenlassen»[5] ermöglicht.
«Alle Linien münden in den Krieg», hatte Musil folgerichtig zu den Plänen seines Romanprojekts notiert, und: «Jeder begrüßt ihn auf seine Weise.»[6] Allerdings stiftete das Präsens dieser Sätze in der Zeit ihrer Niederschrift – Mitte der 1930er Jahre – eine referentielle Verwirrung, die das Datum des Vorkriegsjahrs 1913 in der erzählten Romanhandlung und die Aktualität eines Vorkriegs in der Schreibgegenwart ineinander schob. Projektiert bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ist der Roman seit den zwanziger Jahren zu einem Vorhaben geworden, das in der vergangenen Vorkriegszeit mehr und mehr die gegenwärtige zu lesen versucht und sich einer Oszillation der Zeitschichten überlässt. Gerade die Art und Weise, wie sich die ahnungsvolle Bedrängnis am Vorabend des Ersten Weltkriegs mit den Bedrängnissen des Schriftstellers im Zeichen von «nationale[r] Revolution», Naziregime, Kriegsrüstung und «heutige[m] Elend»[7] kurzschließt, hat die Auftragslage dieses Schreibens geschärft, nämlich die Katastrophen beider Kriege – des einstigen wie des künftigen – zu entziffern, bevor sie passieren. Vor diesem Horizont konnte sich Musils Literatur, so scheint es jedenfalls, nicht von einem diagnostischen Auftrag und von der Aufgabe dispensieren, die dunklen, in der Gegenwart angelegten oder verkapselten Mächte der Zukunft freizulegen. Unter der Hand und durch die Zeitumstände getrieben sind historischer und Gegenwartsroman ununterscheidbar geworden, und in dem Maße, wie Erzähler und Erzählsituation damit ihren festen Ort verloren haben und zwischen den Zeiten schweben, durchfährt man mit diesem hellsichtigen Romanfragment wie in einem Lift die Vor- und Zwischenkriegszeiten des letzten Jahrhunderts, um schließlich und zwangsläufig in der heutigen Gegenwart anzukommen.
Auch wenn hier die unwiderlegbare Fatalität des historischen Geschehens in dessen allmählicher Verfertigung vorgeführt wird und der Roman nicht durch sich selbst, sondern durch den Angriffskrieg des Hitler-Reichs beendet wurde, ist das gesamte Vorhaben doch als Einspruch gegen den scheinbar unausweichlichen Geschichtsverlauf angelegt. Es ist gegen das «Nichternstnehmen der Anzeichen und hintreibenden Kräfte» gewendet und hat die entsprechenden Gegenstrebungen aktiviert. So wurde mit der Einsicht in die Tatsache, dass historische Notwendigkeiten keine naturgesetzlichen sind, der Platz für jene Aktivitäten freigeräumt, mit denen sich Literatur als «Gleichgewichtsstörung» des Wirklichkeitssinns begreifen kann. Sie versteht sich als eine Art Brückenbau, der sich «vom festen Boden so wegwölbt», als besäße er ein stabiles Widerlager im «Imaginären».[8] Je näher das Erzählgeschehen aus dem Jahr 1913 an den Hochsommer 1914 heranrückt, desto mehr bemächtigt sich der Roman des Unwirklichen, privilegiert er das Unfeste, Schwebeereignisse und Imponderabilien, mit denen die Welt nicht in ihrer Fertigkeit, sondern in flüchtigen und veränderlichen Zustandsformen aufgesucht wird, in unfesten Lagen mit unzureichenden Gründen und einer Unwägbarkeit des Gegebenen. Der Roman nimmt damit das Projekt seines Protagonisten Ulrich selbst auf, der sich mit dem «Urlaub von seinem Leben» der Erprobung eines «Möglichkeitssinns», dem Imperativ eines «hypothetischen» Lebens verschrieb und nebenbei auch ein signifikantes intellektuelles Interesse an einer Physik der Aggregatzustände, etwa am Gestaltwandel des Wassers vom Festen zum Flüssigen zum Gasförmigen entwickelte. Gegenüber den Schwerkräften der Vorkriegsrealität hält der Roman damit an möglichen Abzweigungen fest, mithin an einem Übergang zu einer Welt mit geringerem oder unbestimmtem Existenzgehalt, in der die Realien allenfalls embryonal enthalten sind. Und gerade das sagenhafte Vorkriegsreich namens Kakanien – fiktiver Titel für die alte k. u. k. Monarchie Österreich-Ungarn – zeichnete sich dabei durch geschwächte Daseinsgründe, halbverwirklichte Geschehnisse und zuweilen auch durch austriakische Redeweisen aus, in deren «Hauch Tatsachen und Schicksalsschläge so leicht wurden wie Flaumfedern und Gedanken». Die Ereignisse sind hier Ereigniserwartung und führen in eine ungeborene Welt, die wie eine Krypta in der wirklichen, historischen Welt insistiert. Damit beansprucht Musils Roman Anteil an einer Universalgeschichte der Kontingenz, für welche die Gegenwart – im «conjunctivus potentialis» – auch anders als die tatsächliche Zukunft ihrer Vergangenheit hätte möglich sein können: um die «noch nicht erwachten Absichten Gottes» und die «in die Welt versenkten Versprechen» nicht zu vergessen. Es geht um die Erzeugung einer bemerkenswerten Spiegelung, in der das Leben, «wie es ist, in allem gebrochen erscheint durch ein Leben, wie es sein könnte».[9] Angesichts der nahenden Katastrophen hält die Erzählung an einer Gegenverwirklichung fest.
Auch wenn diese Fragen nach Gewichtsverlust und Leichtwerden das literarische Projekt zuweilen dem durchaus berechtigten Selbstverdacht aussetzen, womöglich eine «Geflügelfarm» für «hochfliegende Gedanken» zu betreiben, geben sie doch die Fluchtlinien des Romans vor. Sie kondensieren sich insbesondere in jenen Begebenheiten, die unter dem ominösen Titel «ins tausendjährige Reich» aus dem dritten Romanteil mit der Begegnung der Geschwister Ulrich und Agathe beginnen, ins wolkige Gebiet eines «schwerelosen Ernstes» und zu einer «Reihe wundersamer Erlebnisse» in den Nachlasskapiteln hinüberführen. War Ulrich mit seiner Reserve gegen vorhersehbare Karrieren und Lebensläufe von Anfang an in die schwierige Lage geraten, «beständig im Akt der Schöpfung zu schweben», so münden diese Experimente zum Thema «Schwankendes und Schwebendes» zunächst in ein seltsames und geradezu unmögliches Ereignis, das sich durch die verschiedenen Varianten des Romanprojekts gezogen hat und die Sache des Schwebenden durch ein kompliziertes Arrangement aus Regungen und Bewegungen erfüllen sollte. Eines Abends, so heißt es in der letzten Version dieser Szene, als sich die Geschwister gerade zum Besuch einer «Abendunterhaltung» vorbereiteten, betrachtete Ulrich Agathe beim Ankleiden, sah hinter ihr stehend ihren gebeugten und fast nackten Rücken, den gerundeten Hals, auf dem sich drei Falten bildeten; und nahezu unbewusst, angezogen von der «lieblichen Körperlichkeit dieses Bilds», das sich unmittelbar auf ihn übertrug, näherte er sich seiner Schwester, biss unvermittelt in die Dreifaltigkeit ihres Halses, umschlang sie, hob sie empor und warf sie in die Höhe. Nachdem Agathe ein kurzes Erschrecken überwunden hatte, fühlte sie sich nicht eigentlich durch die Luft fliegen als vielmehr in ihr ruhen, «von aller Schwere entbunden und an deren Stelle von dem sanften Zwang der allmählich langsamer werdenden Bewegung gelenkt». Und dann – so geht es weiter – «bewirkte es einer jener Zufälle, die niemand in seiner Macht hat, daß sie sich in diesem Zustand wundersam besänftigt vorkam, ja aller irdischen Unruhe entrückt; mit einer das Gleichgewicht ihres Körpers verändernden Bewegung, die sie niemals hätte wiederholen können, streifte sie auch noch den letzten Seidenfaden von Zwang ab, wandte sich fallend ihrem Bruder zu, setzte gleichsam noch im Fall das Steigen fort und lag niedersinkend als eine Wolke von Glück in seinen Armen». Was in dieser eigentümlichen Zufallsartistik geschah, im milden Licht des Abends, erschien «merkwürdig entlegen von Kraft und Zwang». Ein «leiblicher Vorgang», der eine unsichtbare Grenze der Annäherung überschritt und doch alle «Gebärden des Fleisches» vermied, bewegte sich in eine zweite und weniger gegenständliche Wirklichkeit, die sich endlich in die «sinnlos» in die Luft gesprochenen Worte übersetzte: «Du bist der Mond»; und: «Du bist zum Mond geflogen und mir von ihm wiedergeschenkt worden». Selbst wenn Erzähler wie Protagonisten sogleich etwas zurücktraten und nach erklärender Distanz gegenüber aller Mondscheinschwärmerei suchten, setzten sie dieses Ereignis, dieses Schweben in Vergleichsreihen fort; diese reichten von einem abenteuerlich veränderten Geschehen in der Stille von «Mondnächten» bis zu einer «Erregung», die «über dem Dunkel der Erde und unter dem Licht des Himmels […] zwischen zwei Gestirnen schwingt».[10]
Im Grunde bietet diese Passage eine sehr genaue Annäherung an die Sache des Schwebens oder des Schwebenden. Demnach wäre das Schweben nicht einfach ein Zustand, sondern ein In-die-Höhe-Sinken, eine gleichzeitige Doppelbewegung von Steigen und Fallen und das Erreichen eines abarischen, d.h. schwerelosen Punkts, wie er wohl erstmals in Johannes Keplers Somnium sive astronomia lunaris oder Traum über die Mondastronomie beschrieben wurde: als Ort und Moment im Zwischenraum von Gestirnen, an dem die Körper noch von der Anziehungskraft des einen und schon von der Gravitation des anderen erfasst sind und darum in ein flüchtiges Gleichgewicht geraten.[11] Gerade dieses bewegte Ruhen selbst aber besitzt einen besonderen Ereignischarakter, es wird umschrieben mit einem Geschehen, in dem nichts wirklich geschieht, oder genauer: in dem sich ein Streben nicht von einem Verharren, das Körperliche nicht von einem Körperlosen, ein Zustand nicht von einer Veränderung, eine Lage nicht von einem Vorgang, ein Werden nicht von einem Entwerden unterscheiden lässt und damit eine Lösung oder Loslösung, eine Freisetzung des Imponderabilen und Unwägbaren, eben des Gewicht- und Schwerelosen vollbringt. Mit der Annäherung an ein metastabiles Gleichgewicht umfasst dieses Ereignis keine statische, sondern eine ekstatische Konstellation, die in den weiteren Begegnungen und Gesprächen zwischen den Geschwistern in verschiedene Komponenten auseinander gefaltet wird. Sie schlägt eine Brücke bis hin zum Kapitel «Atemzüge eines Sommertags», an dem Musil wohl noch am Tag seines Todes gearbeitet hat und das – geradezu programmatisch – vom Schweben eines «geräuschlose[n] Strom[s] glanzlosen Blütenschnees» durch die stille Mittagsluft im Garten der Geschwister eingeleitet wird. Demnach gehört zur gesteigerten Unwahrscheinlichkeit dieser Ausnahmeerfahrung einerseits ein «ausdehnungsloses und darum ganz unbeschaffen starkes» Gefühl von Dasein, in dem das Trennende schwindet, ein Nicht-Gemeinsames nicht existiert und sich eine Entgrenzung vollzieht, «als gehöre der Körper nicht mehr einer Welt an, wo das sinnliche Ich in kleine Nervenstränge und -gefäße eingeschlossen ist». Andererseits wird darin – und zwar im Sog dessen, was der Roman immer dringlicher als Gestalt eines «anderen Zustands» adressiert – eine Raum- und Zeiterfahrung vorgezeichnet, deren Metrik durchbrochen ist und den Unterschied zwischen Augenblicken und Äonen ebenso wenig kennt wie die Demarkationen zwischen Außen und Innen oder die Abstufungen von nah und fern. Wie die Messgrößen eines ausgedehnten Ordnungs- und Ortungsraums ihre Orientierungsmacht verlieren, scheint die Gegenwart sich auszuweiten und das «fließende Band» der Zeit mit seiner «unheimlichen Nebenbeziehung zum Tod»[12] stillzustehen, um in der Schwebe zu halten, was geschah, geschieht oder vielleicht geschehen wird. Möglichkeitssinn und historischer Konjunktiv haben ein episodisches Pendant in der Experimentalform des Schwebens und der Loslösung erhalten.