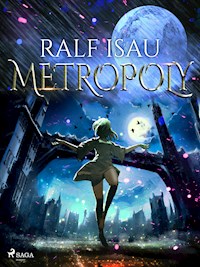
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Der Zirkel der Phantanauten
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band der Fantasy-Reihe "Der Zirkel der Phantanauten" spielt in London im Jahr 1893: Lena wacht am Krankenbett ihrer Mutter und wird zur Ablenkung von Lord Alistair zum Treffen der jungen Phantanauten auf das Schloss eingeladen, die sich dort von ihren Erlebnissen in phantastischen Welten erzählen. Nun ist es an Lena, sich ihre eigene Traumwelt zu erschaffen, um Mitglied zu werden. Kaum taucht sie ein in den See vorm Schloss, befindet sie sich auch schon in Metropoly, der "Stadt der Kinder und des ewigen Spiels"... -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Isau
Metropoly
Saga
Metropoly
Metropoly – Volume 2 of Der Zirkel der Phantanauten Trilogie
Copyright © 2021 by Ralf Isau (www.isau.de)
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 2008 by Thienemann Verlag, Germany
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 2008, 2021 Ralf Isau und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726870121
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Für Olivia
Erst wenn du die Stadt verlassen hast, siehst du,
wie hoch sich ihre Türme über die Häuser erheben.
Friedrich Nietzsche (1844–1900)
EinEinEinführung für den Neophyten
(aus dem »Kodex der Phantanauten«)
Nicht was einer ist, hat oder glaubt, macht ihn zum Phantanauten, zum »Weltenschöpfer«, sondern einzig seine Phantasie. Deren Zirkel bleibt stets auf ein doppeltes Dutzend begrenzt. Er verjüngt sich durchs Ausscheiden der Einundzwanzigjährigen und Nachrücken von Neophyten, die mindestens im zwölften Lebensjahr stehen. Diesen »neu Gepflanzten« ist zuvor ein Teil des Phantalabiums zugefallen, des Zirkels uraltes Erkennungszeichen.
Jährlich versammeln sich die Phantanauten zu einem Erzählreigen am Grauen See, wenn der Vollmond die Ophiuchiden trifft: In diesem Schauer von Sternschnuppen öffnet sich die Quelle der Erleuchtung bis zum Tag vor der Sommersonnenwende und versiegt wieder beim nächsten Vollmond. Während dieses Monats muss der Neophyt eine Nacht in der Kammer der Weltenschöpfer schlafen und dabei dem Meer der Träume Neuland abtrotzen. Wer diese Gabe besitzt, wird am Morgen danach durch das Untertauchen im Grauen See in das von ihm geschaffene Reich gelangen. Nach seiner Rückkehr erstattet er dem Zirkel Bericht und erbringt einen Beweis der Echtheit seiner Schöpfung. Überzeugt er die Mehrzahl der Phantanauten, gilt er als aufgenommen.
Fortan bedarf sein Neuland des täglichen Erinnerns, um nicht wieder unterzugehen. Der kluge Phantanaut soll seine Geschichte daher mindestens zwei anderen Menschen erzählen und sie überdies zur Weitergabe des Gehörten anspornen. So reift der Schöpfer zum lebenslangen Weltenmeister, und derweil sein Werk darüber wächst, wird es die »Welt der Sinne«, unser wirkliches Leben, bereichern.
Der Aufsatz
London (England), 8. April 1893
Es war eine kalte Hand, die das weinende Mädchen umklammerte, so fest, als wolle es sie dem Sensenmann entreißen. Doch nicht Gevatter Tod stritt mit der Elfjährigen um die im Bett liegende Mutter, sondern eine grausame Krankheit. Der Hausarzt hatte sie Rheuma genannt.
Das Mädchen, das von seinen Eltern und Geschwistern Lena genannt wurde, besaß eine überaus empfindsame Seele. Natürlich liebte es seine Familie – die ob ihrer Anmut und Herzenswärme bewunderte große Schwester Vanessa, den wegen seiner Gelehrsamkeit verehrten Vater Leslie und auch die sechs anderen Geschwister. Doch mehr als alle diese zusammen liebte Lena ihre Mutter Julia. Sie so daliegen zu sehen – das einstmals schöne Gesicht verknöchert, den so klugen Geist von Morphium und anderen Drogen betäubt – machte sie ganz krank. Ohne ebenjene Tropfen mit dem so bedrohlich klingenden Namen könne Julia die Schmerzen nicht ertragen, hatte der Doktor schon vor Wochen behauptet. Seitdem dämmerte sie vor sich hin. Selbst im wachen Zustand war sie kaum ansprechbar.
Lenas Blick wanderte zum Fenster, als draußen die Wolken aufrissen und das warme Licht der Frühlingssonne ins Zimmer fiel. Sie stellte sich vor, jetzt mit ihrer Mutter in Cornwall über den Strand zu spazieren und Muscheln zu sammeln. Es war ein schöner Gedanke, ein Hoffnungsschimmer, der ihr Mut machte. Lena wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen und räusperte sich.
»Mein Aufsatz über Oliver Twist ist endlich fertig, Mama. Ich habe ihn dir mitgebracht.«
Julias Atem ging regelmäßig. Sie schlief tief und fest.
»Willst du ihn hören?«
Die Kranke antwortete nicht.
Lena schlug ihr Heft auf und begann trotzdem zu lesen.
»Charles Dickens´ Geschichte von Oliver Twist ist mehr als ein spannendes Erzählstück. Sie öffnet dem Leser die Augen für manches Übel in unserem Land. Vor allem die Armut der Massen und die Ausbeutung von Kindern prangert er an. Die Sprache des Autors ist voller Bilder, in denen er überdies den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse schildert.
Oliver, die Hauptfigur in dem Roman Oliver Twist oder der Weg des Fürsorgezöglings, ist ein Findelkind, ein Waisenknabe, der in einer grausamen Welt ums Überleben kämpft. Er wächst in einem Armenhaus auf, hat ständig Hunger und muss mit anderen Kindern im Arbeitshaus Werg zupfen, den faserigen Hanf- und Flachsabfall. Alsbald schuftet er für einen Sargtischler, flieht nach London und gerät in die Fänge des zwielichtigen Hehlers Fagin, der Straßenjungen für sich stehlen lässt, um sich am Verkauf des Diebesguts zu bereichern ...«
Ungeachtet der mangelnden Aufmerksamkeit ihrer Mutter las Lena den Aufsatz vom Anfang bis zum Ende. Nach der Zusammenfassung der Handlung erging sie sich unter der Überschrift »... und die Moral von der Geschicht« in einer gründlichen Zergliederung dessen, was sie als Symbolik bezeichnete, also des Hintersinns, der in Wortbildern und Gleichnissen jene schlimmen Zustände verurteilte, die auch fünfundfünfzig Jahre nach Veröffentlichung des vollständigen Romans beileibe noch nicht alle beseitigt waren.
Im Gegensatz zu ihrer drei Jahre älteren Schwester Vanessa, die sich schon als zukünftige Malerin sah, hatte Lena für sich die Schönheit der Sprache entdeckt. Begünstigt durch die umfangreiche Bibliothek ihres Vaters las sie sehr viel. Weil er diese mit Hunderten von Büchern angefüllte Schatzkammer gewöhnlich verschlossen hielt, musste Lena ihn jedes Mal fragen, wenn sie neues »Futter« brauchte. Dann schloss er die Tür auf, zog das Buch heraus und übergab es ihr.
Der Umgang mit Worten beschränkte sich bei Lena jedoch nicht nur auf das Lesen fremder Texte. Sie erzählte und schrieb auch selbst sehr gerne. Mit Gutenachtgeschichten schickte sie ihre Geschwister ins Reich der Träume – nicht wenige davon waren ihrer eigenen Phantasie entsprungen.
Wenn keiner der vier Brüder, drei Schwestern, der Eltern und auch niemand vom Hauspersonal als Zuhörer zur Verfügung stand, musste Shag dran glauben. Er war der Familienhund, eine Promenadenmischung mit langen Zotteln und einer Eselsgeduld.
Lena gab sogar eine eigene Hauszeitung heraus, die Hyde Park Gate News, in der sie regelmäßig über Freud und Leid der Stephens berichtete. Das Blatt war allerdings nur im Haus Nummer 22 jener Straße zu lesen, dem es seinen Namen verdankte.
Dies alles mag sehr ungewöhnlich klingen, zieht man das Alter des wortgewandten Mädchens in Betracht. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die Familie Stephen im Allgemeinen und Lena im Besonderen alles andere als gewöhnlich waren.
Die jüngeren Kinder wurden zu Hause von den Eltern unterrichtet. Leslie und Julia waren gutmütige, aber bisweilen auch sehr ungeduldige Lehrer. Schon mit sechs Jahren hatte Lena begonnen, Französisch und Latein zu lernen. Und wenn ihr die Mathematik wieder einmal Kopfschmerzen bereitete, bekam sie vom Vater als Medizin Sir Walter Scott verordnet, dessen Ivanhoe etwa, ein historischer Roman, in dem der schottische Schriftsteller böse Tempelritter, König Richard Löwenherz und – unter dem Namen Locksley – Robin Hood auftreten ließ.
So verwundert es nicht, wenn Lenas Aufsatz über Dickens´ Oliver Twist weit über das hinausging, was man von einer normalen Elfjährigen hätte erwarten dürfen. Vor allem ihr Schlussplädoyer, eine flammende Anklage gegen die Ausbeutung von Kindern, hatte es in sich. Schon bei der Lektüre des Romans war sie über die darin geschilderten Missstände empört gewesen. Als sie hierauf ihren Vater gefragt hatte, ob es in England tatsächlich Kinderarbeit gegeben habe, wollte sie dessen Antwort zunächst kaum glauben.
»Ende des vergangenen Jahrhunderts«, hatte Leslie berichtete, »so etwa um 1795, ist in unseren Baumwollspinnereien fast jeder dritte Arbeiter ein Kind gewesen. Andere wurden bereits im zarten Alter von vier Jahren in Bergwerksstollen geschickt, die so eng waren, dass kein Erwachsener hineingepasst hätte. Hier wie dort schufteten sie sich neunundsechzig Stunden in der Woche die Kindheit aus dem Leib, nur an Sonn- und Feiertagen durften sie ein wenig ruhen. Obwohl sie sich nicht weniger abrackerten als die Erwachsenen, bekamen sie nur einen Bruchteil von deren Lohn. Viele starben, ehe sie die Volljährigkeit erreichten.«
Für Lena, ein behütetes Mädchen aus wohlhabendem Hause, waren diese Schilderungen der Wirklichkeit noch düsterer gewesen als die Geschichte von Oliver Twist. Ungläubig hatte sie entgegnet: »Aber Kinder sind doch für die meisten Arbeiten viel zu klein!«
Leslie hatte lange in die empörte Miene seiner Tochter gesehen, ehe er antwortete: »Alles war auf die geringe Größe und Kraft der kleinen Körper abgestimmt. Sogar die Maschinen wurden so konstruiert, dass Kinder sie bedienen konnten. Bei der ›Mule Jenny‹ etwa, einer Spinnmaschine, lief der Wagen mit den Spindeln extra niedrig vor und zurück, damit auch Neunjährige sich über ihn beugen und die gerissenen Fäden wieder zusammendrehen konnten. Weil die ›Jenny‹ nie stillstand, mussten die Jungen und Mädchen stundenlang dem Spindelwagen folgen. Am Tag legten sie dabei gut und gerne achtzehn Meilen zurück.«
»Glücklicherweise gibt es heute Gesetze zum Schutz von Kindern. Das ist doch so, nicht wahr, Paps?«
Wieder hatte sich Lenas Vater mit seiner Erwiderung viel Zeit gelassen. »Es stimmt schon, seit dem ›Fabrikgesetz‹ von 1833 hat sich für sie manches zum Besseren gewendet, seit 1878 müssen Arbeiter mindestens zehn sein. Solange sie nicht älter als vierzehn sind, dürfen sie nur jeden zweiten Tag oder halbtags beschäftigt werden ...«
»In dem Alter sollten sie zur Schule gehen und spielen, anstatt sich den Rücken krumm zu schuften«, hatte sich Lena ereifert.
»Du hast natürlich recht. Es bleibt Kinderarbeit.«
»Wie kann die Königin so etwas nur zulassen, Paps? Sie ist die mächtigste Frau der Welt und hat selbst neun Kinder. Ein Wort von ihr und dieses Unrecht hätte ein Ende.«
Leslie hatte nachsichtig gelächelt. »Die Welt ist leider ein wenig komplizierter, Sternchen. Sie wird von Männern regiert. Viel zu oft von Halunken, die nur an den eigenen Vorteil denken. Sie benutzen das Bild der großen Mutter des Vereinigten Königreiches wie einen hübsch bemalten Theatervorhang, hinter dem sie ihre Machenschaften verbergen. Solche Männer haben die Ausbeutung von Kindern lange vor Queen Victoria im großen Stil eingeführt und weder die Krone noch das Parlament können ihnen so einfach Einhalt gebieten. Außerdem gibt es die Kinderarbeit ja nicht nur im britischen Reich, sondern auf der ganzen Welt. Nimm nur die ›Schwabenkinder‹.«
»Das Wort sagt mir nichts.«
»Ich habe davon während meiner Bergtouren in den Alpen gehört. Jedes Jahr ziehen Hunderte, manchmal Tausende von Jungen und Mädchen aus Tirol und Vorarlberg nach Süddeutschland. Dort rackern sie sich während der Sommermonate bei den schwäbischen Bauern in der Landwirtschaft ab, oft als Hütekinder für das Vieh.«
Die Beschreibungen ihres Vaters hatten Lena tief berührt. Sie war entrüstet, dass es auf der Welt nach wie vor so viele Oliver Twists gab, denen geldgierige Erwachsene, meistens Männer wie der Hehler Fagin, rücksichtslos die Kindheit raubten – die hässliche Fratze des Gauners verfolgte Lena bis in die Träume. Und so endete ihr Aufsatz über den Dickens-Roman in einem Feuerwerk gerechten Zorns. Man müsse die Kinder den Ausbeutern entreißen, wetterte sie. Weder ihr noch der schlafenden Mutter wurde bewusst, wie ihre Stimme dabei immer lauter wurde. Doch jemand anderer merkte es.
Es klopfte an der Schlafzimmertür, sie wurde geöffnet und zwei Köpfe erschienen. Von oben lugte das bärtige Antlitz des Vaters herein und darunter das noch viel struppigere Gesicht von Shag. Der Hund – er sah aus wie ein Flederwisch auf vier Beinen – lief zu Lena und blieb hechelnd vor ihr sitzen.
»Alles in Ordnung, Sternchen?«, fragte Leslie. Seine messerscharfe spitze Nase zuckte, als müsse er jeden Moment niesen. Er stieß die Tür vollends auf und betrat ebenfalls den Raum. Sein trauriger Blick glitt über die Schlafende im Bett hinweg. Gedankenvoll begann er, sich den zerzausten Vollbart zu kraulen. Trotz seiner fünfzig Jahre wirkte er nicht wie ein alter Mann. Er war immer noch recht schlank gebaut und sein dunkles Haar war erst von wenigen grauen Fäden durchzogen. Mit seiner hohen Stirn erinnerte er Lena bisweilen an jene altgriechischen Philosophen, deren Büsten sie aus dem Museum kannte.
»Ich habe Mama meinen Aufsatz über Oliver Twist vorgelesen«, antwortete sie und begann den wandelnden Staubfänger hinterm Ohr zu kraulen.
»Für mich hörte es sich eher so an, als stündest du unten an Speakers’ Corner und hieltest vor tausend Leuten eine Brandrede gegen die Ausbeutung von Kindern.« Besagte »Ecke der Redner« war ein Versammlungsplatz am nordöstlichen Ende des Londoner Hyde Parks, an dem jeder öffentlich seine Meinung kundtun oder sich mit unbequemen Ideen in den Augen seiner Zuhörer sogar zum Narren machen durfte – solange er nicht die Königin und ihre Familie beleidigte.
Lena verzog das Gesicht. »War ich wirklich so laut?«
»Allerdings. Die Einzige, die du damit in diesem Haus nicht alarmiert hast, ist offenbar deine Mutter. Ich wüsste etwas Besseres, als einer Schlafenden vorzulesen. Hast du Lust auf einen kleinen Ausflug?«
Sie schüttelte den Kopf. »Mama braucht mich. Ich bleibe lieber da.«
Er seufzte und erwiderte sanft: »Sie merkt nicht einmal, dass du hier bist, Sternchen.«
Lenas Augen füllten sich mit Tränen. »Das weißt du doch gar nicht. Ich möchte bei ihr sein, wenn sie aufwacht.«
»Jetzt sei doch vernünftig, Kind. Du weißt, wie stark die Medizin ist, die Mama bekommt. Sie kann noch viele Stunden so daliegen. Willst du ihr die ganze Zeit beim Schlafen zusehen?«
»Ich lese ihr doch vor.«
»Nun ist aber Schluss, Lena. Meinst du, Vanessa, Thoby und Adrian haben ihre Mutter nicht lieb? Trotzdem versagen sie sich nicht jede Freude, so wie du es schon seit Wochen tust. Nimm dir ein Beispiel an deinen Geschwistern und gönne dir etwas Ablenkung. Fahre mit mir nach South Norwood. Am Nachmittag sind wir wieder zurück.«
Lena horchte auf. »South Norwood? Du meinst, du besuchst ... ihn?«
Leslie lächelte. Er wusste genau, wie er seine Tochter ködern konnte. »Ganz richtig. Du möchtest den schreibenden Augenarzt doch sicher auch gerne wiedersehen, diesen Mann, von dem ganz London spricht.«
Die Flaschenpost
London (England), 8. April 1893
Das Haus in der Tennison Road Nummer 12 barg viele Geheimnisse. Deshalb konnte Lena kaum widerstehen, wenn ihr Vater sie zu jenem Doktor, Facharzt für Augenheilkunde, mitnahm, der sich neuerdings so brennend für die Schweizer Alpen interessierte. Die Gründe dafür waren weniger medizinischer als literarischer Natur.
Jahrelang hatte es dem Mann an Patienten gemangelt, vielleicht weil nur wenige das Schild an seiner Praxis zu deuten wussten. »Ophthamologe« hatte darauf gestanden. Manche hielten ihn aufgrund dessen wohl für einen Sternendeuter, dabei war er Facharzt für Augenheilkunde. Um den Leerlauf im Wartezimmer sinnvoll zu nutzen, begann er irgendwann, Geschichten aufs Papier zu bannen, die ebenso phantastisch wie mysteriös waren. Bald verdiente er mehr Geld durchs Schreiben als durchs Heilen. Einen seiner Helden nannte er übrigens Sherlock Holmes und der Augenarzt hieß Arthur Ignatius Conan Doyle.
Nach einer lebensbedrohlichen Influenza hatte ebenjener Doktor vor zwei Jahren seinen alten Beruf an den Nagel gehängt, um sich hinfort ganz seiner literarischen Laufbahn zu widmen. Weil Lena ja selbst Schriftstellerin werden wollte, betrachtete sie es immer aufs Neue als große Ehre, Mr Conan Doyle zu treffen, einen Mann, der es auf diesem Gebiet schon weit gebracht hatte.
Ihre Vorfreude war indes aus den nun schon bekannten Gründen nicht ungetrübt. Während ihr Vater den Zweispänner vom südwestlichen Rand des Hyde Parks nach South Norwood kutschierte, pendelten ihre Gedanken zwischen gespannter Erwartung und einem schlechten Gewissen. Letzteres glaubte sie ihrer kranken Mutter zu schulden.
Während der zehn Meilen langen Kutschfahrt versuchte Lena, sich abzulenken, ihre Augen ruhten keinen Moment. Auf Londons Straßen gab es immer etwas Neues zu entdecken. Es war ein windiger Samstagmorgen mit typischem Aprilwetter. Herrenlose Hüte hüpften über das Kopfsteinpflaster. Sonne und Regen wechselten sich ab. Als die Kutsche an einer Kreuzung halten musste, entdeckte Lena eine aufrecht zwischen den Pflastersteinen steckende Bonzemünze. Es war nur ein Penny, das Geldstück mit dem geringsten Wert. Während sie noch überlegte, ob sich ein Absteigen dafür überhaupt lohnte, raubte ihr unvermittelt Leslies ausgestreckter Arm die Sicht. Er deutete auf eine mit Plakaten zugeklebte Mauer.
»Vielleicht sollten wir mal wieder ins Theater gehen. Etwas Zerstreuung täte dir gut. Am London Haymarket gibt es demnächst eine Premiere mit der Neilson.«
»Die kann ich nicht leiden«, antwortete Lena widerborstig, gab die Bronzemünze aber trotzdem verloren, um an der Ziegelwand nach dem Anschlag zu suchen. Die immer bunter werdenden Plakate waren mancherorts zu einer regelrechten Plage geworden. Auch hier klebten sie zuhauf. Da warb die Raleigh Bicycle Company großformatig für die moderne Art der Fortbewegung per Fahrrad, die auch für Frauen zur körperlichen Ertüchtigung famos geeignet sei. Ein anderes Plakat pries mit den Namen berühmter Kunden wie Queen Victoria und Papst Leo XIII. ein mit Blättern des Kokastrauches versetztes weinhaltiges Getränk an – den Vin Mariani. Schließlich entdeckte Lena die Premierenankündigung. Es war ein Stück des bekannten Bühnenschriftstellers Henry Arthur Jones.
Leslie ließ die Zügel schnalzen und die Kutsche setzte sich wieder in Bewegung. »Was hast du gegen Julia Neilson? Ganz London liegt ihr zu Füßen.«
»Höchstens halb London, Paps«, widersprach Lena mit einem strengen Seitenblick. Neben Büchern las sie auch schon regelmäßig Zeitung. Zeitungen wurden von Männern gemacht. Und Männer ließen sich von der Schauspielerin reihenweise den Kopf verdrehen.
Ihr Vater lachte. »Bist du etwa eifersüchtig auf die Aktrice?«
»Ich habe gelesen, sie soll sehr schön und voluptuös sein. Was bedeutet das, Paps?«, fragte Lena, obwohl sie den Sinn des Wortes ganz genau kannte.
»Voluptuös?« Er räusperte sich verlegen. »Das heißt ... äh ... Es bedeutet, diese Frau weckt in manchen Männern gewisse ... Leidenschaften.« Rasch fügte er hinzu: »Aber nicht bei mir. Mit der Schönheit deiner Mutter kann es die Neilson niemals aufnehmen. Und auch nicht mit deiner. Jedes Mal, wenn ich dich betrachte – dein liebreizendes Gesicht, die seidigen, langen, braunen Haare, die jadegrünen Augen, den weißen Schwanenhals und die zarte Gestalt –, dann sehe ich eine Elfe vor mir.«
Lena stöhnte leise. Jetzt fing er bestimmt gleich wieder von den Vorfahren ihrer Mutter an. Darunter hatte es viele Schönheiten gegeben, die als Modelle bei Malern und Fotografen sehr beliebt waren. In einen von Lenas blaublütigen Ahnen hatte sich sogar die einstige Königin von Frankreich, Marie Antoinette, verliebt.
Leslie mochte erraten, was in dem hübschen Dickkopf seiner Tochter vorging, denn statt von den bezaubernden Blüten am Familienstammbaum zu schwärmen, sagte er nur sanft: »Genieße einfach den Vormittag, Sternchen.«
Sie wandte sich ihm zu und sah in sein gütig lächelndes Gesicht. Unschwer ließ sich erkennen, wie sehr auch er unter Julias Krankheit litt. Aber er wollte tapfer sein, wollte seinen Kindern Mut machen. Dafür liebte Lena ihren Vater und um ihm das zu zeigen, lächelte sie zurück.
Für den Rest der Fahrt schwiegen die beiden. Lena versuchte, Leslies Rat zu beherzigen und die Sorge um die leidende Mutter hinter anderen Gedanken zu verstecken. Im Haus des Schriftstellers gibt es immer etwas Spannendes zu entdecken, machte sie sich klar. Was für Überraschungen wird der heutige Besuch wohl bringen? Doch obwohl sie sich alle Mühe gab, wollte die rechte Vorfreude nicht aufkommen.
Mr Conan Doyle wollte sich wieder einmal mit Lenas Vater über dessen große Leidenschaft unterhalten. Leslie Stephen war, neben vielem anderen, ein erfolgreicher Bergsteiger und hatte etliche Schweizer Hochgipfel erklommen, darunter das Bietschhorn und das Schreckhorn in den Berner Alpen. Seine genauen Kenntnisse der Gegend betrachtete der Schriftsteller deshalb als so wertvoll, weil er seines Helden Sherlock Holmes überdrüssig geworden war. Als Künstler wollte er frei sein und nicht ewig über den Meisterdetektiv schreiben. Daher beabsichtigte er, ihn den Reichenbachfall runterzuspülen oder sonstwie umzubringen – über die genauen Umstände des Hinscheidens war er sich noch unschlüssig. »Das letzte Problem«, wie er diese noch zu knackende Nuss nannte, sollte jedoch mit dieser letzten Geschichte ein für alle Mal gelöst werden.
»Und über den Besuch meiner zukünftigen Schriftstellerkollegin freue ich mich ganz besonders. Guten Morgen, Virginia«, hieß Mr Conan Doyle die Tochter seines Alpenfachmanns gleich in der Diele herzlich willkommen. Der Arzt war dreiunddreißig Jahre alt, schlank, immer tadellos gekleidet, hatte ein ovales Gesicht, eine hohe Stirn, dunkle Haare, einen dichten Schnurrbart, einen erfrischenden Humor und ein ansteckendes Lachen. Lena sprach er gewöhnlich weder mit ihrem Kose- noch mit ihrem ersten Vornamen – Adeline –, sondern mit dem zweiten und gebräuchlicheren an.
Sie machte einen Knicks und erwiderte artig den Gruß.
Wie bereits zuvor schickte er sie gleich auf Entdeckungstour durch sein Haus. »Weil die kleine Mary gerade mit Mrs Conan Doyle und dem Kindermädchen irgendwo im Park ist, habe ich mir für dich zum Zeitvertreib ein Spiel ausgedacht, Virginia. Eine Schatzsuche. Irgendwo unter diesem Dach ist ein Straußenei versteckt, ein Andenken aus Afrika. Es ist sehr groß, viel größer als ein Hühnerei. Wenn du es findest, darfst du es behalten. Schau dich in meinen heiligen Hallen ruhig um, während dein Vater und ich miteinander reden. Du darfst deine Nase in alle Räume stecken, die nicht verschlossen sind.«
Lena hatte mit so etwas gerechnet. Mr Conan Doyle war in seinem Leben schon viel herumgekommen. Mehrmals hatte er als Schiffsarzt abenteuerliche Reisen unternommen. So war er 1880 als Medizinstudent auf dem Walfänger Hope nach Grönland gefahren. Nach dem Universitätsabschluss heuerte er auf der Mayumba an, einen altersschwachen Dampfer, der regelmäßig zwischen Liverpool und der Westküste Afrikas verkehrte. In seinem Haus gab es daher manches Kuriosum zu bestaunen, das man sonst nicht einmal auf dem Jahrmarkt zu sehen bekam. Für ein neugieriges Mädchen wie Lena, gab es im Haus des Doktors also viel zu entdecken, doch an diesem Morgen ließ sie die sonst übliche Begeisterung vermissen.
»Stimmt etwas nicht?«, wunderte sich Mr Conan Doyle.
Lena senkte beschämt den Blick und zuckte die Achseln.
»Es ist wegen ihrer Mutter«, sagte Leslie und erklärte, wie sehr seine Tochter unter Julias Krankheit leide.
Mr Conan Doyle nickte verständnisvoll. »Ich kann mich gut in deine Lage versetzen, Virginia. Mrs Conan Doyle – meine liebe Touie – leidet auch sehr. Bei ihr sind es die ständigen Hustenanfälle. Ich fürchte, es könnte die Schwindsucht sein. Als Arzt habe ich jedoch eines gelernt: Den Verlauf einer Krankheit falsch einzuschätzen ist tausendmal leichter, als sie zu diagnostizieren, sie lediglich festzustellen. Ich habe schon Tote auferstehen sehen, nicht buchstäblich, aber gemessen an dem, was andere Kollegen ihren Patienten leichtfertig vorhersagten. Deshalb bewahre dir die Zuversicht auf ein gutes Ende. Das wird deine Stimmung aufhellen. Du kennst doch das Sprichwort: ›Wer in Hoffnung lebt, der tanzt ohne Musik.‹«
»Mir ist aber nicht zum Tanzen zumute, Sir«, murrte Lena.
»Das ändert sich, wenn du erst einmal damit begonnen hast.« Er breitete die Arme aus. »Stelle dir einfach vor, mein Haus wäre eine Terra incognita, ein unerforschtes Reich, voller verborgener Schätze. Fang an, danach zu suchen, ehe es jemand anderes tut.«
Sie kam sich wie eine Spielverderberin vor, weil sie das großzügige Angebot des von ihr so bewunderten Schriftstellers nicht gebührend zu würdigen vermochte. Da sie ihn keinesfalls vor den Kopf stoßen wollte, lächelte sie gequält. »Können Sie mir einen Tipp geben, wo sich das Straußenei ungefähr befindet, Sir?«
»Dort, wo du bisher noch noch nie gewesen bist«, antwortete Mr Conan Doyle geheimnisvoll.
Sie seufzte. »Also oben irgendwo?«
Er lächelte bedeutungsvoll.
Nachdem Leslie seine Tochter ermahnt hatte, nichts kaputt und sich nicht schmutzig zu machen, verschwanden die beiden Männer im Salon.
Lena starrte ein oder zwei Minuten lang auf die Stufen, die zu den oberen Geschossen führten, und musste dabei an Mr Conan Doyles tröstende Worte denken. Vielleicht hatte er ja recht und sie musste nur mit dem Tanzen anfangen. »Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt«, murmelte sie und setzte den Fuß auf die unterste Stufe. Der nächste Schritt fiel ihr schon etwas leichter und wenig später befand sie sich im zweiten Stock. Bisher war Lena nur ein einziges Mal hier oben gewesen. Sie hatte mit der kleinen Mary gespielt, Mr Conan Doyles Tochter.
Im ganzen Geschoss herrschte Stille, abgesehen vom Ticken einer Standuhr, die Lena aber nicht sehen konnte. Am Ende des dunklen Flurs lag ein Zimmer, in das sie noch nie einen Blick geworfen hatte. Dort wollte sie mit ihrer Suche beginnen. Hoffentlich war es nicht verschlossen.
Einen Moment verharrte sie mit der Hand auf dem Türknauf. Aus dem Erdgeschoss waren Stimmen und das Klappern von Geschirr zu hören. Vermutlich würde im Salon gleich der Tee serviert. Sie drehte am Griff, die Tür schwang knarrend auf und gab den Blick frei – ins aufgerissene Maul eines Eisbären! Erschrocken wich Lena zurück.
Gleich darauf wurde ihr bewusst, was sie so verängstigt hatte. Es war nur ein Fell mit ausgestopftem Kopf, das auf dem Dielenboden vor sich hinstaubte. Seltsam, dachte Lena. Warum verfütterte Mr Conan Doyle den zweifellos kostbaren Pelz an die Motten, anstatt ihn irgendwo unten im Haus auszustellen?
Da keine Gefahr bestand, von dem Fell angegriffen zu werden, betrat Lena den Raum. Ihr Blick schweifte durch eine Rumpelkammer, anders konnte man es nicht bezeichnen. Das Zimmer war schummrig und etwas ungünstig geschnitten, ungefähr fünf Schritte breit, aber nur halb so tief. Möglicherweise wurde es deshalb nur als Abstellraum benutzt. Durch die halb geöffneten Vorhänge der zwei schmalen Fenster fiel kaum Licht herein – draußen trieb der Wind wohl gerade wieder Regenwolken über den Himmel.
Rechter Hand befand sich ein Kamin. Offenbar wurde er schon lange nicht mehr benutzt, denn in der Asche lagen braune vertrocknete Blätter. Lenas Blick wanderte nach rechts, wo neben der Feuerstelle ein Nashornkopf an der Wand lehnte. Ob der Hausherr den Dickhäuter oder den Eisbären persönlich erlegt hatte? Als Großwildjäger war er ihr bisher nicht bekannt, wohl aber als Draufgänger. So erzählte man sich, Mr Conan Doyle liebe Pferdespiele, aber niemand lasse sich auf eine zweite Runde Polo mit ihm ein, weil es meist mit Spaß begänne und im Hospital ende.
Nachdem Lena die afrikanische Trophäe gebührend bestaunt hatte, setzte sie die Erkundung des Zimmers fort. Wie eine Museumsbesucherin schritt sie bedächtig die verschiedenen Kuriositäten ab. Vor lauter Staunen vergaß sie die Ermahnungen des Vaters und fing mit ihrem hellblauen Kleid und den weißen Strickstrümpfen so manche Staubflocke ein.
Am Boden standen zwei große Holzkisten. Sie waren mit Vorhängeschlössern gesichert und damit für Lena tabu. Darüber hing ein Wandteppich mit allerlei Fabelfiguren, die in ihrer blühenden Phantasie für einen Moment zum Leben erwachten. Danach verharrte ihr Blick kurz auf einer geschnitzten Maske, eine von insgesamt vier oder fünf grausigen Fratzen, die in einem kaputten Korbsessel am Fenster lagen. An der Wand daneben stand ein Köcher mit langen Pfeilen. Davor lagen auf dem Teppich ein Jagdbogen ohne Sehne und zwei Harpunen mit Knochenspitzen ...
Plötzlich verschwand die Dunkelheit aus dem Raum. Der wankelmütige Frühlingswind hatte die Wolken wieder von der Sonne vertrieben. Lenas Körper versteifte sich. Was war das für ein Schatten, der sich da hinter dem rechten Vorhang abzeichnete? Er sah aus wie ... Sie lief rasch zum Fenster, lugte zwischen die beiden Schals hindurch – und schmunzelte.
»Das Straußenei!«, entfleuchte es ihr im Triumphgefühl des Augenblicks.
Es stand auf einem schwarzen Ring aus Ebenholz. Lena war fast ein bisschen enttäuscht, weil die Suche schon zu Ende war. Vorsichtig nahm sie das große Ei mit beiden Händen vom Fensterbrett. Seine von kleinen Dellen überzogene Oberfläche glänzte weiß. Es war ziemlich leicht. Oben und unten befand sich ein kleines Loch – hatte man es wie ein normales Osterei ausgeblasen? Lena schüttelte es. Ja, es war völlig leer.
Sie drückte ihren Fund mit der Linken an die Brust und angelte mit der freien Hand aus der Fensternische den Ebenholzring. Obwohl sie den »Schatz« so schnell gefunden hatte, war sie doch mächtig stolz auf sich. Als sie vom Fenster zurücktrat, bahnte sich die Sonne erneut einen Weg in die Rumpelkammer.
Ein gleißender Lichtstrahl fiel zwischen den Vorhängen hindurch, ließ in der Luft ein Gewirbel aus Staub erglühen, zog sich als leuchtende Spur weiter bis zum Kamin, wo auf dem Sims ein einzelner Gegenstand erstrahlte.
»Eine ... Flaschenpost?«, murmelte Lena überrascht. Spätestens seit der Lektüre von Edgar Allen Poes Kurzgeschichte »Das Manuskript in der Flasche« wünschte sie sich, eines Tages am Strand die Botschaft irgendeines Fremden zu finden, der womöglich bis zum Ende der Welt gereist war und, ehe er für immer aus ihr verschwand, seine Eindrücke niedergeschrieben und einem wasserdichten Gefäß wie diesem anvertraut hatte.
Lena fühlte sich von dem im Sonnenlicht strahlenden Behältnis wie magisch angezogen. Langsam, den Kopf mal nach rechts, mal nach links geneigt, näherte sie sich dem Kamin. Die aufrechtstehende Flasche war ziemlich gewöhnlich, ein schlanker Zylinder aus weißem Glas, ganz milchig geschmirgelt von Sand und Steinen irgendeines Gestades. Der oben herausragende Korken sah aus, als hätten Ratten daran genagt. Lena meinte, noch Reste roten Wachses zu erkennen. Aus irgendeinem Grund hatte Mr Conan Doyle das Siegel nie gebrochen.
Das Straußenei war für sie unwichtig geworden, als sie die Feuerstelle erreicht hatte, verlangte doch das Rätsel der ungeöffneten Flaschenpost nach einer Lösung. Ohne den Blick von dem zerkratzten Glasgefäß zu nehmen, legte sie den Ebenholzring auf den Kaminsims. Bei dem eher gedankenlosen Versuch, das Ei hineinzustellen, verfehlte sie jedoch die Mulde, bemerkte dies aber erst, als sie das Ei losgelassen hatte und es nach vorne kippte. Sie erkannte voller Entsetzen, dass es auf den Steinen vor der Feuerstelle unweigerlich zu Bruch gehen musste. Um das Unglück zu verhindern, packte sie hastig zu, bekam das Ei auch zu fassen, stieß dabei aber mit dem Unterarm gegen die Flasche.
Vor Schreck entfuhr Lena ein spitzer Schrei. Wie gelähmt sah sie den gläsernen »Briefumschlag« zu Boden stürzen, wo er mit lautem Klirren zersprang.
Einige aufgeregte Herzschläge lang vermochte sie sich nicht zu rühren. Lena ahnte, diese Flaschenpost war etwas Besonderes. Warum sonst hatte ihr Besitzer sie nicht geöffnet? Aber das half ihr nun auch nichts mehr. Der Schaden war angerichtet, die Flasche kaputt. Unglücklich betrachtete sie den Scherbenhaufen zu ihren Füßen.
Viele Splitter lagen genau in jenem Streifen aus Sonnenlicht, der sie erst hierhergeführt hatte. Sie erwartete, in dem Geglitzer ein gefaltetes oder zusammengerolltes Stück Papier zu finden, konnte aber nichts dergleichen ...
Mit einem Mal stutzte sie. Sie hatte gerade etwas anderes in den Scherben entdeckt, einen gelbgoldenen Gegenstand, der mehr noch als das Glas im Licht funkelte. »Was ist das?«, flüsterte sie, bückte sich nach dem glitzernden Kleinod und hob es auf. Es bestand aus Metall. In Form und Größe erinnerte es an ein Stück Schale von einer Orange, das innen wie poliert glänzte. Auf der matten Außenseite waren geheimnisvolle goldene Linien und Schriftzeichen eingraviert; dazwischen funkelten winzige rubinrote Steine ...
»Sapperlot!«, rief plötzlich jemand von der Tür her. Es war der Schriftsteller. Hinter ihm stand Lenas Vater. Vermutlich hatte der Lärm die beiden Männer alarmiert.
Als Leslie die Glassplitter am Boden sah, eilte er sofort zu seiner Tochter. »Alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan?«
»Nein. Ja«, antwortete Lena.
Ihr Vater blinzelte verwirrt. »Na, was denn nun?«





























