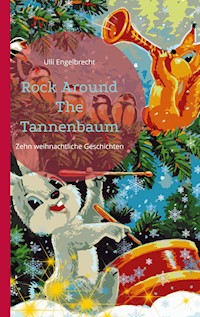Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wenn er gegangen ist, dann brennen mir die Schläfen, dann sitze ich jedes Mal da mit schmerzendem, aufgeblähtem Schädel, in dem für die nächsten Stunden Memoiren und Musik aus den vergangenen Dekaden raumgreifend rotieren." Der nostalgieverliebte Autor erinnert in seinen Rockstorys & Popgeschichten an die Lebens- und Gefühlswelt der jungen Menschen in den 1970er- und 1980er-Jahren und an die Musik jener Zeit, die die Gemütslage und den Zeitgeist kräftig aufmischte. Bonus: 99 Plattenkritiken!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Über die Wiederbelebung von Gedankenschrott
Der Bogen zurück zur Musik
Dreiundachtzig Minuten und zweiundvierzig Sekunden
Der furchtbare und barbarische Akt
An einem Freitag im Oktober
Mir brennen die Schläfen
Der Duft der Jugend
Vicky mit weichem W
Rebell in eigener Sache
Die kleine Grimaldi
Downtown
In stillem Gedenken
Eine haarsträubende Geschichte
Das grüne Auge
Mit Reggae-Musik auf Zeitreise
Born To Be Wild
Eine echt aufregende Geschichte
Hit oder Niete? 99 Scheiben auf dem Prüfstand
Über die Wiederbelebung von Gedankenschrott
Nicht nur zur Weihnachtszeit findet bei mir eine mentale Wiederbelebung meines Gedankenschrotts statt. Ich solle lieber den Blick fest in die Zukunft richten, sagt man mir dann, und damit aufhören, in der Vergangenheit herumzudenken. Als ob das so einfach wäre. Prüfen Sie sich einmal selbst: Was geschieht wohl, wenn ich Ihnen beispielsweise das Wort Klassenfahrt! entgegenrufe. Oder Klammerblues! Oder den Titel eines berühmten Liedes von Abba.
Ich sag’s Ihnen gerne: Da öffnen sich, wie von Geisterhand bewegt, in Ihrem Oberstübchen Schranktüren und Schubladen und geben Ihnen den Blick frei auf Ereignisse, von denen Sie glaubten, dass Sie sie schon längst verdrängt oder komplett vergessen hätten. Mein Tipp: Seien Sie mutig, fahren Sie den Schrott nach und nach ab. Unterhalten Sie damit ihren Freundeskreis oder wildfremde Menschen. Ich tue das ja auch, gerade jetzt sogar, in diesem Moment.
Vor einer Stunde erst habe ich Ten Years After gehört und musste sofort an Fritz Wepper denken. Und warum? Mein Bruder schenkte mir Weihnachten 1972 eine Platte der britischen Band, die ich aber nicht am gleichen Tag hören konnte, weil sich meine Eltern über meine langen Haare aufregten, die aber gar nicht so lang waren, sondern eher so lang wie die von Fritz Wepper in seiner Rolle in der ZDF-Krimi-Serie „Der Kommissar“, die trotz Farbfernsehen stets in schwarz-weiß ausgestrahlt wurde und mit einer markigen Musik begann:
Bam tata-tatata-dudeldidel – Bam tata-tatata-dudeldidel…
Na, klingelt’s? Mit Erik Ode als väterlicher Kommissar Keller, Reinhard Glemnitz als öliger Robert Heines, Günther Schramm als bodenständiger Walter Grabert und eben mit Fritz Wepper als grünschnäbeliger Harry Klein.
Die Mörderjagd als vergrübeltes Kammerspiel, mit Dialogen wie auf der Theaterbühne:
Er:
Tot? Sie ist tot? Wieso ist sie tot? Hast Du gehört Wilma, die Bassenge ist tot!
Sie:
Tot? Aber warum ist sie tot?
Er:
Aber du hast doch gehört, dass der Kommissar gesagt hat, dass sie tot ist? Das hast du doch gehört? Oder?
Sie:
Aber warum ist sie tot? Sie war doch noch heute morgen hier. Hat hier gesessen. Hat hier getrunken. Hat hier gegessen. Hat hier gelacht. Hat hier geredet. Und jetzt – Herr Kommissar – jetzt ist sie – tot? Sie ist tatsächlich – tot?
Er:
Ja doch! Du hörst doch, was der Kommissar sagt. Tot ist sie, nicht wahr, Herr Kommissar? Sie ist tot! Die Bassenge ist doch tot?
So ging das stundenlang.
Unvorstellbar heute.
Und Kommissar Keller stand ungerührt mittendrin, hörte aufmerksam zu, trank wahlweise dazu einen Schoppen Wein, eine Maß Bier oder ein wie auch immer geartetes hochprozentiges Herrengedeck, lächelte gütig und allwissend, schob dabei mehrmals seine rechte Hand in die Anzugtasche, fingerte seine Schachteln heraus und kettenrauchte in einer solchen ermittlungsintensiven Szene ungefähr 45 Zigaretten.
Mein Vater Erich rauchte nicht so viel, dafür stank es aber gewaltig, wenn er zur Serie seine Spezialmarke „Finas“ in Brand steckte. Ägyptische Zigaretten waren das, oval geformt, filterlos, etwas ganz Besonderes. Im Gegensatz zu unserem alten Fernsehapparat. Wir besaßen 1972 immer noch kein Farb-TV und guckten die Christmette in schwarz-weiß.
Farbig waren nur die Hüllen der Schallplatten, die am späten Nachmittag nach der Bescherung aufgelegt wurden: Heintje, Favorit meiner Mutter. Peter Alexander, Favorit meines Vaters. Reinhard Mey, Favorit meines älteren Brudes. Ten Years After, mein Favorit. Das Album, das er mir feierlich überreichte, hieß „Rock’n‘Roll Music Around The World“. Viel später dann, nach der Mette, landete noch eine Platte von James Last auf dem Teller: „Christmas Dancing“. Obwohl keiner von uns dazu tanzte.
Ten Years After spielten in jenen Tagen den angesagtesten Bluesrock überhaupt – also nicht unbedingt die passende Weihnachtsmusik für den sehr engen Familienkreis, deshalb durfte ich sie auch nicht auf dem elterlichen Dual-Plattenspieler auflegen. Nur angucken. Einen eigenen Spieler besaß ich noch nicht. Dafür aber lange Haare. Die waren damals quasi gesetzlich vorgeschrieben für alle Jungs ab 12 aufwärts bis unendlich. Harry Klein trug lange Haare, James Last trug auch lange Haare. Ich war 15. Also war es mir ebenfalls gestattet.
Meine Mutter Maria war außer sich, dass ihr Zweitgeborener uneinsichtig blieb und sogar jetzt, zum Fest der Freude und des Friedens und zu Jesu Geburt, sich weigerte, die Haare kürzen zu lassen. Jesus trug doch auch immer lange Haare, sagte ich bedeutsam, deutete auf das schwarze und massive Holzkreuz, das im Elternschlafzimmer über dem Weihwasserbecken hing, duckte mich fix, damit ich einer eventuell folgenden Ohrfeige ausweichen konnte.
Die Figur an dem Kreuz, sicherlich 50 Zentimeter groß, gefertigt aus schwerem Metall und schon leicht speckig, zeigte den leidenden Jesus, dessen mittelgescheitelte Matte leicht dauerwellig bis weit über seinen Schultern hing. Länger sogar als bei Alvin Lee, dem Gitarristen von Ten Years After, wie ich es dem kleinen Foto auf der Rückseite des Covers entnehmen konnte.
Ich hatte in meinem bislang erst kurzen Leben aber noch keine einzige Jesus-Abbildung gesehen, auf der der Mann einen Kurzhaarschnitt trug. Und immerhin war ich angehalten, als guter Katholik und Messdiener, Gottes Sohn nicht nur zu dienen, sondern auch anzubeten. Einen Langhaarigen!
Mutters Hand blieb diesmal in der Kitteltasche, dafür entwickelte sich zwischen ihr und ihrem Mann ein Disput über das Thema lange Haare, in Dramaturgie und Dialogführung einer „Kommissar“-Folge nicht unähnlich:
Maria:
Lange Haare? Wieso lange Haare? Hast Du gehört Erich, was der Bengel gerade gesagt hat?
Erich:
Jaja. Lange Haare. Das ist eben die Zeit. Es haben doch zurzeit alle lange Haare…
Und so weiter.
Ten Years After war meine vielleicht neunte oder zehnte Begegnung mit einer Band, in der die Musiker lange Haare trugen. Zum allerersten Mal sah ich solche tollen Wollen bei Aphrodite’s Child, einer Band griechischen Ursprungs, die mit Spring, Summer, Winter And Fall und I Want To Live veritable Hits landete, an die ich mich kaum noch erinnere. Was mir jedoch von dem Quartett im Gedächtnis haften geblieben ist, sind die wahnsinnig üppigen Matten und die wahnsinnig dichte Körperbehaarung. Das undurchdringliche Geflecht sah aus wie schwarzes Moos, in dem Handwerkszeuge wie Mikrofone, Trommelstöcke oder Gitarren kaum noch erkennbar waren.
Lange Haare und Rockmusik gehörten seitdem für mich untrennbar zusammen wie Cindy & Bert, Fix & Foxi oder Wim & Wum. Apropos Wum. Warum eigentlich kletterte Wum zur Weihnachtszeit 1972 in die Hitparade? Weltweit wurde John Lennons Happy Christmas, War Is Over gesungen, nur nicht in Deutschland. Hier rauschte alle naselang Ich wünsch‘ mir ‘ne kleine Mietzekatze von Wum durch den Äther. Ein Song, der von einem Weihnachtslied so weit entfernt war wie die damalige Bundeshauptstadt Bonn zum Alpha-Centauri-Sternensystem.
Verrückt, nicht wahr?
Wum, das war der von Loriot gezeichnete putzige Hund, dem der legendäre Cartoonist auch seine Stimme lieh, und der Wim zur Seite stand. Sie erinnern sich? Wim Thoelke, Showmaster der ZDF-Quizsendung „3x9“.
Wim & Wum – eine seltsame Paarbindung. Und beileibe nicht die Einzige in jenen Zeiten, wo es im Fernsehen nur so wimmelte von kuriosen und omnipräsenten Zusammengehörigkeiten, auf die ich im Moment nicht weiter eingehen möchte. Denn die Gefahr wäre groß, dass ich mich auf den labyrinthischen Wegen durch die Historie des Flimmerkastenprogramms und dessen Begleiterscheinungen, und wie sie den Alltag beeinflussten, verlaufen würde.
Und dann hätte ich am Ende noch den Überblick über diesen Aufsatz verloren, der nur verknappt darstellen soll, worum es in meinen Geschichten geht: nämlich um Musik und Mediales und um Leidensfähigkeit und Lebensgefühle. Mein Gedankenschrott will schließlich ordentlich getrennt und aufbereitet und kommentiert sein, ansonsten stünde er wie eine wilde Wortmüllkippe voll mit unreflektiertem und unnützem Wissen völlig verloren in der Textlandschaft herum.
Nachsatz:
Heintje mochte Pferde und sammelte Heiratsanträge von erwachsenen Frauen. James Last ist tot, war aber mal stinkreich und hatte sein gesamtes Vermögen verloren. Und Alvin Lee, auch schon tot, spielte in seiner Freizeit Klarinette.
Das musste noch gesagt werden.
Der Bogen zurück zur Musik
Vielleicht sollte ich mal kurz an die frische Luft gehen und flitzen. Der kleidungsbefreite Betätigungsdrang wäre als besondere Belästigung der Allgemeinheit zu werten und würde sicherlich eine Erregung des öffentlichen Ärgernisses provozieren. Und dann kann es sein, dass das so erhitzte Gemüt meiner Mitbürger mich stimuliert und mir endlich den nötigen energiereichen Kreativschub verpasst, meinen Text zum Thema Frank Zappa fertigzustellen.
Flitzen sagt ihnen nichts? Dooooch, das sagt Ihnen was.
Flitzen wurde um 1974 herum erfunden und zur großen Mode in der Welt. Ein Massenphänomen. Junge Menschen rannten splitterfasernackt über öffentliche Plätze, um auf irgendetwas aufmerksam zu machen oder gegen irgendetwas zu protestieren. Natürlich ein Skandal das Ganze.
Der britischen Band Queen diente diese Flitzer-Aktion offenbar als Inspirationsquelle für ihren Titel Bicycle Race. Diesen Song gab’s kurz vor Ende der 1970er-Jahre nicht nur auf Single zu hören, sondern zusätzlich auch schon als Musikvideo zu sehen. Und was gab es da zu sehen? Nun, quirlige Damen, ein Dutzend mögen es gewesen sein, die textilfrei auf Fahrrädern durch die Gegend flitzten.
Auch in Deutschland traf man auf fleißige Flitzer, die fade Fußballspiele, fröhliche Fernsehshows oder feierliche Festtagsgottesdienste aufmischten.
Im Radio hörte ich seinerzeit davon, dass ein 25-jähriger aus München tatsächlich für sich beschloss, Berufs-Flitzer zu werden. Eine große deutsche Zeitung versprach ihm 200 Mark pro Auftritt. Ob sich der Twen allerdings jobmäßig neu orientierte, habe ich nicht weiterverfolgt.
Entblößt durchs Gemeinwesen zu sausen lohnte sich in jenen Zeiten finanziell ohnehin nur dann, wenn man für eine berühmte Popband warb oder eine Rolle in einem der zahlreichen spaßigen Sexfilme deutscher Provinienz ergattern konnte. Zum einfachen Leben reichte das Darstellerdasein in beiden Sparten wohl aus, lechzte man allerdings nach attraktiveren Aufstiegsmöglichkeiten, musste man sich etwas einfallen lassen. So wie es beispielsweise Konstantin Wecker tat: Die richtige Karriere gelang ihm bekanntlich nicht mit seiner weiteren Mitwirkung beim Gejodel unter’m Dirndl, sondern mit eigenhändig verfasstem Liedgut.
Alternativ gab’s noch die Chance, sich in die Vereinigten Staaten abzusetzen, denn dort suchte Regisseur Russ Meyer, der Charles Bukowski unter den Sexfilmern, ständig neue Mitspieler. Meyer mochte allerdings nur dralle Weiber mit voluminös gewachsenem Hüttenholz und kernige Kerls mit kantigem Kinn, wobei letztere nie den Helden gaben. Die Männer nämlich führte der deutschstämmige Filmemacher mit Vorliebe als antriebsarme Trottel oder sabbernde Hinterwäldler vor, die von selbstbewussten Bumsballerinas in allen Lebens- und Liebeslagen dominiert wurden.
In seinen rasant geschnittenen Zelluloid-Zügellosigkeiten ließ sich Meyer zwar unverblümt unverschämt frech über Gier, Geilheit und Großraumbusen aus, erzählte in seinen grellen Kopulations-Operetten tatsächlich aber auch richtige Geschichten. Er karikierte, ironisierte und attackierte die heile Familienwelt seiner Landsleute, entlarvte niederträchtige Machtspiele und sexuelle Vorlieben, zerrte geheime Begierden und Triebhaftigkeiten aus den Beziehungskisten hervor und komprimierte diese Versatzstücke mit diabolischer Freude zu einem abgründigen und schrullig-schrägen Sittenbild Fellinischer Prägung, versetzte mit diesen seinen Filmen lüsterne Voyeure und seriöse Feuilletonisten gleichermaßen in Verzückung.
Und wenn die Damen und Herren Protagonisten miteinander, gegeneinander oder übereinander in Badewannen, in Särgen, auf Schrottplätzen oder im zahnärztlichen Behandlungsstuhl in den kämpferischen oder in den wollüstigen Clinch gingen, dann erlebten wir Zugucker die intimen Höhepunkte dieser Auseinandersetzungen zumeist in explodierender Comic-Strip-Manier mit eingeblendeten „Krach“-, „Boing“- oder „Zing“-Sprechblasen und untermalt mit schmissiger Marschmusik. Das war echt nicht schlecht.
Zwischen Kitsch und Kunst sind Meyers schwelgerische Trash-Grotesken wie „Up!“ („Drüber, drunter und drauf“) oder „Beneath The Valley Of The Ultra-Vixens“ („Im tiefen Tal der Superhexen“) angesiedelt, die mich an zahlreiche Werke von Frank Zappa erinnern.
So auch an dessen opulente Rockoper „Joe‘s Garage Act I-III”, einem musikalisch und inhaltlich verschrobenem Werk, einem Meyerschen Film nicht unähnlich: In einer faschistoiden Gesellschaft wird Musikus Joe kriminalisiert und von einer Kulturunterdrückungs-Maschinerie dazu gezwungen, einen ordentlichen Beruf zu ergreifen. Die Songs, die das erzählen, sind prallvoll mit bösen Anspielungen auf Politik und Establishment und Anstand und Widerstand und Sexualität.
Das Album ist, wie ich gerade eben noch beim Hören feststellen durfte, eine lauschige Orgie für die Ohren, die mir eigentlich schamhaftem Menschen im Übrigen klar macht, dass ich mich nun doch nicht in nudistisch-sportiver Weise betätigen muss, da mich mein kurzer Meyer-Exkurs derart angeregt hat, dass ich tatsächlich den Bogen zurück zur Musik geschafft habe. Und dafür möchte ich mich nun ausnahmsweise einmal selbst loben, denn nun werde ich zweifellos mit meiner Story über Frank Zappa vorankommen.
Lassen Sie sich überraschen!
Dreiundachtzig Minuten und zweiundvierzig Sekunden
Ich sage es ohne Umschweife: Ein Fan der Band Yes war ich nie!
Das war damals so, das war zwischendurch so, das war auch 2015 so, als Chris Squire, der Bassist, starb. Ich habe an seinem Todestag keine Platte zur Erinnerung aufgelegt. Ich besitze nämlich keine Platte von Yes. Schon gar nicht die „Tales From Topographic Oceans“, die man unbedingt gehört haben muss, wie mein alter Kumpel Benny mir oft genug eindringlich versichert.
Man müsse generell jeden Ton der Musik von Yes tiiiiiief einatmen und wirken lassen. Denn gerade dieses Album sei das absolute und das definitive Hauptwerk der Großmeister des progressiven Rock, ein gedankenoffenbarendes, hochkulturelles und spirituelles Werk zudem, inspiriert von indischer Philosophie.
Benny mal wieder. Musik zu hören ist mir weitaus lieber, als Musik einzuatmen. Doch davon ab: Mir sind schlicht und einfach die dreiundachtzig Minuten und zweiundvierzig Sekunden dieser Doppel-LP zu lang. Das war, wie bereits erwähnt, damals so, das war zwischendurch so, das war auch 1983 so, als Yes mit neuem Personal und völlig neuer Konzeption den Titel Owner Of The Lonely Hearts in die Charts hievte.
Noch heute klingeln mir Bennys Worte in den Ohren: „Das war’s dann wohl mit Yes, denn dieses Popzeugs kannst du total vergessen. Jetzt musst du wirklich mal die alten Aufnahmen hören, vor allem die ‚Tales‘!“
Habe ich aber nicht getan.
2021 erschien mit dem 22. Album seit 1968 offenbar die letzte Veröffentlichung der Band. Die Kapelle sei aber für Live-Konzerte immer noch zu haben, erzählte mir Benny letzten Freitag und drängte mich abermals, mir die „Tales“ anzuhören. Aber warum sollte ich mir jetzt, heute, in diesen Tagen, dreiundachtzig Minuten und zweiundvierzig Sekunden Musik in die Birne knallen, die aus einer Zeit stammt, als der Geldautomat, die Tiefkühlpizza und die Herrenhandtasche erfunden wurden und der damalige Bundespräsident Walter Scheel mit dem Volkslied Hoch auf dem gelben Wagen 15 Wochen lang in der deutschen Hitparade vertreten war?
Februar 1974. Die „Tales“ waren um Weihnachten herum erschienen, rückten aber erst jetzt so nach und nach ins Bewusstsein und sorgten für regen Gesprächsstoff in der Schule.
Y-E-S
Die drei ineinander verschlungenen Buchstaben, vom Graphiker Roger Dean einst für die Band erfunden, weltweit von zigtausenden kreativen Schülerhänden in allen Größen nachgezeichnet und in den kühnsten Farben ausgemalt, schmückten auch an unserer Penne schon seit geraumer Zeit etliche Tornister und Schulhefte. Sie fanden sich in den Klassenzimmern auch auf Tischen und Stühlen und auf dem Pausenhof sogar eingeritzt in den wenigen Bäumen, die das überschaubare Areal begrenzten.
Sänger Jon Anderson, Gitarrist Steve Howe, Bassist Chris Squire, Schlagzeuger Alan White und Keyboarder Rick Wakeman spalteten die jugendlichen Musikliebhaber in zwei Lager: es gab nur beinharte Fans oder nur erbitterte Feinde. Die einen liebten die fünf Briten dafür, weil sie doch so geschickt seien im kunsthandwerklichen Umgang mit Melodien und Metren, die anderen hassten die Inselfreaks dafür, dass sie mit ihrem kaum nachvollziehbarem Klangmatsch weltweit die Plattenläden verstopften. Ich verspürte überhaupt keine Lust, mich an den lebhaften und oftmals auch handgreiflichen Debatten zu beteiligen. Ich weigerte mich nur standhaft, mir die „Tales“ anzuhören. Interessierte mich einfach nicht.
Seit letztem Freitag nun habe ich Albträume und komische Visionen. Benny fesselt mich auf einem Stuhl, schrumpft die „Tales“-Platten auf Zigarettengröße, formt sie zu Wattestäbchen, stopft sie mir links und rechts in die Ohren. Er zückt einen Block, auf dem er meine Kommentare zu den vier Titeln notieren und sie dann dem Klassenlehrer überreichen wolle, der sie wiederum mit in die Prüfungsnoten zu meiner anstehenden Mittleren Reife einfließen lassen soll. Also, sagt Benny, gib‘ dir Mühe und finde die Musik gut, damit du am Ende nicht durchfällst! Dann berührt er die Stäbchen, startet so die „Tales“, und ergötzt sich anschließend daran, wie mich die Klänge peinigen und ich mich schmerzverzerrt in meiner Hilflosigkeit winde.
Ich erzählte Benny von meinem Traum, er lachte und meinte, ich solle mich mal nicht so anstellen, es gehe doch nur um richtig gute Musik. „Guck‘ dir doch wenigstens mal das Doppelalbum einmal an!“ „Okay“, sagte ich, „ich gucke mir das Doppelalbum an.“
- The Revealing Science Of God (Dance Of The Dawn), 20:27
- The Remembering (High The Memory), 20:38
- The Ancient (Giants Under The Sun), 18:34
- Ritual (Nous Sommes Du Soleil), 21:35
Allein die krampfhafte Überlegung, was sich wohl hinter diesen Titeln verbergen mochte, sorgt bereits für Unruhe in meinem Kopf. Meine Augen schweifen nur fahrig über das mystische Gepinsel auf dem Cover und über die Textwüste im Innern des Albums, aber das reicht vollkommen aus: Schon jubilieren hymnische Gesänge in meinem Schädel, die von irrlichternden Saiten-Pling-Plings, fickrigem Getrommel und konfusem Gebasse umrahmt werden.
Es flirrt und flackert, es säuselt und schwebt, es pumpt und poppt - und mittendrin rumort ein eher unlustiger Keyboard-König herum, greift tief in seine Tastenkisten, verteilt ein Synthi-Tönchen hier, ein Mellotrönchen dort, und macht und tut und strickt aus seinem wuchtbrummigen Melodienknäuel ein viel zu weites Klangjackett, das dem magersüchtigen Tonkörper, den seine Kollegen geschaffen haben, wehend um die Beine schlottert, ihm somit weder Stil noch Chic noch Eleganz verleiht.
Ich legte die Doppel-LP zurück, schaute Benny an, schilderte ihm, was mir gerade durch den Kopf ging und konstatierte: „Wenn mich schon das bloße Angucken des Covers und das Lesen der Titel nervös macht und mir so ein schreckliche Musik vorgaukelt, was werde ich denn dann erst beim Hören erleben? Und sollte ich mich nun doch auf deinen Rat einlassen, jeden Ton der Yes-Musik zunächst tiiiiiief einzuatmen und wirken zu lassen, dann hätte ich ein weiteres Problem. Da ich zur Hyperventilation neige und in der Folge an Blähungen und Stuhlproblemen leide, müsste ich mich auf jeden Fall unter fachmännischer Anleitung mit speziellen Yoga-Atemübungen darauf vorbereiten.“
Ich konnte verstehen, dass Benny nun ziemlich säuerlich aus der Wäsche schaute und gereizt reagierte. Sein Alternativ-Vorschlag lautete: „Meine Güte, dann lass‘ das eben mit der ,Tales‘! Vergiss es einfach!“
Ich glaube, das war sein bester Ratschlag seit langem.
Der furchtbare und barbarische Akt
Es soll Menschen geben, die stapeln ihre Schallplatten so, als hätten sie es mit ihrer Unterwäsche tun: nämlich fein säuberlich übereinander.
Grässlich!
Andere gehen mit ihrem Plattenschatz um, als wäre es Schmutzwäsche. Hülle aus dem Cover, Platte aus der Hülle: zack, beides ab in die Ecke.
Fürchterlich!