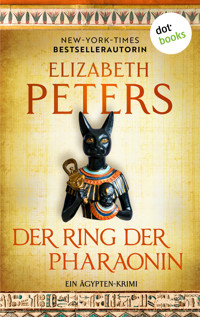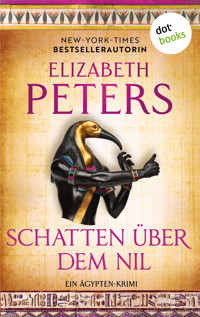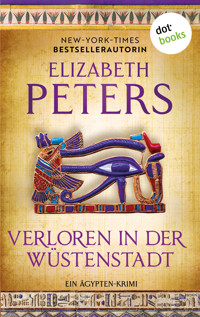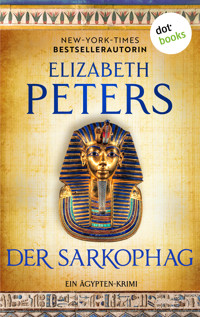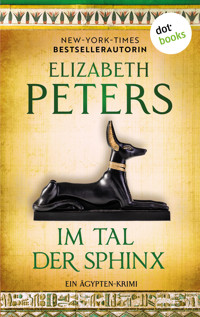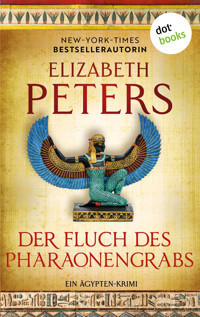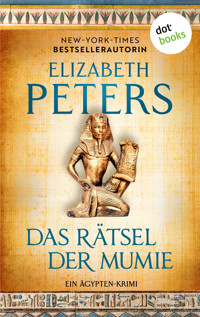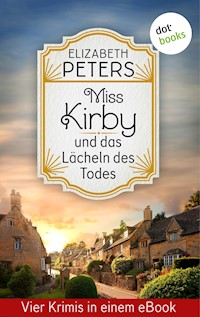
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer zuletzt lacht … Der humorvolle Sammelband »Miss Kirby und das Lächeln des Todes« von Krimi-Queen Elizabeth Peters jetzt als eBook bei dotbooks. Bibliothekarin bei Tag, Hobby-Detektivin bei Nacht … Man nehme eine außergewöhnliche Frau, vier rätselhafte Mordfälle und eine ordentliche Prise Humor: fertig ist der perfekte Krimi-Sammelband! Jacqueline Kirby kann wirklich nichts dafür; ob Rom, eine amerikanische Kleinstadt oder ein englisches Landhaus: Überall scheint der Tod geradewegs auf sie zu warten! Bloß, wer verbreitete auf einem Kostümfest Angst und Schrecken – und zu welchem Zweck? Und wer nutzt eine Liebesroman-Convention, um unliebsame Kritiker aus dem Weg zu räumen? Jacquelines besonderer Spürsinn für faule Machenschaften ist gefragt – und bringt sie und ihre Freunde schon bald in tödliche Gefahr … Über 1.400 Seiten cosy Krimivergnügen: »Spannend, subtil und witzig – Elizabeth Peters in Höchstform!«, sagt Bestsellerautorin Mary Higgins Clark Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Cosy-Crime-Sammelband »Miss Kirby und das Lächeln des Todes« von Bestsellerautorin Elizabeth Peters mit den vier Fällen um Hobby-Detektivin Jacqueline Kirby: »Der siebte Sünder«, »Der letzte Maskenball«, »Ein preisgekrönter Mord« und »Ein todsicherer Bestseller«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1751
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Bibliothekarin bei Tag, Hobby-Detektivin bei Nacht … Man nehme eine außergewöhnliche Frau, vier rätselhafte Mordfälle und eine ordentliche Prise Humor: fertig ist der perfekte Krimi-Sammelband!Jacqueline Kirby kann wirklich nichts dafür; ob Rom, eine amerikanische Kleinstadt oder ein englisches Landhaus: Überall scheint der Tod geradewegs auf sie zu warten! Bloß, wer verbreitete auf einem Kostümfest Angst und Schrecken – und zu welchem Zweck? Und wer nutzt eine Liebesroman-Convention, um unliebsame Kritiker aus dem Weg zu räumen? Jacquelines besonderer Spürsinn für faule Machenschaften ist gefragt – und bringt sie und ihre Freunde schon bald in tödliche Gefahr …
»Spannend, subtil und witzig – Elizabeth Peters in Höchstform!« Bestellerautorin Mary Higgins Clark
Über die Autorin:
Hinter der US-amerikanischen Bestsellerautorin Elizabeth Peters steht Barbara Louise Gross Mertz (1927–2013), die auch unter dem Pseudonym Barbara Michaels erfolgreich Krimis und Thriller schrieb. Die Autorin promovierte an der University of Chicago in Ägyptologie. So haben auch ihre über 20 Kriminalromane, für die sie zahlreiche Preise gewann, meist einen historischen Hintergrund.
Bei dotbooks erscheint auch ihre Krimireihe über die abgebrühte Meisterdetektivin Vicky Bliss:
»Vicky Bliss und der geheimnisvolle Schrein«
»Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde«
»Vicky Bliss und der blutrote Schatten«
»Vicky Bliss und der versunkene Schatz«
»Vicky Bliss und die Hand des Pharaos«
Unter Barbara Michaels erscheinen bei dotbooks ihre Romantic-Suspense-Romane: »Der Mond über Georgetown« »Das Geheimnis von Marshall Manor« »Die Villa der Schatten« »Das Geheimnis der Juwelenvilla« »Die Frauen von Maidenwood« »Das dunkle Herz der Villa« »Das Haus des Schweigens« »Das Geheimnis von Tregella Castle« »Die Töchter von King’s Island«
Sowie ihre historischen Liebesromane: »Abbey Manor – Gefangene der Liebe« »Wilde Manor – Im Sturm der Zeit« »Villa Tarconti – Lied der Leidenschaft« »Grayhaven Manor – Das Leuchten der Sehnsucht«
***
Sammelband-Originalausgabe August 2021
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Andrew Roland, Raftel
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-680-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Miss Kirby und das Lächeln des Todes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Miss Kirby und das Lächeln des Todes
Vier Krimis in einem eBook
dotbooks.
Der siebte Sünder
Aus dem Amerikanischen von Beate Darius
Die perfekte Gelegenheit für einen Neuanfang: Schriftstellerin Jacqueline Kirby greift mit beiden Händen zu, als man ihr eine ruhige Bibliothekarsstelle an der römischen Universität anbietet. Jetzt ist Schluss mit ihrer Vorliebe dafür, ihre hübsche Nase in fremde Angelegenheiten zu stecken! Jacquelines Vorsätze geraten jedoch kräftig ins Wanken, als sie sich mit einer Gruppe Studenten anfreundet – und kurze Zeit später einer von ihnen tot in den Katakomben Roms gefunden wird. Hat ihn seine verrückte Idee, ein Grab mit heiligen Reliquien zu suchen, etwa das Leben gekostet? Jacqueline ist sich sicher: ihre neuen Freunde schweben in Gefahr – höchste Zeit, dem Mörder eine Falle zu stellen!
Für Theron
Mit Dank für die vielen Jahre
konstruktiver Kritik und Unterstützung,
ganz besonders hinsichtlich
der Patenschaft über dieses Buch.
Kapitel 1
Ihre erste Begegnung mit Jacqueline Kirby würde Jean niemals vergessen. Noch Jahre später trieb ihr der Gedanke an diese Episode die Schamesröte ins Gesicht. Eine Bekanntschaft, die mit einem – zugegebenermaßen unbeabsichtigten – tätlichen Angriff und Körperverletzung ihren Anfang nimmt, steht nicht unbedingt unter günstigen Vorzeichen.
In gewisser Weise war Jeans Verhalten allerdings entschuldbar. Den ganzen Morgen hatte sie in der Institutsbibliothek gearbeitet – oder es zumindest versucht. Aber sie wurde abgelenkt. Die Sphärenklänge der Stadt lagen allgegenwärtig über den staubigen Bücherregalen. Paris im April ist phantastisch, doch der Mai in Rom hat eine Faszination, die die Ziele der ehrgeizigsten Studenten ins Wanken bringt. Die Stadt Michelangelos und die Dolce vita, der Vatikan und die Cäsaren – was auch immer es ist, Rom bietet die Erfüllung aller Wünsche. Jeans Forschungsstipendium an einer der weltweit renommiertesten Einrichtungen für Kunst und Archäologie geriet in den Hintergrund angesichts eines Frühlingsmorgens in Rom, und die Motivation zur Pflichterfüllung war weniger ausgeprägt als Odysseus' Widerstand gegenüber dem Gesang der Sirenen.
Michael war ein weiterer Ablenkungsgrund; wenn auch nicht so überwältigend wie die Stadt, befand er sich doch in unmittelbarer Nähe. Auch er hätte arbeiten sollen, vernachlässigte sein Studium jedoch ebenso wie sein ungepflegtes, schulterlanges Haar. Ziellos schlenderte er entlang der Regale, beobachtete Jean durch die zwischen den Buchreihen entstandenen Lücken und stellte ihr nach, sobald sie sich in einer dunklen Ecke aufhielt.
Aufgebracht und verwirrt aufgrund dieser Annäherungsversuche, mußte sich Jean eingestehen, daß sie sie beileibe nicht so konsequent zurückwies, wie sie das eigentlich hätte tun sollen. Wenn sie sich in ihr Büro zurückzog und die Tür verschloß, würde Michael sie in Ruhe lassen. Die kleinen, fensterlosen Räume, die den Stipendiaten zur Verfügung standen, waren spartanisch eingerichtet und verfügten lediglich über einen Schreibtisch, einen Stuhl und einige Bücherregale. War die Tür geschlossen, wollte man nicht gestört werden. Lediglich ein Großbrand oder ein politischer Umsturz hätten ein Klopfen gerechtfertigt.
Während sie unschlüssig vor ihrer Bürotür verharrte, gesellte sich Michael erneut zu ihr. Als sein Arm ihre Taille umschlang, war Jeans Konzentration schlagartig wiederhergestellt. Dann allerdings mußte sie feststellen, daß ihr Körper Bereitwilligkeit signalisierte. Sie entzog sich ihm. Es hätte ihr gerade noch gefehlt, in inniger Umarmung von einem der Mitglieder des Komitees erwischt zu werden, das in zwei Wochen über eine weitere Verlängerung der Stipendienfonds für die Studenten entschied.
»In Ordnung«, zischte sie wütend. »Ich gebe auf ... Nein, verflucht, so habe ich das nicht gemeint! Ich meine, laß uns von hier verschwinden.«
Jean war sich nie ganz sicher, wer von ihnen beiden für den unglücklichen Zwischenfall verantwortlich zeichnete. Die Hallen des Instituts waren beeindruckende Fluchten aus blankpoliertem Marmor. Als Jean aus der Bibliothek trat, fiel ihr Blick auf den verlassenen Flur – ein langer, schneeweißer Parcours gähnender Leere, glänzend wie Eis und genauso spiegelglatt. Sie rannte los, und Michael nahm begeistert die Verfolgung auf.
Gemeinsam stürmten sie um die Ecke. Für Sekundenbruchteile nahm Jean ein Gesicht mit fassungslos offenstehendem Mund wahr, einen unterdrückten Schrei, einen dumpfen Aufprall, und dann befand sie sich auch schon in einem Gewirr aus rudernden Armen und Beinen. Ihr und Michael gelang es irgendwie, sich wieder aufzurichten, und sie starrten auf eine reglos am Boden liegende Gestalt.
»Heiliger Herrgott«, entfuhr es Michael. »Ist sie tot?«
Die gestürzte Frau wirkte nicht mehr sonderlich lebensbejahend. Im Verlauf der vorangegangenen Wochen hatte Jean sie wiederholt in der Bibliothek gesehen und sie desinteressiert als zeitweilige Besucherin eingestuft – irgendeine Dozentin oder Wissenschaftlerin. Gewöhnlich trug sie schlichte Schneiderkostüme und eine Hornbrille, und ihr Haar war zu einem strengen Knoten hochgesteckt.
In ihrer derzeitigen, mißlichen Lage sah sie vollkommen verändert aus. Der Inhalt einer riesigen Handtasche breitete sich, vergleichbar mit den Folgen eines mittleren Erdbebens, in großzügigem Radius auf dem Boden um die Frau herum aus. Der sittsame, knielange Rock war hochgerutscht und entblößte Beine, die Michael einen bewundernden Pfiff entlockten. Das einfallende Sonnenlicht glitt über den Kopf und die Schultern der Frau und lenkte die Aufmerksamkeit auf ein blasses, ernstes Gesicht – hohe Wangenknochen, energisches Kinn, wohlgeformte Lippen wie die einer klassischen griechischen Statue. Ihr Haar war bemerkenswert. Aufgrund des Sturzes hatte es sich gelöst und umrahmte ihr friedliches Gesicht wie geschmolzene Bronze.
»Haben wir sie umgebracht?« wollte Michael wissen.
»Sei nicht albern ... Ich hoffe nicht!«
Ohne jede Vorwarnung schlug sie plötzlich die Augen auf. Sie waren von einem klaren stechenden Grün, einer für Menschen ungewöhnlichen Augenfarbe. Durchschimmernd wie Meerwasser fixierten sie Jean mit dem Ausdruck konzentrierter Feindseligkeit, der im Gegensatz zu ihren entspannten Gesichtszügen höchste Alarmstufe signalisierte.
Die zusammengepreßten Lippen der Frau öffneten sich.
»O Gott, hier etwa auch?« stöhnte eine mitleiderregende Stimme. Jean, die eine Gehirnerschütterung in Erwägung gezogen hatte, korrigierte ihre Diagnose. Ein eindeutiger Fall von einem leichten Dachschaden. Rasch kniete sie sich neben die Frau. »Versuchen Sie, nicht zu sprechen«, sagte sie aufgebracht. »Bewegen Sie sich nicht. Haben Sie sich verletzt? Haben Sie –«
»Ob ich mich verletzt habe?« Die feindseligen grünen Augen musterten Michael, der unbehaglich von einem Fuß auf den anderen trat. »Ich habe gar nicht die Absicht, mich zu bewegen. Für den Rest des Tages werde ich hier liegenbleiben. Das scheint mir der sicherste Ort zu sein. Sofern Sie keine hilflosen Opfer niedertrampeln.«
Jean ließ sich auf ihre Fersen zurücksinken. »Ich denke, Ihnen fehlt nichts.«
»Mit mir ist alles in Ordnung. Es geht mir zwar nicht berauschend, aber es könnte schlimmer sein ... So wie jetzt rede ich eigentlich immer. Wer sind Sie?«
»Jean Suttman, Michael Casey«, erwiderte Michael. »Möchten Sie, daß ich Ihnen aufhelfe?«
»Nein«, entgegnete sein Opfer entschieden.
Michael setzte sich auf den Boden. »Und wer sind Sie?« fragte er höflich.
»Jacqueline Kirby.«
»Angenehm.«
»Wie man's nimmt.«
Jean blickte von Michael, der wie ein indischer Fakir im Schneidersitz hockte, zu Jacqueline, die nach wie vor am Boden lag und den Eindruck erweckte, diese Haltung auf unbestimmte Zeit beizubehalten. Sie fing an zu lachen. Als die beiden anderen sie mißfällig betrachteten, erheiterte deren säuerlicher Gesichtsausdruck sie nur noch mehr. Nachdem sie sich schließlich beruhigt hatte, sagte Jacqueline in strengem Ton: »Wenn Sie jetzt fertig sind, können Sie meine Habseligkeiten zusammensuchen.«
»Selbstverständlich«, erwiderte Jean und fügte vorsichtig hinzu: »Würde es Ihnen etwas ausmachen aufzustehen, Miss ... Mrs .... Doktor ...?«
»In Anbetracht des ungezwungenen Charakters unserer Begegnung können Sie mich ruhig Jacqueline nennen. Warum wollen Sie eigentlich, daß ich aufstehe? Ich empfinde meine derzeitige Situation als überaus angenehm.«
»Es geht ihr weniger darum, wie Sie sich fühlen«, erklärte Michael sachlich. »Vermutlich möchte sie die Spuren des Verbrechens beseitigen, bevor einer der Fellows vorbeirauscht. Das Komitee setzt sich bereits in Kürze zusammen, um darüber zu entscheiden, wer von uns ein weiteres Jahr hier studieren darf«
»Ach wirklich«, sagte Jacqueline nachdenklich.
Jean hielt mitten in ihrer Suche nach Puderdose, Kugelschreibern, Postkarten und einer kleinen Flasche, die Crème de Menthe zu enthalten schien, inne.
»›Ach wirklich‹ klingt irgendwie nach Erpressung«, meinte sie. »Sie würden doch nicht ... Oder etwa doch?«
»Schätzungsweise eher nicht«, erwiderte Jacqueline mit Bedauern. »Also gut. Würden Sie mir bitte aufhelfen, Michael?«
Nach einem letzten anerkennenden Blick auf Jacquelines wohlgeformte Knie gehorchte Michael. Jacqueline war dieser Blick nicht entgangen; sanft entzog sie sich Michael, der willkürlich an ihr zerrte, und bemerkte: »Danke. Für alles ... Die Vorstellung ist beendet. Ich werde mich wieder in mein Alter ego zurückverwandeln.«
Sie griff in ihr Haar und schlang es erneut zu einem Knoten zusammen.
»Warum tun Sie das?« wollte Michael wissen. »Tragen Sie es doch einfach offen. Sie haben wunderschönes Haar, Madam.«
»Ich weiß«, entgegnete Jacqueline kühl. »Aber es paßt nicht zu meinem derzeitigen Erscheinungsbild. Jean, haben Sie meine Haarnadeln gefunden?«
»Hier.«
Scheinbar willkürlich rammte Jacqueline sie in ihren Knoten, dennoch hatte die Frisur tadellosen Sitz. Jean sprang auf und reichte ihr die Tasche.
»Sie haben die Schachtel Heftpflaster vergessen«, sagte Jacqueline. »Hinter der Topfpflanze. Und das da unter der Büste des Aristoteles ist mein Stein.«
»Ihr Stein«, wiederholte Jean verständnislos. Sie sammelte besagten Gegenstand, das Heftpflaster und außerdem noch einen Augenbrauenstift ein und mußte der Versuchung widerstehen, Jacqueline zu fragen, ob sie nicht auch gleich Aristoteles dazupacken sollte. Die stechenden, auf sie fixierten grünen Augen nahmen ihr jedoch jeglichen Mut. Aber als sie ihr die Tasche überreichte, konnte sie sich die Bemerkung nicht verkneifen: »Bislang hielt ich die Männer für ungerecht, die sich über Frauenhandtaschen lustig machten.«
»Ich habe gern alles griffbereit.« Mit zusammengekniffenen Augen spähte Jacqueline in die Tiefen ihrer Tasche. »Ich glaube nicht, daß Sie alles eingesammelt haben, Jean. Ich sehe weder die Taschenlampe noch die Flasche –«
»Vielleicht sollten Sie Ihre Brille aufsetzen«, schlug Jean vor und reichte sie ihr.
»Trage ich sie denn nicht? Ach nein, tatsächlich nicht. Vielen Dank.«
Jacqueline setzte ihre Brille auf, und Jean starrte sie an. Die Verwandlung war perfekt. Die Brille, die strenge Frisur, die schlichte Garderobe – eine gebildete Dame mittleren Alters wühlte in ihrer vollgestopften Handtasche, während sie damenhaft schickliche Begriffe wie »verflucht« und »zum Teufel« murmelte.
»He«, meinte Michael grinsend. »Ich denke, wir haben eine Freundin gefunden, Jean. Kommen Sie, Jacqueline. Wir spendieren Ihnen einen Drink zur Nervenstärkung.«
»Warum nehmen Sie nicht einfach einen Schluck davon?« schlug Jean vor, als Jacqueline mit einem Seufzer der Erleichterung die winzige grüne Flasche aus den Tiefen ihrer Handtasche hervorkramte.
Jacqueline starrte sie an. »Davon? Das ist für meine Katze.«
»Natürlich«, sagte Michael. »Zweifellos ein Aphrodisiakum für Katzen. Oder verwandelt es die Katze bei Mondlicht in eine Frau?«
»Eine kleine alte Dame in Trastevere stellt das her«, erklärte Jacqueline. »Aber eigentlich gehört die Katze nicht mir. Sie –«
»Sie gehören ihr. Ganz klar.« Entschlossen zog Michael sie am Ellbogen. »Kommen Sie mit, Jacqueline. Sie können eine Stärkung vertragen. Ich weiß zwar nicht genau, was, aber ein Espresso kann nie schaden.«
»Bei Gino's?« meinte Jean verunsichert. »Michael, meinst du, daß die anderen –«
»Ich möchte mich nicht aufdrängen«, bemerkte Jacqueline spröde.
Korrekt gekleidet und mit Brille strahlte sie die würdevolle Zurückhaltung aus, die Jean mit altjüngferlichen Tanten und Lateinlehrerinnen in Verbindung brachte. Jean fand sie furchteinflößend, hatte sie doch eine völlig veränderte Person vor sich als die grünäugige, auf den Marmorboden des Instituts gestürzte Hexe. Michael blieb unbeeindruckt. Seine Umklammerung von Jacquelines Arm wurde lediglich fester, als er sagte: »Die anderen werden begeistert sein.«
Jean war immer wieder fasziniert von dem Gegensatz zwischen Institutsgelände und der um seine Mauern verlaufenden Straße. Das Institut war in einer der repräsentativen alten Villen in der Nähe des Tibers untergebracht und von wunderschönen Parkanlagen umgeben. Pinien und Zypressen bildeten einen dunklen Kontrast zu farbenprächtigen Azaleen, Bougainvillea und Oleander und spendeten den weißen, ringsum stehenden Bänken ihren kühlenden Schatten.
Die elegante Villa hob sich vornehm von den sie umgebenden Bürgerhäusern und von der lauten, belebten Straße ab. Aufdringlich warben die Geschäfte für die von ihnen feilgebotenen Waren, und das dunkle, abbröckelnde Mauerwerk trug noch die Spuren der einstigen Herrschaft. Es waren unauffällige Hinweise, die häufig mit schmutzigen Papierfetzen überklebt waren, doch Jean würde niemals das unbeschreibliche Gefühl vergessen, als sie zum ersten Mal die schwarzen, in Stein gehauenen Lettern bemerkte, die auf Roms Größe vor zweitausend Jahren hindeuteten. S. P. Q R. – Senatus Populusque Romanus. Der Senat und das römische Volk. Trotz der zunehmenden Korruptheit und Funktionsuntüchtigkeit dieses symbolträchtigen Begriffs stand er doch immer noch für die erste mächtige Republik.
Gino's Café war klein und hatte eine offene Fensterfront mit einigen wackligen Tischen und Stühlen auf dem Bürgersteig. Gegenüber den anderen in dieser Gegend besaß es nur einen Vorteil – die Aussicht. Auf der Spitze eines Hügels gelegen, bot es seinen Gästen den Blick über Baumkronen und Dächer bis hin zum wolkenverhangenen Petersdom. In der anderen Richtung genoß man an klaren Tagen die Aussicht über die Altstadt. Solche Tage waren allerdings selten, da die Automobilabgase die Stadt der Cäsaren meist in eine diesige Nebelwolke hüllten.
Als sie den Hügel hinaufschlenderten, stellte Jean fest, daß drei ihrer Freunde bereits im Café eingetroffen waren. Mittlerweile waren ihr diese Gesichter so vertraut, daß sie gar nicht mehr genau hinschaute. Doch im Beisein einer Fremden sah sie sie heute mit anderen Augen und wesentlich kritischer. Sie hatte das Gefühl, sich Jacquelines Brille ausgeliehen und damit deren Einschätzung übernommen zu haben.
Ein Mitglied der Gruppe wirkte wenig originell; in Rom wimmelt es von Priestern sämtlicher Glaubensrichtungen, Nationen und Rangordnungen. Padre Ximenez trug die lange schwarze Kutte, die ihm sein Orden während seines Romaufenthalts vorschrieb. Auf Außenstehende, dachte Jean und bemerkte schlagartig, was sie seit Beginn ihrer Freundschaft unbewußt verdrängt hatte, mußte Josés dunkle mediterrane Ausstrahlung vermutlich überaus anziehend wirken.
Die Scovilles waren Bruder und Schwester, allerdings schien es auf die Entfernung hin fast unmöglich, sie zu unterscheiden. Die Ähnlichkeit war phänomenal; größtenteils resultierte sie aus der gängigen Mode. Ann trug die gleiche ausgebleichte Jeans und ein ähnliches Oberhemd wie ihr Bruder. Die rotgoldene Mähne der Scovilles ähnelte den Frisuren bekannter Persönlichkeiten wie Struwwelpeter oder Art Garfunkel. Ihre Frisur war identisch, außer daß Andys Haar eine Idee länger war als das seiner Schwester und sein Gesicht wie einen Heiligenschein umgab. Ansonsten boten Andys Gesichtszüge keine weiteren Anzeichen auf einen Heiligen; schwierig, sich einen Heiligen mit Sommersprossen vorzustellen, und Andys blaue Augen besaßen ein Funkeln, das man eher der gegenläufigen Überzeugung zugesprochen hätte. Neben ihm wirkte seine Schwester fade und unauffällig.
Michael war in eine seiner nachdenklichen Stimmungen verfallen. Er ließ sich auf den nächstbesten Stuhl fallen, kramte einen Skizzenblock hervor, den er immer bei sich trug, und überließ Jean die Erklärungen für Jacquelines Anwesenheit. Andy fand die Geschichte höchst amüsant. Er brach in schallendes Gelächter' aus, das allerdings abrupt endete, als er Jacquelines stechenden Blick bemerkte.
»Es tut mir leid«, murmelte er wenig überzeugend. »Sicherlich war das alles andere als lustig.«
»O doch, das war es«, meinte Jacqueline sanft. »Sofern Sie, verflucht noch mal, ein Fan von Tortenschlachten sind ... Wissen Sie, ich bin nicht aus freien Stücken hier. Man hat mich überrumpelt. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich hier sein will. Was für eine Gruppe stellen Sie eigentlich dar? Eine Keimzelle der internationalen Verschwörung? Eine Gesellschaft für die Verhinderung von irgendwas?«
Die Reaktionen der drei, die zum ersten Mal mit Jacquelines spitzer Zunge konfrontiert wurden, waren ebenso unterschiedlich wie ihre Persönlichkeiten. Ann wirkte verunsichert. Sie war ein ruhiger, schüchterner Typ, der Kontroversen verabscheute. José grinste. Andy, der einen ebenbürtigen Gegner witterte, entspannte.
»Wenn überhaupt, dann sind wir eine Gesellschaft zur Ermutigung und nicht zur Verhinderung von irgendwas. Wir sind nur ein Teil der Gruppe. Unser Motto –«
»Halt den Mund!«, herrschte ihn Jean an. Sie blickte zu Jacqueline. »Wir haben uns angewöhnt, uns hier jeden Morgen zum Kaffee zu treffen. Vier von uns sind Stipendiaten. Das Institut bewilligt diese Stipendien für einen einjährigen Studienaufenthalt in Rom –«
»Ich bin mir dieser Funktion des Instituts sehr wohl bewußt.«
»Nun, wir vier haben ein Stipendium für dieses Jahr erhalten. José studiert Buntglasdesign bei einem der Künstler am Institut, und die beiden anderen Mitglieder unserer Truppe sind ebenfalls ausländische Studenten, die teilweise die Institutsbibliothek nutzen«, erklärte Jean.
»Also insgesamt sieben«, stellte Jacqueline fest.
»Es hat sich einfach so ergeben. Eigentlich sind wir kein Geheimbund.«
»Das denkt sie«, mischte sich Andy todernst ein, »aber sie verkennt die Numerologie – ihre tiefere Bedeutung. Wir wurden zusammengeführt. Es liegt ein Sinn in unserem Hiersein, daß wir uns aus allen Ecken der Welt in der Ewigen Stadt zusammengefunden haben.«
»Hmhm«, meinte Jacqueline. Sie schob ihren Stuhl zurück, um Andy genauer zu betrachten. Ohne von seinem Skizzenblock aufzusehen, hielt Michael ihren Stuhl fest. Als ihm Jacqueline einen verwirrten Blick zuwarf, beruhigte sie Jean: »Machen Sie sich nichts draus. Wenn er sprechen könnte, würde er Ihnen erklären, daß er Sie gerade zeichnet und Sie sich deshalb nicht bewegen dürfen.«
»Aber er kann sprechen, das habe ich doch mit meinen eigenen Ohren gehört. Warum –«
»Er ist Künstler«, erwiderte Andy. Michael, der seine Skizze nicht aus den Augen ließ, entfuhr ein leises Knurren, als Andy fortfuhr: »Maler, um genau zu sein. Die sind echt ausgeflippt, diese Kunsttypen ... In Ordnung, Michelangelo, aber irgendeine Bezeichnung muß ich dir schließlich verpassen. Würde dir ›Bohemien‹ eher zusagen? Nein, ich glaube nicht ... Wie auch immer, meine eigene Schwester gehört auch dazu. Sie ist Bildhauerin. Und nennen Sie sie bloß nicht Bildhauer, wenn Sie an Ihrem Leben hängen. Man sollte gar nicht glauben, daß Menschen, die mit den Händen arbeiten, solche Wortklaubereien betreiben, was?«
»Das macht schließlich jeder«, sagte Jacqueline. Sie lächelte Ann zu, die ihr Lächeln zwar vorsichtig erwiderte, jedoch weiterhin schwieg. »Dann repräsentieren Michael und Ann also die ›Kunst‹ des Instituts für Kunst und Archäologie. Und Sie und Jean sind die Archäologen, Andy?«
»Das Institut diskriminiert die Archäologen«, entgegnete Andy. »Jean verkörpert die Kompromißlösung. Kunsthistorikerin.«
»Darauf läuft es schließlich hinaus«, meinte Jean in ernstem Ton. »Sie versuchen, ein gewisses Gleichgewicht zu erzielen.«
»Sie ist in mehrfacher Hinsicht ein Kompromiß.« José grinste Jean an. »Sie versucht, Frieden unter uns zu stiften. Das ist nicht immer leicht.«
»Das glaube ich Ihnen.« Jacquelines smaragdgrüne Augen musterten ihn, was er entspannt lächelnd zur Kenntnis nahm. Ihr Blick schweifte zu Michael. Jacquelines Gesichtsausdruck blieb unverändert, doch Jean konnte nicht anders, als sich zu fragen, was sie wohl von diesem jungen Exzentriker hielt. Er wirkte so ästhetisch wie ein Raufbold. Mit Ausnahme seines wohlgeformten Mundes – der sicherlich nur einem scharfen Beobachter auffiel – waren seine Gesichtszüge grob und ungeschlacht. Seine großen Hände mit den dicken schwieligen Fingern hätten, gemessen an den Prinzipien der Handlesekunst, eher zu einem Bauern als zu einem bildenden Künstler gepaßt. Seine breiten Schultern, die er gelegentlich einzog, ließen ihn kleiner als seine knapp 1,80 Meter wirken. Sein Hemd ähnelte dem bei jungen Amerikanern beliebten Batiklook, doch Michaels schreiend bunte Version war ein Zufallsprodukt seiner im Laufe des Jahres verwendeten Farbpaletten. Er trug das Hemd offen, nicht etwa bis zur Taille, sondern eher bis zu den Hüften, wo der Gürtel seiner verwaschenen Jeans Halt gefunden zu haben schien.
Über ihre Schulter hinweg spähte Jacqueline zum Eingang des Cafés, der dunkel und abstoßend wie der Schlund einer Höhle aufklaffte. Im Inneren bemerkte sie kein Lebenszeichen.
»Wo bleibt denn Ihr genialer Kellner?« wollte sie wissen. »Ich könnte einen Kaffee vertragen.«
Das abrupte Gelächter der anderen veranlaßte sie zu einem Stirnrunzeln.
»›Genial‹ ist das treffende Wort!«, rief Andy, der selbsternannte Sprecher der Gruppe, belustigt. »Gino haßt uns. Ich würde es am liebsten unter Fremdenfeindlichkeit verbuchen, aber ich glaube, er kann uns persönlich nicht ausstehen.«
»Deshalb läßt er Sie warten«, sagte Jacqueline gedankenverloren. Dann drehte sie sich schlagartig um und brüllte in einer Lautstärke, die noch einen Straßenzug weiter hörbar war: »Senta!«
Alle außer Michael, der viel zu sehr in Gedanken versunken war, zuckten zusammen. Wie ein heraufbeschworener dienstbarer Geist tauchte Gino im Türrahmen auf. Seine dichten schwarzen Brauen waren zu einem bedrohlichen Stirnrunzeln zusammengezogen, seine aufgedunsenen, unrasierten Wangen gerötet. Die weiße Schürze vor seinem Bauch war mit Kaffee-, Wein- und anderen undefinierbaren Flecken übersät. Jean beschlich der Verdacht, daß ihn reine Neugier und nicht etwa Arbeitseifer ins Freie getrieben hatte, aber niemand hinterfragte seine Motive.
»Un cappuccino, per favore«, erklärte Jacqueline mit dunklem Timbre in der Stimme. Die anderen nutzten Ginos sprachlose Wut aus, um ihre Bestellungen aufzugeben, und schließlich verschwand der Kellner mit finsterem Blick.
»Magnifico«, meinte José bewundernd. »Wo haben Sie das denn gelernt?«
»Zehn Jahre lang war ich als lauteste Mutter im ganzen Viertel bekannt«, bemerkte Jacqueline selbstgefällig. »Meine Kinder kamen schon freiwillig eine halbe Stunde eher nach Hause, damit ich meine berühmt-berüchtigte Stimme nicht einsetzen mußte.«
»Wie viele Kinder haben Sie?« fragte Jean.
»Zwei.«
»Nun? Wollen Sie uns nicht deren Fotos zeigen?« fragte Andy mit einem Blick auf die voluminöse Handtasche zu Jacquelines Füßen. Der unförmige weiße Sack hatte eine entsetzliche Ähnlichkeit mit der Ledertasche, die in M. R. James' schaurigsten Gespenstergeschichten ein grauenvolles Eigenleben führte; Jean rechnete jeden Augenblick damit, daß die Tasche winzige Tentakel ausstreckte, um sich der Fußgelenke der Anwesenden zu bemächtigen.
»Nein. Ich habe auch nicht vor, über die beiden zu reden.«
»Warum nicht?«
»Weil ich«, Jacqueline seufzte, »zwanzig Jahre lang von und mit ihnen geredet habe. Dies ist der erste Sommer, den sie allein verbringen. Ich denke, sie haben meine Erziehung recht gut überstanden, aber ich will nicht über sie sprechen. Wechseln wir das Thema. Wo sind die anderen Mitglieder Ihrer geheimen Verbindung?«
Andy deutete eine dramatische Geste an. »Friede, lasset ab, seht, daß sie kommen«, zitierte er unkorrekt.
Jean schoß durch den Kopf, daß sie diesen Hügel nie wieder so unbefangen hinaufschlendern würde. Für einen kritischen Beobachter war das Café ein günstiger Aussichtspunkt.
Klein, schmächtig und ernst, wirkte Ted mit seiner dicken Brille und dem kurzen Bürstenhaarschnitt wie ein Sechzehnjähriger. Doch die lange weiße Narbe auf seinem Oberarm war das Resultat einer Bajonettverwundung aus dem Sechstagekrieg, und in akademischen Kreisen galt er bereits als Fachmann für Felsengräber. Er war in Israel geboren und folglich ein echter Sabre; sein Vater, ein hochrangiger Regierungsbeamter und einer der Kriegshelden von 1948, lebte in Tel Aviv. Das war alles, was sie über Teds familiären Hintergrund wußten; er redete das Blaue vom Himmel herunter, aber nie über sich selbst.
Für Dana hingegen gab es kaum ein anderes Thema. Nachdem sie sich der Gruppe angeschlossen hatte, erfuhren die anderen in den ersten Wochen so viel über Jagden, Personal und Rasentennis, daß sie mißtrauisch wurden. Schließlich äußerte Andy einen sarkastischen Kommentar hinsichtlich der Oberschicht, und Dana verstand den Wink. Wenn sie sich vergaß, erinnerte ihr Akzent stark an die Beatles – ein waschechter Liverpooler Dialekt, was, wie Jean vermutete, Danas wirkliche Kinderstube verriet.
Irgend jemand hatte Jean gegenüber einmal bemerkt, daß sie und Dana wie Schwestern aussähen: glattes braunes Haar, dunkle Augen, rundliches Gesicht, Stupsnase. Sie hatten in etwa die gleiche Größe von 1,65 Meter, doch Dana wog knapp 10 Pfund mehr als Jean mit ihren 53 Kilogramm. Das hätte ein Pluspunkt für Jean sein können; sie nahm sehr leicht zu und lag im ständigen Kampf mit der italienischen Pasta, einem der für Studenten erschwinglichen Hauptnahrungsmittel. Dennoch mußte sie zugeben, daß Danas Übergewicht an den richtigen Stellen saß.
Während Jean diese Gedanken durch den Kopf gingen, begrüßte sie die Neuankömmlinge und beobachtete höflich lächelnd, wie Dana sich auf einen Stuhl zwischen Michael und Andy zwängte. Gino tauchte mit einem Tablett auf und verteilte die Tassen. Offensichtlich verärgert, knallte er die meisten Tassen mit der gewohnten Ungeschicklichkeit auf den Tisch; doch Jacquelines Cappuccino wurde sorgfältig vor ihr plaziert.
José hob seine Tasse von dem überschwappenden Unterteller. »Meine Tasse hat es wie üblich am ärgsten erwischt«, verkündete er düster. »Mit Sicherheit ist Gino kirchenfeindlich eingestellt. Vermutlich ein Kommunist.«
»Ein Kirchenfeind muß nicht zwangsläufig Kommunist sein«, meinte Ted. »Er muß lediglich logisch denken.«
»Mein Lieblingsgegner«, erklärte der Priester Jacqueline. »Vermutlich ist Ihnen nicht entgangen, daß wir eine überaus tolerante Gruppe sind?«
»Aber natürlich. Katholisch, evangelisch, jüdisch, freidenkend –« Andy verbeugte sich spöttisch.
»Und atheistisch«, fuhr José mit einem Kopfnicken zu Michael fort, der unbeirrt weiterzeichnete.
»Was Ihnen fehlt, ist ein Moslem«, bemerkte Jacqueline.
Andy brach in schallendes Gelächter aus.
»Ich weiß zwar nicht, wer und was Sie sind, Madam, aber Sie stehen wirklich Ihren Mann. Ständig werfen Sie mir neue Spielbälle zu. Aber ich habe mein Pulver verschossen. Alles, was mir zu diesem Thema noch einfällt, ist – haltet die Luft an. Da kommt er.« Jean drehte sich um. Auf halber Höhe in Richtung Café bemerkte sie die Gestalt, auf die Andy deutete.
»Das ist doch bloß Albert«, meinte sie frustriert. »Du bist ein Idiot, Andy.«
»Wer ist denn dieser Albert?« fragte Jacqueline. »Ein weiteres Mitglied der Gruppe?«
»Nein, wie ich Ihnen bereits erklärte, handelt es sich bei uns um eine magische Zahl. Die sieben Sünder.«
»Warum Sünder?«
»Der Begriff stammt von Andy«, erklärte Ted. »Er hält ihn für lustig. Sein Sinn für Humor ist ziemlich unterentwickelt.«
»Aber wir sind doch alle Sünder«, erklärte Andy. »Durch die Bank bedauernswerte Sünder in einer sündhaften Welt. Stimmt's, José?«
Den Blick gen Himmel gerichtet, fluchte der Geistliche lautstark. Unbeirrt fuhr Andy fort: »Albert ist eine der widerwärtigen Prüfungen in unserem Leben. Geduldig ertragen wir dieses Kreuz, weil wir uns zu läutern versuchen. Deshalb wurde uns Albert gesandt. Sollte es uns jemals gelingen, Albert zu lieben, sind wir in der Lage, Gottes gesamte Schöpfung zu lieben.«
Jacqueline rückte ihre Brille zurecht, die ständig von ihrem Nasenrücken herunterrutschte, und starrte auf die schwerfällige Gestalt.
»Was ist denn so schrecklich an ihm? Oder sind Sie einfach nur antimuslimisch eingestellt?«
»Er ist kein Moslem«, entgegnete Ted frostig. »Wie üblich ist Andy unkorrekt. Er ist Maronit – ein libanesischer Christ. Und Andy haben wir seine reizende Anwesenheit zu verdanken – eine weitere Verfehlung in Andys umfangreichem Sündenkatalog. Sie waren Jugendfreunde in Beirut.«
»Freunde, zum Teufel damit«, protestierte Andy. »Vor Jahren unterrichteten sein Alter Herr und mein Alter Herr an der Amerikanischen Universität, und wir beide besuchten dieselbe Schule. Hör auf, mich zu schikanieren, Ted. Albert hätte sich uns selbst dann aufgedrängt, wenn er keinen von uns gekannt hätte. Er ist eben ein widerlicher Kriecher.«
Niemand antwortete. Der Neuankömmling stand vor ihnen.
Jean mußte zugeben, daß Albert nicht nur häßlich, sondern auch unsympathisch war. Diese beiden Eigenschaften sind nicht zwangsläufig gleichzusetzen. Physische Häßlichkeit kann durchaus ansprechend, sogar attraktiv wirken. Sie hatte schon unscheinbarere Männer als Albert kennengelernt – wenn auch nicht viele. Er besaß wirklich nichts Anziehendes.
Fettige schwarze Locken verdeckten einen Teil seiner Stirnglatze. Sein Gesicht war von tiefen Aknenarben gezeichnet. Aufgrund seiner vorstehenden Schneidezähne wirkte seine Oberlippe unglaublich verzerrt; sein konturloses Profil hatte Ähnlichkeit mit dem eines Menschenaffen. Außerdem war er dick – nicht mollig oder untersetzt, sondern regelrecht fettleibig. Genau wie Michael trug er seinen Gürtel auf den Hüften statt um die Taille, doch während die Schwerkraft Michaels Gürtel aufgrund seiner schlanken Erscheinung nach unten zog, schloß Alberts riesiger Bauch jegliches Vorhandensein einer Taille aus. Seine kleinen Schweinsaugen verschwanden beim Lachen zwischen seinen feisten Wangen und den wulstigen Brauen. Die abgewetzte Aktentasche, die er mit sich trug, schien seine Schulter nach unten zu ziehen, so daß sein Gang merkwürdig schleppend wirkte.
Dennoch war es nicht Alberts Aussehen, das ihn abstoßend machte, sondern sein Verhalten. Seine unangenehme Aura war wie Körpergeruch. Insgeheim tat er Jean leid, doch als er einen Stuhl neben den ihren schob und ihr mit seiner schwammigen Hand das Knie tätschelte, mußte sie sich zwingen, ihn anzulächeln, statt wie vor einem Aussätzigen die Flucht zu ergreifen.
Eine von Alberts entsetzlichen, aber auch bemitleidenswerten Eigenschaften war seine Ahnungslosigkeit, wie er auf Menschen wirkte. Schmierig grinsend begrüßte er die Anwesenden. Dann verstaute er sorgfältig die Aktentasche unter seinem Stuhl. Die Schweinsaugen musterten die anderen in der Runde, verweilten am längsten auf Jean und Dana – die mit einem angedeuteten Grinsen reagierte – und entdeckten schließlich Jacqueline.
»Albert Gébara«, stellte er sich vor, wobei er seinem Vornamen die französische Betonung verlieh.
»Angenehm. Ich bin Jacqueline Kirby.«
»Keinesfalls Studentin«, meinte Albert, sie taxierend. »Zu alt, was? Madame ou mademoiselle Kirby? Docteur, peut-être?«
»Schlicht und einfach Jacqueline.«
»Mais non, ce n'est pas bien de parler à une dame d'un certain age –«
Andy stöhnte.
»Unser taktvoller Albert. Du Kretin, weißt du eigentlich nicht, daß es unhöflich ist, auf das Alter einer Dame anzuspielen? Und sprich um Himmels willen Englisch. Das kannst du doch, oder? Wenigstens einigermaßen ... Es ist taktlos, sich in einer Sprache zu artikulieren, die deine Mitmenschen nicht verstehen.«
Alberts Knopfaugen blieben weiterhin auf Jacqueline fixiert.
»Mais vous comprenez francais, vous comprenez fort bien ce que je vous dis –«
»Un peu«, räumte Jacqueline vorsichtig ein.
»Alors. Madame Kirby? Madame la professeur? Madame la –«
»Nein«, erwiderte Jacqueline. »Ich bin keine Dozentin. Ich bin Bibliothekarin.«
»Une bibliothécaire.« Zufrieden nickte Albert. Er stand auf, nahm seinen Stuhl und seine Aktentasche und gesellte sich zu Jacqueline.
Aufgrund des sich daran anschließenden Gesprächs brummte Andy leise: »Gott sei Dank, daß noch jemand der französischen Sprache mächtig ist. Ich war es leid, Alberts einziger Vertrauter zu sein. Allerdings hat seine Gesprächsführung auch Vorteile, er bekommt die gewünschten Informationen. Eine Bibliothekarin! Darauf wäre ich nie gekommen.«
»Wirklich nicht?« Dana machte sich nicht die Mühe, leise zu sprechen. »Männer sind wirklich schlechte Beobachter. Ich habe mir das gleich gedacht. Langweilig, weltfremd, kleinbürgerlich.«
»Im Gegensatz zu dir«, erwiderte Andy. »Der Prototyp der Liebenswürdigkeit – unsere Dana.«
Dana schwieg. Andy war der einzige, der sie empfindlich treffen konnte.
Mittlerweile war Albert zu Höchstform aufgelaufen. Er sprach Englisch; offenbar hatte Jacquelines »dürftiges« Französisch versagt. In Alberts Gegenwart erstarb jegliche Unterhaltung. Seine laute Stimme übertönte die der anderen, und seine ungeheuerlichen Äußerungen zogen seine Zuhörer unwillkürlich in ihren Bann.
»Ich bin Christ, verstehen Sie«, erklärte er einer skeptischen Jacqueline. »Sie glauben vielleicht, daß ich ein dreckiger Moslem bin. Aber ich bin –«
»Nein«, sagte Jacqueline. »Nicht unbedingt.«
Der Sarkasmus entging Albert.
»Kein dreckiger Moslem«, wiederholte er genüßlich. »Guter Christ, wahrer Christ. Ich verehre die Heilige Mutter Gottes und alle Heiligen. Ich kam hierher, ich arbeite, ich studiere, und das alles für diese verflixten Heiligen. Die Kirche hat keine guten Christen. Heute nicht mehr. Sie braucht gute Christen wie mich, um wieder besser zu werden.«
Jacqueline blickte zu José, erhielt jedoch keine Unterstützung von seiner Seite. Der Blick des Priesters wirkte verklärt.
»Sie wollen die Kirche verbessern?« wiederholte Jacqueline. »Inwiefern?«
Anerkennend tätschelte Albert ihr Knie. Dieser Teil der weiblichen Anatomie schien ihm sichtlich am Herzen zu liegen.
»Heilige retten«, erklärte Albert. »Die Kirche sagt nicht – sie sagt – à renoncer les saints. Mais les histoires des saints sont incontestables. Les saints –«
»Das ist ein Tick von ihm«, bemerkte José, unfähig, sich noch länger zu beherrschen. Seine Worte waren unmittelbar an Jacqueline gerichtet, als versuchte er, Alberts Gegenwart zu verdrängen. »Er bezieht sich auf die Revision des Kalenders der Heiligen vor einigen Jahren. Und ich kann ihn nicht davon überzeugen, daß das keine Verwerfung derjenigen Heiligen darstellt, die eliminiert worden sind. Sie werden nach wie vor verehrt. Aber die Legenden–«
»Nein, nein, du befindest dich im Unrecht«, bemerkte Albert mit dem ihm eigenen Taktgefühl – und in einem Englisch, das er auf wundersame Weise optimierte, sobald er eine Beleidigung oder einen Widerspruch ausdrückte. »Du bist dumm. Die Kirche verleugnet – verleugnen ist der zutreffende Begriff – die alten Heiligen. Sankt Christophorus, die heilige Barbara, les autres. Alle echt. Alle wahrhaftig. Ich kann es beweisen. Der Papst irrt sich und ist genauso dumm wie du.«
»Ich gebe es ungern zu, aber ich konnte dem Heiligen Vater nie verzeihen, daß er Christophorus fallengelassen hat.« Michael blickte von seiner Zeichnung auf. Er besaß die verblüffende Angewohnheit, sich plötzlich wieder mit einer Bemerkung einzuschalten, die bewies, daß er eine Diskussion aufmerksam verfolgt hatte. »Eine Woche nachdem er ihn rausgeschmissen hatte, prallte ich mit meinem Motorrad gegen einen Baum.«
Seine Äußerung erzielte die gewünschte Wirkung. Unwillkürlich grinste José und entspannte.
»Ich gebe zu, daß du auf einem Motorrad sicherlich jede nur erdenkliche Hilfe gebrauchen kannst, Michael. Aber die Legendenbildung um diese Heiligen wurde schon seit langem in Frage gestellt. Daran ist auch nichts Verwerfliches, schließlich praktiziert das sogar die Kirche. Die frühen Theologen besaßen nicht das geschichtliche Wissen; sie mißinterpretierten –«
»Nein, nein, nein«, mischte sich Albert ein. »Keine Mißinterpretation. Alles wahr. Gott ist die Wahrheit, die alleinige Wahrheit. Wir kennen die Wahrheit bereits. Aber die Zweifler brauchen Beweise. Ich werde sie finden.«
»Albert«, sagte Andy, »warum hältst du nicht endlich den Mund?«
Albert grinste ihn an. »Ich erbringe Beweise. Sieben heilige Jungfrauen –«
José legte beide Hände auf die Tischplatte, als versuchte er, sie im Auge zu behalten, damit sie keine Gewalttat begingen.
»Es gibt keine sieben heiligen Jungfrauen«, stieß er hervor. »Es gibt Hunderte davon. Oder zweiundvierzig oder neun oder gar keine. Aber nicht sieben. Das ist eine magische Zahl, ein Relikt des Heidentums –«
»Sieben«, wiederholte Albert halsstarrig. »Ich werde es beweisen.«
Er zerrte die sperrige Aktentasche unter seinem Stuhl hervor und machte sich an deren Verschluß zu schaffen.
Andy erhob sich. »Ich klinke mich aus«, verkündete er. »Ich habe genug. Bis dann, Freunde.«
»Ich auch«, sagte Dana. »Heute bin ich nicht in der Stimmung, über Jungfräulichkeit zu diskutieren. Kommst du mit zurück in die Bibliothek, José?«
Einer nach dem anderen standen sie auf, sammelten ihre Sachen ein und machten sich auf den Weg. Albert sprach unermüdlich weiter. Jean war klar, daß er sich den gesamten Weg zurück zum Institut an ihre Fersen hängen und auf sie einreden würde. Er preßte die Aktentasche vor seine feiste Brust und erhob sich.
Jacqueline wandte sich ihm zu.
»Sie können nicht mitkommen«, herrschte sie ihn in demselben Tonfall an, der Gino wie ein Stromschlag getroffen hatte. »Heute habe ich keine Lust mehr, mit Ihnen zu diskutieren. Ein anderes Mal vielleicht. Bleiben Sie hier. Auf Wiedersehen.«
Sie legte Albert eine Hand auf die Schulter und drückte ihn zurück auf seinen Stuhl. Dort saß er mit offenem Mund, während die anderen flüchteten.
Jean fand sich in Begleitung von Jacqueline wieder. Nach einer Weile bemerkte sie, daß jemand leise sang. Es dauerte einen weiteren Augenblick, bis sie erkannte, daß die Geräusche von der zurückhaltenden, vornehmen Person an ihrer Seite stammten. Es handelte sich um das bei den jungen Radikalen so beliebte Musikstück »The Times They Are a-Changing«.
»The battle outside rages‹«, summte Jacqueline. Als sie Jeans Blick bemerkte, brach sie ab und fragte zuckersüß: »Stört Sie das?«
»Warum sollte mich das stören?«
»Meiner Tochter war es immer peinlich. Im Alter von 12 bis 17 Jahren ging sie in der Öffentlichkeit nie neben mir her.«
»Aber Sie haben doch nicht ständig gesungen, oder?« fragte Jean, die das mittlerweile stark annahm.
»Nein, aber sie wußte nie, wann ich loslegen würde. Weihnachten war es am schlimmsten. Ich liebe Weihnachtslieder.«
»Und Bob Dylan?«
»Und die Märsche der Heilsarmee, deutsche Volkslieder und die Hits aus den 40er Jahren. Ich kenne sämtliche Texte. Ich weiß«, fuhr Jacqueline voller Stolz fort, »so viel nutzlosen Kram, daß es fast unvorstellbar ist.«
»Nicht alles davon ist nutzlos. Albert, beispielsweise, haben Sie elegant abserviert.« Jean betrachtete Jacquelines strenges Profil, bemerkte den belustigten Ausdruck in dem für sie sichtbaren grünen Auge und sagte ohne vorherige Überlegung: »Ich kann Sie einfach nicht einschätzen. Wie viele Persönlichkeiten verkörpern Sie eigentlich?«
»So naiv können Sie doch nicht mehr sein«, meinte Jacqueline tadelnd. »Ist Ihnen nicht bewußt, daß jeder Mensch mindestens ein Dutzend andere Personen verkörpert? Ich genieße diesen Sommer und lasse sie alle raus, wie Michael sagen würde. Wenn ich arbeite, bin ich nicht so schizophren.«
Vor den Toren des Instituts blieb die Gruppe stehen. Als Jean sich umdrehte, bemerkte sie, daß José hinter ihnen gegangen war und ihr Gespräch mit angehört hatte. Seine dunklen Augen blickten Jacqueline an.
»Sie haben soeben eine tiefe Wahrheit ausgesprochen«, sagte er.
»Über die Schizophrenie?« Jacqueline blieb ernst.
»Über die Komplexität der Persönlichkeit. 50 Prozent aller Beziehungsprobleme resultieren aus der Erwartungshaltung, daß sich der Mensch auf ein eindimensionales Verhaltensmuster beschränkt. Aber wir alle sind Ungeheuer mit den Köpfen einer Hydra. Was die meisten Menschen allerdings nie begreifen werden.«
Abrupt nickend entfernte er sich mit flatternden Rockschößen. Nach einem halbherzigen Abschiedsgruß rannte Ted hinter ihm her. Die anderen blieben unschlüssig stehen.
»Kommen Sie mit, Jake«, lud Andy sie ein. »Vielleicht brauchen wir Sie, wenn Albert erneut aufkreuzt.«
»Ich«, sagte Jacqueline, den Spitznamen übergehend, »nehme das Mittagessen mit Ihrer Erzfeindin, der geschätzten Institutsbibliothekarin, ein. Sie haßt es, wenn man sie warten läßt, und ich bin bereits spät dran.«
»Eine Freundin von Ihnen?« fragte Andy skeptisch.
Jacquelines Mundwinkel zuckten. »Sie sieht nur eine meiner zahllosen Facetten. Das paßt zu ihr–ehrwürdig, steif und leidenschaftlich interessiert an den Schwachstellen des Dezimalsystems von Dewey.«
»Andy sollte sich leidenschaftlich für die römische Archäologie interessieren«, sagte Ann ungnädig. »Komm, mein Junge. Vater reist nächste Woche an, und bis dahin sollte deine Ausarbeitung für das Fellowship-Komitee besser fertiggestellt sein.«
»Verdammt richtig«, gestand Andy seufzend. »Und wenn meine Arbeit keine Gnade findet, wird mein Stipendium nicht verlängert, und dann bringt mich der nette alte Herr um.«
»Euer Vater kommt?« Dana riß die Augen auf. »Wahnsinn! Ich muß ihn einfach kennenlernen, Andy. Er ist die schillerndste Figur auf unserem Sektor.«
»Und schillernde Archäologen sind selten«, bemerkte Jean trocken. »Er ist ein begnadeter Wissenschaftler. Das Foto, wo er im Iran an einem Seil über dem Felsen baumelt ...«
»Großspurig ist er«, brummte Andy. »Die Behistun-Inschriften sind schon Hunderte Male kopiert worden. Was Sam da veranstaltet hat, war reine Angeberei.«
»Und der Arbeiter, den er vor dem Steinschlag gerettet hat?« wollte Jean wissen. »War das auch Angeberei?«
»Und das Buch über präattische Töpferkunst?« wandte Dana ein.
»Schon gut, wie ich sehe, seid ihr alle Mitglieder seines Fanclubs. Ich werde ein abendliches Treffen arrangieren ... He, das ist eine gute Idee. Wir werden eine Party feiern, und ihr Fans könnt euch um ihn scharen und für seine Zerstreuung sorgen, Er braucht Publikum wie manche Leute Insulin. Sonst fällt er ins Koma.«
»Hört nicht auf ihn«, meinte Ann, nervös kichernd. »Im Grunde genommen hält er Sam für großartig. Komm jetzt, Bruder. An die Arbeit. A-R-B-E-I-T. Sagt dir das was?«
Arm in Arm schlenderten sie davon, und Michael, der sie beobachtete, meinte gedehnt: »Die beiden haben irgendwas Allegorisches.«
»Die Schöne und das Biest«, schlug Dana kichernd vor. »Oder wie wär's mit Orest und Elektra? Das ist doch ein nettes und ganz normales Bruder-Schwester-Gespann für dich.«
Michael versetzte ihr einen Klaps auf ihr Hinterteil, der den Nachhall eines Pistolenschusses besaß. Sie kreischte. Jean, die unter Jacquelines zynischem Blick weitere Ausschreitungen vermeiden wollte, bemerkte beiläufig: »Wie wär's mit den Bobbsey-Zwillingen? Ich kann mir ihre Namen nie merken –«
»Nan und Bert«, erwiderte Jacqueline. »Das reicht jetzt. Was für Lästermäuler ihr doch seid ... Michael, lassen Sie mich doch mal die Zeichnung sehen, die Sie von mir angefertigt haben.«
»Huch?« Michael wich zurück und umklammerte seinen Skizzenblock. »Einen Teufel werde ich tun.«
»Zweifellos. Geben Sie sie mir.«
Schulterzuckend gehorchte Michael. Mit gerunzelter Stirn betrachtete Jacqueline das Blatt. Jean konnte nicht anders, sie spähte Jacqueline über die Schulter.
Michael hatte nicht nur eine Skizze angefertigt; das Papier war mit winzigen Figuren bedeckt: Jacqueline, hingegossen auf dem Boden des Instituts, wie eine Marmorstatue auf einem Sargrelief; Jacqueline mit erhobenem Zeigefinger und vorwurfsvoll geöffneten Lippen; Jacqueline, ziemlich idiotisch über den Rand ihrer Brille spähend; Jacqueline mit Helm und Harnisch von Minerva ausstaffiert; Jacqueline, wie Gott sie schuf, in der klassischen Pose einer römischen Venus.
Dana gab gurgelnde Geräusche unterdrückter Belustigung von sich, doch Jean fand die Zeichnung keineswegs lustig, auch wenn die einzelnen Porträts wunderschöne Karikaturen darstellten. Michael mochte Jacquelines Bemerkungen über vielschichtige Persönlichkeiten gehört haben, doch die Zeichnung war bereits vor besagter Unterhaltung fertiggestellt gewesen. Gelegentlich zeugten Michaels Impressionen von erschreckendem Scharfsinn. Immer wieder hatte er seine sämtlichen Freunde gezeichnet. Dana war sein bevorzugtes Opfer, was auch erklärte, weshalb sie die Bloßstellung eines weiteren Opfers so erheiterte.
Schließlich gab Jacqueline das Blatt zurück und fixierte Michael mit einem langen, durchdringenden Blick. Ihr Gesichtsausdruck wirkte weder belustigt noch beleidigt. Als sie sprach, war Jean klar, daß sie nicht zum Scherzen aufgelegt war.
»Sie haben Glück, daß Sie in diesem Jahrhundert leben, Michael. Vor fünfhundert Jahren hätte man Sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und ich hätte im Publikum gesessen und das Feuer geschürt.«
Kapitel 2
Am folgenden Tag sah sich Jean einem der überaus seltenen Anfälle von Arbeitseifer ausgesetzt. Sie recherchierte mit grimmiger Entschlossenheit und widerstand allen Versuchungen durch ihre Freunde. Da die Institutsbibliothek zu den wenigen Orten in Rom zählte, die amerikanische Öffnungszeiten einhielten, konnte sie vom frühen Morgen bis abends um acht arbeiten. Etwa um diese Uhrzeit passierte eine Woche später das Unvermeidliche. Als sie vor einem Blatt Papier saß und erschöpft den Text studierte, kamen ihr die Worte plötzlich so unverständlich wie Hieroglyphen vor. Ihr Magen knurrte entsetzlich, und ihr Kopf schien losgelöst von ihrem Körper im freien Raum zu schweben.
Jean schob ihre Unterlagen zu einem unordentlichen Stapel zusammen und verließ ihr Büro. Sie war ausgehungert, sehnte sich jedoch nicht nur nach etwas Eßbarem, sondern wollte Geselligkeit, lachen und sich unterhalten, ein Glas Wein, einen riesigen Teller Spaghetti Bolognese, zwölf Stunden Schlaf und ein Bad nehmen – und das nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Keiner dieser verständlichen Wünsche schien spontan realisierbar. Die nächste Trattoria war etwa einen Kilometer entfernt, und ihre sämtlichen Freunde schienen sich in Luft aufgelöst zu haben.
Als sie sich der Treppe näherte, sprang eine der Bürotüren auf. Jean blieb stehen. Der Flur war nur schwach beleuchtet, doch sie erkannte die bronzefarbene Haarpracht und die voluminöse Handtasche. Seit sie die Tasche das letztemal gesehen hatte, schien sie noch schwerer und ausladender geworden zu sein, und sie überlegte, welche widersinnigen Gegenstände mittlerweile hinzugekommen waren.
»Guten Abend«, sagte Jacqueline Kirby. »Sie wirken wie ein Häufchen Elend. Wie geht es Ihnen?«
»Hervorragend.« Das hatte wie ein wenig überzeugendes Krächzen geklungen, und Jean räusperte sich. »Ich bin schlicht und einfach hungrig. Ich arbeite seit ... Welcher Tag ist eigentlich heute?«
»Freitag. Ich weiß, daß Sie gearbeitet haben; ich habe Sie beobachtet.« In Jacquelines Stimme schwang eher Neid als Mitgefühl mit. »In Ihrem Alter konnte ich das auch noch. Das und eine ganze Menge anderer Dinge, zu denen ich heute nicht mehr in der Lage bin ... Soll ich Sie nach Hause fahren? Oder sind Sie auf dem Weg zu Andy?«
»Mir geht es hervorragend«, wiederholte Jean vage. Sie dachte an den letzten von ihr verfaßten Absatz. Dann wurde die allgegenwärtige Aura der Wissenschaft schlagartig von einer Tatsache verdrängt.
»Andy? Andys Party! Für seinen Vater ... Ist er schon gegangen?«
»Wer? Wohin?«
»Andy. Er war den ganzen Nachmittag in seinem Büro.«
»Er ging um fünf, um sich auf die Party vorzubereiten.«
»Ja, die Party.« Jean schüttelte sich. »Gütiger Himmel, bin ich erledigt! Ich muß mich beeilen. Verflucht. Ich sehe aus wie ... Wie spät ist es?«
»Beruhigen Sie sich. Die Party beginnt um neun, folglich wird es erst gegen zehn Uhr interessant. Ihnen bleibt noch genug Zeit, um die Spuren Ihrer Arbeitskonzentration zu beseitigen.«
»Wie steht's mit Ihnen?« Jean schüttelte den Kopf. »Heute abend erzähle ich wirklich einen Haufen Unsinn. Ich meine, Sie sehen großartig aus. Sie brauchen sich nicht –«
»In meinem Alter kann ich ohnehin nicht mehr viel für mich tun«, bemerkte Jacqueline betrübt. »Trotzdem sollte ich vermutlich einen Versuch wagen ... Wollen Sie nun mitfahren oder nicht?«
Als Jean das Zwinkern in ihren Augenwinkeln bemerkte, entspannte sie. »Vielen Dank. Wenn es für Sie kein Umweg ist, gern. Ich wußte gar nicht, daß Sie ein Auto haben.«
»In den letzten Tagen ist Ihnen einiges entgangen. Während Ihres Arbeitsrauschs ist meine Freundin Frau Hilman in Urlaub gefahren und hat mir ihr Auto und ihre Wohnung überlassen.«
»Angenehm, solche Freunde zu haben.«
»Sie hat mir auch ihre Perserkatze, ihren rosafarbenen Pudel und ihr Meerwasseraquarium anvertraut. Die Katze mußte ich bereits mehrfach vom Aquarium verscheuchen, dem Pudel bereite ich tagtäglich sein Gourmetmenü zu, und langsam frage ich mich, ob ich wirklich einen guten Handel eingegangen bin.«
Sie traten aus dem Gebäude in die laue, diesige römische Abendluft, und Jean nahm einen tiefen, befreienden Atemzug.
»Das Auto steht da hinten«, erklärte Jacqueline. Sie zögerte und fuhr dann beinahe widerwillig fort: »Haben Sie nicht Lust, mit zu mir zu kommen, und ich mache uns Rührei oder irgendeine Kleinigkeit? Es gibt auch eine Dusche. Ich möchte nicht wie eine Fernsehwerbung klingen, aber ich habe selbst lange genug in Studentenunterkünften gehaust und kenne die winzigen Waschecken in diesen Zimmern, die in den meisten Fällen nur über zwei Kaltwasserhähne verfügen.«
»Das ist sehr nett von Ihnen«, erwiderte Jean.
»Oh, nett ist in meinem Fall genau das zutreffende Wort«, bekräftigte Jacqueline sarkastisch. Sie ließ die Zündung an und wurde mit einem schnarrenden Motorengeräusch belohnt. Verunsichert trat sie auf das Gaspedal; das Geräusch verwandelte sich in ein lautes Aufheulen. »Ich hasse diesen Wagen«, knurrte sie. »Ich hasse es, in Rom Auto zu fahren.«
»Warum tun Sie es dann?«
»Reiner Masochismus. In Neuengland bezeichnen wir das als Selbstdisziplin, aber es läuft auf das gleiche hinaus.« Sie fädelte den Wagen in den dichten Verkehr ein und entspannte zusehends. »Glücklicherweise befinden sich das Institut und das Apartment auf dieser Seite des Flusses. Wenn ich mich auch noch durch das Straßengewirr der Altstadt manövrieren müßte, würde ich ausrasten.«
»Sind Sie sicher, daß ich mitkommen soll?« vergewisserte sich Jean.
»Warum nicht?«
Keine unbedingt aufschlußreiche Antwort, dennoch wirkte Jacquelines Tonfall beruhigend auf Jean.
»Können wir kurz bei mir anhalten, damit ich mir saubere Sachen hole? Ich wohne in der Nähe der Via di San Pancrazio.«
»Selbstverständlich.«
Innerhalb von drei Minuten kehrte Jean zurück. Ihre Fahrerin warf ihr einen anerkennenden Blick zu.
»Das ging aber schnell.«
»Ich hatte ohnehin nur noch ein sauberes Kleid.«
Auf ihrer weiteren Wegstrecke verfuhren sie sich lediglich ein einziges Mal, was Jacqueline zu undamenhaften Flüchen verleitete und wodurch sie sich im Gegenzug einen anerkennenden Blick von Jean einhandelte.
»Sie klingen überhaupt nicht wie eine Bibliothekarin«, stellte sie fest.
»Ich bin im Urlaub.« Jacqueline lachte. »Nun, vermutlich bringt man damit eine ganz bestimmte Vorstellung in Verbindung, nicht wahr? Doch Stereotypen sind hochgradig irreführend. Es gibt typische Bibliothekare, aber nicht alle Bibliothekare sind typisch für ihren Berufsstand. Nicht mehr und nicht weniger als in allen anderen Berufen.«
»Wie beispielsweise der Archäologie«, bekräftigte Jean. »Wie ich gehört habe, soll Dr. Scoville eher untypisch sein.«
»Ach ja? Der umtriebige Anthropologe gehört zu einer Unterordnung des allgemeingültigen Klischees. Das Elfenbeinturm-Image stört einige Wissenschaftler; sie müssen beweisen, daß sie
mitten im Leben stehen und sich in aktuellen Fragen ebenso auskennen wie in ihrem Fachgebiet.«
»Ich denke nicht, daß Dr. Scoville irgend etwas zu beweisen versucht.«
»Ach, meine Liebe. Ich greife einen Ihrer Helden an«, meinte Jacqueline honigsüß. »Oberflächlich betrachtet scheint er alles zu besitzen – eine erotische Ausstrahlung, Attraktivität, berufliche Reputation, gesellschaftliche Akzeptanz. Aber im Grunde genommen ist er auch nur ein Mensch, der nach dem Genuß von Zwiebeln vermutlich mit Blähungen zu kämpfen hat und seinen Bauch einziehen muß, wenn er sich im Spiegel betrachtet. Das würde auch sein Draufgängertum erklären, das für mich zugegebenermaßen gelegentlich an Exhibitionismus grenzt.«
Verblüfft beobachtete Jean das Profil ihrer Begleiterin, die ganz gelassen wirkte.
»Ich glaube nicht, daß ich schon jemals etwas so Zynisches gehört habe.«
»Sie sind noch jung.«
Jacqueline lenkte den Wagen in eine dunkle, enge Seitenstraße, die zu beiden Seiten von hohen Mauern eingefriedet wurde. Sie schaltete das Abblendlicht ein; auf den breiten, hell erleuchteten Straßen war sie lediglich mit dem in Rom vorgeschriebenen Standlicht gefahren. »Ich glaube, hier war ich noch nie«, bemerkte Jean.
»Das ist die alte Via Aurelia«, erklärte Jacqueline. Als ihnen ein Auto mit hoher Geschwindigkeit entgegenbrauste, kreischten beide, doch zu ihrem beiderseitigen Erstaunen passierte sie das Fahrzeug ohne jeglichen Blechschaden. »Sie ist schwer befahrbar; ich würde am liebsten die Mauer hochklettern, wenn mir ein Wagen entgegenkommt., Aber allein der Name fasziniert mich.«
»Ich bin ja schon froh, daß Sie nicht zu den hartgesottenen Zynikern gehören.«
»Nur im Umgang mit Menschen lege ich einen gewissen Zynismus an den Tag. Plätze und Gegebenheiten erfüllen mich immer noch mit schwärmerischer Romantik. Ein Anzeichen auf das reifere Alter, wenn Sie so wollen.«
Die Mauern wichen neuen Apartmentanlagen; die Straße wurde breiter, und die Romantik nahm ein Ende. Jacqueline bog noch mehrmals ab, steuerte den Wagen durch ein Gewirr von Seitenstraßen und schließlich in einen schmalen Eingang mit dem Hinweis »Privat«. Dort befand sich eine kleine Pförtnerloge; ein portiere trat ins Freie, erkannte das Fahrzeug und wandte sich erneut seinem Abendessen zu.
»Wahnsinn«, entfuhr es Jean. »Ich wußte gar nicht, daß Bibliothekare so gut bezahlt werden.«
Die Durchfahrt führte zu einem der Apartmentkomplexe, wie sie in den römischen Vororten mittlerweile üblich waren. Die einzige Zufahrt, die auch sie genommen hatten, wurde von einem Pförtner bewacht, der fahrende Händler und ungeladene Gäste abwimmelte. Im Gegensatz zu den riesigen Hochhäusern mit ihren preiswerten Wohnungen bestand dieser Komplex aus nur vier Apartments pro Gebäude, und diese lagen verstreut in einer ansprechenden Parklandschaft. Selbst das armseligste römische Apartment besitzt einen Balkon; diese hier hatten fünf oder sogar sechs. Während sie entlang der Immergrünhecken und Azaleenbüsche über den Privatweg fuhren, bemerkte Jean, daß die diffuse Beleuchtung im Zentrum der Wohnanlage einen riesigen Swimmingpool überstrahlte, dessen Wasser türkisfarben schimmerte.
»Wahnsinn«, meinte sie erneut.
»Das ist tatsächlich Wahnsinn.« Jacqueline steuerte den Wagen in eine Parkbucht neben einen tiefergelegten Sportwagen und eine Cadillac-Limousine. »Geben Sie sich keinen falschen Illusionen hin. Zusätzlich zu ihrem Gehalt besitzt Lise Privatvermögen. Kommen Sie; Sie haben noch nicht alles gesehen.«
Das Gebäude verfügte über einen Fahrstuhl, der erst reagierte, nachdem Jacqueline einen Schlüssel ins Schloß gesteckt hatte. Als die Aufzugtür sich erneut öffnete, befand man sich unmittelbar in der Empfangshalle des Apartments. Dieser Raum war größer als Jeans Schlafzimmer und hatte einen Marmorboden. Marmor bedeckte auch den Boden des salone beziehungsweise des Wohn-Eßbereichs, der die gesamte Vorderseite des Gebäudes einnahm. Eine Wand bestand komplett aus Fenstern mit zwei integrierten Schiebetüren, die auf den langen Frontbalkon hinausführten. Durch das Glas sah Jean Unmengen von Pflanzen; Blumenkästen mit Geranien, Bleiwurz und Rosen umsäumten die Balkonbrüstung. Darunter schimmerte der aquamarinblaue Pool wie ein kostbarer Edelstein.
Vollkommen überwältigt folgte Jean ihrer Gastgeberin in den Raum, der mit Orientteppichen und gediegenen Rokokomöbeln ausgestattet war. Das bewegliche Inventar dieses Panoptikums erwartete sie bereits. Die Katze, eine Kugel aus silbergrauem Fell, blinzelte sie aus grünen Augen an, blieb jedoch auf dem Brokatsofa liegen. Der Pudel war tatsächlich rosa. Unter schrillem Gebell machte er einen Satz über den Teppich in Richtung von Jeans Knöcheln.
»Nein, Prinz«, warnte Jacqueline mit fester Stimme.
Der Hund überschlug sich, und seine winzigen Pfoten ruderten in der Luft. Ein rosafarbenes Band, das einen Ton dunkler war als sein Fell, zierte sein Haarkrönchen.
»Der arme kleine Kerl«, sagte Jean und beugte sich vor, um ihm den Bauch zu kraulen. »Warum wirken Pudel nur immer so mitleiderregend auf mich?«
»Eigentlich ist er ein netter kleiner Bursche«, meinte Jacqueline; der Pudel winselte und leckte Jeans nackte Zehen. »Die meisten Leute neigen dazu, sie wie Spielzeuge und nicht wie Hunde zu behandeln, deshalb sind sie so bemitleidenswert. Im Gegensatz zu Nefertiti dahinten; sie hat hier das Sagen, und das weiß sie ganz genau.«
Die Katze blinzelte erneut. Ihr Gesichtsausdruck zeugte von Todesverachtung.
Nachdem Jean geduscht hatte, fand sie Jacqueline in der Küche vor. Der Pudel lag jaulend zu ihren Füßen und bettelte. Nefertiti saß auf dem Tisch. Als sich Jacqueline an den Tisch setzte, befand sie sich in Augenhöhe mit der Katze, und der Gesichtsausdruck von Mensch und Tier war so ähnlich, daß Jean nicht anders. konnte, als laut loszuprusten.
»Ruhe«, bemerkte Jacqueline, ohne ihr Gesicht abzuwenden. »Ich versuche, sie aus der Fassung zu bringen.«
Dann fiel Jeans Blick auf die Flasche. Es war dieselbe kleine grüne Flasche, die sie schon einmal gesehen hatte. Daneben lag eine Pipette.
»Es ist tatsächlich für die Katze«, entfuhr es ihr.
»Das hatte ich doch zum Ausdruck gebracht, oder? Es handelt sich um ein Stärkungsmittel, und Lise schwört darauf. Ich persönlich glaube eher, daß diese Katze Beruhigungsmittel statt Vitaminen braucht, aber ... Schauen Sie, würde es Ihnen etwas ausmachen, ihre Hinterläufe festzuhalten?«
Der Kampf wäre vermutlich lustig gewesen, wenn er nicht so schmerzhaft verlaufen wäre. Jean trug zwei blutende Kratzer auf ihrem Oberarm davon, und Jacqueline war von Kopf bis Fuß mit grünen Spritzern übersät. Die Katze zog sich fauchend zurück, was einen grünen Sprühnebel zur Folge hatte, woraufhin Jacqueline eine Reihe von Verwünschungen in Richtung ihres pelzigen Hinterteils zischte. Sie fütterte den Hund und streute Fischfutter in das Aquarium im salone. Dann wandte sie sich mit einem gequälten Seufzen der Zubereitung der Rühreier zu.
Es gab Rührei mit Schinken, dazu Salat und frische Brötchen mit Weichkäse aus kleinen Papptöpfchen. Das Duschvergnügen hatte Jeans Appetit noch gesteigert. Erst als sie ihren Teller restlos geleert hatte, schnappte sie nach Luft und entschuldigte sich für ihre Gefräßigkeit.
»Noch einen Kaffee?« fragte Jacqueline.
Jean blickte auf ihre Armbanduhr. »Müssen wir denn nicht aufbrechen?«
»Es besteht kein Grund zur Eile.« Jacqueline erhob sich und füllte zwei Kaffeetassen, die sie zum Tisch brachte. »In den letzten Tagen haben Sie nicht sonderlich viel mitbekommen, nicht wahr?«
»Warum? Ist irgendwas passiert?«
»Ja und nein. Vielleicht ist es auch nur meine übersteigerte Einbildungskraft.« Jacqueline seufzte. »Ich war immer sehr gewissenhaft, wenn es um Abschlüsse oder gute Schulleistungen ging. Aber mittlerweile frage ich mich, ob Ihre Freunde nicht recht haben, wenn sie sich über den akademischen Druck beklagen. Bedeutet Ihnen die Verlängerung Ihres Stipendiums denn wirklich so viel? Damit meine ich nicht nur Sie, sondern auch die anderen.«
»Nicht unbedingt«, meinte Jean gedehnt. »Genaugenommen bin ich die einzige, die davon abhängig ist. Michael ist es völlig egal; er ist so abgehoben, daß ihn nichts aus der Ruhe bringen kann. Er würde in einer Höhle wohnen, wenn sie über entsprechende Lichtverhältnisse verfügte. Haben Sie seine Behausung gesehen?«
»Nein.«
»Nun, es ist das entsetzlichste Rattennest ... Er hat die Wohnung allein wegen des Oberlichts genommen. Im Winter gefrieren Eisblumen auf den Fenstern, und im Sommer verwandelt sich sein Zimmer in eine Sauna. Um frische Luft zu bekommen, muß er das Oberlicht offenlassen; das Dach ist ein Tummelplatz für kleinere Kinder, flirtende Halbwüchsige und Scharen verwilderter römischer Katzen. Wenn die Kinder nicht gerade irgendwelche Frechheiten durch das Dachfenster brüllen, erledigen die Katzen ihre Notdurft darauf, oder irgendein Fellcasanova stürzt nach unten. Im übertragenen Sinne. Ein völlig verstörtes Kind ist eines Nachts wirklich durch das Fenster gefallen und geradewegs auf Michaels soeben fertiggestelltem Gemälde gelandet, das noch nicht trocken war ... Ich weiß, das alles klingt verdammt lustig, aber das witzigste ist, daß Michael es nicht einmal bemerkt. Sicher, er bemerkte den Jungen, der auf sein Bild gestürzt war, aber nur, weil er es verschmiert hatte. Wieso ihm da ein Unterschied aufgefallen ist, ist mir ohnehin rätselhaft!«
»Er gehört also zu den abstrakten Malern?« fragte Jacqueline lachend.
»So könnte man es nennen. Ich habe noch nicht viele seiner Arbeiten gesehen. Er tut immer sehr geheimnisvoll, wenn jemand sein Werk betrachten will. Er behauptet von sich, daß er Kritik verabscheut. Und das stimmt auch. Er hat einen Studienplatz bei Professor Lugetti, aber er läßt nicht zu, daß dieser Mann seine Gemälde begutachtet. Michael arbeitet in einem Studio am Institut. Alle paar Wochen dreht Lugetti durch und erkämpft sich mit Gewalt Zugang zu diesem Studio, und dann hört man ihre Auseinandersetzung durch das ganze Gebäude. Sie stehen da und schreien sich eine Stunde lang ununterbrochen an, bis Lugetti ausrastet und ihn mit italienischen Schimpftiraden überhäuft, woraufhin Michael außer sich vor Wut mit englischen Flüchen reagiert.«
»Lugettis Temperament ist bereits Legende«, meinte Jacqueline. »Es überrascht mich, daß er Michael nicht einfach vor die Tür setzt.«
»Das ist ja das Komische daran. Er behauptet, daß Michael der begnadetste Künstler seit Monet ist.«
»Das klingt zugegebenermaßen wirklich nicht so, als sei Michael der sorgenvolle Typ. Wie steht's mit den anderen?«
»José, Ted und Dana sind keine Stipendiaten. Vermutlich haben sie mit anderen Problemen zu kämpfen – wer hat das nicht? –, aber die Verlängerung des Stipendiums läßt sie kalt.«
»Beziehen sie denn keinerlei studentische Unterstützung?«
»Dana spricht nur ungern über ihre finanzielle Situation; ich denke, sie bekommt Geld von ihrer Familie.«
»Und José wird von seinem Orden unterstützt?«
»Orden?«
»Er ist doch Jesuit, oder?«
»Genau. Deshalb muß er sich um Geld keine Gedanken machen, nicht wahr?«
»Nein, vermutlich nicht. Sicherlich nicht um Geld ... Und Ted?«
»Es ist verrückt«, bemerkte Jean stirnrunzelnd, »aber über solche Dinge reden wir nie ... Ich schätze, daß er eine staatliche Förderung oder etwas Ähnliches bewilligt bekommen hat. Aber ich werde das Gefühl nicht los, daß er mit persönlichen Problemen zu kämpfen hat. Er redet fast nie über sich, ist in seiner Heimat allerdings mit einem Mädchen verlobt. Als wir uns kennenlernten, erwähnte er sie gelegentlich. Zeigte uns ihr Foto und so. In letzter Zeit hat er nicht mehr von ihr gesprochen. Wen haben wir noch? Ach ja, die Goldstaub-Zwillinge.«
»Nennt ihr sie so? Ich hätte gar nicht gedacht, daß sich noch einer von euch an den alten Werbegag erinnert.«
»Ann hat den Begriff erwähnt. Ich denke, daß ihr die enge Beziehung zu ihrem Bruder Selbstvertrauen vermittelt. Sie sehen ohnehin wie Zwillinge aus, obwohl sie ein Jahr älter ist als Andy.«
»Ist es nicht ungewöhnlich, daß Bruder und Schwester im gleichen Jahr Stipendiaten des Instituts sind?«