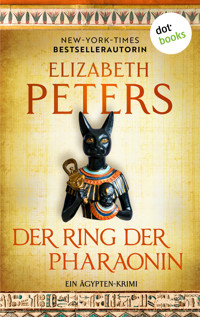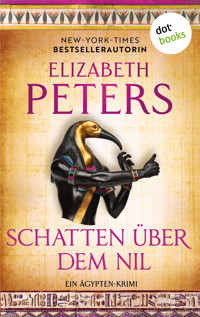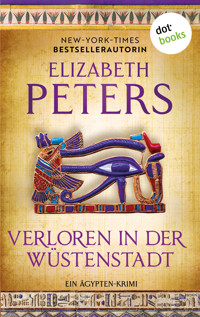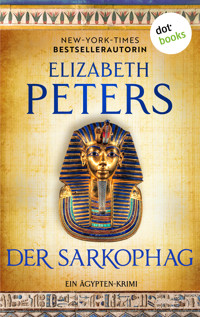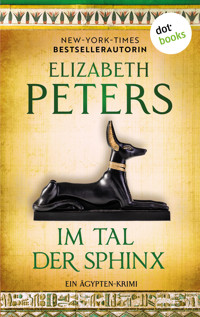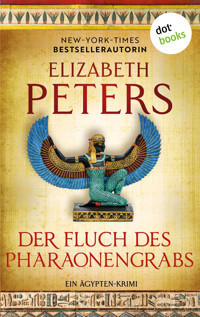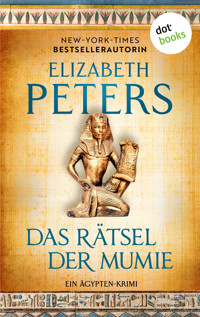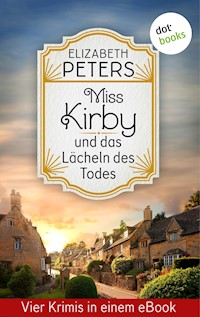6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Vicky Bliss
- Sprache: Deutsch
Der Kunsträuber und die Meisterdetektivin: Der Kriminalroman »Vicky Bliss und die Hand des Pharaos« von Elizabeth Peters als eBook bei dotbooks. Ein aufsehenerregender Kunstraub – und nur eine, die den Fall lösen kann … Als die überaus wertvolle Mumie von Tutanchamun aus einem ägyptischen Museum gestohlen wird, gerät die Kunstexpertin Vicky Bliss zwischen die Fronten: Einziger Verdächtiger ist ihr Freund John – schließlich hat der gefährliche Charmeur einen Ruf als meisterhafter Kunstdieb. Die Beschreibung des Täters passt genau auf ihn – aber trotzdem ist Vicky von seiner Unschuld überzeugt. Sie reist ins Land der Pyramiden und Pharaonen, um sie auch zu beweisen. Es ist der Auftakt einer atemlosen Jagd nach dem wahren Täter – doch er scheint Vicky besser zu kennen, als sie glaubt … »Eine großartige Erzählerin!« Mary Higgins Clark Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Krimi-Highlight »Vicky Bliss und die Hand des Pharaos« von Elizabeth Peters – das spannende Finale der Bestseller-Reihe um die Kunsthistorikerin mit dem Gespür für mörderische Fälle. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein aufsehenerregender Kunstraub – und nur eine, die den Fall lösen kann … Als die überaus wertvolle Mumie von Tutanchamun aus einem ägyptischen Museum gestohlen wird, gerät die Kunstexpertin Vicky Bliss zwischen die Fronten: Einziger Verdächtiger ist ihr Freund John – schließlich hat der gefährliche Charmeur einen Ruf als meisterhafter Kunstdieb. Die Beschreibung des Täters passt genau auf ihn – aber trotzdem ist Vicky von seiner Unschuld überzeugt. Sie reist ins Land der Pyramiden und Pharaonen, um sie auch zu beweisen. Es ist der Auftakt einer atemlosen Jagd nach dem wahren Täter – doch er scheint Vicky besser zu kennen, als sie glaubt …
»Eine großartige Erzählerin!« Mary Higgins Clark
Über die Autorin:
Hinter der US-amerikanischen Bestsellerautorin Elizabeth Peters steht Barbara Louise Gross Mertz (1927–2013), die auch unter dem Pseudonym Barbara Michaels erfolgreich Krimis und Thriller schrieb. Die Autorin promovierte an der University of Chicago in Ägyptologie. So haben auch ihre über 20 Kriminalromane, für die sie zahlreiche Preise gewann, meist einen historischen Hintergrund.
Die Krimireihe um Vicky Bliss bei dotbooks umfasst: »Vicky Bliss und der geheimnisvolle Schrein – Der erste Fall« »Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde – Der zweite Fall« »Vicky Bliss und der blutrote Schatten – Der dritte Fall« »Vicky Bliss und der versunkene Schatz – Der vierte Fall« »Vicky Bliss und die Hand des Pharaos – Der fünfte Fall«
Ebenfalls bei dotbooks erscheint die Krimireihe um die abgebrühte Meisterdetektivin Jacqueline Kirby: »Der siebte Sünder: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 1« »Der letzte Maskenball: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 2« »Ein preisgekrönter Mord: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 3« »Ein todsicherer Bestseller: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 4«
Unter dem Pseudonym Barbara Michaels veröffentlichte sie bei dotbooks die folgenden Romantic-Suspense-Romane:»Das Geheimnis von Marshall Manor«»Die Villa der Schatten«»Das Geheimnis der Juwelenvilla«»Die Frauen von Maidenwood«»Das dunkle Herz der Villa«»Das Haus des Schweigens«»Das Geheimnis von Tregella Castle«»Die Töchter von King’s Island«
Sowie ihre historischen Liebesromane: »Abbey Manor – Gefangene der Liebe«»Wilde Manor – Im Sturm der Zeit«»Villa Tarconti – Lied der Leidenschaft«»Grayhaven Manor – Das Leuchten der Sehnsucht«
***
eBook-Neuausgabe Januar 2019
Dieses Buch erschien bereits 2010 unter dem Titel »Die Hand des Pharaos« bei Weltbild.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2008 by MPM Manor, Inc.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »The Laughter of Dead Kings« bei William Morrow, New York.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2010 by Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Published by Arrangement with BARBARA G. MERTZ REVOCABLE TRUST
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildabbildung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock Evannovostro / faestock / StaniG / Kokorina Mariia / Patryk Kosmider / Lev Kropotov / Protasov AN
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-228-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Vicky Bliss und die Hand des Pharaos« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Vicky Bliss und die Hand des Pharaos
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Ulrich Hoffmann
dotbooks.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Lesetipps
Vorwort
Vor Kurzem habe ich mit mehreren meiner Schriftstellerfreunde über ein Problem gesprochen, das wir unter Kollegen »das gegenwärtige Jetzt« nennen. Eine meiner Serien spielt in Echtzeit; entsprechend altern die Figuren mit jedem Jahr und jedem Band. Die Vicky-Serie und die Arbeiten vieler meiner Freunde funktionieren anders. Vicky trat zum ersten Mal 1973 auf. Da war sie noch keine dreißig. Der letzte Band erschien 1994, über zwanzig Jahre später, aber Vicky war nur einige Jahre gealtert. Sie ist erst Anfang dreißig, obwohl die Welt, in der sie lebt, sich stark verändert hat. Der Kalte Krieg ist zu Ende, der Wahnsinn im Irak hat begonnen, das Internet hat seine Tentakel in unser aller Leben ausgestreckt, und die Leute laufen herum, als hätte man ihnen ihre Handys ans Ohr geklebt.
Wie erklären wir Autoren diese Inkonsistenzen und Anachronismen? Wir tun es eben nicht, denn wir können es nicht. Bitte schreiben Sie mir also nicht, um mich auf diesen Sachverhalt hinzuweisen, ignorieren Sie das Problem, genau wie ich es getan habe, und lesen Sie im »gegenwärtigen Jetzt«. Um meine Freundin Margaret Maron zu zitieren, der ich diesen Begriff und viele ausgezeichnete Ratschläge verdanke: »Ist es nicht toll, in unserem Paralleluniversum Gott spielen zu können? Wir können der Sonne befehlen, stillzustehen, und sie tut es!«
Kapitel 1
I cover my ears, I close my eyes, still I hear your voice and it's tellin' me lies ... Mein Gesang lässt nicht unbedingt Tausende von Fans freudig kreischen, aber ich war doch ein wenig beleidigt, als mein Hund mit einem Jaulen aufsprang und zur Treppe lief. Normalerweise gefällt es ihm, wenn ich singe. Er ist der Einzige, der es mag. Davon abgesehen ist sein Gehör eigentlich ganz gut.
John kam die Treppe herunter. Er stoppte Caesars Frontalangriff mit einem strengen Kommando – etwas, das mir noch nie gelungen ist – und trat auf mich zu. Ich hatte ihn seit zwei Wochen nicht mehr gesehen. Meine Zehen kribbelten. Er trug ein blaues Hemd, passend zur Farbe seiner Augen – und denen der Siamkatze, die sich an seine Schulter schmiegte. Mit einer Hand stützte er Claras Oberkörper; seine langen Finger waren ebenso elegant geformt wie die kleinen seehundbraunen Pfoten, die darauf balancierten. Clara hatte John anfangs nicht sonderlich gemocht, aber er hatte sich bemüht, ihr Katzenherz für sich zu gewinnen (zumal die Alternative Bisse und Kratzer gewesen wären), und es war ihm mithilfe vieler Hühneropfer gelungen. Zusammen sahen sie umwerfend aus. Er sah auch allein umwerfend aus.
Ich hatte aufgehört zu singen und sagte mürrisch: »Wenn man vom Teufel spricht ... Wieso kannst du nicht wie jeder normale Mensch zur Haustür reinkommen, statt durch mein Schlafzimmerfenster zu klettern? Das weckt gewisse Erinnerungen in mir.«
***
Erinnerungen an die Zeit, in der Interpol und mehrere konkurrierende Verbrecher nach ihm und den Kunstschätzen, mit denen er sich davongestohlen hatte, suchten. Mittlerweile war er ein ehrlicher Antiquitätenhändler, sofern ich ihm das glauben durfte – was ich wahrscheinlich besser nicht tun sollte. Telling me lies. Mir Lügen zu erzählen war schon damals eine seiner Lieblingsbeschäftigungen gewesen.
Ich griff nach dem schmuddelig weißen, wollenen Etwas mit der gefährlich lose daran baumelnden Häkelnadel, das ich in meinen Schoß hatte fallen lassen. Ich tat so, als würde ich mein Werk betrachten. Ich gab mich kühl, als würden mich sein gewinnendes Lächeln und die sehnsuchtsblauen Augen komplett kaltlassen. Verdammt, er hatte sich zwei elend lange Wochen nicht sehen lassen. London ist keine zwei Flugstunden von München entfernt. Ich weiß das, ich bin die Strecke oft genug geflogen. Dank eines gutmütigen Chefs konnte ich mich leichter von meinem Job im Museum abseilen als John sich aus seinem Antiquitätenladen – wenn man seiner Darstellung glauben konnte. War das alles nur gelogen?
»Wie laufen die Geschäfte?«, erkundigte ich mich.
Keine Antwort. Ein Plumpsen und eine laute Siamkatzenbeschwerde ließen mich aufblicken. Clara stand auf ihren Pfoten zu seinen Füßen und starrte zu ihm hoch, während John – nein, er starrte nicht, er glotzte mich ungläubig an. Nun ja, weniger mich als das scheußliche Ding, das ich in Händen hielt.
»Was ist denn das?«, krächzte er.
»Kein Grund, unhöflich zu werden«, sagte ich abwehrend. »Es ist ein Babymützchen. Ich kann noch nicht sonderlich gut häkeln, aber ich kriege es schon noch raus.«
John taumelte zum nächsten Sessel und ließ sich hineinfallen. Er war weiß wie ein Laken, viel weißer als die klägliche Mütze, die zudem noch von Claras Versuchen, mit ihr zu spielen, in Mitleidenschaft gezogen worden war. »Was zum Teufel ist los mit dir?«, fragte ich. »Bob – du weißt schon, Bob, mein Bruder – und seine neue Frau erwarten ihr erstes Kind, und ich dachte, es wäre eine nette Geste, wenn ich ... wenn ich ...«
Er stieß erleichtert den Atem aus, und da begriff ich. Es war wie ein Schlag in den Solarplexus.
»Ah«, sagte ich. »Aha. Manchmal bin ich so langsam im Kopf. Hast du das wirklich gedacht? Das hast du also gedacht! Nicht nur, dass ich Mami würde, sondern dass ich – Augenblick, gleich habe ich's, ich komme schon drauf –, dass ich mich habe schwängern lassen, um dich zur Ehe zu zwingen. Allein schon von der Vorstellung wird dir schlecht! Du widerwärtiges Stinktier! Du elender Hurensohn! Ich wette, deine Mutter warnt dich schon seit Monaten: ›Sei vorsichtig mit diesem Flittchen, sie wird versuchen, dich ...‹«
»Vicky!« Normalerweise spricht er in einem samtigen Tenor, aber wenn es wirklich sein muss, kann er lauter brüllen als ich ... Und glauben Sie mir, in diesem Fall musste es sein. Er sprang auf und kam auf mich zu. Ich warf die Babymütze mitsamt der Häkelnadel nach ihm. Er duckte sich. Das Wollknäuel rollte vom Sofa, und Clara schoss hinterher. John packte mich an den Schultern.
»Hör auf zu schreien und hör mir zu.«
»Das hast du geglaubt, nicht wahr? Das hast du geglaubt.«
»Was geglaubt? Dass du blöd genug wärst, so eine antiquierte Nummer abzuziehen? Nicht in meinen wildesten Träumen. Aber du musst zugeben, dass mein erster Eindruck gerechtfertigt war durch die Beweislage, wie sie sich mir zu diesem Zeitpunkt darstellte.«
»Hör auf zu reden wie ein Anwalt. Mir geht es nicht darum, was du gedacht hast, sondern um deine Reaktion darauf. Allein schon die Vorstellung hat dich in Panik versetzt. Du hast ausgesehen, als würdest du gleich ohnmächtig werden.«
»Ja.«
Ich war jetzt in Stimmung für einen lauten, befriedigenden Streit, aber dieses leise Eingeständnis nahm mir den Wind aus den Segeln. Das Beste, was mir noch einfiel, war ein schwaches »Du gibst es also zu?«.
»Vielleicht trifft alles, was du mir vorgeworfen hast, zu, und noch vieles andere mehr, aber ich bin nicht so selbstgefällig, dass mir die Konsequenzen meiner eigenen Missetaten entgehen. Zum Teufel, Vicky, ich habe andauernd Angst! Zugegebenermaßen bin ich einer der größten Feiglinge der Welt, aber ich habe auch Angst um dich. Es gibt in der großen, bösen Welt da draußen eine Menge Menschen, die mich auf den Tod nicht ausstehen können und die mir Rache geschworen haben.« Die Worte quollen aus ihm heraus, sein Gesicht rötete sich, seine Finger gruben sich in meine Haut. »Als wir uns miteinander eingelassen haben, habe ich versucht, es dir auszureden. Dass du mit mir in Verbindung gebracht werden kannst, reicht aus, dich in Gefahr zu bringen. Aber wie du mir damals mit beachtlicher Eloquenz versichert hast, bist du erwachsen, und es war deine Entscheidung. Du hast mich überzeugt, trotz meines klaren Standpunkts und entgegen dem letzten verbliebenen Rest von Gewissen in meiner Brust. Was glaubst du, wie ich mich einen entsetzlichen Augenblick lang gefühlt habe, als ich dachte, dass es noch eine weitere potenzielle Geisel gäbe, ein hilfloses, unendlich verwundbares, absolut unschuldiges Wesen, das möglicherweise für meine Missetaten büßen muss? Die Leute, von denen ich spreche, hätten nicht die geringsten Skrupel, ein Kind zu benutzen, um sich an mir zu rächen – und an dir.«
Jetzt fühlte ich mich wie das widerwärtige Stinktier.
»Es tut mir leid«, murmelte ich. »Ich habe dich beschimpft, ohne nachzudenken. Es gibt auch ein paar Leute, die sauer auf mich sind.«
»Ja, das kann man durchaus sagen.« Es gelang ihm zu lächeln.
»Na ja. Schon gut.«
»Es tut mir leid. Ich meine ... alles.«
Ich wusste, was er meinte, und wagte nicht, es zu Ende zu denken. Ich erhob mich, um meinen erbärmlichen Versuch hausfraulicher Normalität aus Claras Klauen zu retten. Er saß da, mit schlaff im Schoß liegenden Händen, und sah ungewöhnlich hilflos aus. Als ich das Garn unter den Sesseln und den Tischbeinen herausgefädelt hatte, stand John an der Kommode und mixte uns Drinks. Ich konnte ihm wirklich keinen Vorwurf machen. Ich warf das alberne Garnknäuel in den Mülleimer und nahm das Glas, das er mir reichte.
»Tut mir leid, was ich über deine Mutter gesagt habe.« Wenigstens war mir die Luft ausgegangen, bevor ich sie mit Schimpfnamen bedacht hatte. Jen und ich würden nie die besten Freundinnen werden, und meiner nicht sonderlich bescheidenen Meinung nach war sie ein wenig zu besitzergreifend ihrem kleinen Jungen gegenüber, aber unhöflich bleibt unhöflich, selbst wenn man die Wahrheit sagt.
John zuckte mit den Achseln. »Ihretwegen habe ich mich so lange nicht gemeldet. Nein, es ist nicht so, wie du denkst; ich musste runter nach Cornwall und mich um einen kleinen Notfall kümmern. Jemand ist ins Haus eingebrochen.«
»Wie schrecklich!«, rief ich, wobei ich mich nur ein ganz klein wenig verstellen musste. Ein Einbrecher, der Jen in die Arme liefe, hätte mein ganzes Mitleid, es sei denn, er wäre bis an die Zähne bewaffnet.
»Sie ist nicht verletzt und hat sich nicht einmal besonders erschreckt. Du kennst sie ja.«
»Allerdings.«
»Sie hat gar nicht bemerkt, dass jemand eingebrochen hatte, bis sie in den Dachboden ging, weil sie ein wenig sauber machen wollte.«
Mein erster und bislang letzter Besuch auf dem Familiensitz war dem wohlmeinenden Bestreben Johns geschuldet, seine Mutter an mich zu gewöhnen, oder wenigstens an die Vorstellung, dass es mich gab. John hatte bereits bei einer früheren Gelegenheit mitgeteilt: »Du würdest sie nicht mögen, und sie würde dich auch nicht mögen.« Als ich Jen das erste Mal getroffen hatte, auf sozusagen neutralem Boden, hatte ich sie jedoch ganz amüsant und ausgesprochen nett gefunden.
Das war, bevor sie herausgefunden hatte, wer ich war – genau genommen welches Verhältnis ich zu John hatte.
Als er vorgeschlagen hatte, ein paar Tage in Cornwall zu verbringen, damit Jen die Gelegenheit bekäme, mich besser kennenzulernen, hatte ich gedacht: Warum nicht, wir können es ja versuchen. Und ich habe es versucht, wirklich. Ich hatte mir sogar ein Kleid gekauft. Es war in einem zurückhaltenden Grünton, mit einem anständigen Ausschnitt und einem Rock, der bis zur Mitte der Wade reichte. Ich hatte meine Nägel rosa lackiert und passenden Lippenstift aufgetragen. Ich war beim Friseur gewesen. Ich sah, wie John unklugerweise bemerkte, aus wie die jungfräuliche Heldin eines Vierzigerjahre-Musicals.
Dabei müssen Sie bitte berücksichtigen, dass ich Jen nicht als Bedrohung wahrgenommen hatte. Mir war rasch klar gewesen, dass Johns Gefühle seiner Mutter gegenüber aus einer Mischung von Genervtheit und mitfühlender Zuneigung bestanden. Er würde tun und lassen, was er wollte, ganz egal, was sie sagte oder dachte. Mir war allerdings nicht klar gewesen, dass Jen sich schlicht weigerte, diese Sachlage zu akzeptieren.
Es heißt, Amerikaner wären süchtig nach Antiquitäten. Ich vermute, das sind wir wirklich, denn es gibt bei uns nicht viele Häuser, die über dreihundert Jahre alt sind. Jens Zuhause verfügte über das volle Programm – Säulen mit formlosen Wappentieren obenauf, ein schweres schmiedeeisernes Tor, eine gewundene Auffahrt mit knorrigen Bäumen, einen kreisrunden Kiesplatz vor der Haustür. Das Gebäude selbst sah aus wie die Karikatur aus einem Kitschroman: Die originale, für sich genommen durchaus elegante Steinfassade war mittlerweile voller Flechten und dicht mit Efeu überwuchert, und an beiden Ecken ragten unpassende Türmchen auf, zu allem Überfluss samt Mauerzinnen. Einen Moment lang fragte ich mich amüsiert, ob irgendwo in der Nähe ein übermotivierter Deko-Gnom wohnte.
Es hatte den ganzen Tag geregnet oder genieselt; die Wolken hingen tief und dunkel über dem Haus, der Nebel waberte um die Türmchen. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn Jen das Wetter bestellt gehabt hätte. Das Portal öffnete sich, als wir näher kamen, und da stand sie wie die böse Hausherrin in einem dieser Kitschromane: ganz in Schwarz und auf einen schwarzen Krückstock mit silbernem Kauf gestützt. Ich war ziemlich sicher, dass der Stock nur eine Requisite war; auf unserer Ägypten-Kreuzfahrt war sie wieselflink gewesen, und zu ihrer Garderobe hatte kein einziges langes schwarzes Kleid gehört.
Wir tranken Tee im Kleinen Teezimmer (man konnte die Großbuchstaben hören, als Jen die Worte aussprach). Ich hatte erwartet, dass er von einem Treuen Diener serviert würde (entschuldigen Sie die Großbuchstaben, sie sind ansteckend). Ich vermute, dass Jen keinen hatte auftreiben können, aber die Hausdame trug immerhin eine Schürze und eine weiße Rüschenkappe. John saß da und schaute unbeteiligt, während Jen und ich Konversation betrieben. Ich fürchtete so sehr, etwas Falsches zu sagen, dass ich sie die meiste Zeit reden ließ. Es ging im Wesentlichen um den bemerkenswerten Stammbaum und die so tief verwurzelte Ehrbarkeit der Familie Tregarth. Sie fasste es zusammen in dem Satz: »Es hat niemals einen unehrlichen oder ehrlosen Tregarth gegeben.« Ich wäre fast an meinem glasierten Gebäckteil erstickt.
Nach dem Tee führte mich Jen herum, wobei sie darauf achtete, dass mir klar wurde, dass es nicht ein einfaches Haus war, sondern der Familiensitz, durchzogen von Geschichte und Tradition, wie es jemand aus einer amerikanischen Maiszüchterfamilie nie gebührend würde schätzen können. Ich begriff, worauf sie hinauswollte, und es gefiel mir nicht sonderlich, aber während wir durch die Flure über endlose Treppenfluchten stiefelten, steigerte sich meine schlechte Laune aus einem ganz anderen Grund. Das Haus war ein Anachronismus, ein riesiger weißer Elefant. Ich wäre nicht in dem Geschäft, in dem ich bin, wenn ich nichts übrighätte für historische Werte, aber irgendwo muss man die Grenze ziehen, manchmal muss auch etwas Altes Platz machen für Neues. Dieses Haus war ganz nett, aber keineswegs einzigartig, es war hübsch, aber im Alltag völlig unpraktisch. Es kostete John ein kleines Vermögen, dafür zu sorgen, dass das Ding nicht einfach über Jen zusammenstürzte. Er hatte einmal in einem seltenen Augenblick der Frustration zugegeben, dass er das Haus schon längst abgerissen und den Grund verkauft hätte, wenn Jen nicht wäre.
»Das Lager befindet sich auf dem Dachboden, falls du dich erinnerst«, fuhr John fort. »Sie bekam einen ganz schönen Schrecken, als sie sah, was geschehen war – jemand hatte alle Kisten und Schubladen geöffnet und den Inhalt verstreut. Sie rief die zuständige Polizeistation an und ließ einen Constable kommen, um den Schaden zu begutachten. Nachdem sie sich bei dem eine Weile ausgeschimpft hatte, teilte er ihr mit, dass er nicht viel für sie tun könne. Soweit sie sehen konnte, fehlte nichts – jedenfalls nichts von Wert, weil nichts von Wert dort oben gewesen war. Wir bewahren den Familienschmuck nicht auf dem Dachboden auf.«
»Ich wusste nicht, dass ihr Familienschmuck besitzt.«
»Es war eher eine Metapher«, sagte John und lächelte verschmitzt. »Was ich meine, ist, dass dort nichts war, was sich zu stehlen lohnte. Und es gab auch keine nützlichen Anhaltspunkte. Sie konnte nicht einmal sicher sagen, wann der Einbruch stattgefunden hatte.«
»Trotzdem«, fragte ich, weil mich die Sache nun langsam doch interessierte, »ist die Vorstellung beängstigend, dass man irgendwelchen Eindringlingen ausliefert ist. Wie ist der Nicht-Dieb überhaupt reingekommen?«
»Mein liebes Mädchen, du hast das Gebäude doch gesehen; es gibt zwanzig Türen und hundert Fenster allein im Erdgeschoss, und drei verschiedene Treppenhäuser. Sie schläft tief, und ihr Zimmer liegt an der Vorderseite des Hauses.«
»Deutet das nicht darauf hin, dass der Einbrecher sich im Haus auskannte? Er scheint immerhin nicht an ihrer Tür vorbeigetrampelt zu sein.«
»Freu dich nicht zu früh, Sherlock. Man kann aus den vorliegenden Beweisen keine vernünftigen Schlüsse ziehen. Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass irgendein Jugendlicher aus der Gegend von seinen Freunden herausgefordert wurde, ins Haus einzusteigen und wieder herauszukommen, ohne sich erwischen zu lassen. Lächerlich und dumm, ich weiß, aber so ist die Jugend nun einmal. Jen wird in der Umgebung als eine Mischung aus Edeldame und Gewitterhexe betrachtet – mit anderen Worten: eine Herausforderung.«
Er nippte an seinem Drink, und ich sagte empört: »Du reagierst ganz schön gelassen für einen pflichtbewussten Sohn. Sie sollte dort nicht allein sein, in diesem großen, einsamen Haus.«
»Ich habe versucht, sie zu überreden, nach London zu ziehen«, sagte John. »Sie will nichts davon wissen. Ehrlich, Vicky, es geht ihr hervorragend. In ihrer Ecke der Welt gibt es keine Serienmörder, und falls ihr ein bedauernswerter Übeltäter über den Weg laufen sollte, wäre er in größerer Gefahr als sie. Sie nimmt ihren Stock mit ins Bett. Unter dem Silberknauf befindet sich ein Pfund Blei.«
Ich ging zum Fenster und sah hinaus. Alles war grau – grauer Himmel, graue Straßen, graue Häuser wie kleine Schachteln in einer Reihe, und selbst die Blumenbeete und Büsche und alle anderen verzweifelten Versuche der Individualisierung wurden durch das Wetter vergraut. Ich benötigte wegen meines übergroßen Dobermanns ein Haus mit Garten, und dieser Vorort außerhalb des Stadtzentrums von München war das Beste, was ich mir leisten konnte. Es war okay. Ich verbrachte meine Arbeitszeit inmitten von Kunst aus dem Mittelalter und der Renaissance, ich brauche nicht noch mehr davon zu Hause.
Das Schweigen dauerte an, durchbrochen nur durch das Schnurren Claras und das schwere Atmen Caesars. Ich sagte, ohne mich umzuwenden: »Es ist etwas geschehen, oder?«
»Ich habe dir doch ...«
»Nicht Jen. Etwas anderes.«
Er machte Anstalten aufzustehen und stieß einen Schrei aus, als Clara ihre Klauen in ihn schlug. Ich nahm ihm das leere Glas aus der Hand und befüllte es erneut. Ein weiteres Anzeichen, falls ich noch eines gebraucht hätte. Normalerweise brauchte er viel länger, um einen Drink wegzuhauen.
»Du hast überreagiert«, sagte ich. »Okay, ich auch, aber nicht aus demselben Grund. Du wärst nicht in Panik verfallen, wenn du nicht vor Kurzem, und gegen deinen Willen, daran erinnert worden wärst, dass, wie du es so schön formuliert hast, mehrere unangenehme Personen Interesse an dir haben. Wer ist diesmal hinter dir her? Was hast du angestellt?«
»Nichts! Ich habe verdammt noch mal nichts Verbotenes getan. Das ist die Wahrheit, ob du es glaubst oder nicht.«
Ich glaubte es. Nicht wegen des ehrlichen Blicks aus diesen kornblumenblauen Augen – John konnte sich den Weg in den Himmel erlügen –, sondern wegen des Hauchs von Empörung in seiner Stimme. Wie bei einem Ganoven, dem man vorwirft, in ein Haus eingebrochen zu sein, obwohl er doch ein perfektes Alibi hat, weil er zur gleichen Zeit eine Bank ausraubte.
»Schmidt kommt zum Essen«, sagte ich. »Er wird sich freuen, dich zu sehen.«
Seine Reaktion war nicht eindeutig, nur ein Zwinkern und eine winzige Pause, bevor er antwortete. »Wie nett. Ich hoffe, mein unerwartetes Auftauchen bringt dich essensmäßig nicht in die Klemme. Ich kann noch etwas besorgen, wenn du möchtest.«
Vielleicht bildete ich es mir nur ein. Aber wie dem auch sei – es war sinnlos, die Sache jetzt weiterzuverfolgen. »Er bringt etwas zu essen aus seinem Lieblingsdelikatessenladen mit. Es wird genug sein für ein ganzes Regiment. Du kennst doch Schmidt.«
»Ich kenne und ich liebe ihn. Was hat der kleine Schelm in letzter Zeit so getrieben?«
Genau genommen war es mehrere Wochen her, dass ich meinen Chef zu Gesicht bekommen hatte. Ich hatte ihn vermisst. Herr Doktor Anton Z. Schmidt, Direktor des Bayerischen Nationalmuseums in München, ist einer der Spitzenleute auf seinem Gebiet. Was es zu einem großen Vergnügen macht, mit ihm zu tun zu haben, ist jedoch, dass er einige entschieden unakademische Interessen hegt, von amerikanischer Country-Musik, die er mit einem schiefen Bariton und einem lächerlichen Akzent nachsingt, bis zu seiner neuesten Leidenschaft: Herr-der-Ringe-Sammelfiguren. Er hat alle Actionfiguren, alle Schwerter, Gimlis Axt und den Einen Ring, den er an einer Kette um seinen dicken Hals trägt. Er unterhält außerdem die Illusion, er sei ein großer Detektiv und ich seine treue Helferin. Gemeinsam, sagt Schmidt gern, haben wir viele Verbrechen aufgeklärt und unzählige Schurken ins Kittchen gebracht. Trotz Schmidts gewohnheitsmäßiger Übertreibung wohnt der Behauptung ein Körnchen Wahrheit inne. Obwohl ich mein Bestes gegeben hatte, war es mir nicht möglich gewesen, ihn stets aus meinen Begegnungen mit kriminellen Elementen herauszuhalten – von denen die meisten, muss ich hinzufügen, durch John angelockt worden waren.
»Er war im Urlaub«, sagte ich. – »Wo?«
»Ich weiß nicht. Er hat sehr geheimnisvoll getan – mit Zwinkern und Kichern und so weiter. Er könnte sonst wo gewesen sein – in Neuseeland, wo er ganz allein die Schlacht auf dem Pelennor nachgespielt hat, oder in Nashville im Grand Ole Opry, oder im Spionagemuseum in Washington – du weißt ja, wie sehr er Spione liebt.«
John sagte: »Mmm.«
Clara hatte beschlossen, ihm zu vergeben, sie saß nun auf seinem Schoß und haarte auf seinen eleganten Tweed. Caesar sabberte auf sein Knie und hoffte auf Leckerlis, die seiner Erfahrung nach oft abfielen, wenn Gläser mit Flüssigkeit im Spiel waren.
»Wann kommt Schmidt?«, fragte er.
»Erst in ein paar Stunden.«
»Nun denn ...« Er entledigte sich, Kralle für Kralle, Claras und kam auf mich zu.
»Oh nein«, sagte ich und trat zurück. »Ich weigere mich, mich ablenken zu lassen.«
»Ist das der neueste Euphemismus? Sehr ladylike.« Er hob mich hoch und ging zur Treppe. Ich bin beinahe so groß wie er, und obwohl er ausgesprochen fit ist, schaffte er es nur bis zur Hälfte des Stockwerks, bevor er innehalten musste. Er setzte mich ab und ließ sich keuchend auf der Stufe neben mir fallen, woraufhin wir beide zu lachen begannen, und dann überkam mich das Bedürfnis nach Ablenkung plötzlich wie ein Tornado. Zwei Wochen sind eine lange Zeit.
John saß da und beobachtete mich, wie ich durch das Wohnzimmer wirbelte, Kissen aufschüttelte und versuchte, Claras Haare von den Sofakissen zu kratzen.
»Wieso tust du plötzlich so hausfraulich?«, fragte er. »Schmidt wird sowieso überall Zigarrenasche fallen lassen und Bier verschütten, wenn er es sich gemütlich macht.«
»Er bringt jemanden mit.«
Wieder eine dieser kurzen, aber bedeutungsvollen Pausen. »Oh, wen?«
»Hat er nicht gesagt. Aus der Häufigkeit seines Kicherns würde ich jedoch auf eine Dame schließen, oder zumindest irgendeine Art von weiblichem Wesen.«
Ich hielt inne und warf einen schnellen Blick in den Spiegel über dem Sofa. Gelegentlich beschweren sich Gäste, dass er ein bisschen zu hoch für sie hängt, aber ich bin fast eins achtzig groß, und wessen Spiegel ist es schließlich? Ich hasse es, so groß zu sein. Es ist prima, wenn man Model oder Basketballprofi werden will, aber groß und blond und wohlgerundet zu sein (wie ich es gern nenne) kann eine akademische Karriere merklich erschweren. Manche Leute hängen immer noch der Theorie an, dass eine frauenförmige Frau keinesfalls über ein funktionierendes Gehirn verfügen kann.
Ich steckte ein paar lose Strähnen in den Haarknoten in meinem Nacken, überprüfte noch einmal, ob mein Make-up ordnungsgemäß aufgetragen war, und schnitt meinem Spiegelbild eine Grimasse. Für wen brezelte ich mich eigentlich so auf? Für Schmidts potenzielle Freundin?
John warf beiläufig einen Blick auf seine Uhr. »Ich denke, ich werde noch eine kleine Runde mit Caesar drehen, bevor sie kommen.«
»Es regnet immer noch.«
»Es ist ein wenig feucht. Wo ich herkomme, ist das ein ganz normales Wetter.«
Er bewegte sich mit vorgetäuschter Lässigkeit und schaffte es beinahe bis zur Tür, bevor ich ihn einholte.
»Es reicht. Das war's. Setz dich in den Sessel und sag mir, was los ist.«
Caesar begann empört zu bellen. Er ist nicht sonderlich helle, aber er war klug genug, zwei und zwei zusammenzuzählen: Jemand hatte mit ihm spazieren gehen wollen, und jemand anders, hatte das unterbunden. Sein Protest übertönte beinahe ein anderes Geräusch: die Klingel.
»Das kann noch nicht Schmidt sein«, erklärte ich, »der kommt nie pünktlich.«
Es klingelte weiter, fast genauso drängend, wie Caesar bellte. John ließ den Kopf in die Hände sinken.
»Zu spät«, stöhnte er.
»Wer ist das?«, rief ich über die Kakofonie hinweg. Eine lange Liste gefährlicher Namen ratterte durch meinen Kopf. »Max? Blenkiron? Interpol? Scotland Yard?«
»Schlimmer«, sagte John mit düsterer Stimme. »Ruhig, Caesar.«
Caesar gehorchte. In der nun folgenden Stille trat an die Stelle des Klingelns rhythmisches Hämmern. John erhob sich und ging zur Tür.
Die Vierzig-Watt-Birne vor der Haustür illuminierte den Umriss eines Mannes; sein schwarzes Haar schimmerte feucht. Die Schatten verhüllten seine Gesichtszüge, aber ich konnte genug erkennen, um zu wissen, wer es war. Erleichterung durchfuhr mich.
»Feisal? Bist du das? Warum hat John mir nicht gesagt, dass du kommst?« Und warum, fragte ich mich, war er so entsetzt über sein Kommen? Feisal war kein Feind, er war ein Freund, ein wirklich guter Freund, der sein Leben, seine Gesundheit und seinen Ruf aufs Spiel gesetzt hatte, um mich bei unserem letzten Ausflug nach Ägypten zu retten.
John packte Caesar am Halsband und zerrte ihn aus dem Weg, sodass Feisal hereinkommen konnte. Jetzt, wo ich sein Gesicht besser sehen konnte, wurde mir klar, dass es sicherlich kein privater Besuch war, keine nette Überraschung für Vicky. Feisal war ein gut aussehender Mann mit diesen klassischen arabischen Adler-Zügen, langen Wimpern und einer Hautfarbe wie Caffè Latte. Allerdings war es im Augenblick mehr Milch als Kaffee, und die Falten um seinen Mund herum sahen aus, als wären sie in Stein gemeißelt. Ich stellte keine Fragen mehr. Wozu auch, ich bekam ja sowieso keine Antworten. Wortlos führte ich Feisal zu einem Sessel.
»Ich würde dir ja etwas zu trinken anbieten«, begann ich auf der Suche nach einem beruhigenden Klischee. »Aber du trinkst ja keinen Alkohol.«
»Ich aber«, sagte John, »Gott sei Dank.« Er füllte drei Gläser, Wodka Tonic für ihn und mich, Tonic pur für Feisal.
»Rede«, sagte er dann barsch.
Ich starrte ihn an. »Soll das heißen, du weißt auch nicht, worum es geht?«
»Nein. Düstere Andeutungen, hysterisches Stöhnen sowie die Forderung, dass ich mich hier mit ihm treffe – sofort, wenn nicht schon früher. Jetzt rede, Feisal. Schmidt wird bald hier sein.«
»Schmidt!« Entsetzt sprang Feisal auf. »Oh Gott, nein. Nicht Schmidt. Warum hast du mir nicht gesagt, dass er kommt? Ich muss hier weg!«
»Ich wusste es nicht, bevor es zu spät war«, entgegnete John. »Dir bleibt etwa eine Dreiviertelstunde, um uns ins Bild zu setzen und abzuhauen – oder dich zusammenzureißen und wieder normal zu benehmen. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich dich abgefangen, aber es sollte nicht sein. Willst du Vicky mit an Bord haben?«
»Sie ist an Bord«, sagte ich und verschränkte entschlossen meine Arme.
Feisal nickte düster. »Darf ich rauchen?«
Ich schob ihm einen Aschenbecher hin. »Ich dachte, du hättest aufgehört.«
»Hatte ich auch. Bis vorgestern.«
»Erzähl schon«, sagte John.
»Ich werde euch berichten, was geschehen ist, so, wie es mir von dem Mann, der es erlebt hat, geschildert wurde. Ich war nicht dabei. Als Inspektor für die Bewahrung der Altertümer in ganz Oberägypten bin ich für einen großen Bereich zuständig, und ich habe zu wenig Personal, und ...«
»Das wissen wir alles«, sagte John ungeduldig. »Jetzt komm uns nicht mit Entschuldigungen, bevor du uns überhaupt verraten hast, was dir vorgeworfen wird.«
***
Ali schaute hoch zur Sonne, sah dann zur Bestätigung auf seine Uhr und seufzte. Noch über eine Stunde, bevor er und die anderen Aufseher die Touristen aus dem Tal der Könige jagen und nach Hause gehen konnten. Er schraubte seine Wasserflasche auf und trank. Es war ein Tag wie jeder andere, heiß und staubig und trocken. Die berühmte Grabstätte der großen Pharaonen des Alten Ägypten begeisterte ihn nicht; es war bloß ein Job, den er schon seit über zehn Jahren machte.
Die Zahl der Besucher hatte ein wenig abgenommen, aber immer noch verstopften Hunderte von ihnen die Wege im Tal, wirbelten Staub auf, quasselten in einem Dutzend Sprachen. Eine Gruppe Japaner kam an ihm vorüber, sie drängten sich dicht um die Fahne, die ihr Führer hochhielt. Wie Küken, dachte Ali, die hinter der Mutterhenne hereilten, da sie fürchteten, diese aus den Augen zu verlieren. Er wusste nicht, was schlimmer war: die Meinen Küken, oder die Deutschen, die einfach drauflosmarschierten und überall reinwollten, wo sie nichts zu suchen hatten, oder die Franzosen, die ihre haarigen Beine und ihre Körper so unziemlich zur Schau stellten. Nicht, dass er sie hasste. Er mochte sie allesamt nur nicht sonderlich. Die Amerikaner gaben wenigstens ordentlich Trinkgeld. Besser als die Briten, die um jedes einzelne Pfund feilschten.
Das Grab, das er bewachte, war geschlossen, wie es oft der Fall war, aber das hinderte die Leute nicht daran zu versuchen, ihn zu bestechen, damit er sie hineinließe. Ein fetter Amerikaner hatte ihm hundert ägyptische Pfund angeboten – zwei Monate Gehalt für ihn, der Preis eines gehobenen Abendessens für den Amerikaner. Gott wusste, dass er das Geld hätte brauchen können, aber es würde ihn den Job kosten, wenn er die Vorschriften missachtete, vor allem bei diesem Grab. Es würde herauskommen, denn es lag direkt am Weg, und es war das berühmteste Grab im ganzen Tal.
Er lehnte sich zurück und schloss die Augen. Die Stimmen wurden leiser, doch dann ließ ein anderes Geräusch ihn zusammenzucken. Er richtete sich auf und war augenblicklich hellwach.
Ein schwarzer Geländewagen kam auf ihn zu, hupte, scheuchte Fußgänger vom Weg. Es musste ein offizielles Gefährt sein, andere waren im Tal nicht erlaubt. Zwei weitere Wagen folgten, dahinter kam etwas, das Ali die Augen noch weiter aufreißen ließ. Es war fast so groß wie ein Reisebus, aber es war kein Bus, es war eine Art Lieferwagen, weiß gestrichen und mit Schriftzeichen in einer Sprache versehen, die ganz sicher nicht Arabisch war. Erinnerungen stiegen in ihm auf, und Ali rief seinen Gott an. Er hatte so einen Wagen schon einmal gesehen. Was machte der hier? Warum hatte man ihn nicht informiert?
Die Karawane hielt vor der Grabstätte. Männer in schwarzen Uniformen stiegen aus den Pkws und stellten sich fächerförmig auf, sodass sie ein Spalier vor dem Eingang bildeten. Die Türen des Geländewagens öffneten sich. Ein Mann stieg aus und marschierte entschlossen auf Ali zu. Er hatte einen Bart und trug eine Hornbrille. Ein anderer, jüngerer Mann folgte ihm. Er trug eine abgewetzte Aktentasche.
»Sind Sie der Wachmann?«, schnauzte der ältere Mann. »Dann los jetzt. Machen Sie die Tür auf. Wir haben nicht viel Zeit.«
»Aber«, stammelte Ali. »Aber ...«
»Oh, um Gottes willen. Hat man Ihnen nicht gesagt, dass wir kommen?«
Alis leerer Blick war offensichtlich Antwort genug; der Mann wandte sich an seinen jüngeren Begleiter und murmelte etwas. Ali hörte nur die Worte: »Typisch ägyptische Effizienz.«
»Nun, wir sind jetzt hier«, fuhr der Mann mit dem Bart fort. »Ich bin Dr. Henry Manchester vom Britischen Institut für Technoarchäologie. Ich nehme an, Sie wollen meine Genehmigung sehen. Ja, ja, sehr ordentlich.«
Er schnipste mit den Fingern. Der jüngere Mann fummelte in seiner Aktentasche herum und zog einen Zettel heraus, den er Manchester reichte, der ihn wiederum an Ali weitergab. »Ich vermute, Sie können kein Englisch lesen, aber die Unterschrift sollten Sie erkennen.«
Ali war stolz auf seine Englischkenntnisse, verzichtete aber lieber darauf, das jetzt kundzutun. Das Dokument wirkte beeindruckend. Das Supreme Council of Antiquities, Büro des Generalsekretärs. Unterschrieben hatte der Chef selbst. Nicht, dass Ali jemals einen Brief von seinem obersten Dienstherrn erhalten hätte, aber er hatte ihn einmal getroffen, direkt nachdem er diese Stellung angetreten hatte, als er all die großen Stätten besuchte. »Getroffen« war vielleicht nicht das richtige Wort, aber der Chef hat zufrieden in seine Richtung genickt.
»Ja, ich sehe«, sagte er langsam. »Aber ich kann nicht ...«
»Dann rufen Sie beim Supreme Council an«, sagte der Engländer ungeduldig. »Aber zackig.«
Ja klar, dachte Ali. Beim Supreme Council anrufen. Hier ist Ali. Sie erinnern sich sicher an mich, der Wachmann aus dem Tal der Könige. Bitte verbinden Sie mich sofort mit Dr. Khifaya ...
»Nein«, sagte er. »Die Unterlagen sind in Ordnung.«
»Das meine ich aber auch. Und jetzt halten Sie mich nicht länger auf. Wir standen bereits auf der Brücke im Stau und haben nicht mehr viel Zeit. Wir brauchen Ihren Schlüssel nicht. Ich habe einen eigenen.«
Er drängte sich an Ali vorbei die Treppe hinunter.
Von diesem Augenblick an ging alles so schnell, dass Ali sie nicht einmal hätte stoppen können, wenn er es gewollt hätte. Die Hintertüren des Vans öffneten sich. Darin befand sich ein atemberaubendes Maschinengewirr – Kabel, Schläuche, alle möglichen Vorrichtungen aus Plastik und Metall. Mehrere Männer in blendend weißen Overalls sprangen heraus und folgten den beiden Engländern die Treppe hinunter. Ali sah sich nach Hilfe um, nach Rat, nach Unterstützung. Eine kleine Menschenmenge hatte sich versammelt. Touristen starrten und spekulierten, dazu etliche seiner Kollegen, die allesamt von den Männern in den schwarzen Uniformen zurückgehalten wurden. Nach einem Augenblick stieg er die Treppe hinunter und ging durch den Korridor in die Grabkammer. Er stieß einen leisen Protestschrei aus, als er bemerkte, dass die Glasscheibe, die den Steinsarkophag bedeckte, beiseite gehoben worden war. Die weiß gekleideten Männer waren gerade dabei, den Deckel des vergoldeten Sarkophags im Inneren des großen Steinkastens abzuheben. Dem Unterteil des Sarges entnahmen sie eine lange, steife Platte, auf der sich staubige Stoffbahnen befanden. Zügig, aber vorsichtig, manövrierten die Träger ihre Last durch den schmalen Gang hinaus.
Mittlerweile hatten Interesse und Neugier Alis ursprüngliche Sorgen abgelöst. Ja, es war wie beim letzten Mal. Es war nicht derselbe Wagen – der andere war größer gewesen –, aber soweit er es beurteilen konnte, war die Ausrüstung im Inneren dieselbe. Nur waren diesmal keine Journalisten oder Fernsehreporter hier. Er hatte sich selbst im Fernsehen gesehen, als sie die Sendung ausstrahlten – nur einen kurzen Augenblick, aber er hatte sich ein Band gekauft und diesen Teil immer und immer wieder angeschaut. Vielleicht hatten sie beim ersten Mal einen Fehler gemacht und waren zurückgekommen, um das zu korrigieren. Ja, so musste es sein. Sie würden keinen Fehler zugeben wollen, also hatten sie dafür gesorgt, dass das Ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Voranmeldung durchgezogen würde.
Plötzlich stand er allein in der Grabkammer, also lief er durch den Korridor zurück und die Treppe hinauf. Sie hatten die Trage und was sich darauf befand in den Lieferwagen befördert und die Türen geschlossen. Maschinen summten und knarzten. Es piepste, und irgendwelche Leute redeten miteinander. Er kauerte sich hin, zündete sich eine Zigarette an, wartete und dachte an ... ihn. Wie gefiel es ihm wohl, herausgezerrt zu werden aus dem, was er sich als letzte Ruhestelle erhofft hatte, von pietätlosen Fremden angestarrt zu werden, untersucht und diskutiert zu werden, als wäre er ein Stück Holz? Er war ein Ungläubiger gewesen, ein Heide, aber auch er war ein Mensch, und er war in seiner Zeit seinen eigenen Göttern treu ergeben gewesen.
Die Sonne stand tief über den Berghängen, als die Türen des übergroßen Vans sich wieder öffneten. Die merkwürdige Form unter den Stoffbahnen wurde herausgehoben und zurück in das Grab getragen.
»Sie haben uns sehr geholfen«, sagte der Engländer. Er lächelte jetzt zum ersten Mal, und Ali sah das Glitzern eines Goldzahns oder einer Füllung. »Ich werde Dr. Khifaya darüber informieren. Hier.«
Ali nahm das gefaltete Stück Papier, sah es aber erst an, nachdem die Männer in ihre Fahrzeuge gestiegen und davongebraust waren. Er entfaltete die Banknote. Er verzog die Lippen. Zehn erbärmliche ägyptische Pfund. Engländer.
***
»Ich verstehe das nicht«, sagte ich. »Was ist daran so schrecklich? Keiner hat dich darüber im Vorfeld informiert, aber vielleicht war es eine rasch gefällte Entscheidung, und sie haben versucht, dich zu erreichen, und es nicht geschafft, weil du in der Wüste unterwegs warst oder so. Oder vielleicht ...«
Meine Stimme verebbte. Die beiden saßen da und starrten mich an. »Oh du meine Güte«, sagte ich.
»Heute ist sie ein bisschen langsam«, erklärte John und nickte Feisal zu. »Hab Geduld mit ihr. Was hast du getan, nachdem Ali dich über den – äh – Besuch in Kenntnis gesetzt hat?«
»Das Grab besichtigt.« Feisal zog ein zerknittertes weißes Taschentuch aus seiner Tasche und wischte sich über die Stirn. »Auf den ersten Blick sah alles ganz normal aus. Aber ich hatte so ein Gefühl ... eines dieser komischen Gefühle. Es war unwahrscheinlich, nahezu unmöglich, dass man mich nicht im Vorfeld über so etwas informiert hätte. Ich hätte Ali gern rausgeschickt, aber ich konnte den Deckel des Sarkophags nicht allein anheben, er ist zu schwer. Gemeinsam gelang es uns, ihn gerade weit genug beiseitezuschieben, um hineinzuschauen. Der arme Hund ist zerstückelt worden, wisst ihr, deswegen liegen die einzelnen Teile in Baumwolle gebettet auf einem Brett mit Sand unter einer Art Decke. Auf den ersten Blick sah alles ganz normal aus. Aber als ich die Decke zur Seite schlug, wo sein Kopf hätte sein müssen, war er nicht da. Er war verschwunden. Kein einziger Knochen war mehr da.«
»Tutanchamun?«, keuchte ich. »Sie haben Tutanchamun gestohlen?«
Kapitel 2
Johns einzige Reaktion bestand in einer hochgezogenen Augenbraue. Er hatte es kommen sehen. Ich hatte das Gefühl, er wünschte, er wäre selbst darauf gekommen, so eine Nummer durchzuziehen.
»Aber wieso?«, fragte ich. »Warum um Himmels willen würde irgendjemand eine ausgeleierte, vertrocknete alte Leiche klauen?«
»Dazu kommen wir später«, sagte John. »Das Wichtigste zuerst. Wer weiß noch davon, Feisal?«
»Du meinst, wer weiß, dass er verschwunden ist? Nur Ali und ich. Wir haben alles wieder in Ordnung gebracht. Genau genommen kann ich nicht einmal sicher sein, ob seine Beine nicht noch da waren, so weit konnte ich nicht unter die Platte greifen, aber ...«
»Igitt«, sagte ich.
»Wir können davon ausgehen, dass sie auch diesen Teil mitgenommen haben, wenn der Rest fehlt«, sagte John. »Sie hatten jede Menge Zeit. Wird Ali den Mund halten?«
Feisal lachte bitter. »Das wird er allerdings. Er würde ganz sicher seinen Job verlieren und wahrscheinlich sogar im Gefängnis landen – in der Zelle neben mir.«
»Jetzt komm schon«, protestierte ich. »Es war nicht deine Schuld. Du warst ja nicht einmal da.«
»Das Supreme Council wird einen Sündenbock benötigen, und es ist in meinem Zuständigkeitsbereich geschehen. Mein Gott, Vicky, Tutanchamun ist ein Symbol, eine Legende, ein einzigartiger historischer Schatz. Die Medien werden durchdrehen. Sie werden in den Late-Night-Shows Witze darüber machen, wir werden von jedem Museum und jeder wissenschaftlichen Abteilung weltweit kritisiert werden. Sie werden alle sagen: Ägypten hat ja Nerven; erst zu fordern, dass wir ihnen ihre Kunstschätze zurückgeben, wenn sie dann ein paar Betrüger mit dem berühmtesten Pharao der Welt einfach auf und davon marschieren lassen!«
»Hmmm.« John rieb sich das Kinn. »Ich fürchte, da hast du recht. Es wäre ganz schön peinlich für die Regierung.«
»Peinlich!« Feisal warf die Hände in die Luft. »Peinlich ist, wenn man der Frau des Botschafters sein Getränk in den Schoß kippt. Das hier ist beschämend, entehrend, Köpfe werden rollen. Aber wenn ich ihn wiederbeschaffen könnte ...« Er wandte sich an John; seine langen, geschmeidigen Hände vollführten eine bittende Geste.
Ihn, nicht sie, dachte ich. Er sprach die ganze Zeit über diese zerkrümelte Mumie, als wäre sie ein lebendiger Mensch. Na ja, immerhin hatte sie – er – gelebt, vor langer Zeit. Er war kein lebloser Gegenstand wie ein Sarg oder eine Statue, sondern ein Mensch gewesen, ein Herrscher, unglaublich gut konserviert, und das für eine unglaublich lange Zeit. Ich begann eine Ahnung davon zu bekommen, warum Feisal solche Panik empfand. Man musste sich nur vorstellen, dass jemand die Gebeine Georg Washingtons stähle – und der war erst seit zweihundert Jahren tot.
»Wir werden dir helfen, wenn wir können«, sagte ich, wobei ich mich fragte, wie wir das anstellen sollten.
»Du hast es nicht verstanden, Vicky«, sagte John. Er lehnte sich zurück und legte die Fußgelenke über Kreuz, ganz gelassen. »Du glaubst, ich stecke dahinter, Feisal. Deswegen bist du hergeeilt, um mich zu bitten, sie ...«
»Ihn.«
»Entschuldigung ... ihn zurückzugeben.«
»Ihn bitte zurückzugeben.«
»Meine Güte, Feisal«, sagte ich. »Das ist doch verrückt.«
»Nicht unbedingt«, sagte John nachdenklich. »Es wäre durchaus etwas, was ich in jüngeren und wilderen Jahren hätte getan haben können, schon allein der Herausforderung wegen. Die Operation war gut geplant. Sie haben einen Zeitpunkt gewählt, zu dem du anderswo warst, sie haben bis spät am Tag gewartet, wenn die Wärter müde sind und nach Hause wollen, sie sind schnell gewesen und mit arroganter Autorität aufgetreten. Dein Freund Ali sah keine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Wahrscheinlich war es sogar sein Glück, dass er es nicht versucht hat. Die Sache mit den Typen in den schwarzen Uniformen gefällt mir gar nicht.« John brütete, dachte darüber nach. »Ein Ablauf, den Ali schon von einem anderen Mal kannte, dazu korrekte Unterlagen – sogar ein Schlüssel zum Grab. Eine Kopie davon wäre nicht schwer zu besorgen gewesen. Er konnte es nicht überprüfen, du hattest keinen Handyempfang, selbst wenn du ein Telefon bei dir gehabt hättest, und zum Supreme Council wäre er niemals durchgekommen. Die Ausrüstung war natürlich getürkt. Ali hat den Unterschied nicht bemerkt, genauso wenig wie er mir aufgefallen wäre, wenn alles nur beeindruckend genug aussah. Sie haben sie – äh, ihn – in den Laster gesteckt, ihn von der Sandauflage in irgendeinen anderen Behälter verfrachtet, dann eine halbe Stunde rumgesessen und interessante technische Geräusche produziert – und sich dabei garantiert totgelacht – und dann die leere Bahre wieder hineingetragen. Oder vielleicht ... vielleicht hatten sie sogar eine zweite Bahre vorbereitet. Dann müssten sie die zerbrechlichen Knochen nicht bewegen. Ja, so hätte ich es gemacht. Nur ...« Er beugte sich vor, die Finger ineinander verschränkt, und sah seinen Freund intensiv an. »Nur war ich es nicht, Feisal. Abgesehen von der Tatsache, dass ich eine so miese Nummer nicht mit dir durchziehen würde, war ich in London und kann es sogar beweisen.«
Ein Knoten tief in meiner Brust lockerte sich. Ich hatte es nicht geglaubt – nicht wirklich –, aber ich hatte ihn seit zwei Wochen nicht gesehen, und der Modus Operandi, wie wir Gangsterbräute sagen, erinnerte an einige seiner Aktionen.
»Vielleicht war es deine Gang ...«, begann Feisal, der nicht vollständig überzeugt war.
»Ich habe keine verdammte Gang! Gangs bestehen vor allem aus besonders dummen, verdammt unehrlichen Menschen, die für den jeweils höchsten Bieter arbeiten. Ich habe aus schmerzhafter Erfahrung gelernt, dass ich niemandem trauen kann, außer mir selbst. Deswegen habe ich ...«
»John«, sagte ich scharf.
»Oh ja.« Er sah auf die Uhr. »Ich brauche noch mehr Details darüber, aber wie Vicky mich zu Recht erinnert, läuft uns die Zeit davon. Kannst du ein charmanter und wohlgelaunter Gast sein, während Schmidt und seine Freundin da sind? Er darf keinen Wind von der Sache bekommen.«
»Allah verhüte, dass es so weit käme«, sagte Feisal. Er sah ein wenig mehr ... nun ja, fröhlicher sah er nicht aus. Ein bisschen weniger geplagt. »Ich gehe besser. Schmidt hat stets eine ungute Wirkung auf mein Nervenkostüm, das bereits angeschlagen ist. Ruft mich an, wenn er wieder weg ist.«
»Wo erreichen wir dich?«, fragte ich.
Feisal sah mich mit leerem Blick an. »Ich weiß nicht. Ich bin direkt vom Flughafen hergekommen.«
Von der Straße draußen hörten wir das Quietschen gequälter Reifen. Ich kannte das Geräusch. »Oh mein Gott, das ist Schmidt«, rief ich. »Er ist zu früh. Was machen wir jetzt?«
Entsetzt lief Feisal zur Tür. Caesar folgte ihm und bellte hoffnungsvoll.
»Nach oben«, befahl John. »Zweite Tür rechts.«
Feisal hielt nicht an, sondern wirbelte nur herum und rannte die Treppe hinauf. John griff nach seiner Aktentasche und warf sie ihm hinterher. »Schließ die Tür ab. Wir sagen dir Bescheid, wenn die Luft rein ist. Und keinen Mucks!«
Feisal blieb auf der Treppe stehen. »Und wenn ich mal ...«
»Dann musst du improvisieren«, zischte John zwischen zusammengebissenen Zähnen. Es klingelte an der Tür. Caesar bellte. Feisal stieß einen leisen Schrei aus und floh.
»Tief durchatmen, Vicky«, sagte John. »Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde. Ins Maul des Todes, in der Hölle Schlund ... Oder ist es andersherum? Ich mache ihnen auf. In Ordnung?«
Ich konnte immer noch kein Wort hervorbringen und nickte nur. Es wird schon gut gehen, sagte ich mir. Wir mussten Schmidt einfach nur ein paar Stunden bei Laune halten und ihn in Unwissenheit lassen. Das sollte doch zu schaffen sein.
John riss die Tür auf und setzte zu einem jovialen Gruß an. Doch dann holte er nur scharf Luft, und da sah ich auch schon die Frau neben Schmidt. Seine neue Freundin. Suzi Umphenour.
Das war nicht ihr richtiger Name. Es war der Name, unter dem ich sie kennengelernt hatte, als sie Mitpassagierin auf der unglückseligen Queen of the Nile bei meiner letzten Reise nach Ägypten gewesen war – unserer letzten kriminalistischen Ermittlung, wie Schmidt es nannte. Mein Auftrag hatte darin bestanden, einen berühmt-berüchtigten Dieb ausfindig zu machen, der angeblich das Kairoer Museum bestehlen wollte. Suzi spielte die einfältige Gesellschaftsmatrone aus Tennessee mit einem solchem Schmalz, dass ich darauf hätte kommen können, dass es eine Karikatur war; ich hatte jedoch andere Dinge im Kopf gehabt und nicht bemerkt, hinter wem – oder was – sie wirklich her war, bis die ganze unselige Angelegenheit sich erledigt hatte und ich ihr in einem gewissen Büro in der US-Botschaft in Kairo wiederbegegnete. Von wem genau sie ihre Befehle entgegennahm, war nie klar geworden. Interpol? Irgendwelche schönen Großbuchstabenkombinationen? CIA, NSA, BFAE?
Ich hätte wissen müssen, dass Schmidt ihre Nähe suchen würde. Er hatte sie als »eine wirklich ansehnliche Frau« beschrieben. Das ist das Grundprinzip meines Lebens: Wenn etwas schiefgehen kann, dann tut es das auch. Von allen Menschen auf der Erde war diejenige, die ich an diesem Abend am wenigsten sehen wollte, eine Frau, die für irgendwelche Organisationen arbeitete, die auf Verbrecherjagd waren. FBI, BFE, DAR, AA, PETA?
All das und noch ein wenig mehr wirbelte mir durchs Gehirn, während ich wie erstarrt dastand.
»Überraschung!«, quiekte Schmidt. »Ein Abend voller Überraschungen, nicht wahr? John, mein Freund, wie nett, dich zu sehen! Ihr erinnert euch an Suzi? Sie ist meine Überraschung!«
»Und eine wirklich schöne Überraschung«, sagte John, der sich alle Mühe gab. »Kommt herein. Gebt mir eure Mäntel.«
Schmidt war mit Päckchen beladen. »Ich bringe das in die Küche«, erklärte er.
Ich folgte ihm. Im Vergleich zu Suzi war Schmidt das kleinere der beiden Übel. »Die hier muss in den Kühlschrank«, verkündete er und erledigte es gleich selber. »Die hier ...« Er sah Caesars hoffnungsvollen Blick. »... auf ein hohes Regal. Und hier ist Wein.«
Ich nahm ihm die Flasche ab. »Ich wusste nicht, dass ihr, Suzi und du, ein Paar seid.«
Schmidt grinste. »Alles erzähle ich dir eben nicht, Vicky. Ja, wir sind seit einiger Zeit Freunde. Gute Freunde.«
Wenn er jetzt kichert, dachte ich, erschlage ich ihn mit der Flasche.
Schmidt richtete sich auf, eine Hand in die Hüfte gestemmt, das Kinn hochgereckt. »Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie gut ich aussehe.«
Ich hatte ihn auch nicht wirklich angeschaut. Der gute alte Schmidt, eins sechzig auf Zehenspitzen, rund wie eine Orange, rot wie ein Apfel, weiß gebauschter Schnauzer ... Augenblick mal, der war gar nicht mehr weiß – sondern braun. Von einem tiefen, entschiedenen Braun. Wenn ich nicht so entgeistert über Suzi gewesen wäre, hätte ich das sofort bemerkt. Nun drangen auch andere Details in mein Bewusstsein. Seine Wangen waren nicht mehr ganz so rund und prall, und sein Bauch schien sich hinter irgendeine Art solider Barriere zurückgezogen zu haben.
»Du hast deinen Schnurrbart gefärbt«, sagte ich.
»Nicht gefärbt, ich habe seine natürliche Farbe wiederhergestellt«, sagte Schmidt empört »Es ist ein besonderer Wirkstoff für frühzeitig ergraute Personen. Ist das alles, was dir auffällt?« Er klopfte sich auf den Bauch, zuckte zusammen, fuhr fort: »Ich habe zehn Kilo abgenommen. Ich bin fitter als die meisten Männer, die halb so alt sind wie ich. Willst du meine Brustmuskeln sehen?«
»Mein Gott, nein! Ich meine ...« Diese Neuigkeit ließ mich beinahe Feisal vergessen, die verschwundene Mumie und die alte Saufnase Suzi, die unter keinen Umständen, KEINEN UMSTÄNDEN, Wind von den beiden Vorgenannten bekommen durfte. »Du siehst toll aus«, murmelte ich. »War das dein Urlaub? Eine Fett ..., äh, ich meine, ein Sanatorium?«
»Eine Gesundheitsklinik«, korrigierte mich Schmidt. »In der Schweiz.« Er nahm ein Messer aus dem Halter über dem Tresen und drapierte Käsestücke und Apfelschnitze auf einen Teller. (Äpfel? Schmidt?) »Komm, wir wollen unseren Freunden Gesellschaft leisten. Äh – ich wüsste es zu schätzen, wenn du Suzi gegenüber nichts von der Klinik erwähnen würdest.«
Aus Johns erleichtertem Blick schloss ich, dass das Gespräch recht schleppend verlief. Er sah mich an und reichte mir einen Drink. Enttäuscht stellte ich fest, dass es vor allem Tonic war, aber er hatte natürlich recht, wir mussten bei Verstand bleiben.
Die nächste halbe Stunde redete Schmidt praktisch pausenlos. Mein Gott, war das langweilig. Kalorien, gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, Kohlehydrate, der glykämische Index, die Lebensmittelpyramide, das Verhältnis von diesem zu jenem und noch etwas anderem zogen sich durch seinen Vortrag. Er erwähnte Rotwein und Bitterschokolade. Es gab keinen Diättipp, ganz egal, ob wissenschaftlich untermauert oder nicht, den Schmidt ausließ. John lauschte offensichtlich fasziniert. Sein Blick wanderte von dem Teller mit Apfelschnitzen zu Schmidts leuchtend braunem Schnauzer und der Flasche Wein (natürlich Rotwein). Ich betrachtete Suzi.
Als Südstaatenschönheit hatte sie überbordende Massen von blondem Haar, ein blendend weißes Lächeln, bei dem sie viele Zähne zeigte, und eine gut entwickelte, offenherzig zur Schau gestellte Figur. Als ich sie das letzte Mal gesehen hatte, in der Botschaft, hatte sie ein maßgeschneidertes Kostüm getragen, sehr businesslike. Nur das Grinsen war mir bekannt vorgekommen. Es war immer noch dasselbe, aber mittlerweile war ihr Haar kurz, und Spuren von Silber durchzogen die sandfarbenen Wellen. Ich fragte mich, wie alt sie war. Über vierzig. Unter sechzig? Das war heutzutage schwer zu sagen. Ihre schlanke Figur deutete darauf hin, dass sie regelmäßig Sport trieb. Heute Abend war sie leger in Jeans und T-Shirt gekleidet, Letzteres weit genug, um noch dezent zu sein, und doch eng genug, dass Schmidts Blick immer wieder auf ihren Brüsten zum Ruhen kam. Ich hegte keinerlei Zweifel daran, dass Schmidts Interesse romantischer Natur war, nicht professioneller. Aber was war mit ihr?
Ich versuchte mir die Einzelheiten des letzten Gespräches, das ich mit Suzi geführt hatte, ins Gedächtnis zu rufen. Meine Erinnerung daran war undeutlich. Ich war ziemlich sauer gewesen, oder, um ganz ehrlich zu sein, sogar stinkwütend. Als ich mich einverstanden erklärt hatte, auf diese verdammte Kreuzfahrt zu gehen, hatte man mir versichert, dass die anonymen Offiziellen, die mich aussandten, eine ebenso anonyme Agentin an Bord haben würden, die mich retten sollte, falls es irgendwelche Probleme gäbe. Es hatte einen Haufen Probleme gegeben, und Suzi hatte die ganze Chose vermasselt. Es war nicht allein ihre Schuld, und der Großteil meiner Wut richtete sich gegen ihre Chefs, wer auch immer sie waren. Ich hasste diese Leute – FBI, CIA, die ganze Bande. Sie waren so besessen von ihren diversen Sicherheitsvorkehrungen, dass die über allem anderen standen, inklusive des Wohlergehens der Leute, die sie angeblich beschützten. Sie reden nicht einmal miteinander.
Was auch immer Suzis offizielle Funktion sein mochte, es musste irgendetwas mit Kunst und Antiquitätenbetrug zu tun haben, sonst wäre sie nicht auf dieser Kreuzfahrt gewesen. »Sir John Smythe« war immer noch von Interesse für mehrere europäische Regierungen, ganz zu schweigen von Interpol. Meine Verbindung zu dem berühmt-berüchtigten Meisterdieb war ausgezeichnet dokumentiert. Suzi wusste vielleicht nicht, dass Smythe und John Tregarth, ein anerkannter Händler legaler Antiquitäten, ein und derselbe waren, aber am Ende unseres Gespräches damals hatte sie etwas gesagt ... Nein, sie hatte eigentlich darüber nichts gesagt, sie hatte nur geguckt, als wäre ...
Den berüchtigten Sir John Smythe zu fassen wäre ein Fest für jeden Gesetzeshüter. Versuchte Suzi, über mich an John heranzukommen und über Schmidt an mich? Oder las ich zu viel hinein in einen Blick, bildete ich mir die Anspielung darin nur ein? Warum konnte sie sich nicht einfach in Schmidt verknallt haben? Ich konnte ihn mir als nichts anderes vorstellen als meinen niedlichen, kleinen, verrückten, drolligen Begleiter, aber das war ja kein Grund, davon auszugehen, dass er keiner Frau gefallen könnte. Chacun à son goût. Er war witzig, charmant, klug, und, Gott segne ihn, er hungerte sich sogar in relative – man kann es nur relativ nennen – Fitness. Ein bisschen Gewicht zu verlieren schadete ihm bestimmt nicht. Aber wenn Suzi ihm sein treues Herz brach, würde ich sie umbringen.
Wir aßen und tranken und hörten Schmidt zu, der den ganzen Abend von Fitness schwafelte. Ich versuchte Suzi über ihre Arbeit auszuhorchen, ohne mir anmerken zu lassen, warum ich daran so interessiert war. »Irgendwelche ungewöhnlichen Fälle in letzter Zeit?« (eine Frage, bei der John sich auf die Unterlippe biss und die Augen himmelwärts verdrehte) brachte mir nur ein extrem breites Grinsen ein und die nichtssagende Bemerkung: »Nichts, worüber ich sprechen könnte.«
Normalerweise muss ich Schmidt rauswerfen, solange er noch sprechen kann, oder ihn auf meinem Sofa zum Schlaf betten, wenn er zu viel gebechert hat. An diesem Abend war er derjenige, der verkündete, nun wäre es an der Zeit, unseren reizenden Abend zu beenden. Der Blick, den er Suzi zuwarf, war, wie man so schön sagt, bedeutungsschwanger. Sie erwiderte ihn und erhob sich gehorsam. Sie hielten sich nicht lange mit der Verabschiedung auf.
Ich blieb in der Tür stehen, bis ich Schmidt aufs Gas treten und davonbrausen hörte. Dann drehte ich mich sehr langsam zu John um.
»Ich brauche etwas«, krächzte ich. »Ich weiß nicht, was, aber ich brauche es dringend.«
»Du hast genug zu trinken gehabt, Rauchen ist ungesund, und wir haben keine Zeit für – wie war das Wort? – Ablenkung.«
»Verdammt noch mal, ich habe das Gefühl, dir macht das alles sogar Spaß!«
»Was mir Spaß macht, ist die Tatsache, dass bislang keiner versucht hat, mich zu erschießen, zu erstechen oder zu schlagen. Holen wir Feisal ... Ah, da ist er.«
»Ich habe von oben gesehen, wie sie gefahren sind.« Feisal kam vorsichtig die Treppe herunter. »Wer war die Frau?«
John und ich sahen einander an. »Das spielt im Augenblick keine Rolle«, sagte John. »Ich vermute, Feisal hat Hunger. Er hat noch nicht zu Abend gegessen.«
»Und auch nicht zu Mittag oder, soweit ich mich erinnern kann, zum Frühstück«, sagte Feisal.
Wir setzten uns um den kleinen Küchentisch, auf dem die Überreste von Schmidts Gaben ruhten. Obwohl er sich strikt an seine Diät gehalten hatte, wollte er uns andere nicht darben lassen; Feisal machte sich über ein Brot mit Leberpastete her.
»Und was tun wir jetzt?«, fragte er. Seine Augen, groß und schimmernd und braun, fixierten John mit einem Hauch rührender Hoffnung.