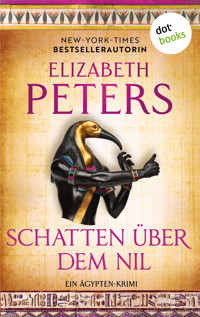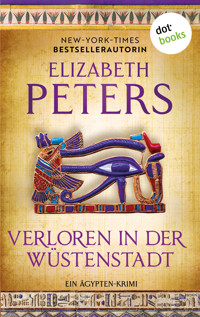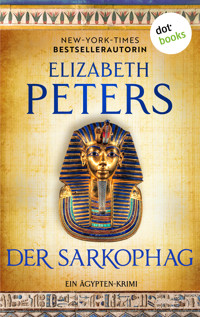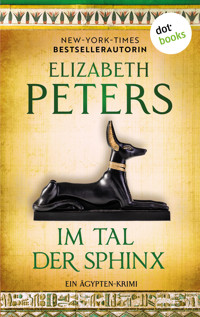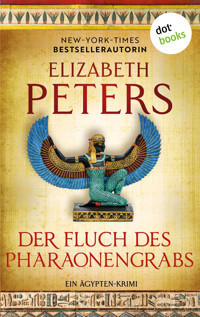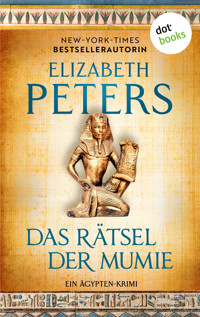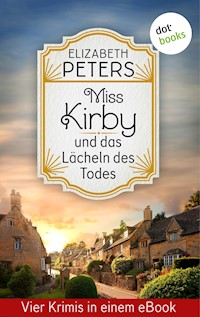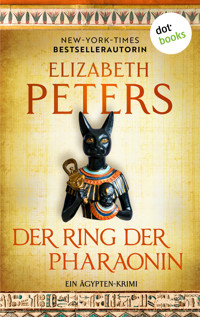
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Auftrag, ein Toter im Nil – und eine unerschrockene Archäologin in Bestform! Während einer Silvesterparty im berühmten Shepards Hotel in Kairo wendet sich ein geheimnisvoller Fremder an Archäologin Amelia Peabody. Er bittet sie und ihren Mann Emerson, das Grabmal der Königsmutter Tetisheri zu finden und vor Grabräubern zu schützen. Bevor er jedoch nähere Erklärungen geben kann, verschwindet der Mann spurlos … Vom detektivischen Spürsinn getrieben, segelt das Forscherehepaar auf den Spuren des mysteriösen Mannes nach Theben, unterstützt – oder vielmehr beeinträchtigt –von Teenagersohn Ramses und Adoptivtochter Nefret. Doch schon bald verwandelt sich der heitere Familienausflug in eine gefährliche Schatzsuche: Wieder einmal muss die mutige Amelia ihre Liebsten vor Entführern, alten Flüchen und hinterlistigen Mördern beschützen – natürlich nicht, ohne die ein oder andere bahnbrechende Entdeckung zu tätigen! »Eine Schriftstellerin, die so beliebt ist, dass Bibliotheken ihre Bücher hinter Schloss und Riegel halten müssen.« – Washington Post Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Ägypten-Krimi »Der Ring der Pharaonin« ist der siebte Teil der mitreißenden Amelia-Peabody-Reihe von Elizabeth Peters. Die Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Während einer Silvesterparty im berühmten Shepards Hotel in Kairo wendet sich ein geheimnisvoller Fremder an Archäologin Amelia Peabody. Er bittet sie und ihren Mann Emerson, das Grabmal der Königsmutter Tetisheri zu finden und vor Grabräubern zu schützen. Bevor er jedoch nähere Erklärungen geben kann, verschwindet der Mann spurlos … Vom detektivischen Spürsinn getrieben, segelt das Forscherehepaar auf den Spuren des mysteriösen Mannes nach Theben, unterstützt – oder vielmehr beeinträchtigt –von Teenagersohn Ramses und Adoptivtochter Nefret. Doch schon bald verwandelt sich der heitere Familienausflug in eine gefährliche Schatzsuche: Wieder einmal muss die mutige Amelia ihre Liebsten vor Entführern, alten Flüchen und hinterlistigen Mördern beschützen – natürlich nicht, ohne die ein oder andere bahnbrechende Entdeckung zu tätigen!
Über die Autorin:
Elizabeth Peters (1927 – 2013) ist das Pseudonym von Barbara G. Mertz, einer amerikanischen Autorin und Ägyptologin. Sie promovierte am berühmten Orient-Institut in Chicago und wurde für ihre Romane und Sachbücher mit vielen Preisen ausgezeichnet. Einer dieser Preise, der »Amelia Award«, wurde sogar nach ihrer beliebten Romanfigur benannt, der bahnbrechenden Amelia Peabody. Besonders ehrte sie jedoch, dass viele ÄgyptologInnen ihre Bücher als Inspirationsquelle anführen.
Elizabeth Peters veröffentlichte bei dotbooks die folgenden eBooks:
Die »Amelia Peabody«-Reihe:
»Das Rätsel der Mumie«
»Der Fluch des Pharaonengrabes«
»Im Tal der Sphinx«
»Der Sarkophag«
»Verloren in der Wüstenstadt«
»Schatten über dem Nil«
»Der Ring der Pharaonin«
Die »Vicky Bliss«-Reihe:
»Vicky Bliss und der geheimnisvolle Schrein«
»Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde«
»Vicky Bliss und der blutrote Schatten«
»Vicky Bliss und der versunkene Schatz«
»Vicky Bliss und die Hand des Pharaos«
Ihre Krimireihe um Jacqueline Kirby:
»Der siebte Sünder – Der erste Fall für Jacqueline Kirby«
»Der letzte Maskenball – Der zweite Fall für Jacqueline Kirby«
»Ein preisgekrönter Mord – Der dritte Fall für Jacqueline Kirby«
»Ein todsicherer Bestseller – Der vierte Fall für Jacqueline Kirby«
Unter Barbara Michaels veröffentlichte bei dotbooks ihre Romantic-Suspense-Romane:
»Der Mond über Georgetown«
»Das Geheimnis von Marshall Manor«
»Die Villa der Schatten«
»Das Geheimnis der Juwelenvilla«
»Die Frauen von Maidenwood«
»Das dunkle Herz der Villa«
»Das Haus des Schweigens«
»Das Geheimnis von Tregella Castle«
»Die Töchter von King’s Island«
Sowie ihre historischen Liebesromane:
»Abbey Manor – Gefangene der Liebe«
»Wilde Manor – Im Sturm der Zeit«
»Villa Tarconti – Lied der Leidenschaft«
»Grayhaven Manor – Das Leuchten der Sehnsucht«
***
eBook-Neuausgabe November 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »The Hippopotamus Pool« bei Grand Central Publishing, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1997 im ECON Verlag
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe Copyright © 1996 by MPM Manor, Inc
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by ECON Verlag GmbH, Düsseldorf und München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)
ISBN 978-3-98952-294-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Der Ring der Pharaonin
Ein Ägypten-Krimi. Amelia Peabody 7
Aus dem Amerikanischen von Karin Dufner, Kollektiv Druck-Reif
dotbooks.
Widmung
Für George und Dennis
Danksagung
Wegen dieses Buches habe ich fast alle meine Ägyptologenfreunde mit Fragen gelöchert und belästigt. Folgenden Personen bin ich zu besonderem Dank verpflichtet, da sie mir vergriffene Bücher und verschiedene Photographien zur Verfügung stellten und mir mit Rat und Tat zur Seite standen:
Dennis Forbes, Herausgeber von KMT (der mich auch zum Titel dieses Buches angeregt hat); George B. Johnson, seinem fähigen Kollegen, der überdies ein ausgezeichneter Photograph ist; der Wilbour Library of Egyptology des Brooklyn Museums; Dr. Donald Ryan, der mir Tetischeris Grüße übermittelte; allen Mitarbeitern der epigraphischen Forschungsgesellschaft des Chicago House in Luxor, besonders dem Mudir, Peter Dorman, der mich gegen meinen erbitterten Widerstand auf die Spitze der Drah Abu’l Naga schleppte; Dr. Daniel Polz, der sich höflicherweise mit der Entdeckung von Tetischeris Grab geduldete, bis ich die Gelegenheit dazu bekam; dem Institut für Orientalistik, seiner Bibliothek und seinem Direktor, Dr. William Sumner; Dr. Peter Der Manuelian, der die Karte und den Plan des Grabes entwarf. Er ist meinen (oft verwirrenden) Anweisungen gefolgt, weshalb ich die Schuld für sämtliche Fehler und/oder Abweichungen auf mich nehme.
Außerdem möchte ich Dr. Edna Russman danken, die mich auf die Möglichkeit hinwies, es könnte sich bei der Statue der Tetischeri um die Kopie eines alten Originals und nicht um eine unverfrorene Fälschung handeln. Sie räumte gnädig ein, daß Emerson vielleicht schon vor ihr auf diesen Gedanken gekommen ist.
Die handelnden oder erwähnten Personen in diesem Roman
Abd el Hamed – Antiquitätenhändler und Fälscher, wohnhaft in Gurneh.
Abdullah ibn Hassan al Wahlhab – Reis (Vorarbeiter) von Emersons ägyptischer Mannschaft.
Ali – ein Suffragi (Zimmerkellner) im Hotel Shepheard.
Ali, Mohammed usw. – Abdullahs Söhne, die ebenfalls für die Emersons arbeiten.
Ali Murad – Antiquitätenhändler und amerikanischer Konsulatsmitarbeiter in Luxor.
Amherst, William – Cyrus’ Assistent, ein junger Ägyptologe, der mit dieser Geschichte eigentlich nur wenig zu tun hat.
Bertha – eine geheimnisvolle Frau und alte Feindin der Emersons.
Brugsch, Emile – Assistent von Masperso, dem Archäologen, der als erster das Versteck der Königsmumien in Deir el Bahri betrat.
Budge, William – Verwalter der ägyptischen und assyrischen Antiquitäten im Britischen Museum; berüchtigt für seine zweifelhaften Methoden der Exponatsbeschaffung.
Carter, Howard – frischernannter Antiquitäteninspektor für Oberägypten.
Daoud – Abdullahs Neffe.
David Todros – Abdullahs Enkel.
Emerson, Amelia Peabody – viktorianische Lady, Archäologin und Expertin für Verbrechen.
Emerson, Evelyn – Walters Frau, Enkelin des verstorbenen Grafen von Chalfont.
Emerson, Radcliffe — Amelias Gatte, »der bedeutendste Ägyptologe der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft«, von den Ägyptern »Vater der Flüche« und von seiner Frau »Emerson« genannt.
Emerson, Walter – Radcliffes Bruder, Fachmann für die Sprachen des alten Ägypten.
Emerson, Walter, junior – Amelias und Radcliffes Sohn, bei seinen Freunden als Ramses, beim Rest der Welt als Afreet (Dämon) bekannt.
Forth, Nefret – Adoptivtochter von Amelia und Emerson, Enkelin des verstorbenen Lord Blacktower.
Layla – Abd el Hameds äußerst interessante Gattin.
Mahmud – Steward auf der Dahabije (Hausboot) der Emersons.
Marmaduke, Gertrude – Hauslehrerin der Emerson-Kinder. Maspero, Gaston – 1899 das zweite Mal zum Leiter der Antiquitätensammlung ernannt.
Murch, Chauncey – ein amerikanischer Missionar und Antiquitätenhändler in Luxor.
Newberry (Percy) – englischer Ägyptologe.
O’Connell, Kevin – Starreporter des Daily Yell.
Petrie, William Flinders – Emersons größter Konkurrent um den Titel »Vater der wissenschaftlichen Archäologie«.
Quibell, J. F. – frischernannter Antiquitäteninspektor für Unterägypten.
Riccetti, Giovanni– früherer Drahtzieher des illegalen Antiquitätenhandels in Luxor; will diesen Posten unter allen Umständen zurückerobern.
Sethos, alias »Meisterverbrecher« – früherer Drahtzieher des illegalen Antiquitätenhandels in ganz Ägypten; größter Feind von Amelia und Emerson (und Ramses).
Shelmadine, Leopold Abdullah, alias Mr. Saleh – Reinkarnation des Hohepriesters Heriamon oder Mitglied einer Grabräuberbande? Vielleicht auch beides?
Vandergelt, Cyrus – amerikanischer Millionär und begeisterter Hobbyarchäologe.
Washington, Sir Edward – zweitgeborener Sohn mit einem Talent für archäologische Photographie und einem zweifelhaften Ruf bei den Damen.
Willoughby, Dr. – englischer Arzt, wohnhaft in Luxor.
Einleitung
Für diejenigen Leser, die mit Mrs. Emersons Tagebüchern noch nicht vertraut sind, drucken wir mit Genehmigung des National Autobiographical Dictionary (45. Auflage) folgende Textpassage ab:
Das genaue Datum meiner Geburt ist nicht von Bedeutung. Wirklich zu leben begann ich ohnehin erst im Jahr 1884, als ich bereits Ende Zwanzig war.i In jenem Jahr nämlich reiste ich mit einer Freundin, Evelyn Forbes, nach Ägypten, wo ich auf die drei Dinge stieß, die meinem Dasein einen Sinn und ein Ziel geben sollten: das Verbrechen, die Ägyptologie und Radcliffe Emerson!
Emerson (damals am Anfang seiner bemerkenswerten Archäologenlaufbahn, die in diesem Lexikon an gesonderter Stelle behandelt wird) und sein Bruder Walter führten Ausgrabungen in Amarna, einem abgelegenen Ort in Mittelägypten, durch. Kurz nach meiner und Evelyns Ankunft wurden die Arbeiten durch eine Reihe außergewöhnlicher Vorkommnisse gestört, in denen eine scheinbar belebte Mumie eine Rolle spielte. Die Enttarnung des schurkischen Urhebers dieses Possenspiels hinderte uns nicht daran, die Ausgrabungssaison zu einem erfolgreichen Ende zu bringen.
Kurz darauf heiratete ich Emerson, und auch Evelyn und Walter wurden ein Paar. Die Geburt unseres einzigen Kindes, Walter Peabody Emerson, allgemein Ramses genannt, führte zwangsläufig zu einer kurzen Unterbrechung unserer jährlichen Ägyptenreisen. Erst im Herbst 1889 führte uns die Bitte der Witwe von Lord Henry Baskerville, der bis zu seinem mysteriösen Tod in den Königsgräbern von Theben gearbeitet hatte, wieder dorthin (mit welcher Freude, kann sich der Leser sicherlich vorstellen). Natürlich gelang es uns, Lord Henrys Werk zu vollenden und das Rätsel um sein Dahinscheiden zu lösen.ii
In jenem Jahr hatten wir unseren Sohn bei Tante und Onkel in England zurückgelassen, da ihn sein zartes Alter (und gewisse persönliche Eigenschaften) sicherlich in Gefahr gebracht hätten – und mit ihm auch seine gesamte Umgebung. Allerdings hatte er schon von frühester Jugend an ein großes Talent für die Ägyptologie bewiesen, weshalb er uns (auf Beharren seines liebenden Vaters) im folgenden Jahr nach Ägypten begleitete. Eigentlich hatten wir beabsichtigt, Ausgrabungen im großen Pyramidenfeld von Dashûr durchzuführen, doch auf Veranlassung des mißgünstigen Leiters der Antiquitätenverwaltungiii verbannte man uns ins nahegelegene Mazghunah – wahrscheinlich die langweiligste und bedeutungsloseste Ausgrabungsstätte in ganz Ägypten.
Glücklicherweise wurden wir durch unsere erste Begegnung mit dem geheimnisvollen Genie namens Sethos abgelenkt, den ich jedoch lieber den »Meisterverbrecher« nenne.
Niemand weiß etwas Genaues über das Leben dieses erstaunlichen Mannes, der seine Laufbahn wahrscheinlich in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts in der Gegend von Luxor begann. Bald hatte er seine sämtlichen Konkurrenten beseitigt und herrschte nun allein über den illegalen Handel mit Antiquitäten. Alle Kunstgegenstände, die ägyptische und europäische Räuber aus Gräbern und Tempeln entwendeten, gingen durch seine Hände. Überlegene Intelligenz, absolute Skrupellosigkeit und große schauspielerische Begabung trugen zu seinem Erfolg bei; nur seine engsten Mitarbeiter wußten, wer er in Wirklichkeit war.
Uns gelang es, Sethos daran zu hindern, die Prinzessinnengräber in Dashûr auszurauben und außerdem seinen Anschlägen auf unser Leben zu entrinnen. Allerdings konnte er entkommen, und im folgenden Jahr mußten wir feststellen, daß er uns wieder auf der Spur war. Gewisse private Entwicklungen (die zu schildern den Rahmen dieses Artikels sprengen würden) gaben uns jedoch Anlaß zu der Hoffnung, daß wir ihn für immer los waren.iv
Im Herbst 1897 machten wir uns auf den Weg in den Sudan, der nach einer langen Besatzungszeit durch die Derwische gerade von ägyptischen Truppen unter britischer Führung zurückerobert wurde. Wir hatten Ausgrabungen in den Ruinen der alten kuschitischen Hauptstadt Napata geplant. Doch eine Botschaft von Willy Forth, einem alten Freund Emersons, der seit über zehn Jahren als vermißt galt, führte uns hinaus in die endlose Wüste. Die Einzelheiten dieser abenteuerlichen Suche habe ich an anderer Stelle beschriebenv; am Ende retteten wir Forths Tochter Nefret, die ihr ganzes bisheriges Leben in einer abgelegenen Oase verbracht hatte.
Im Winter 1898/1899 besuchten Emerson und ich wieder Amarna. Ramses und Nefret (inzwischen unsere Adoptivtochter) hatten wir in England zurückgelassen, und ich freute mich, meine glücklichen Erinnerungen an die erste Begegnung mit meinem geliebten Ehemann wieder zum Leben erwecken zu können. Die überraschenden Ereignisse, die in jenem Jahr unsere Arbeiten störten, sind ausschließlich privater Natur und in einer offiziellen Biographie fehl am Platzevi; es muß genügen, wenn ich sage, daß wir damals zum dritten Mal unserem großen und schrecklichen Feind, dem Meisterverbrecher, begegneten (außerdem noch einigen seiner Handlanger und einer geheimnisvollen Frau, die wir nur als Bertha kannten). Unser Abenteuer fand seinen Höhepunkt, als Sethos von der Kugel eines Mörders niedergestreckt wurde, den Emerson ihm auf den Hals gehetzt hatte – Bertha und die Handlanger verschwanden spurlos.
Häufig hat man mich schon gefragt, warum ausgerechnet wir so oft mit Verbrechern der verschiedensten Spezies zusammentrafen und -treffen. Nach eingehender Überlegung bin ich zu der Ansicht gelangt, daß zwei Faktoren dafür ausschlaggebend sind: erstens die chaotischen Zustände in der damaligen Archäologie und zweitens die Wesensart meines Gatten. Emerson hat in seinem Kreuzzug, den er führte, um die historischen Schätze Ägyptens vor Schändung zu bewahren, schon von jeher – und anfangs meist ohne fremde Hilfe – gegen Grabräuber, unfähige Antiquitäteninspektoren und gewissenlose Kunstsammler gekämpft. Natürlich muß nicht eigens erwähnt werden, daß ich ihm bei seinem Streben nach Wissen und der Jagd nach Verbrechern immer zur Seite stand.
Kapitel 1
Das Problem mit unbekannten Feinden ist, dass man sie so schwer erkennt.
Durch das offene Fenster des Ballsaals drang die milde ägyptische Nachtluft herein und kühlte die erhitzten Gesichter der Tanzenden. Seide und Satin schimmerten, Juwelen glitzerten, Goldtressen blitzten, süße Melodien erfüllten den Raum. Der Neujahrsball im Hotel Shepheard war stets das wichtigste Ereignis der Kairoer Saison. Und an jenem Abend sollte das Ende des letzten Dezembertages von noch größerer Bedeutung sein als gewöhnlich: In weniger als einer Stunde würden die Glocken den Beginn eines neuen Jahrhunderts verkünden – den 1. Januar 1900.
Nachdem ich gerade einen schwungvollen Schottischen mit Captain Carter hinter mich gebracht hatte, suchte ich mir ein ruhiges Plätzchen hinter einer Topfpalme und gab mich den Gedanken hin, die wohl jeden grüblerisch veranlagten Menschen bei einem solchen Anlaß beschäftigen. Was würden die nächsten hundert Jahre einer Welt bringen, die immer noch unter den alten Geißeln der Menschheit, Armut, Unwissen, Krieg und der Unterdrückung des weiblichen Geschlechts, litt? Obwohl ich Optimistin und überdies mit einer ausgezeichneten Vorstellungsgabe gesegnet bin (und das im Übermaß, wie mein Mann behauptet), durfte ich nicht erwarten, daß sich alle diese Probleme in einem einzigen Jahrhundert lösen würden. Allerdings vertraute ich darauf, daß mein Geschlecht schließlich die Rechte bekommen würde, die ihm so lange verwehrt geblieben waren – und daß ich selbst diesen Freudentag noch würde erleben dürfen! Berufe für Frauen! Das Wahlrecht für Frauen! Weibliche Anwälte und Ärzte! Weibliche Richter und Politiker! Frauen an der Spitze aufgeklärter Nationen, in denen das weibliche Geschlecht den Schulterschluß geschafft hatte und meine Bestrebungen unterstütze!
Meiner Ansicht nach hatte auch ich einen kleinen Beitrag zu den Veränderungen geleistet, die ich noch zu sehen hoffte. Eine Barriere hatte ich bereits niedergerissen: Als erste Frau führte ich archäologische Ausgrabungen in Ägypten durch und hatte bewiesen, daß ein »schwaches Weib« durchaus in der Lage war, dieselben Gefahren und Strapazen zu ertragen und denselben professionellen Ansprüchen zu genügen wie ein Mann. Allerdings zwangen mich Ehrlichkeit und auch zärtliche Gefühle zu dem Eingeständnis, daß ich ohne die rückhaltlose Unterstützung meinen Ehemann Radcliffe Emerson, dem bedeutendsten Ägyptologen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft niemals soviel erreicht hätte.
Obwohl es im Saal von Menschen wimmelte, zog er meinen Blick geradezu magnetisch an. Emerson ragt stets über seine Zeitgenossen hinaus. Sein hoher Wuchs, seine muskulöse Gestalt, seine markanten Züge, seine leuchtend blauen Augen, der dunkle Haarschopf über der Denkerstirn – ich könnte noch seitenlang fortfahren, Emersons körperliche und geistige Vorzüge zu beschreiben. Bescheiden danke ich dem Himmel dafür, daß er mich so reich gesegnet hat. Womit hatte ich die Liebe eines solchen Mannes verdient?
Nun, im Grunde hatte ich eine ganze Menge dazu beigetragen. Doch ich muß zugeben, daß mein eigenes Äußeres nicht unbedingt einnehmend ist (obwohl Emerson gewisse Teile meiner Anatomie durchaus schätzt). Widerspenstiges schwarzes Haar, stahlgraue Augen, eine Haltung, die eher würdig als anmutig wirkt, geringe Körpergröße – damit kann eine Frau eigentlich kein Herz gewinnen. Trotzdem war es mir gelungen, das von Radcliffe Emerson zu erobern, und nicht nur einmal, sondern sogar zweimal; während all der erstaunlichen Abenteuer, die unsere Arbeiten störten, hatte ich an seiner Seite gestanden und neben ihm gekämpft. Ich hatte ihn vor Gefahren gerettet, ihn gepflegt, wenn er krank oder verletzt war, ihm einen Sohn geschenkt ...
... und diesen Sohn bis zu seinem augenblicklichen Alter von zwölfeinhalb Jahren großgezogen. Trotz meiner Bekanntschaft mit tollwütigen Hunden, Meisterverbrechern und Mördern beiderlei Geschlechts halte ich Ramses’ Erziehung für meine herausragendste Leistung. Wenn ich an alles denke, was Ramses angestellt hat, und mir überlege, wie oft andere Menschen ihm (häufig berechtigterweise) etwas antun wollten, wird mir noch immer ganz übel.
Im Augenblick stand Emerson da und unterhielt sich mit Ramses und dessen Adoptivschwester Nefret. Mit seinem rotblonden Haar und der hellen Haut unterschied sich das Mädchen völlig von meinem Sohn, der eher aussah wie ein Araber. Allerdings stellte ich jetzt überrascht fest, daß er inzwischen so groß war wie sie. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie sehr er im letzten Sommer gewachsen war.
Ramses redete. Das tut er meistens. Ich fragte mich, was er wohl gesagt haben mochte, da Emerson finster die Stirn runzelte. Hoffentlich hielt er seinem Vater keinen ägyptologischen Vortrag. Obgleich Ramses in vielen Bereichen nur ein höchst durchschnittliches Talent an den Tag legt, ist er so etwas wie ein Sprachengenie und hat sich schon seit seiner frühen Kindheit mit dem ägyptischen Idiom befaßt. Emerson empfindet zwar einen väterlichen Stolz auf die Fähigkeiten seines Sohnes, kann es aber nicht ausstehen, wenn Ramses ihm sein Wissen unter die Nase reibt.
Ich wollte schon aufstehen und zu ihnen hinübergehen, als die Musik wieder einsetzte und Emerson – der nun noch finsterer dreinblickte – die jungen Leute wegschickte. Sobald Nefret sich umdrehte, wurde sie schon von einigen jungen Herren umringt. Doch Ramses nahm sie beim Arm und führte sie – oder besser: zerrte sie – auf die Tanzfläche. Die Herren trollten sich verlegen, alle bis auf einen, ein hochgewachsener, schlanker Bursche mit blondem Haar. Er verharrte reglos, zog die eine Augenbraue hoch und folgte Nefret mit einem kühlen, abschätzenden Blick.
Obgleich Ramses’ Manieren einiges zu wünschen übrigließen, war ich mit seinem Handeln voll und ganz einverstanden. Das hübsche Gesicht und die zierliche Figur des Mädchens zog Männer an wie eine Rose die Bienen, aber für einen Verehrer war sie noch viel zu jung – was vor allem für den blonden Gentleman galt. Ich hatte ihn zwar noch nicht kennengelernt, aber eine Menge von ihm gehört. Die ehrbaren Damen aus Kairos Europäerkreisen wußten über Sir Edward Washington so manches zu berichten. Er stammte aus einer angesehenen Familie in Northamptonshire, war jedoch der Zweitgeborene mit wenig Aussichten auf eine Erbschaft und hatte eine fatale Wirkung auf leichtgläubige junge Frauen (und auf ältere).
Die verführerischen Klänge eines Walzers von Strauß schwebten durch den Raum, und ich blickte lächelnd zu Graf Stradivarius auf, der sich mir in der eindeutigen Absicht näherte, mich zum Tanzen aufzufordern. Er war ein kahlköpfiger, würdevoller Mann und nicht viel größer als ich – aber ich tanze nun einmal für mein Leben gern Walzer. Ich wollte schon die ausgestreckte Hand des Grafen ergreifen, als dieser plötzlich von einer anderen Gestalt verdeckt wurde, die mir nun ihrerseits den Arm bot.
»Gibst du mir die Ehre, Peabody?« fragte Emerson.
Es mußte Emerson sein, denn niemand sonst nennt mich so liebevoll beim Mädchennamen, doch einen Moment lang glaubte ich zu träumen – denn Emerson tanzt nicht. Schon oft hatte er mit der für ihn typischen Vehemenz geäußert, daß er das Tanzen für einen sinnlosen Zeitvertreib hielt.
Er machte einen ziemlich merkwürdigen Eindruck. Unter seiner Sonnenbräune breitete sich eine geisterhafte Blässe aus. Die saphirblauen Augen waren glanzlos, und er hielt die Lippen eng zusammengepreßt. Das dichte, schwarze Haar war zerzaust, die breiten Schultern hatte er hochgezogen, als rechne er mit einem Schlag. Er wirkte ... er wirkte verängstigt. Das war bei Emerson, der sich vor nichts und niemandem fürchtet, sehr ungewöhnlich!
Wie hypnotisiert starrte ich ihm in die Augen und entdeckte, daß ein Funke in ihnen aufblitzte. Ich kannte diesen Funken: Er deutete auf einen Wutanfall hin, einen von Emersons berühmten Wutanfällen, die ihm bei seinen treu ergebenen ägyptischen Arbeitern den Namen »Vater der Flüche« eingebracht haben. Dann nahm sein Gesicht wieder eine dunklere Färbung an, und die Spalte in seinem markanten Kinn zitterte bedenklich.
»Mach den Mund auf, Peabody!« zischte er. »Sitz nicht da wie ein Kaninchen vor der Schlange. Gibst du mir jetzt die Ehre, verdammt?«
Obwohl es mir, wie ich glaube, nicht an Mut fehlt, kostete es mich große Überwindung einzuwilligen. Ich ging nämlich nicht davon aus, daß Emerson vom Walzertanzen auch nur den leisesten Schimmer hatte. Es hätte zu ihm gepaßt zu glauben, daß er eine Sache beherrschte, nur, weil er sich diese Überzeugung in den Kopf gesetzt hatte. Unterricht oder Übung benötigt er nicht. Allerdings ließ mich sein bleiches Gesicht jetzt vermuten, daß er mindestens ebenso große Angst hatte wie ich, und so siegte die Liebe über die Sorge um meine Zehen und meine zarten Abendschühchen. Ich legte meine Hand in seine schwielige Pranke.
»Danke, mein Lieber.«
»Oh«, sagte Emerson. »Du willst tatsächlich?«
»Ja, mein Liebling.«
Emerson holte tief Luft, warf sich in Positur und packte mich.
Die ersten Momente waren ziemlich schmerzhaft, besonders für meine Füße und Rippen. Doch zu meinem Stolz kann ich sagen, daß mir kein Schrei über die Lippen kam und sich mein lächelnder Mund nicht eine Sekunde lang verzerrte. Nach einer Weile wurde Emersons ängstlicher Griff lockerer. »Hm«, brummte er. »Gar nicht so schlecht, was?«
Zum ersten Mal, seit wir auf der Tanzfläche waren, holte ich Luft und erkannte, daß meine Leiden belohnt worden waren. Wenn Emerson will, bewegt er sich so geschmeidig wie eine Katze; ermutigt davon, daß es mir anscheinend gefiel, bekam auch er allmählich Spaß an der Sache und tanzte endlich im Rhythmus der Musik.
»Wirklich nicht schlecht«, wiederholte er. »Sie haben mir gesagt, es würde mir gefallen, wenn ich erst einmal den Dreh heraus hätte.«
»Sie?«
»Ramses und Nefret. Wie du weißt, haben sie im letzten Sommer Unterricht genommen; sie haben es mir beigebracht. Ich habe ihnen das Versprechen abgenommen, dir nichts zu verraten. Schließlich ist mir bekannt, welchen Spaß es dir macht. Und ich muß sagen, es ist ein größeres Vergnügen, als ich erwartet habe. Wahrscheinlich bist du es, die ... Peabody? Weinst du? Verflixt, bin ich dir etwa auf die Zehen getreten?«
»Nein, mein Liebling.« Ich verstieß aufs schändlichste gegen die guten Sitten, als ich mich an ihn schmiegte und meine Tränen an seiner Schulter trocknete. »Ich weine, weil ich so gerührt bin. Wenn ich mir vorstelle, welches Opfer du für mich ...«
»Angesichts dessen, welche Opfer du für mich gebracht und welchen Gefahren du dich meinetwegen gestellt hast, ist es noch viel zu wenig, meine liebe Peabody.« Ich hörte seine Worte nur gedämpft, da seine Wange auf meinem Scheitel ruhte und er die Lippen an meine Schläfe preßte.
Viel zu spät fiel mir ein, daß wir uns ja in der Öffentlichkeit befanden, und ich rückte ein wenig von ihm ab. »Die Leute schauen schon. Du hältst mich viel zu eng.«
»Nein, das stimmt nicht«, widersprach Emerson.
»Du hast recht«, sagte ich und sank in seine Arme, ohne mich um die Blicke der anderen Gäste zu scheren.
***
Seit Emerson »den Dreh heraus« hatte, durfte kein anderer Mann mehr mit mir Walzer tanzen. Ich wies sämtliche Herren ab, nicht nur, weil ich wußte, es würde ihm gefallen, sondern auch, weil ich die Verschnaufpausen zwischen den Tänzen bitter nötig hatte. Emerson tanzte Walzer, wie er sich auch jeder anderen Beschäftigung widmete: mit vollem Körpereinsatz. Und da er mich so heftig herumwirbelte, daß ich mehrmals den Boden unter den Füßen verlor, brauchte ich Zeit, um wieder zu Atem zu kommen.
In diesen Pausen hatte ich Gelegenheit, die übrigen Gäste zu beobachten. Das Studium der menschlichen Natur in all ihren Erscheinungsformen ist eine interessante Beschäftigung für einen klugen Menschen – und ein besseres Betätigungsfeld als das, welches sich mir heute bot, konnte es gar nicht geben.
Die Mode in jenem Jahr gefiel mir sehr gut, denn man hatte sich endlich von der übertrieben betonten Silhouette gelöst, welche die weibliche Gestalt bislang verunziert hatte (und später wieder verunzieren sollte). Die Röcke fielen – ohne Krinolinen und Gesäßpolster – elegant von der Taille ab; die Mieder waren nicht zu tief ausgeschnitten. Bei den älteren Damen war Schwarz sehr beliebt, doch der Satin schimmerte üppig, und die Spitzen an Hals und Ellenbogen waren fein wie Spinnweben. Juwelen blitzten, Perlen funkelten bleich auf dunklem Stoff; die Hälse der Damen waren schwanenweiß. Welch ein Jammer, so dachte ich, daß die Männer sich von den Vorgaben der Konvention derart einschränken ließen. In den meisten Kulturen, angefangen beim alten Ägypten bis hin in die jüngere Vergangenheit, putzten sich die Männer so prächtig heraus wie die Frauen und hatten angeblich genau wie diese ihre Freude an Juwelen und spitzenbesetzten Kleidungsstücken.
Die einzige Ausnahme in der männlichen Eintönigkeit machten die bunten Uniformen der ägyptischen Offiziere. Allerdings war keiner dieser Herren wirklich Ägypter, denn die Armee stand – wie alle anderen Bereiche des Staates – unter britischer Aufsicht, und die Posten wurden von Engländern und Europäern bekleidet. Die Uniformen unserer eigenen Streitkräfte waren um einiges schlichter. An jenem Abend waren einige Angehörige der Armee anwesend. Ich bildete mir ein, in den jungen, vom Lachen geröteten Gesichtern mit den heldenhaften Schnurrbärten einen Anflug von Niedergeschlagenheit zu bemerken. Bald würden sich die Soldaten auf den Weg nach Südafrika machen, wo ein Krieg tobte. Und manche würden nie zurückkehren.
Mit einem Seufzer und einem gemurmelten Gebet (mehr hat eine schwache Frau in einer Welt, in der Männer das Schicksal der hilflosen Jugend bestimmen, nicht zu bieten) wandte ich mich erneut meinen Beobachtungen der menschlichen Natur zu. Alle, die nicht tanzten, standen am Rande des Ballsaals, beobachteten die komplizierten Schritte des Kotillon oder plauderten. Viele der Anwesenden waren mir persönlich bekannt; interessiert stellte ich fest, daß Mrs. Arbuthnot wieder ein paar Kilo zugenommen hatte. Mr. Arbuthnot hatte eine mir nicht bekannte junge Dame in eine Ecke gedrängt. Ich konnte zwar nicht sehen, was er tat, doch die Miene der jungen Damen wies darauf hin, daß er sich wie immer zu große Freiheiten herausnahm. Miss Marmaduke (von der später noch die Rede sein wird) hatte keinen Tänzer. Ein gefrorenes Lächeln auf dem Gesicht, kauerte sie auf der Kante ihres Stuhls und sah aus wie eine gerupfte Krähe. Neben ihr saß Mrs. Everly, die Frau des Innenministers, und zeigte ihr unhöflicherweise die kalte Schulter. Ihre Züge wirkten sehr belebt, als sie über Miss Marmadukes Kopf hinweg mit einer schwarzverhüllten Dame plauderte, woraus ich schloß, daß es sich bei dieser um eine wichtige Persönlichkeit handeln mußte. War sie seit kurzem verwitwet? Ansonsten gab es keinen Grund für solch strenge Trauerkleider. Falls das allerdings zutraf, hatte sie auf einem Ball nichts zu suchen. Vielleicht, so überlegte ich, war ihr Gatte schon vor längerer Zeit verstorben. Wahrscheinlich hatte sie – nach dem Beispiel einer gewissen königlichen Witwe – entschieden, die sichtbaren Zeichen ihres Verlusts nie mehr abzulegen.
Dieser Abend würde für die nächste Zeit mein letztes gesellschaftliches Ereignis bleiben. In einigen Tagen wollten wir die Annehmlichkeiten des besten Hotels in Kairo hinter uns lassen und nach ...
Nun, nur der Himmel und Emerson kannten unser Ziel. Er hatte die reizende Angewohnheit, mir stets erst im allerletzten Moment zu verraten, wo wir in diesem Jahr unsere Ausgrabungen vornehmen würden. Das war zwar zuweilen recht ärgerlich, erhöhte aber die Spannung, und ich unterhielt mich damit, im Geiste die verschiedenen Möglichkeiten durchzugehen. Dahshûr? Das Innere der krummen Pyramide hatten wir noch nicht bis ins letzte untersucht, und ich muß gestehen, daß Pyramiden meine Leidenschaft sind. Auch Amarna hätte mir sehr zugesagt, denn schließlich hatte dort meine Romanze mit Emerson ihren Anfang genommen. Die Gegend von Theben besaß ebenfalls ihren Reiz: die Königsgräber im Tal der Könige, der majestätische Tempel von Königin Hatschepsut ...
Nefret und Ramses rissen mich aus meinen Träumereien. Mit erhitzten, rosigen Wangen ließ sich das Mädchen auf den Stuhl neben mich fallen und funkelte ihren Pflegebruder böse an. Dieser stand, die Arme verschränkt, mit unbewegter Miene da. Seit diesem Jahr trug Ramses lange Hosen – das plötzliche Wachstum seiner unteren Gliedmaßen hatte diese Entscheidung vor allem aus ästhetischen Gründen notwendig gemacht.
»Ramses sagt, ich darf nicht mit Sir Edward tanzen!« rief Nefret aus. »Tante Amelia, sag ihm ...«
»Sir Edward«, fing Ramses an, wobei die Flügel seiner Hakennase zitterten, »ist kein Mensch, mit dem Nefret Umgang pflegen sollte. Mutter, sag ihr ...«
»Ruhe, ihr beiden«, unterbrach ich sie streng. »Mit wem Nefret Umgang pflegt, entscheide immer noch ich.«
»Hmpf«, knurrte Ramses.
Nefret murmelte etwas, das ich nicht verstand. Wahrscheinlich handelte es sich um eines der nubischen Schimpfwörter, mit denen sie um sich warf, wenn sie erbost war. Die Wut und die große Hitze im Raum hätten wohl jede Frau puterrot und verschwitzt aussehen lassen, Nefret aber war wie immer wunderschön. Ihre kornblumenblauen Augen funkelten zornig, und die Schweißperlen auf ihrer Haut schimmerten, als würde sie von innen her erleuchtet.
»Ramses«, sagte ich. »Bitte geh und fordere Miss Marmaduke zum Tanzen auf. Da sie eure Hauslehrerin werden wird, bist du ihr diese Höflichkeit schuldig.«
»Aber Mama ...« Ramses Stimme kippte. In den meisten Fällen hatte er die bei jungen Burschen unvermeidlichen Schwankungen zwischen Sopran und Bariton gut im Griff; doch nun sorgten die aufgewühlten Gefühle dafür, daß er die Beherrschung verlor. Daß er mich wieder mit dem kindlichen »Mama« ansprach, obwohl er diese Anrede kürzlich abgelegt hatte, war ein weiterer Hinweis auf seine Verstörung.
»Hörst du schlecht, Ramses?« rügte ich.
Ramses Miene war wieder unbewegt wie gewöhnlich. »Wie du sicherlich weißt, Mutter, ist dies nicht der Fall. Natürlich werde ich deinem Befehl gehorchen, denn als solchen verstehe ich deine Bitte trotz der Worte, in die du sie gekleidet hast. Allerdings kann ich nicht umhin, das Wort ›Bitte‹ in diesem Zusammenhang als bedeutungslos ...«
»Ramses!« unterbrach ich ihn laut, denn ich wußte genau, was er im Schilde führte. Er war durchaus dazu in der Lage, den Satz so lange weiterzuführen, bis es zu spät war, die unglückliche Miss Marmaduke auf die Tanzfläche zu geleiten.
»Ja, Mutter.« Ramses machte auf dem Absatz kehrt.
Nefret, inzwischen wieder besserer Stimmung, lachte und drückte mir verschwörerisch die Hand. »Geschieht ihm recht für seine Unverschämtheit, Tante Amelia. Miss Marmaduke ist wirklich eine alte Jungfer!«
Ich mußte zugeben, daß sie damit recht hatte. Miss Marmaduke behauptete zwar, unter dreißig zu sein, wirkte aber viel älter. Wegen ihres hohen Wuchses hatte sie sich eine krumme Haltung angewöhnt; Strähnchen ihres mausbraunen Haares ragten zwischen den Nadeln und Kämmen hervor, mit denen sie es zu bändigen versuchte. Allerdings war Nefrets Bemerkung unhöflich und nicht sehr nett gewesen, und ich fühlte mich verpflichtet, sie darauf hinzuweisen.
»Diese Bemerkung war unhöflich und nicht sehr nett, Nefret. Die Arme kann nichts dafür, daß sie so unscheinbar aussieht. Wir hatten großes Glück, sie zu finden. Denn du und Ramses dürft in diesem Winter eure Schulbildung nicht vernachlässigen; wie ihr beide wißt, haben wir es vor unserer Abreise aus England nicht mehr geschafft, einen passenderen Lehrer zu finden.«
Nefret zog ein Gesicht. »Ich wollte es in Ramses’ Gegenwart nicht sagen, weil er sich ohnehin schon für allwissend hält«, fuhr ich fort. »In diesem Fall aber bin ich gezwungen, ihm zuzustimmen. Sir Edward hat, was Frauen – besonders junge Frauen – angeht, einen schlechten Ruf. Und du bist erst fünfzehn und besonders empfänglich für derartige Aufmerksamkeiten.«
»Du mußt schon entschuldigen, Tante Amelia.« Nun war sie wütend auf mich, und ihre Augen blitzten. »Ich glaube, ich weiß mehr über die Dinge, auf die du hier anspielst, als eine englische Fünfzehnjährige.«
»Du bist eine englische Fünfzehnjährige«, entgegnete ich. »Aber in mancher Hinsicht benimmst du dich, als wärst du gerade zwei.« Ich hielt inne und dachte über meine eigenen Worte nach. »Wie interessant! Darauf war ich noch gar nicht gekommen; doch es stimmt: Die Sitten und Gebräuche des merkwürdigen Volkes, bei dem du deine ersten dreizehn Lebensjahre verbracht hast, unterscheiden sich so grundlegend von denen der modernen Welt, daß du noch einmal ganz von vorne anfangen mußtest. Und einige Dinge, die du gelernt hattest – besonders über den ... äh ... Umgang mit Angehörigen des anderen Geschlechts –, solltest du rasch wieder vergessen. Ich versuche doch nur, dich zu schützen.«
Ein weicher Ausdruck huschte über ihr hübsches Gesicht, und sie nahm meine Hand. »Das weiß ich, Tante Amelia. Es tut mir leid, wenn ich grob gewesen bin. Ich war wütend auf Ramses, nicht auf dich. Er behandelt mich wie ein Kind und bewacht mich auf Schritt und Tritt. Ich lasse mich nicht von einem kleinen Jungen herumkommandieren!«
»Natürlich ist er jünger als du«, antwortete ich, »aber er will nur dein Bestes. Und inzwischen kannst du auch nicht mehr auf ihn hinunterschauen.«
Als ich beobachtete, wie Ramses Miss Marmaduke gehorsam zwischen den Tanzenden herumwirbelte, konnte ich ein Lächeln nicht unterdrücken. Sie versuchte, kleiner zu wirken, indem sie die Schultern krümmte und den Kopf senkte, so daß ihr hoher Dutt immer wieder sein Gesicht streifte. Ramses’ heldenhafte Bemühungen, ein Niesen zu unterdrücken, ließen meine Gefühle für ihn wieder freundlicher werden. Er hätte sich zwar nicht wie ein Gentleman benommen, wenn ich ihn nicht dazu gezwungen hätte, aber er stellte sich der Aufgabe und schlug sich trotz widriger Umstände sehr wacker. Miss Marmaduke hatte etwa soviel Rhythmus im Blut wie ein Kamel, und ihr langärmeliges, hochgeschlossenes schwarzes Kleid war für einen Ball denkbar ungeeignet.
Die meisten meiner Ballkleider sind scharlachrot, weil das Emersons Lieblingsfarbe ist. An jenem Abend trug ich allerdings schlichtes Schwarz. Nefret erkannte, daß sich mein Gesichtsausdruck verändert hatte. »Du denkst an das Baby«, sagte sie leise.
An jenem schrecklichen Vormittag im Juni hatte ich mich nach Walters Anruf auf die Suche nach Nefret gemacht. Erst einen Monat zuvor hatten wir ein Telephon installieren lassen, und ich hätte nie gedacht, daß es so bald zum Übermittler einer solchen Hiobsbotschaft werden sollte.
Rose, mein unersetzliches und weichherziges Hausmädchen, schluchzte in ihre Schürze, während unser Butler Gargery, dem selbst die Tränen in den Augen standen, sie zu trösten versuchte. Nefret war nicht im Haus. Nachdem ich die Ställe und die Gärten abgesucht hatte, fiel mir ein, wo sie stecken könnte.
Wahrscheinlich finden es einige Menschen befremdlich, daß ein derartiges Monument auf dem Grundstück eines ruhigen englischen Landhauses steht. Andererseits sind falsche Ruinen und Pyramiden inzwischen recht in Mode gekommen, und so mancher Ägyptenreisende schmückt sein Heim mit mitgebrachten Stelen und Sarkophagen. Die kleine Ziegelpyramide in einer stillen Lichtung war allerdings kein modisches Dekorationsobjekt. Sie erhob sich über den sterblichen Überresten eines kuschitischen Prinzen, der beim vergeblichen, aber heldenhaften Versuch, Nefret zu ihrer Familie zurückzubringen, sein Leben gelassen hatte. Auf die Bitte seines Bruders hin, der diese Bemühungen zu einem triumphalen Abschluß gebracht hatte, hatten wir den jungen Mann feierlich nach den Sitten seines Volkes beerdigt. Eine kleine Kapelle, über deren Tür die Sonnenscheibe und die Namen und Titel des toten Knaben eingemeißelt waren, bildeten den Sockel des Monuments. Hin und wieder kam Nefret hierher, denn Tabirka war der Spielgefährte ihrer Kindheit gewesen. Auch ich verbrachte häufig eine stille Stunde bei der Pyramide, die idyllisch inmitten von Bäumen und Wildblumen stand.
Nefret saß auf einer steinernen Bank neben der Kapelle und flocht eine Blumengirlande. Als sie mich kommen hörte, blickte sie auf. Der Schrecken war mir wohl anzusehen, denn sie stand sofort auf und bot mir einen Platz an.
»Ich muß nach Chalfont Castle«, sagte ich, noch ganz durcheinander. »Ich habe versucht, Emerson und Ramses zu erreichen, aber sie waren weder im London House noch im Museum, und ich habe ihnen eine Nachricht hinterlassen. Ich darf keine Zeit verlieren; Evelyn braucht mich. Kommst du mit?« »Natürlich, wenn du willst.«
»Vielleicht muntert es Evelyn ein wenig auf«, sagte ich. »Wie soll sie nur darüber hinwegkommen? Ich habe mit Walter gesprochen ...«
Wahrscheinlich wäre ich benommen sitzengeblieben, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Aber Nefret zog mich hoch und brachte mich zum Haus.
»Ich helfe dir packen, Tante Amelia. Und selbstverständlich komme ich mit. Wie ist es geschehen?«
»Das Ende kam ganz plötzlich, und sie mußte – Gott sei Dank – nicht leiden«, antwortete ich. »Als Evelyn sie gestern Abend ins Bett brachte, fehlte ihr nichts. Und heute Morgen hat das Kindermädchen sie gefunden ...«
Ich glaube, ich brach wieder in Tränen aus. Nefret legte mir ihren schlanken Arm um die Taille. »Sei nicht traurig, Tante Amelia. Ich habe Tabirka gebeten, auf sie zu achten. Er ist sehr mutig und hat ein gutes Herz; er wird sie vor den Gefahren der Finsternis beschützen und sie sicher in die Arme des Gottes legen.«
Damals hörte ich Nefrets kleiner Ansprache kaum zu und entnahm ihr nur den Trost, den sie mir vermitteln sollte. Als ich mich später wieder daran erinnerte, überkam mich ein merkwürdiges Gefühl. Hatte ich ihr vom Tod des Babys erzählt? Nein, und trotzdem hatte sie es gewußt – noch ehe ich überhaupt ein Wort gesagt hatte. Noch beängstigender war ihre Anspielung auf die alte (und natürlich heidnische) Religion, der sie doch angeblich abgeschworen hatte. Schlich sie sich deshalb zur Kapelle ihres toten Pflegebruders – um Gebete zu flüstern und den alten Göttern zu opfern, die sie heimlich verehrte?
Evelyn und ihr Mann Walter, Emersons jüngerer Bruder und selbst ein angesehener Ägyptologe, waren unsere besten Freunde und nächsten Verwandten. Sie liebten ihre Kinder, und ich hatte damit gerechnet, daß Evelyn am Boden zerstört sein würde. Doch als Wilkins mit rotgeränderten Augen unsere Ankunft meldete, eilte sie uns entgegen und wirkte auf den ersten Blick weniger betrübt als er.
»Wir hatten mehr Glück als die meisten Familien, liebe Freundin«, sagte sie mit einem gefrorenen Lächeln auf den Lippen. »Gott hat uns fünf gesunde Kinder gelassen. Wir müssen uns seinem Willen beugen.«
Gegen eine derartige Zurschaustellung christlicher Stärke konnte man nur wenig einwenden, doch im Laufe des Sommers kam ich immer mehr zu dem Schluß, daß sie es übertrieb. Tränen und Gefühlsausbrüche wären mir lieber gewesen als dieses entsetzliche Lächeln.
Sie weigerte sich, Trauer zu tragen, und wurde fast wütend, als ich es tat. Und als ich ihr nach einem besorgten Gespräch mit Emerson und Walter mitteilte, wir würden diesen Winter in England bleiben, anstatt wie sonst nach Ägypten zu fahren, fuhr sie mich an, und ich bekam zum ersten Mal im Leben von ihr harte Worte zu hören. Ich solle und müsse nach Ägypten fahren. Traute ich ihr etwa nicht zu, ohne meine Hilfe zurechtzukommen? Sie brauche mich nicht. Sie brauche überhaupt niemanden.
Damit meinte sie auch ihren eigenen Mann. Inzwischen schliefen Walter und sie in getrennten Zimmern. Mit mir sprach Walter nicht darüber – er war zu schamhaft und zu treu, um sich zu beklagen. Doch Emerson gegenüber war er weniger zurückhaltend (und für Emerson ist Zurückhaltung ohnehin ein Fremdwort).
»Verdammt, Peabody, was zum Teufel hat sie vor? Sie wird Walter umbringen; er liebt sie von ganzem Herzen und würde nicht im Traum daran denken ... äh ... etwas mit einer anderen Frau anzufangen. Aber Männer haben nun mal ihre Bedürfnisse ...«
»Ach, papperlapapp!« rief ich aus. »Verschone mich mit diesem bodenlosen Unsinn! Was diese Sache betrifft, so haben Frauen ebenfalls Bedürfnisse, was du von allen Menschen am besten wissen solltest ... Emerson, laß mich sofort los. Ich lasse mich nicht von meinem Thema ablenken.«
»Verdammt«, wiederholte Emerson. »Sie tut es, um ihn zu bestrafen. Wie Lysistrata. Peabody, wenn du es jemals wagen solltest, solche Spielchen mit mir zu treiben ...«
»Evelyn treibt keine Spielchen. Wahrscheinlich weiß sie selbst nicht, warum sie sich so verhält. Ich weiß es natürlich: Sie ist wütend – wütend auf Gott. Und da sie sich an dem nicht rächen kann, bestraft sie dafür uns und vor allem sich selbst. Sie gibt sich die Schuld am Tod ihres Kindes.«
»Laß mich mit diesem psychologischen Mumpitz in Ruhe!« brüllte Emerson. »Das ist doch absurd. Wie kann sie sich selbst die Schuld geben? Der Arzt sagt ...«
»Die menschliche Seele richtet sich nicht nach dem Verstand«, philosophierte ich. »Ich weiß, wovon ich spreche. Selbst ich habe schon oft völlig grundlos Schuld empfunden, wenn Ramses wieder einmal in Todesgefahr schwebte – auch, wenn er sich das einzig und allein selbst zuzuschreiben hatte. Evelyn fühlt sich schuldig und hat gleichzeitig Angst. Sie will dem Schicksal keine Geiseln mehr ausliefern.«
»Aha«, brummte Emerson und dachte darüber nach. »Aber Peabody, es gibt doch Methoden ...«
»Ja, mein Liebling, ich weiß. Allerdings sind diese Methoden nicht immer erfolgreich, und außerdem wäre es im Augenblick unmöglich, dieses Thema gegenüber Evelyn zur Sprache zu bringen. Es geht um etwas völlig anderes: Momentan brauchen wir keine praktischen Lösungen, sondern etwas, womit wir sie aufrütteln können. Ich weiß nur nicht, wie.« Ich wandte mich ab. Als Emerson mich diesmal in die Arme nahm, sträubte ich mich nicht.
»Dir fällt schon etwas ein, Peabody«, sagte er zärtlich.
Aber der ersehnte Geistesblitz blieb aus, und seit diesem Gespräch waren vier Monate vergangen. Wir hatten unsere Abreise länger als gewöhnlich hinausgeschoben, da wir auf eine Besserung hofften – leider vergeblich. Außerdem mußten wir in jenem Jahr einige zusätzliche Vorkehrungen treffen. Ramses und Nefret sollten uns zum ersten Mal begleiten, und ich war fest entschlossen, ihre Schulbildung deswegen nicht schleifen zu lassen. Entgegen meinen Erwartungen erwies es sich als ziemlich schwierig, einen Lehrer oder eine Lehrerin zu finden. Die meisten Bewerber, mit denen ich Gespräche führte, lehnten ab, als sie erfuhren, daß sie den Winter in einem Zelt oder einem ägyptischen Grab zubringen sollte. (Einige hielten durch, bis sie Ramses besser kennenlernten.)
Daher empfand ich es als außergewöhnlichen Glücksfall, als sich kurz nach unserer Ankunft im Shepheards Miss Marmaduke bei uns vorstellte. Ihre Zeugnisse waren ausgezeichnet, ihre Referenzen stammten aus den besten Kreisen der Gesellschaft, und der Grund, warum sie auf Arbeitssuche war, ließ sie in meiner Achtung noch steigen: Sie sei mit einer Reisegruppe von Cook’s nach Ägypten gekommen und habe sich in dieses Land verliebt. Da sie von gemeinsamen Bekannten gehört habe, daß wir in Kürze eintreffen würden und eine Lehrerin für die Kinder suchten, habe sie, in der Hoffnung, bei uns eine Stelle zu bekommen, ihre Abreise verschoben. Auch habe sie – wie sie schüchtern erklärte – den Wunsch, etwas über ägyptische Antiquitäten zu lernen. Das erfreute Emerson, der auf den ersten Blick nicht sehr von ihr begeistert gewesen war. Er hätte gern eine Ägyptologin angelernt, doch keine passende Kandidatin gefunden. Damals gab es kaum Studentinnen, denn die meisten Professoren hätten lieber einen Massenmörder in ihrem Seminar geduldet als eine Frau. Miss Marmaduke verfügte zudem über Büroerfahrung und war gern bereit, einen Teil der Sekretärinnenarbeiten zu übernehmen, die bei einer ordentlich geführten archäologischen Ausgrabung gemeinhin anfallen.
(Daß Emerson anfangs nicht von ihr eingenommen gewesen war, stellte in meinen Augen einen Pluspunkt dar. Emerson ist ein sehr bescheidender Mensch und ahnt nicht, welche Wirkung er auf Frauen ausübt.)
Als der nächste Walzer einsetzte und Emerson auf mich zukam, erhob ich mich und ging ihm entgegen. Ich war fest entschlossen, über den Freuden des Tanzes meine Sorgen zu vergessen. Doch statt mich auf die Tanzfläche zu führen, hakte er mich unter.
»Kommst du mit, Peabody? Es tut mir leid, dich des tänzerischen Vergnügens berauben zu müssen. Aber ich bin sicher, daß du meinen Vorschlag bevorzugen würdest, wenn ich dich vor die Wahl stellte.«
»Mein geliebter Emerson!« rief ich errötend aus. »Die Sache, auf die du anspielst, käme bei mir stets an erster Stelle, doch kann das nicht warten? Es würde sich nicht schicken, die Kinder unbeaufsichtigt zurückzulassen.«
Emerson warf mir einen erstaunten Blick zu und brach dann in Gelächter aus. »Das werden wir ganz sicher verschieben müssen – hoffentlich jedoch nicht zu lang. Nun mach schon – wir haben nämlich eine Verabredung. Vielleicht ist es reine Zeitverschwendung, allerdings besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, daß der Bursche nützliche Informationen für uns hat. Bitte stell mir keine Fragen, wir sind schon spät dran. Und sorg dich nicht um Ramses und Nefret. Sie sind alt genug, um sich zu benehmen. Außerdem ist Miss Marmaduke da. Schließlich ist es ihre Aufgabe, auf die Kinder aufzupassen.«
»Wer ist der Mensch, mit dem wir uns treffen?«
»Das weiß ich nicht. Aber«, fügte Emerson hinzu, um meinem Einwand zuvorzukommen, »die Botschaft, die ich heute Morgen von ihm bekam, enthielt einige interessante Hinweise. Da er weiß, wo ich in dieser Saison graben will, bietet er an ...«
»Dann weiß er mehr als ich«, unterbrach ich ihn vorwurfsvoll. »Wann hast du denn die Entscheidung getroffen, Emerson? Und warum ist ein wildfremder Mensch besser über deine Pläne im Bilde als ich, deine Frau und Mitarbeiterin?«
Emerson zog mich hinter sich her über den Treppenabsatz und die letzte Treppe hinauf. »Ich schwöre hoch und heilig, ich habe keine Ahnung, Peabody. Gerade das hat mich ja so neugierig gemacht. Der Brief war ziemlich merkwürdig; ganz offensichtlich handelte es sich bei dem Schreiber um einen intelligenten und gebildeten Mann, der allerdings sehr aufgeregt gewesen sein muß. Er verlangt äußerste Geheimhaltung und deutet an, er schwebe in großer Gefahr. Seine Behauptung, er kenne ein noch unberührtes Grab, ist zweifellos unsinnig ...«
»Was?« Das Wort klang eher wie ein Quietscher, denn ich war außer Atem, weil Emerson mich so rasch die Stufen hinaufgezerrt hatte. »Wo?« wollte ich wissen. Emerson blieb stehen und musterte mich tadelnd.
»Du brauchst nicht so zu schreien. In Theben natürlich. Genauer gesagt ... aber das werden wir ja gleich herausfinden. Komm, Peabody, komm, sonst überlegt dieser mysteriöse Mensch es sich vielleicht noch anders.«
Vor der Tür zu unserem Salon stand ein Mann. Er war nicht Emersons geheimnisvoller Besucher, sondern ein Angestellter des Hotels. Ich erkannte ihn als den Zimmerkellner von der Nachtschicht. Bei unserem Anblick nahm er Haltung an. »Emerson Effendi! Sehen Sie, ich habe getan, was Sie mir befohlen haben. Ich habe Ihre Tür bewacht. Dieser Mensch ...«
»Welcher Mensch?« fragte Emerson und blickte den leeren Korridor entlang.
Ehe Ali antworten konnte, erschien ein Mann hinter einer Biegung des Flurs. Er huschte lautlos dahin wie ein Gespenst, und er sah auch so aus, denn er war von oben bis unten in dunklen Stoff gehüllt und hatte einen breitkrempigen Hut tief in die Stirn gezogen. Einige Meter von uns entfernt blieb er, mit dem Rücken zum Licht, stehen, und ich war sicher, daß er diesen Platz absichtlich gewählt hatte: Sein Gesicht war im Schatten der Hutkrempe nicht zu erkennen.
»Aha«, sagte Emerson aufgeräumt. »Sie sind also der Gentleman, der mich um ein Gespräch gebeten hat. Entschuldigen Sie, daß ich zu spät komme, aber das war nur Mrs. Emersons Schuld. Ich hoffe doch, Sie haben nichts dagegen, wenn sie dabei ist.«
»Überhaupt nichts.« Die Antwort war kurz, die Stimme leise und heiser – offensichtlich verstellt.
Emerson öffnete die Tür. »Nach dir, meine liebe Peabody. Sir, bitte folgen Sie mir.«
Ich hatte eine Lampe brennen gelassen, da ich aufgrund einiger unangenehmer Erfahrungen weiß, wie unklug es ist, einen stockfinsteren Raum zu betreten. Ihr Licht reichte jedoch nur aus, um uns die Gewißheit zu geben, daß uns keine Mörder und Einbrecher auflauerten. Ich wollte schon den Schalter betätigen, als sich eine Hand auf meine legte. Überrascht stieß ich einen Schrei aus. »Was zum Teufel ...« rief Emerson.
»Ich bedaure unendlich, Mrs. Emerson«, sagte der Fremde und ließ meine Hand los – gerade noch rechtzeitig, denn Emerson hatte ihn schon beim Kragen gepackt. »Ich wollte Sie nicht erschrecken. Indem ich Sie aufsuche, gehe ich ein großes Risiko ein; bitte gestatten Sie mir, meine Anonymität zu wahren, bis wir zu einer Einigung gekommen sind – falls das möglich ist.«
»Verdammt!« rief Emerson. »Ich warne Sie, Mr. Saleh ... Demnach kann ich davon ausgehen, daß Sie mir einen falschen Namen angegeben haben?«
»Für den Augenblick wird er genügen.« Der Fremde hatte sich in eine schattige Ecke zurückgezogen und hob die Hände vors Gesicht. Betete er? Das glaubte ich nicht. Ich zitterte vor Spannung.
Emerson stöhnte laut auf. »Ach, du meine Güte, wird das wieder eine dieser melodramatischen Geschichten? Wahrscheinlich ist eine Saison archäologischer Ausgrabungen ohne Störungen durch Verbrecher zuviel verlangt. Hätte ich das nur früher gewußt ... Nun, verdammt, jetzt ist es schon zu spät. Selbst wenn ich meinen Instinkten folgen würde, die mir sagen, es wäre besser, Sie hinauszuwerfen, ehe Sie auch nur ein Wort von sich gegeben haben, würde Mrs. Emerson darauf bestehen, Sie anzuhören. Sie liebt Melodramen. Wenn Sie also Ihre Maske zu Ihrer Zufriedenheit zurechtgerückt haben, Mr. Unbekannt, setzen Sie sich, und dann heraus mit der Sprache. Ich bin ein geduldiger Mensch, doch meine Zeit ist knapp, und ich habe den starken Verdacht, daß dies hier ...«
»Er kann nicht zu reden anfangen, ehe du nicht damit aufhörst, Emerson«, unterbrach ich ihn. »Nehmen Sie Platz, Mr .... äh ... Saleh. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Tee, Kaffee, Brandy, Whiskey?«
» Whiskey bitte.«
Vor sich hinmurmelnd bedeutete mir Emerson, mich aufs Sofa zu setzen, und ging zur Anrichte. Ich musterte neugierig den Fremden, der unter dem schwarzen Umhang europäische Kleidung trug. Er hatte uns zwar einen ägyptischen Namen angegeben, aber da er Alkohol trank, konnte er kein Moslem sein – zumindest kein gläubiger. Sein ganzes Gesicht war von einer Maske aus schwarzer Seide bedeckt, die er – ich konnte nicht feststellen, wie – unter dem Kinn befestigt hatte. Ein ovales Loch gab seine Lippen frei, und ich vermutete, daß auch Öffnungen für die Augen existierten, obwohl ich diese unter der Hutkrempe nicht erkennen konnte.
Emerson reichte mir ein Glas und bot das andere unserem Besucher an, der die Hand ausstreckte und es entgegennahm.
Anscheinend hatte er mich ebenso prüfend betrachtet wie ich ihn, denn als er sah, wie mein Blick aufmerksamer wurde, stieß er ein leises Hüsteln aus, das ebensogut ein Lachen sein konnte. »Sie haben eine gute Beobachtungsgabe, Mrs. Emerson. Haben Sie mir deshalb etwas zu trinken angeboten?«
»Es war einen Versuch wert«, erwiderte ich ruhig. »Denn es ist schwerer, die Hände zu tarnen als das Gesicht. Altersflecken kann man überschminken, doch nicht die hervortretenden Venen, die nicht minder aufschlußreich sind; ebensowenig Narben, Schwielen, Muttermale, die Form von Handfläche und Fingern – oder, wie bei Ihnen, ein auffälliges Schmuckstück. Da Sie den Ring nicht vorsichtshalber abgenommen haben, bevor Sie zu uns kamen, haben Sie doch sicherlich nichts dagegen, wenn ich ihn mir ein wenig näher ansehe?«
»Durchaus nicht – er dient dazu, die Geschichte zu untermauern, die ich Ihnen jetzt erzählen werde.« Er zog den Ring vom Finger und legte ihn in meine ausgestreckte Hand.
Selbst ein ungebildeter Tourist hätte die Form erkannt. In pharaonischen Zeiten war der Skarabäus ein beliebtes Amulett, das auf der Unterseite stets eine Inschrift oder einen Namen in Hieroglyphen trug. Nachahmungen verkaufte man zu Hunderten an ausländische Besucher. Dieser Skarabäus bestand nicht aus gewöhnlicher Fayence oder aus Stein, sondern anscheinend aus massivem Gold. Man hatte ihn auf eine Weise am Ring befestigt, die ich von alten Vorbildern her kannte: mit gezwirbelten Golddrähten zu beiden Seiten des Skarabäus, so daß man ihn um die eigene Achse drehen konnte. Als ich das tat, entdeckte ich, wie erwartet, einen Namen in Hieroglyphenschrift – allerdings einen, den man gewöhnlich nicht auf solchen Schmuckstücken fand.
Ich reichte den Ring Emerson, der ihn stirnrunzelnd musterte, während Mr. Saleh zu sprechen begann.
»Dieses Schmuckstück wird seit dreitausend Jahren von Generation zu Generation weitergegeben. Es ist das Zeichen des Hohepriesters, der über das Ka der Königin Tetischeri wacht. Ihren Namen haben Sie auf dem Skarabäus gesehen. Nur der Körper zerfällt, der unsterbliche Geist, das Ka der Ägypter, wandert von einer fleischlichen Hülle zur nächsten. Im Laufe unzähliger Jahrhunderte war es meine Pflicht, das Überleben und die Wiedergeburt dieser großen Königin zu gewährleisten. In meiner ersten Inkarnation als Heriamon von Theben war ich ihr treuer ...«
Emersons Gebrüll ließ die Fensterscheiben erzittern: »Himmelherrgottkreuzdonnerwetter!«
»Emerson!« rief ich aus. »Mäßige dich. Und paß auf den Ring auf. Er besteht aus zweiundzwanzigkarätigem Gold und ist ziemlich empfindlich.«
»Peabody, so einen Unsinn höre ich mir nicht länger an.« Die Zornesröte hatte seinem Gesicht einen hübschen Mahagoniton verliehen, doch er legte mir den Ring vorsichtig auf die Hand, ehe er die Faust ballte und sie unter meiner Nase schwenkte. »Reinkarnation! Entweder ist dieser Mann ein Spinner, oder er erfindet diesen Schwachsinn, um einen verbrecherischen Plan zu verschleiern.« Er sprang auf und stürzte auf den Fremden zu.
Dieser jedoch war, durch Emersons Wutschrei gewarnt, ebenfalls aufgestanden. Die Pistole in seiner Hand ließ sogar meinen Gatten ruckartig innehalten. »Zum Teufel!« drohte Emerson. »Wenn Sie es wagen, meiner Frau auch nur ein Haar zu krümmen ...«
»Es liegt nicht in meiner Absicht, einem von Ihnen etwas anzutun«, lautete die rasche Antwort. »Ich bin aus anderen Gründen bewaffnet. Allerdings überrascht mich Ihre Reaktion nicht. Bitte, hören Sie mich an. Was haben Sie dabei zu verlieren?«
»Raus mit der Sprache«, forderte Emerson ihn barsch auf.
»Ich habe Ihnen die reine Wahrheit gesagt. Dieser Körper ist nur der letzte in einer Reihe von vielen, in denen mein Ka wiedergeboren wurde. Ob Sie das glauben oder nicht, ist für mich ohne Bedeutung. Ich habe es nur erwähnt, um zu erklären, woher ich weiß, was ich Ihnen nun erzählen möchte. Ich kenne ihr Grab und kann Sie hinführen – es ist das Grab einer Königin, und alle Schätze sind noch unangetastet.«
Emerson hielt den Atem an. Er glaubte es nicht – aber, ach, wie gern hätte er es geglaubt! Nicht für alles Geld und alle Macht der Welt hätte er seine Seele verkauft, doch für ein Königsgrab ... Mephisto selbst hätte einem Ägyptologen kein verführerischeres Angebot machen können, zudem einem Ägyptologen, dem das Wissen über schnöden Ruhm ging. Emersons Leistungen auf dem Gebiet der Ägyptologie hatten ihm die Anerkennung seiner Berufskollegen (und, wie ich leider sagen muß, auch einen gewissen Grad an schnödem Ruhm) eingebracht, doch noch nie war ihm die aufsehenerregende Entdeckung geglückt, von der jeder Archäologe träumt. Bot sich ihm jetzt vielleicht die große Chance? »Wo?« wollte er wissen.
»Drah Abu’l Naga.« Der Fremde trat einen Schritt zurück und ließ die Pistole sinken. Wie ich hatte er erkannt, daß Emerson es zwar nicht glaubte, aber gern geglaubt hätte.
Als Emerson noch einen Bart trug, hatte er die Angewohnheit besessen, daran zu zerren, wenn er angestrengt nachdachte. Da er inzwischen auf meinen Wunsch hin glattrasiert war, mußte er sich damit zufriedengeben, die Spalte an seinem Kinn zu reiben. »Es klingt logisch«, murmelte er. »Doch wenn Sie sich – wovon ich ausgehe – nur ein wenig in der Ägyptologie auskennen, können Sie das genausogut erfunden haben. Zum Teufel, Saleh, oder wie Sie sonst heißen, was wollen Sie wirklich? Warum sollten Sie ausgerechnet mir verraten, wo das Grab liegt, falls Sie es überhaupt wissen?«
»Wenn ich Ihnen die Wahrheit sagte, würden Sie mir ohnehin nicht glauben. Nein« – ich hatte in diesem Augenblick versucht, ihm den Ring zurückzugeben – »er gehört mir nicht mehr. Die Aufgabe ist in andere Hände übergegangen.«
»Jetzt hören Sie mir mal gut zu«, fing Emerson an. Er hielt sich weitaus besser im Zaum, als ich jemals für möglich gehalten hätte. »Wenn Sie damit andeuten wollen, daß Mrs. Emerson Ihre Nachfolgerin – die nächste Inkarnation –, ach, zum Teufel!«
»Sie sind es, nicht Ihre Frau«, lautete die Antwort.
In Erwartung des drohenden Wutausbruchs hielt ich den Atem an. Doch zu meiner Überraschung schien Emerson auf einmal in besserer Stimmung zu sein. Der Anflug eines Lächelns huschte über sein strenges Gesicht.
»Diese Möglichkeit kommt mir angemessener vor. Jetzt interessiert mich nur noch, wie Sie diese Übertragung der Persönlichkeit zuwege bringen wollen, Mr. Saleh. Gewiß erwarten Sie nicht von mir, daß ich mich einem klassischen Reinigungsritual unterziehe. Mrs. Emerson ist zwar eine Feindin von Bärten, aber sie würde zweifellos Einspruch erheben, wenn ich mir den Kopf kahlrasieren lassen wollte. Außerdem würde ich nicht einmal um den ehrenvollen Posten eines Hohepriesters der Tetischeri willen auf mein Roastbeef und ... äh ... und gewisse andere Genüsse verzichten.«
»Sie verstecken sich nur hinter Spott, um der Wahrheit nicht ins Auge sehen zu müssen, Professor. Schon bald werden Sie feststellen, daß das Schicksal eines jeden Menschen vorherbestimmt ist; auch Sie können dem Ihren nicht entrinnen. Es wird Sie ereilen, und Sie werden sich fügen müssen. Bis dahin will ich Sie in dem Glauben lassen, daß ich Sie aus rein praktischen Gründen um Ihre Hilfe bitte, falls Ihnen das lieber ist.
Das Geheimnis kann nicht länger bewahrt werden. Seit tausend Generationen haben wir Tetischeri vor den Grabräubern aus Gurneh, vor griechischen, römischen und byzantinischen Dieben und vor den Plünderern aus Europa und Amerika geschützt. Es gibt Mittel und Wege, solche Leute in die Irre zu führen. Und wenn nichts anderes mehr half ...«
»Mord?« hauchte ich.
»Nur im äußersten Notfall. Inzwischen allerdings gibt es zu viele Schatzsucher, und es werden immer mehr. Auf den Klippen des westlichen Theben wimmelt es von ausländischen Archäologen, und die ortsansässigen Diebe sind umtriebiger denn je. Wenn Tetischeris Grab entdeckt werden muß, dann besser von einem Wissenschaftler als von einem Räuber – denn letzterer wird zerstören, was er nicht fortschaffen kann, und die Schätze an jeden x-Beliebigen verkaufen, so daß sie über die ganze Welt verstreut werden. Sie müssen mir etwas versprechen – einen heiligen Eid schwören.« Die Hand mit der Waffe hing nun locker herunter, und der Mann tat einen Schritt auf Emerson zu. »Sie werden nicht zulassen, daß ihre Mumie geschändet wird. Sie werden dafür sorgen, daß die Grabbeigaben vollständig und unversehrt bleiben und die sterbliche Hülle der Königin mit Ehrfurcht behandelt wird. Schwören Sie das?«
Diese mit eindringlicher Stimme gesprochenen feierlichen Worte klangen wie ein Gebet oder eine Zauberformel. Emerson trat zwar verlegen von einem Fuß auf den anderen, hielt aber dem Blick des Fremden stand.
»Das kann ich nicht schwören«, antwortete er. »Wenn es in meiner Macht läge, würde ich Ihren Wunsch gerne erfüllen. Allerdings muß ich Ihnen der Ehrlichkeit halber gestehen, daß meine Gründe nicht die Ihren wären. Ein solcher Fund würde eine Sensation bedeuten und müßte schon aus wissenschaftlichen Erwägungen heraus intakt bleiben. Man würde ihn gut bewachen und nach allen Regeln der Kunst konservieren. Sie haben recht mit Ihrer Einschätzung: Wenn Grabräuber die Mumie zuerst fänden, würden sie sie in Stücke reißen und alles zerstören, was sie nicht wegschaffen können. Vom archäologischen Standpunkt aus wäre das eine Tragödie ... Aber warum verschwende ich meine Zeit mit sinnlosen Vermutungen? Ein solches Grab gibt es nicht, und selbst, wenn dem so wäre, könnte ich Ihnen nichts versprechen, denn die Entscheidung läge letztendlich nicht bei mir.«
»Sie haben genug gesagt, und es war die Wahrheit. Nur wenige Menschen wären so ehrlich, und nur wenige würden das Grab verteidigen wie Sie.«
»Das ist richtig«, warf ich ein, weil Emerson schwieg. »Und du weißt genau, Emerson, daß wir gute Chancen auf Erfolg haben. Als Verantwortliche für die Ausgrabungen hätten wir einen gewissen Anspruch auf den Inhalt des Grabes; wenn Monsieur Maspero uns verspricht, den Fund nicht zu zerstückeln, könnten wir diesen Anspruch ans Museum abtreten ...«
»Ach, sei doch still, Peabody!« Mit funkelnden Augen drehte Emerson sich zu mir um. Mein geliebter Emerson sieht am besten aus, wenn er wütend ist. Er fletschte seine weißen Zähne, seine Augen blitzten wie der Himmel im Osten, wenn die Dämmerung seine azurblauen Weiten tiefer erscheinen läßt, und seine Wangen röteten sich. Sprachlos vor Bewunderung (und auch da es mir unmöglich war, sein Gebrüll zu übertönen) starrte ich ihn an.
»Es sieht dir wieder ähnlich, auf der Grundlage eines Hirngespinsts Pläne für ein genaues Vorgehen zu schmieden«, fuhr Emerson erbost fort. »Meine Geduld ist jetzt zu Ende, Saleh. Ich gebe Ihnen noch« – er zog die Uhr aus der Tasche – »genau sechzig Sekunden. Wenn Sie uns bis zum Ablauf dieser Zeit keine greifbaren Beweise vorgelegt haben, werde ich Sie hinauswerfen.«
Saleh hatte die Pistole wieder eingesteckt. Ungerührt ließ er sich wieder in seinem Sessel nieder und trank einen Schluck. »Ist der Ring Ihnen nicht Beweis genug?«
Als Emerson schnaubte, fuhr Saleh spöttisch fort: »Für einen so gnadenlos logisch arbeitenden Verstand wie den Ihren wohl nicht. Was also würde Ihren Ansprüchen genügen?«
»Eine genaue Wegbeschreibung«, erwiderte Emerson prompt. »Der Eingang ist bestimmt gut versteckt. Sonst wäre er schon längst gefunden worden. In besagtem Gebiet gibt es kilometerweite Felswüsten.«
»Ich wußte, daß Sie das sagen würden.« Saleh hatte sein Glas geleert. Er stellte es ab, griff in die Tasche und holte ein gefaltetes Stück Papier heraus. »Ich habe erfahren ... ich ...«