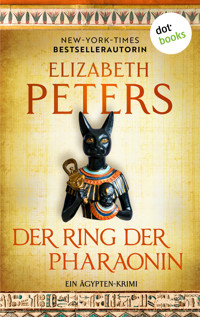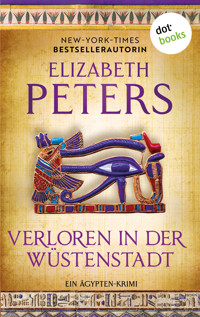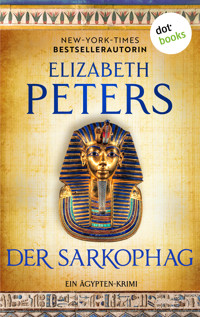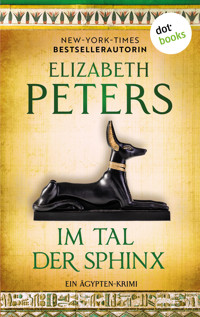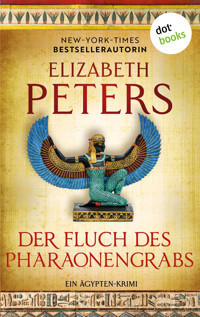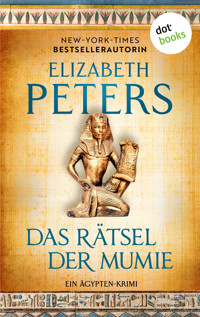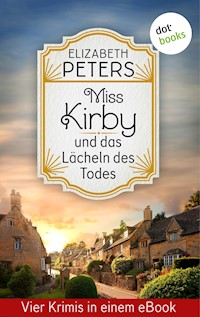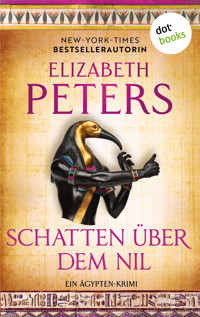
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Friede, Freude, Flitterwochen? Nicht für abenteuerlustige Ägyptologinnen … Ägypten, 1898. Mit Sonnenschirm und Fernglas gemütlich den Nil heraufschippern während sie das Grab der Nofretete suchen – so zumindest haben sich Ägyptologin Amelia und ihr Ehemann Radcliffe Emerson ihr neuestes Abenteuer vorgestellt. Doch ihr Versuch, mit einer Expedition aus der Glut ihrer Ehe ein neues Feuer zu entfachen, wird bald vom Auftauchen alter und neuer Feinde unterbrochen: Eine Gruppe von mysteriösen Verschwörern will Amelia dazu zwingen, ein wohl gehütetes Geheimnis zu lüften. Schon bald muss die taffe Archäologin um den Verlust von Schätzen fürchten, die viel wertvoller sind als jede Antiquität – der Liebe ihres Mannes und ihrer beider Leben … »Die toughe Archäologin Amelia Peabody ist die perfekte Begleiterin für eine Kreuzfahrt auf dem Nil.« New York Times »Schatten über dem Nil« ist der sechste Teil der mitreißenden Amelia-Peabody-Reihe von Elizabeth Peters und wird Fans von Agatha Christie und Dorothy L. Sayers begeistern. Die Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ägypten, 1898. Mit Sonnenschirm und Fernglas gemütlich den Nil heraufschippern während sie das Grab der Nofretete suchen – so zumindest haben sich Ägyptologin Amelia und ihr Ehemann Radcliffe Emerson ihr neuestes Abenteuer vorgestellt. Doch ihr Versuch, mit einer Expedition aus der Glut ihrer Ehe ein neues Feuer zu entfachen, wird bald vom Auftauchen alter und neuer Feinde unterbrochen: Eine Gruppe von mysteriösen Verschwörern will Amelia dazu zwingen, ein wohl gehütetes Geheimnis zu lüften. Schon bald muss die taffe Archäologin um den Verlust von Schätzen fürchten, die viel wertvoller sind als jede Antiquität – der Liebe ihres Mannes und ihrer beider Leben …
Über die Autorin:
Elizabeth Peters (1927 – 2013) ist das Pseudonym von Barbara G. Mertz, einer amerikanischen Autorin und Ägyptologin. Sie promovierte am berühmten Orient-Institut in Chicago und wurde für ihre Romane und Sachbücher mit vielen Preisen ausgezeichnet. Einer dieser Preise, der »Amelia Award«, wurde sogar nach ihrer beliebten Romanfigur benannt, der bahnbrechenden Amelia Peabody. Besonders ehrte sie jedoch, dass viele ÄgyptologInnen ihre Bücher als Inspirationsquelle anführen.
Elizabeth Peters veröffentlichte bei dotbooks ihre »Vicky Bliss«-Reihe und ihre Krimireihe um Jacqueline Kirby.
Unter Barbara Micheals veröffentlichte sie bei dotbooks ihre historischen Liebesromane »Abbey Manor – Gefangene der Liebe«, »Wilde Manor – Im Sturm der Zeit«, »Villa Tarconti – Lied der Leidenschaft« und »Grayhaven Manor – Das Leuchten der Sehnsucht«.
Außerdem veröffentlichte sie unter Barbara Michaels ihre Romantic-Suspense-Romane »Der Mond über Georgetown«, »Das Geheimnis von Marshall Manor«, »Die Villa der Schatten«, »Das Geheimnis der Juwelenvilla«, »Die Frauen von Maidenwood«, »Das dunkle Herz der Villa«, »Das Haus des Schweigens«, »Das Geheimnis von Tregella Castle« und »Die Töchter von King’s Island«.
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »The Snake, The Crocodile & The Dog« bei Warner Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Die Schlange, das Krokodil und der Tod« bei Econ, Düsseldorf
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 by Barbara Mertz
Published by Arrangement with Dr. Barbara Mertz c/o Dominick Abel Literary Agency Inc., 146 West 82nd Street. 1B, New York, NY, 10024 USA
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1993 by Econ Verlag, Düsseldorf
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3- 98952-293-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Schatten über dem Nil
Ein Ägypten-Krimi. Amelia Peabody 6
Aus dem Amerikanischen von Karin Dufner und Bernhard Jendricke
dotbooks.
Kapitel 1
»Soll die Ehe gedeihen, ist es
nötig, sein Temperament zu
zügeln.«
Meiner Ansicht nach kann ich mit bestem Wissen und Gewissen von mir behaupten, daß ich weder Gefahr noch harte Arbeit scheue. Allerdings ziehe ich erstere vor. Als einzige unverheiratete Tochter eines verwitweten und äußerst zerstreuten Vaters war ich für die Führung des Haushalts verantwortlich – wie jede Frau weiß, die schwierigste, undankbarste und am schlechtesten bezahlte (das heißt, unbezahlte) Arbeit, die es überhaupt gibt. Dank der bereits erwähnten Zerstreutheit meines Erzeugers gelang es mir jedoch zu verhindern, daß ich mich zu Tode langweilte, indem ich mich unweiblichen Beschäftigungen wie dem Studium von Geschichte und Sprachen widmete. Denn Papa kümmerte sich nicht darum, was ich tat, solange sein Essen pünktlich auf dem Tisch stand, seine Kleider gewaschen und gebügelt waren und ihn niemand störte.
Wenigstens glaubte ich, mich nicht zu langweilen. Doch in Wahrheit fehlten mir schlichtweg die Vergleichsmöglichkeiten, an denen ich mein Leben messen konnte, und auch die Hoffnung, es werde sich jemals etwas daran ändern. In jenen Jahren des ausklingenden neunzehnten Jahrhunderts stellte die Ehe für mich keine verlockende Alternative dar – ich hätte nur ein relativ bequemes Dienstbotendasein gegen die völlige Versklavung eingetauscht; das glaubte ich zumindest. (Und was die Mehrheit aller Frauen betrifft, bin ich immer noch dieser Ansicht.) Mein weiterer Lebensweg stellte sich allerdings als eben die Ausnahme heraus, die die Regel bestätigt, und hätte ich gewußt, welch ungeahnte und unvorstellbare Freuden mich erwarteten, die Fesseln, die mich gefangen hielten, wären mir unerträglich vorgekommen. Doch diese Fesseln wurden erst durchtrennt, als mich der Tod meines armen Papas zur Erbin eines bescheidenen Vermögens machte und ich aufbrach, um die antiken Stätten, die ich bis dahin nur aus Büchern und von Photographien her kannte, mit eigenen Augen zu sehen. Inmitten der Altertümer Ägyptens begriff ich endlich, was mir so lange gefehlt hatte – Abenteuer, Aufregung, Gefahren, eine Lebensaufgabe, die meinen gesamten beachtlichen Intellekt in Anspruch nahm, und die Gemeinschaft mit einem bemerkenswerten Mann, der ebenso für mich bestimmt war wie ich für ihn. Welch rasende Verfolgungsjagden! Welche Kämpfe um die Freiheit! Welch wilde Verzückung!
***
Eine gewisse Dame, Lektorin von Beruf, teilte mir mit, daß ich die Geschichte nicht richtig angefangen hätte. Sie behauptete, daß eine Autorin, will sie die Aufmerksamkeit ihrer Leserschaft fesseln, am besten mit einer gewaltsamen und/oder leidenschaftlichen Szene beginnt.
»Ich habe doch etwas von ... äh ... wilder Verzückung geschrieben«, sagte ich.
Die Dame lächelte mich nachsichtig an. »Poesie, wenn ich es recht verstehe? Poesie können wir nicht dulden, Mrs. Emerson.
Sie nimmt der Handlung den Schwung und verwirrt den normalen Leser.« (Dieses geheimnisvolle Individuum wird von Angehörigen der Verlagsbranche stets gern zu Felde geführt, und zwar in einem Tonfall, der sowohl von Herablassung als auch von abergläubischer Ehrfurcht zeugt.)
»Wir brauchen Blut«, fuhr die Dame fort, wobei ihre Stimme vor Aufregung vibrierte, »Ströme von Blut! Das dürfte Ihnen doch nicht schwerfallen, Mrs. Emerson. Soweit ich weiß, sind Ihnen schon einige Mörder über den Weg gelaufen.«
Nicht zum ersten Mal hatte ich erwogen, meine Aufzeichnungen für eine etwaige Veröffentlichung zu überarbeiten, aber ich war noch nie so weit gegangen, mich tatsächlich an einen Lektor zu wenden. Also sah ich mich gezwungen, der Dame zu erläutern, daß – falls ihre Ansichten repräsentativ für die Verlagsbranche wären –, die Verlagsbranche in Zukunft ohne Amelia P. Emerson auskommen müßte. Wie ich den schäbigen Sensationshunger verachte, durch die sich die literarischen Produkte unserer Tage auszeichnen! Die edle Kunst der Schriftstellerei ist in den letzten Jahren wahrlich tief gesunken! Ein durchdachter, lockerer Stil findet keine Anerkennung mehr. Stattdessen prügelt man den Leser zur Aufmerksamkeit, und das durch Mittel, die an die niedersten und gemeinsten menschlichen Instinkte appellieren.
Kopfschüttelnd und irgendetwas von Mord nuschelnd, schlich die Lektorin von dannen. Es tat mir leid, sie zu enttäuschen, denn sie war wirklich recht nett – für eine Amerikanerin. Ich bin mir sicher, daß man mir wegen dieser Bemerkung keinen nationalen Chauvinismus vorwerfen wird. Amerikaner haben viele bewundernswerte Eigenschaften, aber literarisches Feingefühl gehört nicht dazu. Wenn ich noch einmal mit dem Gedanken an Veröffentlichung spielen sollte, werde ich einen britischen Verleger zu Rate ziehen.
***
Eigentlich hätte ich diese naive Lektorin auch darauf hinweisen können, daß es viel Schlimmeres als Mord gibt. Mit Leichen komme ich mittlerweile gut zurecht, wenn ich so sagen darf, doch einen der schlimmsten Momente in meinem Leben durchlitt ich im letzten Winter, als ich auf allen vieren über einen mit unsäglichem Müll bedeckten Hof kroch; dorthin, wo ich hoffte, den Menschen wiederzufinden, den ich mehr liebe als mein eigenes Leben. Er war seit fast einer Woche verschwunden, und ich konnte mir nicht vorstellen, daß irgendein Gefängnis einen Mann von seiner Intelligenz und Körperkraft so lange festhalten konnte, außer ... Diese Möglichkeit war zu schrecklich, um darüber nachzudenken; die entsetzliche Sorge ließ mich meine schmerzhaft aufgeschürften Knie und die zerschundenen Hände vergessen und mir die Angst vor überall lauernden Feinden unwichtig erscheinen. Schon hing die Sonne kreisrund am westlichen Himmel. Die Schatten stachliger Gräser fielen grau auf den Boden und auf die Mauern des Hauses, das unser Ziel war. Es handelte sich um ein kleines, niedriges Gebäude aus schmutzigen Lehmziegeln, das inmitten eines mit Abfällen übersäten Hofes stand. Die beiden Wände vor mir hatten weder Fenster noch Türen. Man mußte schon ein Sadist sein, um auch nur einen Hund in einem solchen Verschlag zu halten ...
Ich schluckte und drehte mich nach meinem treuen Vorarbeiter Abdullah um, der dicht hinter mir herkroch. Er schüttelte warnend den Kopf und legte den Finger an die Lippen. Mit einem Handzeichen gab er mir zu verstehen, was er mir sagen wollte: Das Dach war unser Ziel. Er half mir hinauf und folgte mir dann.
Ein bröckeliges Sims schützte uns vor Blicken, Abdullah atmete keuchend. Er war ein alter Mann, und die Sorge und Anstrengung forderten allmählich ihren Tribut. Aber ich hatte keine Zeit, ihn zu bemitleiden – was ihm auch nicht recht gewesen wäre. Ohne innezuhalten, kroch er zur Mitte des Daches, wo sich eine kleine Öffnung von etwa dreißig Zentimetern Durchmesser auftat. Sie war mit einem rostigen Eisengitter gesichert, das an einem Vorsprung dicht unter dem Dach befestigt war. Die Stäbe waren dick und standen eng beieinander.
Sollten die langen Tage der Sorge zu Ende sein? War er in diesem Haus? Die letzten Sekunden, ehe ich die Öffnung erreichte, kamen mir unendlich lang vor. Doch sie waren nicht das Schlimmste. Das sollte erst noch kommen.
Die zweite Lichtquelle in dem stinkenden Loch dort unten war ein Spalt über der Tür. Im dämmerigen Dunkel erblickte ich in der gegenüberliegenden Ecke eine reglose Gestalt. Ich kannte diese Gestalt. Ich hätte sie in der finstersten Nacht wiedererkannt, obwohl ich ihre Gesichtszüge nicht ausmachen konnte. Mir schwindelte. Dann fiel ein Strahl der untergehenden Sonne durch die kleine Öffnung und auf ihn. Er war es! Meine Gebete waren erhört worden! Aber – oh, Himmel – waren wir zu spät gekommen? Steif und reglos lag er ausgestreckt auf der schmutzigen Pritsche. Sein Gesicht, gelb und starr, ähnelte einer wächsernen Totenmaske. Angestrengt versuchte ich, ein Lebenszeichen an ihm zu entdecken, Atemzüge ... und sah nichts.
Doch das war noch nicht das Schlimmste. Es sollte erst noch kommen.
Ja, in der Tat könnte ich, wenn ich mich der verachtenswerten Mittel bedienen würde, die der jungen Dame vorschwebten, die Geschichte so weitererzählen ..., aber ich weigere mich, die Intelligenz meines (noch) hypothetischen Lesers zu beleidigen. Und deswegen fahre ich mit meiner Erzählung in der ursprünglichen Chronologie fort.
***
Wie ich bereits sagte: »Welch rasende Verfolgungsjagden! Welch Kämpfe um die Freiheit! Welch wilde Verzückung!«
Selbstverständlich meinte Keats das in einem anderen Zusammenhang. Trotzdem bin ich schon oft verfolgt worden (manchmal rasend) und habe (erfolgreich) mehr als einmal um meine Freiheit gekämpft. Und auch der letzte Satz ist durchaus zutreffend, auch wenn ich es selbst ein wenig anders formuliert hätte.
Verfolgungsjagden, Kämpfe und das andere, obengenannte Gefühl nahmen in Ägypten ihren Anfang, wo ich zum ersten Mal auf die alte Zivilisation traf, die Inhalt meines Lebenswerks werden sollte, und dem Mann begegnete, der es mit mir teilen würde. Die Ägyptologie und Radcliffe Emerson! Diese beiden sind untrennbar miteinander verbunden, nicht nur in meinem Herzen, sondern auch in den Augen aller namhaften Wissenschaftler. Man kann durchaus sagen – und ich habe es schon oft gesagt –, daß Emerson die Ägyptologie geradezu verkörpert und der beste Forscher aller Zeiten ist. Als ich das schrieb, standen wir an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts, und ich bezweifelte nicht, daß Emerson dem zwanzigsten ebenso seinen Stempel aufdrücken würde wie dem neunzehnten. Wenn ich noch hinzufüge, daß Emersons körperliche Merkmale unter anderem saphirblaue Augen, dicke, rabenschwarze Locken und eine Figur einschließen, die schlichtweg das Sinnbild männlicher Kraft darstellt, wird der einfühlsame Leser begreifen, warum unsere Verbindung so durch und durch befriedigend ist.
Emerson verabscheut seinen Vornamen aus Gründen, die ich nie nachvollziehen konnte. Ich habe ihn nie danach gefragt, denn ich rede ihn lieber auf eine Weise an, die von unserer Freundschaft und Gleichberechtigung zeugt und die in mir liebevolle Erinnerungen an die ersten Tage unserer Bekanntschaft wachruft. Ebenso verabscheut Emerson Titel. Diese Abneigung hat ihren Ursprung in seiner radikalen Weltanschauung. Er beurteilt einen Mann (und eine Frau, wie ich wohl kaum hinzufügen muß) nach Fähigkeiten und nicht nach Rang und Stellung. Anders als die meisten Archäologen lehnt er die blumigen Ehrenbezeugungen ab, mit denen die Fellachen Ausländer bedenken. Seine ägyptischen Arbeiter, die ihn sehr bewunderten, haben ihm respektvoll den Beinamen »Vater der Flüche« verliehen, und ich muß zugeben, daß sie damit den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
Meine Verbindung mit diesem bewundernswerten Menschen verhalf mir zu einem Leben, das ganz nach meinem Geschmack war. Emerson akzeptierte mich als gleichberechtigte Partnerin sowohl im Beruf als auch in der Ehe, und wir verbrachten die Winter an verschiedenen Ausgrabungsstätten in Ägypten» Ich muß hinzufügen, daß ich die einzige Frau war, die sich dieser Arbeit widmete – was traurige Schlüsse auf die Einschränkungen zuläßt, denen das weibliche Geschlecht im späten neunzehnten Jahrhundert unterworfen war –, und ohne die hundertprozentige Unterstützung meines außergewöhnlichen Ehemannes wäre mir das nie möglich gewesen. Emerson redete mir gar nicht zu, ich solle mich beteiligen, er nahm es als selbstverständlich. (Ich nahm es auch als selbstverständlich, was zu Emersons Haltung beigetragen haben mag)
Aus Gründen, die ich mir nie erklären konnte, wurden unsere Ausgrabungen häufig durch Aktivitäten krimineller Natur gestört: Mörder, wandelnde Mumien und Meisterverbrecher hielten uns von der Arbeit ab; wir schienen Grabräuber und mordgierige Individuen regelrecht anzuziehen. Alles in allem hätte das Leben wunderschön sein können. Es hatte nur einen kleinen Makel in Gestalt unseres Sohnes, Walter Peabody Emerson, Freunden und Feinden gleichermaßen unter dem Spitznamen »Ramses« bekannt.
Daß alle kleinen Jungen Rabauken sind, ist eine allgemein anerkannte Tatsache. Ramses, der seinen Namen einem Pharao verdankt, dem er in Sturheit und Arroganz in nichts nachstand, hatte alle für sein Alter und Geschlecht typischen Unzulänglichkeiten: eine unglaubliche Liebe zum Dreck und faulenden, stinkenden Objekten, eine kaum vorstellbare Gleichgültigkeit, was sein eigenes Überleben betraf, sowie völlige Ignoranz gegenüber den Regeln des gesellschaftlichen Umgangs. Dazu kamen die für ihn charakteristischen Eigenschaften, die ihn noch unerträglicher machten. Seine Intelligenz war (nicht weiter überraschend) hoch entwickelt, doch sie äußerte sich auf recht beunruhigende Weise. Sein Arabisch war auffallend flüssig (woher er all die Wörter hatte, ist mir ein Rätsel; von mir ganz bestimmt nicht); ägyptische Hieroglyphen konnte er ebenso gut lesen wie viele erwachsene Wissenschaftler; und er hatte die unheimliche Fähigkeit, mit Tieren jeglicher Spezies (außer der zweibeinigen) zu kommunizieren. Er ... Aber Ramses außergewöhnliche Wesensart zu schildern, würde sogar meine literarischen Fähigkeiten übersteigen.
In den Jahren, die dieser Erzählung vorangingen, hatte Ramses Anzeichen der Besserung gezeigt. Er stürzte sich nicht mehr Hals über Kopf in jede Gefahr, und sein deftiger Wortschatz war gemäßigter geworden. Inzwischen war eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem stattlichen Erzeuger zutage getreten, obwohl er in Haut- und Haarfarbe eher wie ein Ägypter aus früherer Zeit als wie ein englischer Knabe wirkte. (Das kann ich mir ebenso wenig erklären wie unsere ständigen Begegnungen mit kriminellen Elementen. Es gibt eben Dinge, die jenseits unseres begrenzten Verständnisses liegen, und wahrscheinlich ist das auch gut so.)
Ein noch nicht lange zurückliegendes Ereignis hatte jene drastischen Veränderungen in meinem Sohn hervorgerufen, wobei der letztendliche Ausgang dieser Entwicklung noch offenstand. Unser jüngstes und vielleicht bemerkenswertestes Abenteuer hatte sich im vergangenen Winter zugetragen, als der Hilferuf eines alten Freundes von Emerson uns in die Wüste des westlichen Nubiens und in eine abgelegene Oase führte, wo die Reste der alten meroitischen Zivilisation noch sichtbar waren. Es kam zu den üblichen Katastrophen: Nach dem Dahinscheiden unseres letzten Kamels verdursteten wir beinahe, man versuchte, uns zu entführen, und wir wurden zum Ziel gewalttätiger Übergriffe – nichts Außergewöhnliches also. Und als wir unseren Bestimmungsort erreichten, mußten wir feststellen, daß unsere Hilfe zu spät kam. Das unglückliche Paar hatte jedoch ein Kind zurückgelassen – ein junges Mädchen, das wir mit der Hilfe ihres ritterlichen und tapferen Pflegebruders vor einem schrecklichen Schicksal bewahren konnten. Ihr verstorbener Vater hatte sie, was sehr treffend war, »Nefret« genannt, denn das alte ägyptische Wort bedeutet »schön«. Bei ihrem Anblick verschlug es Ramses die Sprache – ein Zustand, den ich bei ihm nie erwartet hätte –, und er verharrte fortan in diesem Zustand.
Mich erfüllte das mit den düstersten Vorahnungen. Ramses war zehn, Nefret dreizehn, doch der Altersunterschied würde sich ausgleichen, wenn sie erst erwachsen waren. Außerdem kannte ich meinen Sohn zu gut, um seine Empfindungen als jugendliche Schwärmerei abzutun. Sein Gefühlsleben war von Leidenschaft bestimmt, sein Charakter (um es milde auszudrücken) dickköpfig. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war nicht mehr daran zu rütteln. Er war unter Ägyptern aufgewachsen, die körperlich und emotional früher reif sind als ihre kühlen englischen Altersgenossen. Einige seiner Freunde hatten schon mit dreizehn Jahren Kinder gezeugt. Und dann noch die dramatischen Umstände, unter denen er dem Mädchen begegnet war ...
Wir hatten nicht einmal von ihrer Existenz gewußt, ehe wir das kahle, von einer Lampe erleuchtete Zimmer betraten, wo sie uns erwartete. Sie so zu sehen, in ihrer strahlenden Jugend, mit ihrem rotgoldenen Haar, das ihr über das schimmernde, weiße Gewand fiel; das tapfere Lächeln, mit dem sie den Gefahren trotzte ... Nun, selbst mich hatte das tief beeindruckt.
Wir reisten mit dem Mädchen zurück nach England und nahmen sie in unsere Familie auf. Das war Emersons Idee. Und ich muß zugeben, daß uns eigentlich keine andere Wahl blieb, denn ihr einziger lebender Angehöriger war ihr Großvater, der so tief dem Laster verfallen war, daß er sich nicht einmal zum Vormund für eine Katze, geschweige denn eines jungen Mädchens geeignet hätte. Wie Emerson Lord Blacktower davon überzeugte, den Anspruch auf sie aufzugeben, wollte ich gar nicht wissen. Ich bezweifle, daß »überzeugen« das richtige Wort ist. Blacktower lag im Sterben (und brachte das tatsächlich einige Monate später hinter sich), sonst hätte Emersons beachtliche Sprachfertigkeit wahrscheinlich nichts ausrichten können. Nefret klammerte sich an uns – nur bildlich gesprochen, sie war ein zurückhaltendes Kind –, denn wir waren die einzigen Vertrauten in einer Welt, die ihr so fremd vorkommen mußte wie mir das Leben auf dem Mars (falls es dort Leben gibt). Alles, was sie über unsere moderne Gesellschaft wußte, hatte sie entweder von uns oder aus den Büchern ihres Vaters erfahren. Und in dieser Welt war sie nicht die Hohepriesterin der Isis, die Verkörperung einer Göttin, sondern ein völlig bedeutungsloses Wesen – nicht einmal eine Frau, was bei Gott schon bedeutungslos genug ist, sondern ein weibliches Kind. Ein wenig höher angesiedelt als ein Haustier und auf einer beträchtlich niedrigeren Stufe als jeder Mann, ganz gleich welchen Alters. Emerson hätte nicht weiter auszuführen brauchen (obwohl er es bis ins Detail tat), daß wir uns besonders gut dazu eigneten, ein junges Mädchen zu erziehen, das unter solch außergewöhnlichen Umständen aufgewachsen war.
Emerson ist ein bemerkenswerter Mann, aber doch nur ein Mann. Ich glaube, dazu muß ich nichts weiter sagen. Nachdem er seine Entscheidung gefällt und mich überredet hatte, sie zu billigen, wies er alle düsteren Vorahnungen von sich. Emerson würde nie zugeben, düstere Vorahnungen zu haben, und er wird wütend, wenn ich meine zur Sprache bringe. Und in diesem Fall hatte ich eine ganze Menge.
Was mir besonderes Kopfzerbrechen bereitete, war die Frage, wie wir erklären sollten, wo Nefret sich die letzten dreizehn Jahre lang aufgehalten hatte. Allerdings machte das nur mir Sorgen, denn Emerson versuchte, das Problem zu ignorieren, wie er es mit allen Problemen tut. »Warum sollten wir irgendetwas erklären? Wenn sich jemand erdreisten sollte zu fragen, sag ihm, er soll sich zum Teufel scheren.«
Glücklicherweise ist Emerson vernünftiger, als er oft klingt, und schon ehe wir Ägypten verließen, war er bereit zuzugeben, daß wir uns irgendeine Geschichte ausdenken mußten. Wenn wir in Begleitung eines Mädchens von offensichtlich englischer Abstammung aus der Wüste zurückkamen, würde das sogar den Dümmsten neugierig machen. Außerdem mußte man ihre Identität preisgeben, wenn sie das Vermögen ihres Großvaters erben wollte. Darüber hinaus enthielt ihre Lebensgeschichte alles, was das Herz eines Reporters erfreut – Jugend, Schönheit, geheimnisvolle Herkunft, Adel und viel Geld –, und, wie ich Emerson sagte, hatten es die Schakale von der Presse, wie Emerson diese Herren zu bezeichnen pflegte, aufgrund vergangener Ereignisse ohnehin auf uns abgesehen.
Wenn möglich ziehe ich es vor, die Wahrheit zu sagen. Nicht nur, weil uns die moralischen Grundsätze unserer Gesellschaft zur Ehrlichkeit verpflichten, sondern weil es viel einfacher ist, bei den Tatsachen zu bleiben, als zu lügen, ohne sich in Widersprüche zu verwickeln. Doch in diesem Fall kam die Wahrheit nicht in Frage. Als wir die »Verlorene Oase« (oder die Stadt des heiligen Bergs, wie die Bewohner sie nannten) verließen, hatten wir geschworen, nicht nur ihre Lage, sondern auch ihre Existenz geheim zuhalten. Da diese aussterbende Zivilisation nur aus wenigen Menschen bestand, die keine Feuerwaffen kannten, hätten Abenteurer, Schatzjäger und – nicht zu vergessen – skrupellose Archäologen ein leichtes Spiel gehabt. Außerdem durfte man einen zwar weniger zwingenden, aber trotzdem wichtigen Punkt nicht aus den Augen verlieren, und das war Nefrets guter Ruf. Wäre es bekannt geworden, daß sie bei einem sogenannten primitiven Volk aufgewachsen war und dort als Hohepriesterin einer heidnischen Gottheit fungiert hatte, hätten ihr die anzüglichen Spekulationen und unschicklichen Witze, zu denen eine solche Vorstellung die Unwissenden hinreißt, das Leben zur Hölle gemacht. Nein, die Wahrheit durfte nicht ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Also war es nötig, sich eine überzeugende Lüge einfallen zu lassen, und wenn ich gezwungen bin, von meinem Prinzip der Aufrichtigkeit abzuweichen, lüge ich nicht schlecht.
Glücklicherweise lieferten uns die damaligen historischen Ereignisse eine plausible Erklärung. Der Aufstand der Mahdisten im Sudan, der 1881 begonnen und in dem unglücklichen Land länger als ein Jahrzehnt gewütet hatte, neigte sich dem Ende zu. Ägyptische Truppen (selbstverständlich unter Führung britischer Offiziere) hatten den Großteil des verlorenen Gebiets zurückerobert, und einige Menschen, die schon als verschollen gegolten hatten, tauchten wie durch Zauberhand wieder auf. Die Flucht von Slatin Pasha – früher Slatin Bey – war wohl das erstaunlichste Beispiel einer wundersamen Rettung, aber es gab noch andere, zum Beispiel Vater Ohrwalder und zwei Nonnen seiner Mission, die sieben Jahre der Sklaverei und Folter hatten ertragen müssen, ehe es ihnen gelang zu entkommen.
Eben dieser Fall brachte mich auf den Gedanken, ein gütiges Missionarspaar als Pflegeeltern für Nefret zu erfinden, deren leibliche Eltern – wie ich erklärte – kurz nach ihrer Ankunft an Krankheit und Entbehrungen zugrunde gegangen waren. Beschützt von ihrer treuen bekehrten Gemeinde, waren die gütigen Missionare dem Gemetzel der Derwische entronnen, hatten es aber nicht gewagt, ihr sicheres, abgelegenes Dorf zu verlassen, solange im Lande der Aufstand tobte.
Emerson merkte an, daß die treuen bekehrten Gemeindemitglieder, soweit er informiert sei, für gewöhnlich die ersten waren, die ihre Geistlichen in den Kochtopf steckten, aber ich hielt meine Geschichte für höchst glaubhaft. Und nach den Reaktionen zu urteilen, erging es der Presse genauso. Wo immer möglich, war ich bei der Wahrheit geblieben – eine wichtige Regel beim Erfinden von Geschichten –, und es gab keinen Grund, bei den Einzelheiten der Wüstendurchquerung zu schwindeln. Gestrandet in der Einöde, verlassen von unseren Dienern, unsere Kamele tot oder im Sterben ... Es war eine dramatische Geschichte, und ich glaube, sie beschäftigte die Presse derart, daß niemand nach wichtigeren Details fragte. Ich erfand noch einen Sandsturm und einen Überfall nomadisierender Beduinen dazu, um die Sache abzurunden.
Dem Journalisten, den wir am meisten fürchteten, konnten wir aus dem Weg gehen. Kevin O’Connell, der kühne junge Starreporter des Daily Yell befand sich gerade auf dem Weg in den Sudan, als wir das Land verließen, denn die Truppen rückten rasch vor, und die Wiedereroberung Khartums wurde jeden Tag erwartet. Ich mochte Kevin (Emerson mochte ihn nicht), doch wenn sich seine journalistischen Instinkte regten, traute ich ihm nicht über den Weg.
Also war auch das geregelt. Doch die größte Schwierigkeit war Nefret selbst.
Ich gebe freimütig zu, daß ich keine sehr mütterliche Frau bin. Allerdings wage ich die Vermutung, daß selbst die mütterlichen Instinkte der heiligen Madonna unter dem ständigen Kontakt mit meinem Sohn gelitten hätten. Zehn Jahre mit Ramses hatten in mir die Überzeugung reifen lassen, daß meine Unfähigkeit, weitere Kinder zu bekommen, nicht, wie ich zuerst glaubte, eine traurige Enttäuschung, sondern einen Gnadenakt der allwissenden Vorsehung darstellte. Ein Ramses war genug. Zwei oder mehr von der Sorte hätten mir den Rest gegeben.
(Soviel ich weiß, hat der Umstand, daß Ramses ein Einzelkind ist, zu einigen böswilligen Spekulationen geführt. Ich möchte nichts weiter dazu sagen, als daß es bei seiner Geburt zu gewissen Komplikationen kam, die ich nicht im Detail erläutern möchte, da sie nur mich etwas angehen.)
Und nun hatte ich noch ein Kind, um das ich mich kümmern mußte. Nicht etwa ein leicht zu formendes Kleinkind, sondern ein Mädchen an der Schwelle zur Frau, deren Lebensgeschichte noch ungewöhnlicher war als die meines so entsetzlich altklugen Sohnes. Was um Himmels willen sollte ich mit ihr anfangen? Wie sollte ich ihr Umgangsformen beibringen und die enormen Bildungslücken schließen, was nötig war, damit sie in ihrem neuen Leben glücklich wurde?
Wie ich zu vermuten wage, hätten die meisten Frauen sie in ein Internat gesteckt. Doch ich weiß, daß man sich seiner Pflicht nicht entziehen darf. Es wäre eine ausgemachte Grausamkeit gewesen, Nefret der beengenden Frauenwelt eines Mädchenpensionats zu überantworten. Ich eignete mich besser dazu, sie zu erziehen als eine Lehrerin, denn ich kannte die Welt, aus der sie kam. Außerdem teilte ich ihre Verachtung für die absurden Regeln, denen die sogenannte Zivilisation das weibliche Geschlecht unterwirft. Und ... ich mochte das Mädchen.
Wenn ich nicht so ehrlich wäre, würde ich sagen, daß ich sie liebte. Zweifelsohne hätte ich so empfinden müssen. Sie hatte Eigenschaften, die sich jede Frau bei einer Tochter gewünscht hätte – einen reizenden Charakter, Scharfsinn, Ehrlichkeit und, wie schon erwähnt, außergewöhnliche Schönheit. Doch dieses letztere Merkmal, das viele in unserer Gesellschaft an erster Stelle nennen würden, zählt bei mir nicht so viel, obwohl ich mich daran freute.
Sie hatte das Aussehen, um das ich andere immer beneidet hatte. Ganz anders als ich. Mein Haar ist schwarz und kraus, Nefret fiel das Haar über die Schultern wie ein goldener Vorhang. Ihre Haut war zart und hell, ihre Augen kornblumenblau. Bei mir ... ist das ganz anders. Ihre schlanke, zierliche Gestalt würde wahrscheinlich nie die Ausbuchtungen entwickeln, die die meine kennzeichnen. Emerson hatte immer wieder betont, daß ihm das an mir gefällt, aber ich bemerkte das Wohlgefallen, mit dem sein Blick Nefrets zarter Gestalt folgte.
Wir waren im April nach England zurückgekehrt und hatten uns wie immer im Amarna House, unserem Zuhause in Kent, eingerichtet. Allerdings nicht ganz wie immer, denn unter gewöhnlichen Umständen hätten wir uns sofort an unsere Ausgrabungsberichte gesetzt. Emerson lag viel daran, sie so schnell wie möglich zu veröffentlichen. In diesem Jahr würde er weniger schreiben müssen als sonst, denn unsere Expedition in die Wüste hatte den Großteil des Winters in Anspruch genommen. Trotzdem hatten wir nach unserer Rückkehr nach Nubien einige produktive Wochen lang in den Pyramidenfeldern von Napata gearbeitet. (Wobei uns Nefret, wie ich hinzufügen muß, eine große Hilfe gewesen war. Sie zeigte ein beachtliches Talent für die Archäologie.)
Ich konnte Emerson nicht assistieren, wie ich es sonst tat. Gewiß muß ich nicht erklären, warum ich anderweitig beschäftigt war. Das lud eine gehörige Last auf Emersons Schultern, doch diesmal beschwerte er sich nicht und wimmelte meine Entschuldigungen mit (beängstigendem) Gleichmut ab. »Ist schon in Ordnung, Peabody; das Kind kommt zuerst. Sag’ mir, wenn ich etwas für dich tun kann.«
Diese ungewöhnliche Freundlichkeit und die Tatsache, daß er meinen Mädchennamen benutzte – das tut Emerson, wenn er entweder in besonders liebevoller Stimmung ist, oder wenn er mich zu etwas überreden will, womit ich nicht einverstanden bin –, ließ in mir die schrecklichsten Befürchtungen keimen.
»Du kannst nichts tun«, antwortete ich. »Was verstehen Männer schon von Frauenangelegenheiten?«
»Hmmm«, meinte Emerson und zog sich eilends in die Bibliothek zurück.
Ich muß zugeben, daß es mir Spaß machte, das Mädchen anständig auszustaffieren. Als wir in London eintrafen, besaß sie kaum ein nennenswertes Kleidungsstück bis auf ein paar bunte Gewänder, wie sie die Nubierinnen tragen, und einige billige Konfektionskleider, die ich für sie in Kairo erstanden hatte. Ein Interesse an Mode ist, wie ich glaube, durchaus mit intellektuellen Fähigkeiten vereinbar, die denen eines Mannes gleichkommen oder sie sogar übersteigen; also suhlte ich mich (der Ausspruch stammt, wie ich nicht eigens betonen muß, von Emerson) in gerafften Nachthemden und spitzenbesetzten Unterröcken, gerüschten Wäschestücken, die ein anständiger Mensch nicht beim Namen nennt, und Blusen mit Volants; in Handschuhen und Hüten und Taschentüchern, Badeanzügen und Pumphosen zum Radfahren, Mänteln, Knöpfstiefeln und einem regenbogenbunten Sortiment von Satinschärpen mit passenden Bändern.
Auch ich gönnte mir einige Neuerwerbungen, da ein Winter in Ägypten stets schreckliche Folgen für meine Garderobe hat. Die Mode in diesem Jahr war weniger lächerlich als die im vorangegangenen; die Gesäßpolster waren verschwunden, die Ballonärmel vom letzten Jahr zu einem vernünftigen Umfang geschrumpft. Und die Röcke hingen weich hinunter, anstatt sich über Schichten von Unterröcken zu bauschen. Sie waren besonders gut für Frauen geeignet, die keine künstliche Unterstützung brauchten, um gewisse Körperstellen zu betonen.
Oder wenigstens dachte ich, daß die Mode nicht mehr so lächerlich wäre, bis ich Nefrets Kommentare hörte. Bei der bloßen Vorstellung, einen Badeanzug zu tragen, wollte sie sich vor Lachen ausschütten. »Warum soll man sich anziehen, wenn die Sachen dann doch tropfnaß werden?« fragte sie (mit einiger Berechtigung, wie ich zugeben mußte). »Gehen die Frauen hier auch mit Waschanzügen in die Badewanne?« Und was ihre Bemerkung über Unterhosen betraf ... Glücklicherweise äußerte sie sich nicht in Gegenwart der Verkäuferin oder im Beisein von Emerson und Ramses. (Zumindest hoffe ich das, denn Emerson sind solche Themen stets peinlich – und Ramses kann man mit nichts in Verlegenheit bringen.)
Sie paßte besser in unseren Haushalt, als ich angenommen hatte, denn unser Personal ist inzwischen mehr oder weniger an exzentrische Gäste gewöhnt. (Wenn nicht, verlassen sie die Stellung meist auf eigenen Wunsch.) Gargery, unser Butler, erlag sofort Nefrets Charme; ebenso hingebungsvoll wie Ramses folgte er ihr auf Schritt und Tritt und wurde es nie müde, die (geschönte) Geschichte darüber zu hören, wie wir sie gefunden hatten. Gargery ist, wie ich leider sagen muß, ein Romantiker. (Romantik ist eigentlich keine Eigenschaft, die ich ablehne, bei einem Butler kann sie allerdings zu Komplikationen führen.) Seine Hände ballten sich zu Fäusten, und seine Augen leuchteten, wenn er verkündete (wobei er vor lauter Begeisterung der Hochsprache nicht mehr mächtig war): »Ach, ich wär’ ja so gern dabei gewesen, Ma’am! Ich hätt’ diesen hinterlistigen Dienern ein paar verpaßt, und diesen dreckigen Beduinen hätt’ ich’s auch gezeigt! So wahr ich hier steh’!«
»Ich bin mir sicher, daß Sie uns eine große Hilfe gewesen wären, Gargery«, antwortete ich. »Vielleicht ein andermal.« (Wenn ich nur geahnt hätte, daß diese harmlose Bemerkung sich als prophetisch erweisen sollte!)
Das einzige Mitglied unseres Haushalts, das nicht Nefrets Zauber erlag, war unser liebes Hausmädchen Rose. In ihrem Fall war das schlicht und einfach auf Eifersucht zurückzuführen. Sie hatte geholfen, Ramses großzuziehen und hegte eine unerklärliche Zuneigung zu ihm. Eine Zuneigung, die auch erwidert wurde – oder vielmehr worden war. Jetzt galten Ramses Geschenke, die Blumen und interessanten wissenschaftlichen Anschauungsobjekte (Gräser, Knochen und mumifizierte Mäuse) einer anderen. Rose litt darunter. Das bekam ich deutlich zu spüren, denn Rose war mir sonst immer ein großer Trost gewesen, wenn mir die vereinten Umtriebe der männlichen Haushaltsmitglieder zuviel wurden. Auf Bastet, die Katze, konnte ich mich, obwohl sie ein Weibchen war, auch nicht mehr verlassen. Es hatte seine Zeit gebraucht, bis sie die Anziehungskraft des anderen Geschlechts entdeckte, was sie jedoch dann mit einem solchen Feuereifer wettgemacht hatte, daß es nun überall im Haus von ihrem Nachwuchs wimmelte. Ihre letzten Jungen hatte sie im April kurz vor unserer Ankunft geworfen, und Nefret verbrachte viele glückliche Stunden im Spiel mit den Kätzchen. Eine ihrer Aufgaben als Hohepriesterin der Göttin Isis war die Pflege der heiligen Katzen gewesen, vielleicht erklärte das nicht nur ihre Zuneigung zu diesen Tieren, sondern auch ihre fast unheimliche Fähigkeit, mit ihnen zu sprechen. Eine Katze behandelt man am besten wie ein gleichberechtigtes Wesen – oder besser noch wie ein überlegenes, was sie ihres Wissens nach auch ist.
Nur Emersons jüngerer Bruder und seine Frau, meine liebe Freundin Evelyn, kannten Nefrets wahre Geschichte. Es wäre unmöglich gewesen, sie ihnen zu verheimlichen, auch wenn wir kein Vertrauen in ihre Diskretion gehabt hätten. Und außerdem hoffte ich, Evelyn würde mich in der angemessenen Erziehung einer jungen Dame richtig beraten. Schließlich hatte sie als Mutter von sechs Kindern – darunter drei Mädchen – genug Erfahrung und dazu noch das gütigste Herz der Welt.
Ich erinnere mich an einen schönen Junitag, als wir vier Erwachsene auf der Terrasse des Armana House saßen und zusahen, wie die Kinder auf dem Rasen spielten. Die idyllische Landschaft wirkte, als habe die Hand des großen Constable sie auf die Leinwand gebannt – der blaue Himmel mit weißen Schäfchenwolken, das sattgrüne Gras und die stattlichen Bäume. Jedoch hätte es der Talente eines Malers ganz anderer Stilrichtung bedurft, um die lachenden Kinder zu Papier zu bringen, die die Szenerie wie bewegliche Blumen belebten. Das Sonnenlicht tauchte ihre wehenden Locken in einen goldenen Schein und liebkoste ihre rosigen und vor Gesundheit strotzenden Glieder. Mein Patenkind, die kleine Amelia, folgte den noch unsicheren Schritten ihres jüngeren Bruders so fürsorglich wie eine Mutter; Raddie, der älteste von Evelyns Kinderschar, dessen Knabengesicht bereits Ähnlichkeit mit den sanften Zügen seines Vaters aufwies, versuchte, die ausgelassenen tobenden Zwillinge zu bändigen, die einen Ball hin und her warfen. Der Anblick dieser unschuldigen Kinder, denen das Schicksal Gesundheit, Wohlstand und die zärtliche Liebe ihrer Eltern beschert hatte, wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben.
Allerdings waren, wie ich vermutete, meine Augen die einzigen, die auf meinen hübschen Nichten und Neffen ruhten. Selbst ihre Mutter blickte, das jüngste Kind schlafend an der Brust, woanders hin.
Nefret saß abseits unter einer der hohen Eichen. Sie hatte die Beine überkreuzt, und ihre bloßen Füße lugten unter dem Saum ihres Kleides hervor – eines der nubischen Gewänder, die ich ihr während unserer Ausgrabungsarbeiten in Napata besorgt hatte, weil nichts Besseres aufzutreiben gewesen war. Das Kleid bestand aus leuchtend papageiengrünem Stoff und war mit großen bunten Flecken bedruckt – scharlachrot, senfgelb, türkis. Ein rotgoldener Zopf lag über ihrer Schulter, und sie neckte mit dessen Ende das Kätzchen auf ihrem Schoß. Ramses, ihr ständiger Schatten, kauerte daneben. Von Zeit zu Zeit blickte Nefret auf und sah lächelnd den Kindern beim Spielen zu. Aber Ramses dunkle Augen wandten sich nie von ihr ab.
Walter stellte seine Tasse ab und griff nach dem Notizbuch, auf das er sich selbst bei diesem gemütlichen Beisammensein zu verzichten geweigert hatte. Während er darin blätterte, meinte er: »Ich glaube, jetzt weiß ich, wie sich die Funktion des Infinitivs entwickelt hat. Am besten frage ich Nefret ...«
»Laß das Kind in Ruhe.« Evelyn hatte ihren Mann unterbrochen, und das in einem so scharfen Ton, daß ich sie erstaunt ansah. Evelyn schlug niemals einen scharfen Ton an, besonders nicht gegenüber ihrem Gatten, den sie (meiner Meinung nach) kritiklos vergötterte.
Walter warf ihr einen überraschten und gekränkten Blick zu. »Liebling, ich wollte doch nur ...«
»Wir wissen, was du willst«, sagte Emerson lachend, »nämlich als der Mann zu Ruhm und Ehren gelangen, der das alte Meroitisch entziffert hat. Eine Begegnung mit einem lebenden Menschen, der diese Sprache spricht, kann bei einem Wissenschaftler schon dazu führen, daß ihm die Pferde durchgehen.«
»Sie ist der Stein von Rosetta in Menschengestalt«, murmelte Walter. »Bestimmt hat sich die Sprache im Laufe eines Jahrtausends bis zur Unkenntlichkeit verändert, aber dennoch kann Nefret einem Fachmann wichtige Hinweise ...«
»Sie ist kein Stein«, sagte Evelyn, »sondern ein junges Mädchen.«
Noch eine Unterbrechung! So etwas war noch nie vorgekommen. Emerson starrte Evelyn verblüfft, doch auch bewundernd an. Er hatte sie immer für erbärmlich sanftmütig gehalten. Walter schnappte nach Luft und meinte reumütig: »Du hast ja ganz recht, liebe Evelyn. Nicht um alles in der Welt würde ich etwas tun, das ...«
»Dann verschwindet«, sagte Evelyn. »Ab in die Bibliothek mit euch beiden. Vergrabt euch in eure toten Sprachen und eure staubigen Bücher. Das ist doch alles, was euch Männer interessiert!«
»Komm schon, Walter.« Emerson stand auf. »Wir sind in Ungnade gefallen und sparen uns besser die Mühe, uns zu verteidigen. Eine Frau gegen ihren Willen zu überzeugen ...«
Ich warf ein Stück Gebäck nach ihm. Er fing es geschickt im Flug auf, grinste und ging, unwillig gefolgt von Walter, davon.
»Entschuldige, Amelia«, sagte Evelyn. »Es tut mir leid, wenn ich Radcliffe die Laune verdorben habe ...«
»Unsinn, deine Kritik war viel freundlicher als das, was er normalerweise von mir zu hören kriegt. Und was die schlechte Laune anbelangt: Hast du ihn jemals selbstzufriedener gesehen? Dermaßen in ekelhafter Selbstgerechtigkeit versunken und so widerwärtig gutgelaunt?«
»Die meisten Frauen würden sich nicht darüber beklagen«, meinte Evelyn lächelnd.
»Das ist nicht der Emerson, den ich kenne. Wenn ich es dir sage, Evelyn, seit wir aus Ägypten zurück sind, hat er nicht mehr geflucht – nicht ein einziges ›Verdammt!‹.« Evelyn lachte; ich sprach mit steigender Entrüstung weiter. »Die Wahrheit ist, daß er sich einfach weigert zuzugeben, vor was für einem ernsthaften Problem wir stehen.«
»Du meinst wohl das dort drüben unter der Eiche?« Evelyns Lächeln schwand, während sie die anmutige Gestalt des Mädchens betrachtete. Das Kätzchen hatte sich davongetrollt, und Nefret saß reglos, die Hände im Schoß, da und blickte über den Rasen. Sonnenlicht drang durch das Laub und ließ kleine Funken in ihrem Haar aufsprühen, so daß sie aussah wie in einem goldenen Glanz gehüllt.
»Sie ist so entrückt und schön wie eine junge Göttin«, sagte Evelyn, womit sie meine eigenen Gedanken wiedergab. »Was soll aus einem solchen Mädchen werden?«
»Sie ist willig und intelligent und wird sich anpassen«, sagte ich mit Nachdruck. »Und sie scheint glücklich zu sein. Sie beklagt sich nicht.«
»Was Durchhaltevermögen anbelangt, ist sie, wie ich mir vorstellen kann, durch eine harte Schule gegangen. Aber, meine liebe Amelia, bis jetzt hat sie auch wenig Grund zum Klagen gehabt. Du hast sie – meiner Ansicht nach völlig berechtigt – von der Außenwelt abgeschirmt. Wir alle akzeptieren und lieben sie, wie sie ist. Früher oder später jedoch wird sie ihren rechtmäßigen Platz in einer Welt einnehmen müssen, auf die sie von Geburt her einen Anspruch hat. Und diese Welt kennt keine Gnade gegenüber Menschen, die anders sind als die anderen.«
»Glaubst du, daß ich das nicht weiß?« fragte ich und fügte lachend hinzu: »Es gibt sogar gewisse Menschen, die selbst mich für exzentrisch halten. Natürlich kümmere ich mich nicht um diese Leute, aber ... nun, ich gebe zu, daß ich mich gefragt habe, ob ich der geeignete Mensch bin, um Nefret zu erziehen.«
»Sie könnte nichts Besseres tun, als dich zum Vorbild zu nehmen«, sagte Evelyn liebevoll. »Und du weißt, du kannst auf mich zählen. Ich helfe dir, so gut es mir möglich ist.«
»Wir müßten es eigentlich schaffen«, meinte ich. Mein angeborener Optimismus erwachte wieder zum Leben. »Schließlich habe ich zehn Jahre mit Ramses überstanden. Mit deiner Hilfe und mit der Walters ... Vielleicht warst du ein bißchen streng mit ihm, liebste Evelyn. Die Entzifferung antiker, unbekannter Sprachen ist nicht nur sein Beruf, sondern das, was ihm am meisten am Herzen liegt. Von dir natürlich abgesehen – und den Kindern ...«
»Das frage ich mich.« Evelyn sah mit ihrem goldenen Haar, dem zarten Gesicht und dem Baby im Arm wie eine raphaelitische Madonna aus. In ihrer Stimme aber lag ein Ton, den ich noch nie zuvor bei ihr gehört hatte. »Welch merkwürdige Veränderungen im Laufe der Jahre mit uns vorgehen, Amelia ... letzte Nacht habe ich von Amarna geträumt.«
Damit hätte ich am allerwenigsten gerechnet, und es hatte eine sehr eigenartige Wirkung auf mich. Ein Bild blitzte vor meinem geistigen Auge auf, so lebendig, daß es die Wirklichkeit verdrängte: sengend heißer Wüstensand und schroffe Klippen, so leblos wie eine Mondlandschaft. Fast konnte ich die trockene Luft auf meiner Haut spüren; mir war, als hörte ich die gespenstischen, stöhnenden Schreie der Erscheinung, die unser Leben bedroht und uns beinahe um den Verstand gebracht hatte ...
Mühsam vertrieb ich dieses eindrucksvolle Bild. Ohne meine Geistesabwesenheit zu bemerken, hatte Evelyn inzwischen weitergesprochen. »Erinnerst du dich noch, wie er an jenem Tag aussah, Amelia – an jenem Tag, an dem er mir seine Liebe erklärte? Bleich und stattlich wie ein junger Gott hielt er meine Hand und nannte mich die tapferste aller Frauen. Ein bröckeliger Papyrus, kein Stein von Rosetta hätte mir damals den Platz in seinem Herzen streitig gemacht. Trotz Gefahren, Zweifeln und Strapazen war es eine wunderbare Zeit! Inzwischen erinnere ich mich sogar schon gerne an den Kerl mit der lächerlichen Mumienverkleidung.«
Ich seufzte tief. Evelyn sah mich überrascht an. »Du auch, Amelia? Was könntest du bedauern? Du hast alles gewonnen, ohne etwas zu verlieren. In jeder Zeitung, die ich aufschlage, steht etwas über deine Eskapaden – entschuldige, Abenteuer.«
»Ach, die Abenteuer«, winkte ich ab. »Daß es dazu kommt, ist mehr oder weniger selbstverständlich. Emerson zieht sie an.«
»Emerson?« Evelyn lächelte.
»Vergiß nicht, Evelyn: Lord Blacktower hat sich an Emerson gewandt, um seinen vermißten Sohn ausfindig zu machen; Emerson enttarnte den Verbrecher in dem Fall mit der Mumie aus dem Britischen Museum. Und an wen wandte sich Lady Baskerville, als sie einen Mann suchte, der die Ausgrabungen ihres Gatten weiterführen sollte? An Emerson, den angesehensten Wissenschaftler seiner Zeit.«
»So habe ich mir das noch nie überlegt«, gab Evelyn zu. »Du hast recht, Amelia. Aber du hast mir nur recht gegeben. Dein Leben ist so voller Aufregung und Abenteuer, die in meinem fehlen ...«
»Richtig. Doch es ist nicht wie früher, Evelyn. Darf ich es dir gestehen? Ich glaube schon. Ich träume genauso wie du von jenen längst vergangenen Tagen, als ich noch Emersons ein und alles war, das einzige, was er bewunderte.«
»Mein liebe Amelia ...«
Ich seufzte wieder. »Amelia nennt er mich kaum noch, Evelyn. Wie gut und mit wieviel Freude erinnere ich mich an seinen gereizten Ton, wenn er mich mit diesem Namen ansprach. Inzwischen heißt es nur Peabody – meine liebe Peabody, Peabody, mein Schatz ...«
»In Amarna hat er dich auch Peabody genannt«, sagte Evelyn.
»Ja, aber in einem anderen Ton! Was anfangs als Provokation gedacht war, ist heute ein Ausdruck zufriedener, träger Zuneigung. Er war so männlich damals, so romantisch ...«
»Romantisch?« wiederholte Evelyn zweifelnd.
»Du hast deine liebevollen Erinnerungen, Evelyn, ich habe meine. Wie gut erinnere ich mich noch an den Schwung seiner schönen Lippen, als er mir sagte: ›Sie sind nicht dumm, Peabody, auch wenn Sie eine Frau sind.‹ Wie seine blauen Augen funkelten an diesem nie vergessenen Morgen, als er dank meiner Pflege den Höhepunkt des Fiebers überstanden hatte. Er knurrte: »Danke, daß Sie mir das Leben gerettet haben. Und jetzt verschwinden Sie.« Ich suchte nach einem Taschentuch. »Oje. Entschuldige, Evelyn. Ich hatte nicht vor, mich so von meinen Gefühlen hinreißen zu lassen.«
Mitleidig und schweigend tätschelte sie mir die eine Hand, während ich mir mit der anderen das Taschentuch auf die Augen drückte. Die Stimmung verflog. Ein Kreischen von Willie und noch eines von seinem Zwillingsbruder wiesen darauf hin, daß zwischen den beiden wieder einmal eine jener Raufereien im Gange war, die ihr liebevolles Verhältnis zueinander kennzeichneten. Raddie, der hingelaufen war, um die Kämpfenden zu trennen, taumelte zurück und hielt sich die Nase. Evelyn und ich stießen gleichzeitig einen Seufzer aus.
»Glaube nicht, daß ich es bereue«, sagte sie leise. »Ich würde keine Locke von Willies Kopf gegen mein Leben von damals eintauschen. Ich liebe meine Kinder sehr. Nur – nur, liebe Amelia, es sind so viele!«
»Ja«, meinte ich hilflos. »Das stimmt.«
Ramses war näher an Nefret herangerückt. Das Bild war unwiderstehlich und gleichzeitig beunruhigend: die Göttin und ihr Hohepriester.
Und sie würden bei mir sein, Tag und Nacht, sommers und winters, in Ägypten und in England, und das noch viele Jahre lang.
Kapitel 2
»Auch wenn man entschlossen
ist, sich würdevoll ins
Martyrium zu fügen,
ist ein Tag Aufschub
nicht zu verachten.«
Ich glaube an die Kraft von Gebeten; als Christin bin ich dazu verpflichtet. Allerdings glaube ich als rational denkender Mensch wie auch als Christin (das ist nicht zwangsläufig unvereinbar, was auch immer Emerson dazu sagen mag) nicht, daß der Allmächtige unmittelbar Anteil an meinen persönlichen Belangen nimmt. Es gibt zu viele andere Menschen, um die er sich kümmern muß, und die meisten von ihnen benötigen seine Hilfe weitaus dringender als ich.
Jedoch bin ich geneigt zu glauben, daß eines Nachmittags, einige Monate nach dem oben geschilderten Gespräch, ein gütiges Wesen das Gebet erhörte, das ich nicht einmal in meinen geheimsten Gedanken in Worte zu fassen gewagt hatte.
Wie schon so viele Male zuvor lehnte ich an der Reling des Dampfers und wartete gespannt auf das Auftauchen der ägyptischen Küste. Und wieder einmal stand Emerson neben mir und brannte wie ich darauf, die neue Ausgrabungssaison in Angriff zu nehmen. Doch zum ersten Mal in ach so vielen Jahren waren wir beide allein.
Allein! Die Schiffsbesatzung und die übrigen Passagiere zähle ich nicht. Wir waren ALLEIN. Ramses hatte uns nicht begleitet. Er kletterte also nicht – trotz Lebensgefahr – auf der Reling herum, er stachelte die Mannschaft nicht zur Meuterei auf; er versuchte nicht, in seiner Kabine Dynamit herzustellen. Denn er war nicht an Bord, sondern in England, und wir ... wir waren ganz weit fort. Ich hätte mir nicht träumen lassen, das je zu erleben. Ich hätte nie zu hoffen gewagt, geschweige denn darum gebetet, daß ein solcher Glücksfall jemals eintreten möge.
Das Walten der Vorsehung ist wahrlich unergründbar, denn ausgerechnet Nefret, von der ich eigentlich zusätzliche Schwierigkeiten erwartet hatte, war für dieses glückliche Ereignis verantwortlich.
***
Denn einige Tage, nachdem Walter, Evelyn und die Kinder abgereist waren, hatte ich Nefret eingehend beobachtet und war zu dem Schluß gekommen, daß die bösen Vorahnungen, die mich an jenem schönen Juninachmittag beschlichen hatten, nur einer melancholischen Stimmung zu verdanken gewesen waren. Evelyn war an dem Tag in einer seltsamen Laune gewesen; ihr Pessimismus hatte mich angesteckt. Ganz offensichtlich kam Nefret gut zurecht. Sie hatte gelernt, wie man mit Messer und Gabel umging, mit dem Knöpfhaken hantierte und eine Zahnbürste benutzte. Sie hatte sogar begriffen, daß es ungehörig war, bei Tisch Gespräche mit den Bediensteten zu führen. (Damit war sie Emerson einen Schritt voraus, der sich dieser allgemein anerkannten Umgangsform nicht unterordnen konnte oder wollte.) Wenn sie ihre geknöpften Stiefel und zierlichen weißen Kleidchen trug und ihr Haar mit Bändern zurückgebunden hatte, sah sie wie ein hübsches englisches Schulmädchen aus. Sie zog Stiefel an, obwohl sie sie verabscheute, und auf meine Bitte hin ließ sie die prächtigen nubischen Kleider im Schrank verschwinden. Nie äußerte sie ein Wort der Klage oder des Widerspruchs gegen einen meiner Vorschläge. Also beschloß ich, nun den nächsten Schritt zu wagen. Es war an der Zeit, Nefret in die Gesellschaft einzuführen, was selbstverständlich langsam und behutsam vor sich gehen mußte. Und welch bessere und liebenswürdigere Gefährtinnen, überlegte ich, konnte es geben als Mädchen ihres Alters?
Rückblickend betrachtet muß ich zugeben, daß mir ein geradezu lachhafter Denkfehler unterlief. Allerdings möchte ich zu meiner Verteidigung anführen, daß ich sehr wenig Kontakt mit Mädchen dieses Alters hatte. Deshalb konsultierte ich meine Freundin, Miss Helen McIntosh, die eine nahegelegene Mädchenschule leitete.
Helen war Schottin, unverblümt und energisch; alles an ihr war braun – von ihrem schon leicht angegrauten Haar bis zu ihren praktischen Tweedkostümen. Als sie meine Einladung zum Tee annahm, machte sie kein Hehl aus ihrer Neugier auf unser neues Mündel.
Ich setzte alles daran, daß Nefret einen guten Eindruck machte, und beschwor sie, sich nicht zu verplappern und dadurch Zweifel an der Geschichte zu wecken, die wir verbreitet hatten. Vielleicht habe ich es übertrieben. Die ganze Zeit über saß Nefret wie eine Statue der Schicklichkeit da, hielt die Augen gesenkt und die Hände gefaltet und sprach nur, wenn sie dazu aufgefordert wurde. Das Kleid, das sie auf meine Bitte hin trug, paßte hervorragend zu ihrem Alter – weißer Batist mit gerüschten Manschetten und einer breiten Schärpe. Ich hatte ihr die Zöpfe aufgesteckt und ihr große weiße Schleifen ins Haar gebunden.
Nachdem ich Nefret gestattet hatte, sich zurückzuziehen, blickte mich Helen mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Meine liebe Amelia«, sagte sie, »was haben Sie nur getan?«
»Nur das, was christliche Nächstenliebe und Anstand gebieten«, erwiderte ich trotzig. »Welchen Fehler können Sie ihr denn vorwerfen? Sie ist intelligent und bemüht, einen guten Eindruck zu machen ...«
»Meine Liebe, die Schleifen und Rüschen täuschen niemanden. Auch wenn Sie das Mädchen in Lumpen steckten, würde es immer noch so exotisch wirken wie ein Paradiesvogel«
Das konnte ich nicht bestreiten. Ich schwieg – wie ich zugeben muß – verärgert, während Helen an ihrem Tee nippte. Allmählich glätteten sich die Falten auf ihrer Stirn, und schließlich meinte sie nachdenklich: »Zumindest kann kein Zweifel bestehen, was die Reinheit ihres Blutes betrifft.«
»Helen!« rief ich aus.
»Nun, solche Fragen stellen sich nun einmal bei Nachkommen von Männern, die in weit entfernten Gebieten des Empire stationiert sind. Mütter, die günstigerweise verstorben sind, Kinder mit glänzenden schwarzen Augen und sonnengebräunten Wangen ... Sehen Sie mich doch nicht so böse an, Amelia, ich rede hier nicht von meinen eigenen Vorurteilen, sondern von denen der Gesellschaft, und wie ich bereits sagte, besteht kein Zweifel an Nefrets ... Ich rate Ihnen, ihr einen anderen Namen zu geben. Wie wäre es mit Natalie? Er ist zwar ungewöhnlich, aber unzweifelhaft englischer Herkunft.«
Helens Äußerungen riefen in mir gewisse Bedenken hervor, doch nachdem ihr Interesse geweckt war, machte sie sich mit solcher Begeisterung an die Arbeit, daß ich nicht wußte, wie ich ihr widersprechen sollte. Obwohl ich eigentlich nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen leide, fühlte ich mich in diesem Fall unsicher. Schließlich war Helen Expertin, was junge Damen betraf, und da ich sie um ihre Meinung gebeten hatte, fühlte ich mich nicht berechtigt, ihre Ratschläge anzuzweifeln.
Diese Episode hätte mir schon damals eine Lehre sein sollen, niemals mein eigenes Urteil in Frage zu stellen. Seitdem habe ich diesen Fehler nur noch einmal gemacht – und er endete, wie Sie sehen werden, fast in einer noch größeren Katastrophe.
Die ersten Begegnungen von Nefret mit den »jungen Damen«, die Helen sorgfältig ausgewählt hatte, schienen gut zu verlaufen. Mir kamen diese Mädchen reichlich albern vor, und nachdem eins von ihnen bei der ersten Zusammenkunft auf Emersons höfliche Begrüßung mit Gekicher antwortete und ein anderes ihm eröffnete, er sehe viel besser aus als irgendeiner ihrer Lehrer, verbarrikadierte sich Emerson jedes Mal in der Bibliothek und weigerte sich herauszukommen, solange sie im Haus waren. Er stimmte jedoch zu, daß es wahrscheinlich eine gute Idee sei, Nefret mit ihren Altersgenossinnen zusammenzubringen. Nefret selbst schien nichts gegen die Mädchen zu haben. Ich hatte auch keineswegs erwartet, daß sie sich anfangs wirklich amüsieren würde. Sich an gesellschaftlichen Umgang zu gewöhnen, ist ein hartes Stück Arbeit.
Schließlich meinte Helen, es sei nun an der Zeit, daß Nefret die Besuche erwiderte, und lud sie in aller Form zu einer Teestunde mit ihr und den ausgewählten jungen »Damen« in die Schule ein. Ich war nicht eingeladen. Genauer gesagt, Helen verbat mir ausdrücklich zu kommen und fügte in ihrer unverblümten Art hinzu, Nefret solle sich unbefangen fühlen und natürlich benehmen. Die unterschwellige Andeutung, daß meine Anwesenheit Nefret daran hindere, sich unbefangen zu fühlen, war natürlich lächerlich, doch ich wagte – damals! – nicht, einer solchen anerkannten Expertin für junge Damen zu widersprechen. Als Nefret sich auf den Weg machte, hegte ich all die Bedenken, die jede besorgte Mutter beschleichen; doch ich sagte mir, daß ihr Erscheinungsbild nichts zu wünschen übrig ließe, von ihrem hübschen rosengeschmückten Hut bis hin zu ihren zierlichen Schühchen. William, der Kutscher, gehörte auch zu ihren Bewunderern: Er hatte die Pferde gestriegelt, daß ihr Fell glänzte; die Knöpfe an seinem Rock schimmerten im Sonnenlicht.
Nefret kehrte früher zurück, als ich erwartet hatte. Ich saß gerade in der Bibliothek und arbeitete die angehäufte Post durch, als Ramses hereinkam.
»Nun, Ramses, was willst du?« fragte ich gereizt. »Siehst du denn nicht, daß ich zu tun habe?«
»Nefret ist zurückgekommen«, sagte er.
»So früh schon?« Ich legte meinen Federhalter beiseite und drehte mich zu ihm um. Er stand, die Hände auf dem Rücken, breitbeinig da und blickte mich unverwandt an. Seine schwarzen Locken waren zerzaust (wie immer), und sein Hemd war über und über mit Schmutz und Chemikalien besudelt (wie immer). Bestimmte Partien seines Kopfes, insbesondere die Nase und das Kinn, waren noch zu groß für sein schmales Gesicht, doch wenn er weiterhin so zunehmen würde wie bisher, würden seine Gesichtszüge eines Tages nicht unansehnlich wirken – vor allem sein Kinn, das ein noch unentwickeltes Grübchen, den Ansatz zu einer Spalte zeigte, ähnlich der im Kinn seines Vaters, die ich so bezaubernd fand.
»Ich hoffe, es hat ihr gefallen«, sagte ich.
»Nein«, erwiderte Ramses. »Das hat es nicht.«
Sein Blick war nicht ruhig, er war anklagend. »Hat sie das gesagt?«
»SIE hat das nicht gesagt«, entgegnete mein Sohn, der noch nicht gänzlich die Gewohnheit aufgegeben hatte, von Nefret in Großbuchstaben zu sprechen. »Sich zu beklagen, würde SIE ebenso für eine Form von Feigheit halten wie für einen Ausdruck mangelnder Loyalität dir gegenüber; denn ihre Gefühle dir gegenüber sind, meines Dafürhaltens nach völlig zurecht ...«
»Ramses, ich habe dich schon mehrmals darum gebeten, diese Formulierung nicht mehr zu verwenden.«
»Ich bitte um Verzeihung, Mama. Ich will versuchen, in Zukunft deiner Bitte nachzukommen. Nefret ist in ihrem Zimmer; sie hat die Tür geschlossen. Ich glaube – auch wenn ich mir dessen nicht sicher sein kann –, daß sie weinte, als sie mit abgewandtem Gesicht an mir vorbeilief.«
Ich wollte schon meinen Stuhl vom Schreibtisch wegrücken, hielt aber plötzlich inne. »Meinst du, ich sollte zu ihr gehen?«
Ich war über meine eigene Frage ebenso sehr erstaunt wie Ramses. Ich hatte nicht die Absicht gehabt, ihn um Rat zu fragen; das hatte ich noch nie getan. Seine Augen, die so dunkelbraun waren, daß sie schwarz aussahen, wurden riesengroß. »Ist das eine Frage an mich, Mama?«
»Sieht so aus«, antwortete ich. »Auch wenn ich nicht sagen kann, warum ich dich frage.«
»Wäre die Situation nicht reichlich dringlich, würde ich meiner Freude über das Vertrauen, das du in mich setzt, eingehender Ausdruck verleihen. Es beglückt und berührt mich mehr, als ich sagen kann.«
»Das hoffe ich, Ramses. Nun? Fasse dich kurz, bitte.«
Sich kurz zu fassen, kostet Ramses einige Mühe. Es war seiner Sorge um Nefret zu verdanken, daß es ihm diesmal gelang. »Ich glaube, du solltest zu ihr gehen, Mama. Und zwar sofort.«
Und das tat ich auch.
Ich fühlte mich seltsam unwohl in meiner Haut, als ich vor Nefrets Tür stand. Mit jungen Damen, die in Tränen aufgelöst waren, hatte ich schon früher zu tun gehabt, und meine Maßnahmen hatten stets die gewünschte Wirkung gezeitigt. Jedoch bezweifelte ich, daß die Methoden, die ich seinerzeit angewandt hatte, in diesem Fall etwas ausrichten würden. Ich stand hier, wie man sagen könnte, an Eltern Statt, und diese Rolle war mir nicht auf den Leib geschneidert. Was sollte ich tun, wenn sie sich mir weinend in den Schoß warf?
Ich straffte die Schultern und klopfte an die Tür. (Kinder haben meiner Meinung nach genauso ein Recht auf Privatsphäre wie jedes menschliche Wesen.) Als sie antwortete, hörte ich erleichtert, daß ihre Stimme ganz wie immer klang.
Beim Eintreten sah ich, daß sie ruhig dasaß, mit einem Buch auf dem Schoß. Auf ihren sanften Wangen war keine Spur von Tränen zu erkennen. Doch dann bemerkte ich, daß sie das Buch verkehrt herum hielt, und entdeckte auf dem Boden neben dem Bett die zerknüllte Ruine, die einmal ihr bester Hut gewesen war, eine Kreation aus feinem Stroh und Satinbändern, deren breite Krempe mit rosafarbenen Seidenblumen geschmückt war. Kein Unfall konnte diesen Hut so zugerichtet haben. Sie mußte mit den Füßen auf ihm herumgetrampelt haben.
Sie hatte wohl nicht mehr an den Hut gedacht. Als ich sie wieder ansah, hielt sie die Lippen fest zusammengepreßt, und ihr ganzer Körper war angespannt, als würde sie eine Rüge oder eine Ohrfeige erwarten.
»Rosa ist wohl nicht deine Farbe«, sagte ich. »Ich hätte dich nicht dazu überreden sollen, so ein albernes Ding aufzusetzen.«
Einen Augenblick lang dachte ich, sie würde in Tränen ausbrechen. Ihre Lippen bebten, doch dann verzogen sie sich zu einem Lächeln.
»Ich bin darauf herumgesprungen«, sagte sie.
»Das dachte ich mir schon.«
»Es tut mir leid. Ich weiß, er hat eine Menge Geld gekostet.«
»Du besitzt eine Menge Geld. Du kannst auf so vielen Hüten herumtrampeln, wie du möchtest.« Ich setzte mich ans Fußende der Chaiselongue. »Aber vielleicht gibt es einen besseren Weg, mit der Angelegenheit fertig zu werden, die dich bedrückt. Was ist geschehen? War jemand unhöflich zu dir?«
»Unhöflich?« Sie dachte über die Frage mit einer derart erwachsenen Kühle nach, daß es mir fast unheimlich war. »Ich weiß nicht, was ›unhöflich‹ bedeutet. Ist es unhöflich, Dinge zu sagen, die dem anderen das Gefühl geben, unbedeutend zu sein und häßlich und dumm?«
»Sehr unhöflich«, erwiderte ich. »Doch wie kannst du dir nur solche Gemeinheiten zu Herzen nehmen? Du brauchst doch nur einen Blick in den Spiegel zu werfen, um zu sehen, daß du diese unscheinbaren kleinen Biester so überstrahlst wie der Mond die Sterne. Du meine Güte, jetzt hätte ich beinahe die Beherrschung verloren. Wie ungewöhnlich. Was haben sie denn gesagt?«
Sie blickte mich forschend an. »Versprichst du, nicht gleich in die Schule zu laufen und sie mit deinem Sonnenschirm zu verprügeln?«
Es dauerte einen Augenblick, bis ich erkannte, daß das Funkeln in ihren blauen Augen die Andeutung eines Lachens war. Sie machte fast nie Scherze, zumindest nicht mir gegenüber.
»Oh – ja gut«, antwortete ich lächelnd. »Sie waren also eifersüchtig auf dich, diese häßlichen kleinen Kröten.«
»Vielleicht.« Ihre grazilen Lippen kräuselten sich. »Ein junger Mann war auch dort, Tante Amelia.«
»O guter Gott!« rief ich aus. »Wenn ich das gewußt hätte ...«
»Miss McIntosh wußte ebenfalls nicht, daß er kommen würde. Er suchte nach einer geeigneten Schule für seine Schwester, deren Vormund er ist, und äußerte den Wunsch, einige der anderen jungen Damen kennenzulernen, um herauszufinden, ob sie geeignete Kameradinnen für sie wären. Er muß sehr reich sein, weil Miss McIntosh äußerst höflich zu ihm war. Auch sah er sehr gut aus. Eines der Mädchen, Winifred, begehrte ihn.« Als sie meinen Gesichtsausdruck sah, erstarb ihr Lächeln. »Jetzt habe ich etwas Falsches gesagt.«
»Äh – nicht etwas Falsches. Es ist nur nicht ganz der Ausdruck, den Winifred verwenden würde ...«
»Siehst du?« Mit einer gleichermaßen graziösen wie fremdartigen Geste breitete sie die Hände aus. »Ich kann nichts sagen, ohne solche Fehler zu machen. Ich habe nicht dieselben Bücher wie sie gelesen und auch nicht dieselbe Musik gehört. Ich kann nicht Klavier spielen und so singen wie sie, und ich beherrsche auch nicht diese Fremdsprachen ...«
»Das tun sie auch nicht«, schnaubte ich verächtlich. »Ein paar Brocken Französisch und Deutsch ...«
»Genug, um etwas zu sagen, das ich nicht verstehe, und dann schauen sie einander an und lachen. Das haben sie schon immer so gemacht, aber heute, als Sir Henry neben mir saß und mich ansah anstatt Winifred, war jedes Wort eine getarnte Beleidigung. Sie sprachen nur von Dingen, die ich nicht kenne, und stellten mir – zuckersüß freundlich – Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Winifred bat mich, zu singen, obwohl ich ihr zuvor bereits gesagt hatte, daß ich es nicht kann.
»Was hast du dann getan?«
Nefret machte ein Gesicht, als könne sie kein Wässerchen trüben. »Ich habe gesungen. Ich habe die Anrufung der Isis gesungen.«
»Die ...« Ich mußte erst einmal schlucken. »Das Lied, das du in dem Tempel des Heiligen Berges gesungen hast? Hast du auch ... getanzt, so wie damals?«