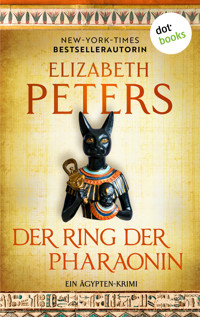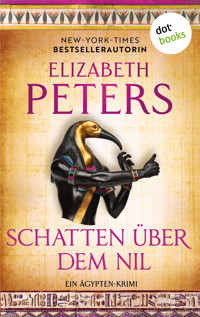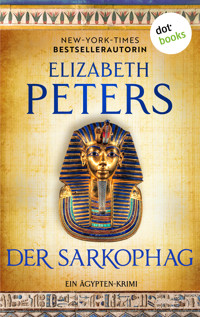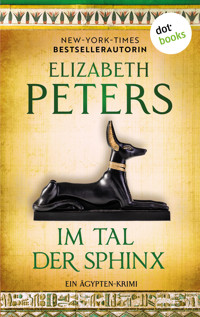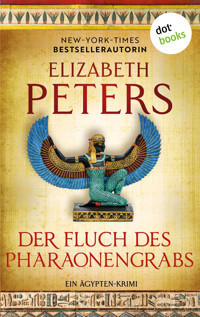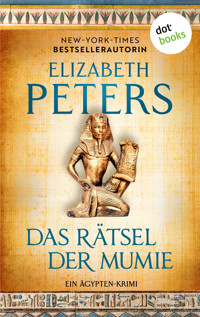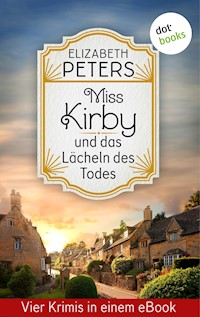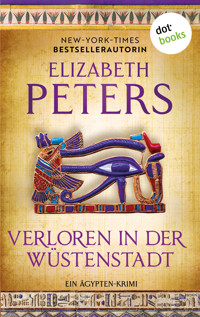
9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Familie Peabody-Emerson auf gefährlicher Wüstenmission… Ägyptologin Amelia Peabody, ihr Mann Emerson und ihr kleiner Sohn Ramses sind bereit für ihr neuestes Abenteuer: Eine Reise zu den Ruinen der antiken Stadt Napata im Herzen des Sudan – einer Gegend, in der noch kein Archäologe zuvor gewesen ist! Doch noch während sie von ungeahnten Funden und bahnbrechenden Entdeckungen träumen, stranden sie in der trockenen nubischen Wüste. Dort wird ihnen ein mysteriöser Auftrag zuteil: Sie sollen ein vor vierzehn Jahren verschwundenes Forscherehepaar aufspüren. Eine Sache der Unmöglichkeit – und nicht gerade ungefährlich … Doch die Peabody-Emersons stellen sich mutig der irrwitzigen Mission – und machen bei ihrer Suche den außergewöhnlichsten Fund ihrer bisherigen Karriere … »Ein Juwel von einer Romanreihe.« New York Times Book Review Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Ägypten-Krimi »Verloren in der Wüstenstadt« ist der fünfte Teil der mitreißenden Amelia-Peabody-Reihe von Elizabeth Peters. Die Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ägyptologin Amelia Peabody, ihr Mann Emerson und ihr kleiner Sohn Ramses sind bereit für ihr neuestes Abenteuer: Eine Reise zu den Ruinen der antiken Stadt Napata im Herzen des Sudan – einer Gegend, in der noch kein Archäologe zuvor gewesen ist! Doch noch während sie von ungeahnten Funden und bahnbrechenden Entdeckungen träumen, stranden sie in der trockenen nubischen Wüste. Dort wird ihnen ein mysteriöser Auftrag zuteil: Sie sollen ein vor vierzehn Jahren verschwundenes Forscherehepaar aufspüren. Eine Sache der Unmöglichkeit – und nicht gerade ungefährlich … Doch die Peabody-Emersons stellen sich mutig der irrwitzigen Mission – und machen bei ihrer Suche den außergewöhnlichsten Fund ihrer bisherigen Karriere …
Über die Autorin:
Elizabeth Peters (1927 – 2013) ist das Pseudonym von Barbara G. Mertz, einer amerikanischen Autorin und Ägyptologin. Sie promovierte am berühmten Orient-Institut in Chicago und wurde für ihre Romane und Sachbücher mit vielen Preisen ausgezeichnet. Einer dieser Preise, der »Amelia Award«, wurde sogar nach ihrer beliebten Romanfigur benannt, der bahnbrechenden Amelia Peabody. Besonders ehrte sie jedoch, dass viele ÄgyptologInnen ihre Bücher als Inspirationsquelle anführen.
Elizabeth Peters veröffentlichte bei dotbooks ihre »Vicky Bliss«-Reihe und ihre Krimireihe um Jacqueline Kirby.
Unter Barbara Micheals veröffentlichte sie bei dotbooks ihre historischen Liebesromane »Abbey Manor – Gefangene der Liebe«, »Wilde Manor – Im Sturm der Zeit«, »Villa Tarconti – Lied der Leidenschaft« und »Grayhaven Manor – Das Leuchten der Sehnsucht«.
Außerdem veröffentlichte sie unter Barbara Michaels ihre Romantic-Suspense-Romane »Der Mond über Georgetown«, »Das Geheimnis von Marshall Manor«, »Die Villa der Schatten«, »Das Geheimnis der Juwelenvilla«, »Die Frauen von Maidenwood«, »Das dunkle Herz der Villa«, »Das Haus des Schweigens«, »Das Geheimnis von Tregella Castle« und »Die Töchter von King’s Island«.
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1991 unter dem Originaltitel »The Last Camel Died at Noon« bei Warner Books, Inc., New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1991 by Elizabeth Peters
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 by ECON Taschenbuch Verlag GmbH, Düsseldorf
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-292-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Verloren in der Wüstenstadt
Ein Ägypten-Krimi. Amelia Peabody 5
Aus dem Amerikanischen von Karin Dufner
dotbooks.
Widmung
Für Ellen Nehrmit Grüßen von der Autorinund Ahmet, dem Kamel
Danksagung
Die Übersetzung von Ramses’ lateinischer Anmerkung verdanke ich der Freundlichkeit von Miss Tootie Godlove-Ridenour. Eventuelle Fehler sind vermutlich auf meine mangelnde Sorgfalt bei der Übertragung oder (was wahrscheinlicher ist) auf Ramses’ Hast zurückzuführen.
Meinen Hut ziehe ich vor Charlotte MacLeod, denn sie hat mich auf eine besonders widerwärtige Methode hingewiesen, einen Gegner schachmatt zu setzen. Tropenhelm ab, Dr. Lyn Green, denn Ihnen verdanke ich den Zugang zu seltenen ägyptologischen Forschungsmaterialien.
Am meisten jedoch, geneigte, intelligente Leserin, werter Leser, stehe ich in Ihrer Schuld. Wie Amelia (und Emerson, obwohl er es nicht zugibt) liebe auch ich die Romane von Sir Henry Rider Haggard. Er war ein Meister der literarischen Form, wie man sie leider in diesen oberflächlichen Zeiten nur noch selten antrifft. Da mir der Lesestoff ausgegangen war, beschloß ich, selbst ein Buch zu schreiben, das ich dem verehrten Autor in Zuneigung, Bewunderung und voller Sehnsucht nach vergangenen Tagen widme.
Erstes Buch
Kapitel 1
»Ich habe dir doch gesagt,
es ist ein
hirnrissiger Plan!«
Die Hände in die Hüften gestemmt, stand Emerson da und starrte den darniederliegenden Wiederkäuer fassungslos an. Ein mitfühlender Freund (wenngleich zweifelhaft ist, ob Kamele über mitfühlende Freunde verfügen) hätte Trost in dem Umstand gefunden, daß der Sand rund um die Stelle seines Dahinscheidens kam aufgewühlt war. Wie seine Artgenossen in unserer Karawane, von denen allein es übriggeblieben war, hatte das Tier plötzlich innegehalten, war in die Knie gesunken und hatte still und friedlich das Zeitliche gesegnet. (Ein Verhalten, das, wie ich hinzufügen darf, für Kamele – ganz gleich ob lebendig oder todgeweiht – äußerst untypisch ist).
Auch für Emerson ist ein solches Verhalten untypisch. Diejenigen Leser, die bereits persönlich oder anhand meiner früheren Werke Gelegenheit hatten, die Bekanntschaft meines hochgeschätzten Gatten zu machen, wird seine Reaktion auf den Tod des Kamels nicht weiter überraschen: Er tat, als habe das Tier Selbstmord begangen, und zwar einzig und allein in der Absicht, ihm Unannehmlichkeiten zu bereiten. Die Augen in seinem markanten, gebrannten Gesicht blitzten wie zwei Saphire, als er sich den Hut vom Kopf riß, ihn in den Sand schleuderte und ihm einen Tritt versetzte, so daß er ein gutes Stück weit fortflog. Dann richtete er seinen lodernden Blick auf mich.
»Verdammt, Amelia! Ich habe dir doch gesagt, es ist ein hirnrissiger Plan!«
»Ja, Emerson, das stimmt«, erwiderte ich. »In genau diesen Worten, wenn ich mich recht entsinne. Und falls du dich an unser erstes Gespräch über diese Unternehmung erinnern solltest, wirst du vielleicht noch wissen, daß ich damals deine Meinung teilte.«
»Was ...« Emerson drehte sich einmal um die eigene Achse. Grenzenlos und kahl erstreckte sich die karge, brettebene Wüste bis hin zum Horizont. »Was zum Teufel tun wir dann hier?« brüllte er.
Das war eine durchaus vernünftige Frage, die sich wahrscheinlich auch dem Leser dieser Geschichte aufdrängen wird. Professor Radcliffe Emerson, Mitglied der Londoner Akademie der Wissenschaften, Angehöriger der Britischen Akademie, Doktor der Rechte (Edinburgh), Doktor der keltischen Literatur (Oxford), Mitglied der Amerikanischen Philosophischen Gesellschaft und so weiter und so fort und überdies angesehenster Ägyptologe aller Zeiten, war jedoch häufig an ungewöhnlichen, wenn nicht sogar eigenartigen Orten anzutreffen. Nie werde ich den zauberhaften Augenblick vergessen, als ich ihn in einer Höhle inmitten einer einsamen Klippenlandschaft nahe des Nils vorfand: Er fieberte stark, brauchte dringend Hilfe und war zu schwach, sich dagegen zu wehren. Das Band, das durch meine fachkundige Pflege zwischen uns entstand, wurde durch die später gemeinsam überstandenen Gefahren unauflöslich. Und nach einer angemessenen Zeit heiratete ich ihn. Seit diesem denkwürdigen Tag haben wir an allen bedeutsamen Stätten Ägyptens Ausgrabungen durchgeführt und unsere Entdeckungen in unzähligen Publikationen festgehalten. Die Bescheidenheit verbietet mir, meinen Anteil an unserem wissenschaftlichen Ruhm allzusehr hervorzuheben. Allerdings hätte Emerson als letzter abgestritten, daß wir stets an einem Strang zogen – sowohl in der Archäologie als auch in der Ehe.
Hand in Hand (natürlich nur bildlich gesprochen) hatten wir Ägypten von den sandigen, verlassenen Gräberfeldern in Memphis bis zur Nekropolis in Theben durchquert und waren dabei auf Gegenden gestoßen, die fast ebenso unwirtlich waren wie die Wüste, die uns im Augenblick umgab. Jedoch hatten wir uns nie zuvor weiter als einige Kilometer vom Nil und seinen lebenspendenden Wassern entfernt. Nun lag der Fluß weit hinter uns. Keine Pyramide, kein Überrest einer Mauer waren zu sehen, geschweige denn ein Baum oder ein Anzeichen dafür, daß hier Menschen lebten. Was wollten wir eigentlich hier? Ohne Kamele waren wir buchstäblich Gestrandete in einem Meer aus Sand. Nur, daß unsere Lage nun einiges verzweifelter aussah als die von Schiffbrüchigen.
Ich setzte mich auf den Boden und lehnte mich an das Kamel. Die Sonne stand hoch am Himmel, und außer dem armen Tier gab es nichts, was mir hätte Schatten spenden können. Emerson lief schimpfend auf und ab und wirbelte Sand auf. Sein Talent für Verbalinjurien hatte ihm bei unseren ägyptischen Arbeitern den Ehrentitel »Vater der Flüche« eingebracht, und diesmal übertraf er sich selbst. Zwar hatte ich Verständnis für seine Gefühle, aber die Pflicht zwang mich, ihn zu tadeln.
»Du vergißt dich, Emerson«, bemerkte ich und wies auf unsere Begleiter.
Sie standen nebeneinander da und betrachteten mich besorgt. Ich muß sagen, daß die beiden ein komisches Gespann abgaben. Viele Bewohner des Niltals sind ungewöhnlich hochgewachsen, und Kemit, unser einziger verbleibender Diener, maß fast einen Meter neunzig. Er trug einen Turban und ein weites Gewand aus blauweiß gestreifter Baumwolle. Mit seinen ebenmäßigen, bronzefarbenen Gesichtszügen ähnelte er sehr seinem Freund, nur daß dieser weniger als einen Meter zwanzig groß war. Außerdem war er mein Sohn, Walter Peabody Emerson, auch als »Ramses« bekannt. Und eigentlich hätte er gar nicht hier sein dürfen.
Emerson brach mitten in seiner Schimpfkanonade ab, obgleich er an dieser Anstrengung fast erstickte. Da er jedoch immer noch ein Ventil für seine brodelnden Gefühle brauchte, ließ er sie an mir aus.
»Wer hat diese verfl... verflixten Kamele ausgesucht?«
»Das weißt du ganz genau«, antwortete ich. »Ich suche stets die Tiere für unsere Expeditionen aus und kümmere mich auch um ihre Gesundheit. Die Leute hier behandeln ihre Esel und Kamele so schlecht ...«
»Erspare mir deine Vorträge über Veterinärmedizin und Tierliebe!« brüllte Emerson. »Ich wußte es ... Ich wußte, die Wahnvorstellung, du verfügtest über medizinische Kenntnisse, würde uns eines Tages ins Unglück stürzen. Du hast diesen verd... vermaledeiten Tieren Medizin verabreicht; was hast du ihnen gegeben?«
»Emerson! Beschuldigst du mich allen Ernstes, ich hätte die Kamele vergiftet?« Nur mit Mühe konnte ich meine Entrüstung über diesen ungeheuerlichen Vorwurf hinunterschlucken. »Ich glaube, jetzt bist du vollkommen übergeschnappt.«
»Auch wenn dem so sein sollte, habe ich im Moment wohl allen Grund dazu«, erwiderte Emerson in etwas gemäßigterem Ton. Er rückte näher an mich heran. »Unsere Lage ist so verzweifelt, daß selbst ein ausgeglichener Mensch wie ich die Fassung verlieren kann. Äh ... ich bitte dich um Verzeihung, meine liebe Peabody. Weine nicht.«
Emerson nennt mich nur Amelia, wenn er böse auf mich ist. Peabody ist mein Mädchenname; und so sprach mich Emerson in seinen kümmerlichen Versuchen, sarkastisch zu sein, während der ersten Zeit unserer Bekanntschaft an. Inzwischen mit liebevollen Erinnerungen verknüpft, ist diese Anrede mittlerweile zu meinem Kosenamen geworden, der – wenn man so sagen will – Zuneigung und Respekt ausdrücken soll.
Ich ließ das Taschentuch sinken, das ich mir an die Augen gehalten hatte, und lächelte ihn an. »Ich habe nur Sand ins Auge bekommen, Emerson. Nie wirst du erleben, daß ich hilflos in Tränen ausbreche, wenn Entschlußkraft gefordert ist. Und das weißt du ganz genau.«
»Hmmm«, brummte Emerson.
»Wie dem auch sei, Mama«, mischte sich Ramses ein. »Papa hat etwas Bedenkenswertes angesprochen. Anzunehmen, daß alle Kamele plötzlich und ohne Krankheitssymptome innerhalb von achtundvierzig Stunden sterben, hieße, den Zufall überzustrapazieren.«
»Du kannst dir sicher sein, Ramses, daß mir dieser Gedanke auch schon gekommen ist. Sei jetzt bitte so gut und hole Papas Hut zurück. Nein, Emerson, ich weiß, wie sehr du Hüte verabscheust, aber ich bestehe darauf, daß du ihn aufsetzt. Es würde uns gerade noch fehlen, wenn du zu allem Überfluß einen Sonnenstich bekommst.«
Emerson antwortete nicht. Er blickte der kleinen Gestalt seines Sohnes nach, der gehorsam dem Sonnenhut nachtrottete. Sein Gesichtsausdruck war so wehmütig, daß sich mein Blick verschleierte. Es war nicht die Angst um sein eigenes Leben, die meinem Gatten zu schaffen machte, es war nicht einmal die Sorge um mich. Gemeinsam hatten wir nicht nur eine, sondern unzählige Begegnungen mit dem Tod heil überstanden. Emerson wußte, er konnte darauf vertrauen, daß ich dem finsteren Gesellen mutig und lächelnd gegenübertreten würde. Nein, der Gedanke an das Schicksal, das Ramses bevorstand, ließ seine Augen feucht werden. Bewegt gelobte ich mir, Emerson nicht daran zu erinnern, daß sein Sohn und Erbe nun durch die Schuld des eigenen Vaters mit einem langsamen, qualvollen und schmerzlichen Tod durch Verdursten zu rechnen hatte.
»Wie dem auch sei, wir haben schon Schlimmes erlebt«, sagte ich. »Wenigstens wir drei, und ich nehme an, Kemit, daß auch Ihnen Gefahren nicht fremd sind. Haben Sie einen Vorschlag, mein Freund?«
Auf meine Handbewegung hin kam Kemit näher und kauerte sich neben mich. Ramses tat es ihm sofort nach. Inzwischen bewunderte er diesen schweigsamen, gutaussehenden Mann sehr, und der Anblick der beiden – man mußte an einen Storch mit seinem Küken denken – brachte mich immer wieder zum Lächeln.
Emerson hingegen war ganz und gar nicht nach Lächeln zumute. Er fächelte sich mit seinem Hut Kühlung zu und höhnte: »Falls Kemit einen Einfall hat, wie er uns aus diesem Schlamassel retten kann, ziehe ich den Hut vor ihm. Wir ...«
»Du kannst den Hut nicht ziehen, ehe du ihn nicht aufgesetzt hast«, unterbrach ich ihn.
Emerson klatschte den Gegenstand meiner Stichelei so heftig auf seinen schwarzen, zerzausten Schopf, daß seine Wimpern erzitterten. »Wie ich bereits sagte, sind wir sechs Tage vom Nil entfernt, das heißt mit der Schrittgeschwindigkeit eines Kamels. Zu Fuß dauert es erheblich länger. Wenn man der sogenannten Karte, der wir gefolgt sind, trauen kann, gibt es, wenn man weiter geradeaus geht, eine Oase oder ein Wasserloch. Mit einem Kamel würde der Weg etwa zwei Tage in Anspruch nehmen, aber wir haben keins. Unser Wasser reicht für etwa zwei Tage, vorausgesetzt wir rationieren es streng.«
Das war eine akkurate und besorgniserregende Bestandsaufnahme. Dabei hatte Emerson eines nicht erwähnt, weil wir es sowieso alle wußten, nämlich daß unsere Lage noch aus einem anderen Grund verzweifelt war: Unsere Diener hatten uns im Stich gelassen. In der letzten Nacht hatten sie sich gemeinsam aus dem Staub gemacht und alle Wasserschläuche, bis auf die halbvollen Behälter in unseren Zelten und die Feldflasche, die ich immer am Gürtel trage, mitgenommen. Allerdings hätte es noch schlimmer kommen können: Sie hatten es wenigstens unterlassen, uns zu ermorden. Doch diese Rücksichtnahme war mit Sicherheit nicht auf Menschenfreundlichkeit zurückzuführen. Emerson ist für seine Körperkraft und seine aufbrausende Art berüchtigt, und viele der schlichten Eingeborenen glauben, daß er übernatürliche Kräfte hat. (Ich selbst habe auch einen gewissen Ruf als Sitt Hakim, Spenderin geheimer Heiltränke.) Deshalb hatten sie es vorgezogen, sich in der Dunkelheit davonzustehlen, anstatt es auf eine Auseinandersetzung ankommen zu lassen. Kemit behauptete, man habe ihn niedergeschlagen, als er versucht habe, die Abtrünnigen aufzuhalten. Warum er sich nicht ebenfalls den Meuterern angeschlossen hatte, konnte ich mir nicht erklären. Vielleicht war es Treue – obwohl er uns nicht mehr zu Dank verpflichtet war als die anderen, die schon genauso lange für uns arbeiteten. Möglicherweise hatte man ihn einfach nicht aufgefordert mitzukommen.
Kemit hatte vieles an sich, das einer Erklärung bedurfte. Obwohl er nun mit ausdruckslosem Gesicht auf dem Boden hockte, wobei seine Knie fast die Ohren berührten, wirkte er alles andere als komisch. Seine markanten Züge erinnerten mich an einige Skulpturen aus der Vierten Dynastie, besonders an das ausgezeichnete Portrait König Chephrens, des Erbauers der Zweiten Pyramide. Ich hatte Emerson auf diese Ähnlichkeit angesprochen, und seine Antwort hatte gelautet, das sei nicht weiter überraschend. Schließlich fließe das Blut vieler Völker in den Adern der alten Ägypter, und einige der nubischen Stämme seien wahrscheinlich ihre entfernten Abkömmlinge. (Ich sollte hinzufügen, daß diese Theorie meines Gatten – er betrachtete sie nicht als Theorie, sondern als Tatsache – von der Mehrheit seiner Kollegen abgelehnt wurde.)
Ich stelle fest, daß ich vom roten Faden meiner Erzählung abgekommen bin, wie es mir häufig passiert, wenn wissenschaftlich interessante Fragen aufgeworfen werden. Lassen Sie mich also die Seiten meines Tagebuchs zurückblättern und in der richtigen zeitlichen Reihenfolge erzählen, wie wir überhaupt in diese ungewöhnlich mißliche Lage geraten waren. Dahinter, werter Leser, steht nicht die unlautere Absicht, Ihre Sorge um unser Überleben ins Unerträgliche zu steigern. Denn schließlich verfügen Sie über die Intelligenz, die ich von meinen Lesern erwarte, und wissen deshalb, daß ich diesen Bericht nicht schreiben könnte, wenn ich das Schicksal der Kamele geteilt hätte.
Ich muß nicht nur einige, sondern viele Seiten zurückblättern und Sie in unser ruhiges Landhaus in Kent entführen. Es war fast Herbst, und die Blätter färbten sich schon golden. Nach einem geschäftigen Sommer voller Lehrveranstaltungen und Vorträge und der Fertigstellung der letztjährigen Ausgrabungsberichte bereiteten wir uns allmählich auf unsere jährliche Winterexpedition nach Ägypten vor. Emerson saß an seinem Schreibtisch; ich schritt, die Hände auf dem Rücken, rasch im Zimmer auf und ab. Die Büste von Sokrates – seltsam schwarz gefleckt, da Emerson die Angewohnheit hatte, seinen Füllfederhalter nach ihr zu werfen, wenn ihm die Inspiration versagt blieb oder ihn sonst etwas verärgerte – beobachtete uns mit gütigem Blick.
Unser Gespräch drehte sich, so glaubte ich damals zumindest, um die zukünftige intellektuelle Entwicklung unseres Sohnes.
»Ich teile deine Vorbehalte gegen Privatschulen aus ganzem Herzen, Emerson«, versicherte ich ihm. »Aber der Junge muß irgendwo und irgendwann irgendeine Form von Schulbildung erhalten. Er wächst auf wie ein kleiner Wilder.«
»Du gehst zu hart mit dir ins Gericht«, nuschelte Emerson und versenkte den Blick in der Zeitung.
»Er hat sich gebessert«, räumte ich ein »Er redet nicht mehr soviel wie früher und hat sich schon seit einigen Wochen nicht mehr in Lebensgefahr gebracht. Doch er hat keine Ahnung vom Umgang mit Gleichaltrigen.«
Emerson runzelte die Stirn. »Aber, aber, Peabody, das ist nicht richtig. Letzten Winter mit Ahmeds Kindern ...«
»Natürlich spreche ich von englischen Kindern, Emerson.«
»An englischen Kindern ist nichts Natürliches. Mein Gott, Amelia, in unseren Privatschulen gibt es ein Kastensystem, schlimmer als in Indien, und die auf den unteren Sprossen der Leiter werden schrecklicher gequält als jeder Unberührbare. Und falls du seinen Umgang mit Angehörigen des anderen Geschlechts meinst, hoffe ich nur, daß du Ramses nicht an Freundschaften mit Mädchen hindern willst. Genau darauf zielen Privatschulen bekanntermaßen ab.« Emerson war nun richtig in Fahrt gekommen. Er sprang auf, so daß Papiere in alle Richtungen stoben, und fing an, ebenfalls auf und ab zu laufen, wobei sein Weg den meinen im rechten Winkel kreuzte. »Verdammt, manchmal frage ich mich, wie es die sogenannten besseren Leute in diesem Land überhaupt schaffen, sich zu vermehren. Wenn ein junger Bursche die Universität verläßt, fürchtet er sich derart vor Mädchen seiner Gesellschaftsschicht, daß er fast nicht mehr in der Lage ist, ein vernünftiges Wort mit ihnen zu wechseln! Und wenn er es täte, würde er ohnehin keine vernünftige Antwort bekommen, denn die Schulbildung von Frauen, wenn man sie überhaupt so nennen kann – Autsch! Entschuldige, Liebling. Habe ich dir weh getan?«
»Nicht im Geringsten.« Ich nahm die Hand, die er mir entgegenstreckte, um mir beim Aufstehen zu helfen. »Aber wenn du darauf bestehst, während deines Vortrags auf und ab zu laufen, solltest du neben mir hergehen, anstatt meinen Weg im rechten Winkel zu kreuzen. Der Zusammenstoß war unvermeidlich.«
Seine finstere Miene ging in ein sonniges Lächeln über, und er umarmte mich liebevoll. »Solange es bei dieser Art von Zusammenstößen bleibt. Komm schon, Peabody, du weißt, daß wir beide einer Ansicht sind, was die Unzulänglichkeiten unseres Bildungssystems betrifft. Du willst doch nicht, daß die Persönlichkeit des Kindes gebrochen wird?«
»Nur ein wenig zurechtgebogen«, sagte ich leise. Allerdings ist es so schwer, Emerson zu widerstehen, wenn er lächelt und ... Ganz gleich, was er tat; ich möchte nicht mehr sagen, als daß er saphirblaue Augen, dichtes, schwarzes Haar und eine Figur so muskulös wie die eines griechischen Athleten hat – nicht zu vergessen das Grübchen in seinem Kinn und die Begeisterung, mit der er seinen ehelichen Pflichten nachkommt ... Nun, ich glaube, ich brauche nicht deutlicher zu werden. Doch ich bin mir sicher, jede Frau mit gesundem Menschenverstand wird begreifen, warum mich Ramses Schulbildung plötzlich nicht mehr interessierte.
Nachdem Emerson sich wieder gesetzt und zur Zeitung gegriffen hatte, wandte ich mich erneut diesem Thema zu, jedoch in weitaus milderer Stimmung. »Mein lieber Emerson, deine Überredungskünste – genauer gesagt, deine Argumente – sind sehr wirksam. Ramses könnte in Kairo zur Schule gehen. Es gibt dort eine neue Akademie für junge Gentlemen, über die ich Gutes gehört habe. Und da wir in Sakkara Ausgrabungen durchführen werden ...«
Die Zeitung, hinter die Emerson sich zurückgezogen hatte, raschelte laut. Ich hörte auf zu sprechen und wurde von einer schrecklichen Vorahnung ergriffen – die allerdings, wie sich noch herausstellen würde, von den Ereignissen an Grauen übertroffen werden sollte. »Emerson«, meinte ich sanft, »du hast doch die Genehmigung beantragt? Du hast doch nicht etwa den Fehler wiederholt, den du vor einigen Jahren machtest? Damals hast du den Antrag nicht rechtzeitig eingereicht, und statt eine Genehmigung für Dahshoor zu bekommen, mußten wir uns mit der langweiligsten und unergiebigsten Ausgrabungsstätte von ganz Unterägypten begnügen. Emerson! Leg die Zeitung weg und antworte mir! Hast du von der Altertumsverwaltung die Genehmigung erhalten, in dieser Saison Ausgrabungen in Sakkara durchzuführen?«
Emerson ließ die Zeitung sinken. Als er mein Gesicht nur wenige Zentimeter von seinem entfernt bemerkte, fuhr er zurück. »Kitchener«, sagte er, »hat Berber eingenommen.«
Mir ist es unvorstellbar, daß zukünftige Generationen meine Begeisterung für das Studium der Geschichte möglicherweise nicht teilen könnten. Außerdem fehlt mir jegliches Verständnis für Briten, die nichts über dieses bemerkenswerteste Kapitel der Historie ihres Empires wissen. Allerdings sind schon merkwürdigere Dinge vorgekommen. Und angesichts einer solchen Katastrophe (denn anders würde ich das nicht nennen), bitte ich Sie, meine Leser, um Erlaubnis, Ihnen Fakten in Erinnerung zu rufen, die Ihnen genauso vertraut sein sollten wie mir.
Als ich im Jahre 1884 zum ersten Mal Ägypten besuchte, war der Mahdi für die meisten Engländer nichts weiter als einer von vielen zerlumpten religiösen Fanatikern, und das, obwohl seine Gefolgsleute bereits den halben Sudan überrannt hatten. Dieses Land, das sich von den felsigen Katarakten in Assuan bis zu den Urwäldern südlich der Stelle, wo der Blaue und der Weiße Nil zusammenfließen, erstreckt, wurde im Jahre 1821 von Ägypten erobert: Die Regierung der Paschas – eigentlich keine Ägypter, sondern Nachkommen eines albanischen Abenteurers – herrschte in dieser Region noch korrupter und unfähiger als in Ägypten selbst. Obgleich die wohlwollende Intervention einiger Großmächte (besonders Großbritanniens) Ägypten vor einer Katastrophe bewahrte, verschlechterte sich die Lage im Sudan zusehends. Schließlich erklärte sich ein gewisser Mohammed Ahmed Ibn el-Sayyid Abdullah zum Mahdi, zur Wiederverleiblichung des Propheten, und zettelte eine Rebellion gegen die ägyptische Tyrannei und Mißwirtschaft an. Seine Anhänger hielten ihn für den Nachkommen einer Familie von Scheichs, seine Gegner verspotteten ihn als armen, unwissenden Bootsbauer. Doch ungeachtet seiner Herkunft verfügte er über eine erstaunlich charismatische Persönlichkeit und ein bemerkenswertes rhetorisches Geschick. Nur mit Knüppeln und Speeren bewaffnet, hatten seine zerlumpten Soldaten Meter um Meter des Landes erobert und bedrohten nun die sudanesische Hauptstadt Khartum.
Gegenspieler des Mahdi war der heldenhafte General Gordon. Anfang des Jahres 1884 hatte man ihn nach Khartum geschickt, um den Rückzug der dort und im nahe gelegenen Omdurman stationierten Truppen einzuleiten. In der Öffentlichkeit war diese Entscheidung sehr umstritten, denn Khartum zu verlassen bedeutete, den gesamten Sudan aufzugeben. Damals und auch später warf man Gordon vor, er habe von Anfang an die Absicht gehabt, den Befehl nicht zu befolgen. Jedenfalls verzögerte er den Truppenabzug, aus welchen Gründen auch immer. Als ich im Herbst 1884 in Ägypten eintraf, belagerten die wilden Horden des Mahdi Khartum. Das ganze Umland bis zur ägyptischen Grenze befand sich in den Händen der Rebellen.
Der heldenhafte Gordon hielt Khartum, und die britische Öffentlichkeit, angeführt von der Königin persönlich, forderte seine Befreiung. Also schickte man schließlich eine Expedition los, die die belagerte Stadt jedoch erst im Februar des folgenden Jahres erreichte – drei Tage nachdem Khartum gefallen und der heldenhafte Gordon im Garten seines eigenen Hauses niedergemetzelt worden war. »Zu spät!« schrie man in England gequält auf. Eine Laune des Schicksals wollte es, daß der Mahdi seinen großen Gegner nur um sechs Monate überlebte. Daraufhin nahm einer seiner Offiziere, Khalifa Abdullah el-Taashi, seinen Platz ein, der noch tyrannischer herrschte als sein ehemaliger Anführer. Mehr als ein Jahrzehnt lang stöhnte das Land unter seinen Grausamkeiten, während der britische Löwe seine Wunden leckte und sich weigerte, seinen gefallenen Helden zu rächen.
Die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Gründe, die zu der Entscheidung führten, den Sudan zu erobern, sind zu komplex, um sie hier zu erörtern. Es sei nur so viel gesagt, daß der Feldzug 1896 begann. Im Herbst des folgenden Jahres rückten unsere Streitkräfte unter der Führung des heldenhaften Kitchener, den man inzwischen Sirdar der ägyptischen Armee nannte, zum Vierten Katarakt von vor.
Aber was, mag man fragen, hatten diese welterschütternden Ereignisse mit den Winterplänen zweier unschuldiger Ägyptologen zu tun? Ich kannte die Antwort nur zu gut und ließ mich auf einen Stuhl neben den Schreibtisch sinken. »Emerson«, begann ich. »Emerson«, ich flehe dich an. Sag mir jetzt nicht, du willst diesen Winter im Sudan graben.«
»Meine liebe Peabody!« Emerson schleuderte die Zeitung beiseite und richtete seinen leuchtenden Blick unverwandt auf mich. »Du weißt ganz genau, daß ich schon seit Jahren in Napata oder Meroë Ausgrabungen vornehmen will. Schon im letzten Jahr hätte ich mich daran gemacht, hättest du nicht so ein Theater veranstaltet – oder wärest du bereit gewesen, mit Ramses in Ägypten zu bleiben, während ich mich an die Arbeit machte.«
»Um auf die Nachricht zu warten, daß sie deinen Kopf auf eine Stange gespießt haben wie Gordons«, meinte ich leise.
»Unsinn. Für mich hätte keine Gefahr bestanden. Einige meiner besten Freunde waren Anhänger des Mahdi. Aber ganz gleich«, fuhr er rasch fort, um meinem Widerspruch zuvorzukommen, der mir schon auf den Lippen lag. Nicht, daß ich an der Wahrheit seiner Worte gezweifelt hätte; Emerson hat Freunde in den merkwürdigsten Winkeln der Erde. Allerdings hatte ich Einwände gegen den Plan als solchen. »Inzwischen hat sich die Situation völlig geändert, Peabody. Die Region um Napata ist bereits in ägyptischer Hand. Wenn Kitchener mit der jetzigen Geschwindigkeit weiter vorrückt, hat er zum Zeitpunkt unserer Ankunft in Ägypten Khartum erobert, und Meroë, mein Hauptziel, liegt nördlich von Khartum. Es besteht keine Gefahr.«
»Aber Emerson ...«
»Pyramiden, Peabody.« Emersons Stimme sank zu einem verführerischen Knurren. »Königspyramiden, die noch kein Archäologe gesehen hat. Die Pharaonen der Fünfundzwanzigsten Dynastie waren Nubier – stolze Männer und Soldaten, die vom Süden aus losmarschierten, um die verkommenen Herrscher eines dekadenten Ägyptens zu stürzen. Diese Helden wurden in ihrer Heimat Kusch begaben – früher Nubien, heute der Sudan ...«
»Das weiß ich, Emerson, aber ...«
»Nachdem Ägypten seine Unabhängigkeit an die Perser, die Griechen, die Römer und die Moslems verloren hatte, entstand im Kusch ein blühendes Königreich«, fuhr Emerson poetisch – und ein wenig ungenau – fort. »Die ägyptische Kultur überlebte in einem fernen Land – der Region, aus der sie meiner Meinung nach eigentlich stammt. Stell dir vor, Peabody! Wir würden nicht nur die Weiterentwicklung dieser großen Zivilisation erforschen können, sondern vielleicht auch ihre Wurzeln ...«
Er wurde von Gefühlen übermannt. Die Stimme versagte ihm, seine Augen wurden feucht –
Nur zwei Dinge konnten Emerson in einen solchen Zustand versetzen. Eines davon war die Vorstellung, sich an einen Ort zu begeben, wo noch kein Wissenschaftler vor ihm jemals gewesen war, und neue Welten, neue Zivilisationen zu entdecken. Brauche ich noch zu betonen, daß auch ich diesen edlen Drang verspürte? Nein. Mein Puls beschleunigte sich. Ich spürte, wie meine Vernunft vor der Leidenschaft seiner Worte die Waffen streckte. Nur ein letzter Rest gesunden Menschenverstandes ließ mich murmeln: »Aber ...«
»Kein ›aber‹, Peabody.« Er nahm meine Hände in die seinen – diese kräftigen, gebräunten Hände, die Hacke und Schaufel mit mehr Schwung handhaben konnten, als es einer seiner Arbeiter vermochte, und die doch in der Lage waren, mich so unglaublich sanft zu berühren. Er sah mir in die Augen; ich hatte das Gefühl, daß die gleißenden, saphirblauen Strahlen direkt in mein verwirrtes Gehirn drangen. »Du willst das gleiche wie ich, das weißt du ganz genau, Peabody, mein Liebling – diesen Winter in Meroë!«
Er zog mich hoch und nahm mich wieder in seine kräftigen Arme. Ich sagte nichts mehr. Oder besser, ich konnte nichts mehr sagen, da er seine Lippen auf meine preßte. Nun gut, Emerson, ich komme mit – aber Ramses bleibt in der Akademie für junge Gentlemen in Kairo.
Ich irre mich selten. Und wenn ich mich doch einmal irren sollte, habe ich meist Emersons Starrsinn oder Ramses’ exzentrische Anwandlungen unterschätzt – manchmal auch beides. Zur Verteidigung meiner wahrsagerischen Fähigkeiten muß ich allerdings sagen, daß die bizarre Wendung, die unsere Expedition nehmen sollte, ihre Ursache nicht in unserer kleinen ehelichen Meinungsverschiedenheit hatte. Vielmehr lag der Grund in einem überraschenden Ereignis, das keiner von uns, nicht einmal ich, hätte vorhersehen können.
Es trug sich an einem regnerischen Herbstabend zu, nicht lange nach dem Gespräch, das ich bereits geschildert habe. Ich hatte verschiedene Vorbehalte gegen Emersons Pläne für diesen Winter, nachdem die durch seine Überzeugungsversuche ausgelöste Euphorie verflogen war. Und ich hatte keine Hemmungen, diese Vorbehalte laut zu äußern. Obwohl der Norden des Sudan bis hinunter nach Dongola offiziell »befriedet« war und unter ägyptischer Besatzung stand, wäre nur ein Dummkopf davon ausgegangen, in dieser Region ungefährdet reisen zu können. Die unglücklichen Bewohner der Gegend hatten einen Krieg, Unterdrückung und Hungersnot durchmachen müssen. Viele waren obdachlos, es fehlte an Lebensmitteln, und wer ohne bewaffnete Eskorte zwischen ihnen herumlief, forderte seine eigene Ermordung geradezu heraus. Emerson tat diesen Einwand ab. Wir würden nicht zwischen ihnen herumlaufen, sondern in einem Gebiet arbeiten, das unter militärischer Besatzung stand. Außerdem seien einige seiner besten Freunde ohnehin ...
Nachdem ich mich mit seinen Plänen abgefunden hatte – und ich gebe zu, die Aussicht auf Pyramiden, meine große Leidenschaft, hatte darauf einigen Einfluß –, traf ich eilig die Vorbereitungen für unsere Abreise. Nach so vielen Jahren hatte ich zwar einige Routine darin, doch wenn wir uns in eine so abgelegene Region vorwagten, würden wir besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen und eine Unmenge zusätzlicher Ausrüstung einpacken müssen. Natürlich half mir Emerson kein bißchen. Er brütete tagaus, tagein über merkwürdigen Folianten, um ihnen das wenige Bekannte über die Ureinwohner des Sudan zu entnehmen. Ansonsten führte er stundenlange Gespräche mit seinem Bruder Walter. Walter war ein brillanter Linguist, der sich auf die alten Sprachen Ägyptens spezialisiert hatte. Bei der Aussicht, Texte in der geheimnisvollen und immer noch nicht entzifferten meriotischen Sprache in die Finger zu bekommen, geriet er ganz aus dem Häuschen. Anstatt Emerson von seinem gefährlichen Vorhaben abzubringen, bestärkte er ihn noch darin.
Walter hatte meine liebe Freundin Evelyn, Enkelin und Erbin des Herzogs von Chalfont, geheiratet. Ihre Ehe war sehr glücklich und mit vier – nein, damals waren es, wie ich glaube, schon fünf – Kindern gesegnet. (Man verlor bei Evelyn leicht den Überblick, wie mein Gatte einmal unflätig bemerkte. Dabei übersah er, wie Männer es so häufig tun, daß sein Bruder mindestens ebensoviel Anteil daran hatte.) An besagtem Abend waren Evelyn, Walter und ihre Kinder bei uns zu Besuch. Sosehr ich mich auch über die Gelegenheit freute, meine liebste Freundin, meinen Schwager, den ich sehr schätze, und natürlich auch ihre fünf (oder waren es doch sechs?) reizenden Kinder wiederzusehen, hatte ich sie aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen. Ich hatte die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, Emerson davon zu überzeugen, Ramses in England zurückzulassen, wenn wir zu unserer gefährlichen Reise aufbrachen. Ich wußte, ich konnte mich auf Evelyn verlassen. Sie würde – ebenso wie ich – ihre sanften Überredungskünste einsetzen. Und aus Gründen, die ich nie begreifen werde, liebte sie Ramses abgöttisch.
Es ist unmöglich, einen Eindruck von Ramses zu vermitteln, indem man seine Eigenheiten beschreibt. Man muß ihn in Aktion erleben, um zu verstehen, wie selbst die bewundernswertesten Eigenschaften verdreht oder so übertrieben werden können, daß sie sich von Tugenden ins Gegenteil verwandeln.
Damals war Ramses zehn Jahre alt. Er konnte Arabisch sprechen wie ein Eingeborener und drei verschiedene altägyptische Schriften ebenso mühelos lesen wie Latein, Hebräisch und Griechisch – was bedeutet, daß er sie wie seine Muttersprache beherrschte. Außerdem kannte er eine Unmenge schmutziger arabischer Lieder und vermochte auf fast allem zu reiten, was vier Beine hatte. Andere nützliche Fähigkeiten hatte er nicht.
Er liebte seine hübsche, sanfte Tante, und ich hoffte, sie würde ihn dazu überreden, diesen Winter lieber bei ihr zu verbringen. Seine Vettern und Cousinen stellten einen weiteren Anreiz dar, denn Ramses mochte sie sehr, obwohl ich nicht sicher bin, inwieweit sie diese Gefühle erwiderten.
An jenem Tag war ich mit weniger Sorge als sonst, wenn ich Ramses zu Hause zurückließ, nach London gefahren, schließlich regnete es wie aus Kannen, und ich ging davon aus, Evelyn würde den Kindern verbieten, nach draußen zu gehen. Ich hatte Ramses jegliches chemische Experiment strengstens untersagt, ebenso die Fortführung seiner Ausgrabungen im Weinkeller und das Messerwerfen im Haus. Weiterhin war es ihm nicht gestattet, der kleinen Amelia seine mumifizierten Mäuse vorzuführen oder seinen Vettern und Cousinen irgendwelche arabischen Lieder beizubringen. Außerdem gab es da noch eine Reihe anderer Dinge. Ich habe sie inzwischen vergessen, doch ich war mir einigermaßen sicher, daß ich an alles gedacht hatte. Deshalb konnte ich in aller Seelenruhe meinen Erledigungen nachgehen, obwohl es um mein körperliches Wohlbefinden nicht sehr gut bestellt war. Der Kohlenruß, der über London wabert, hatte sich mit dem Regen zu einer schwärzlichen Schmiere vermischt, die sich klebrig auf Kleider und Haut legte. Auf den Straßen stand knöcheltief der Schlamm. Als ich am späten Nachmittag aus dem Zug stieg, war ich froh, daß die Kutsche schon wartete. Zwar hatte ich die meisten meiner Einkäufe liefern lassen, aber ich war trotzdem mit Paketen beladen, den Rock bis zum Knie durchnäßt.
Die Lichter von Amarna House schienen mir warm und einladend durch die Abenddämmerung entgegen. Wie sehr freute ich mich auf ein Wiedersehen mit all jenen, die ich am meisten liebte. Nicht zu verachten waren auch einige weitere zwar geringere, doch trotzdem angenehme Freuden – ein heißes Bad, trockene Kleider und eine Tasse des Getränks, das einen zwar anregt, aber nicht berauscht. Als die Kälte aus feuchten Schuhen und klammen Röcken an mir emporstieg, entschloß ich mich, stattdessen lieber doch zu einem berauschenden Getränk zu greifen – das besagte Wirkung jedoch nur hat, wenn man es in unmäßigen Mengen zu sich nimmt, was ich ohnehin niemals tue. Gegen eine Erkältung gibt es nichts Besseres als einen ordentlichen Whisky Soda.
Gargery, unser ausgezeichneter Butler, hatte schon nach der Kutsche Ausschau gehalten. Während er mir aus dem nassen Mantel half, sagte er fürsorglich: »Darf ich mir den Vorschlag erlauben, Madam, daß Sie etwas als Vorbeugung gegen eine Erkältung zu sich nehmen sollten? Wenn Sie wollen, schicke ich einen der Diener sofort damit hinauf.«
»Eine famose Idee, Gargery«, antwortete ich. »Ich danke Ihnen.«
Beinahe hatte ich mein Zimmer erreicht, als ich bemerkte, daß es im Haus unnatürlich still war. Keine Stimmen erhoben sich in angeregter Debatte aus dem Arbeitszimmer meines Gatten, kein Kinderlachen, kein ...
»Rose!« rief ich und riß Tür auf. »Rose, wo ... ach, da sind Sie ja.«
»Ihr Bad ist fertig, Madam«, sagte Rose aus der offenen Badezimmertür, wo sie, von Dampf umwallt, dastand wie ein wohlwollender Geist. Sie sah ein wenig erhitzt aus, aber die hübsche Rötung ihrer Wangen rührte sicherlich vom heißen Badewasser her.
»Danke, Rose, ich wollte gerade fragen ...«
»Ziehen Sie das scharlachrote Nachmittagskleid an, Madam?«
Sie eilte zu mir hin und begann, an meinen Kleiderknöpfen herumzuzerren.
»Ja. Aber wo ... Meine liebe Rose. Sie schütteln mich ja wie ein Terrier eine Ratte. Ein bißchen weniger heftig, wenn ich bitten darf.«
»Ja, Madam. Aber Ihr Badewasser wird gleich kalt.« Nachdem sie mich von meinem Kleid befreit hatte, machte sie sich an die Unterröcke.
»Nun gut, Rose. Was hat Ramses jetzt wieder angestellt?«
Es dauerte eine Weile, bis ich ihr die Wahrheit entlockt hatte. Rose hat keine Kinder, woraus sich zweifellos ihre eigenartige Liebe zu Ramses erklärt, den sie seit seiner Geburt kennt. Es ist richtig, daß er sie mit Geschenken überhäuft – Sträußen aus meinen preisgekrönten Rosen oder stacheligen Wildblumen, kleinen Pelztierchen und geschmacklosen Handschuhen, Schals und Handtaschen, die er selbst aussucht und mit seinem Taschengeld bezahlt. Doch selbst, wenn seine Geschenke passend waren, was sie meistens nicht sind, können sie die Stunden nicht aufwiegen, die Rose damit verbringt, hinter ihm her zu putzen. Ich habe schon vor langer Zeit aufgegeben, diese irrationale Ader in einer sonst so vernünftigen Frau verstehen zu wollen.
Nachdem Rose mich entkleidet und in die Wanne gesetzt hatte, war sie der Meinung, die beruhigende Wirkung des heißen Wassers habe mich nun genügend besänftigt, so daß ich die Wahrheit ertragen könne. Eigentlich war diese Wahrheit weniger schlimm als befürchtet. Ich hatte offenbar nur vergessen, Ramses zu verbieten, ein Bad zu nehmen.
Rose versicherte mir, die Decke in Professor Emersons Arbeitszimmer habe keinen großen Schaden davongetragen, und der Teppich hätte eine Wäsche ohnehin einmal nötig gehabt. Ramses habe den Wasserhahn eigentlich zudrehen wollen, doch dann habe Bastet, die Katze, eine Maus gefangen. Wäre er dem Tier nicht sofort zur Hilfe geeilt, hätte Bastet ihm den Garaus gemacht. Dank Ramses’ schnellem Eingreifen liege die Maus nun friedlich mit verbundenen Wunden in seinem Schrank.
Rose haßt Mäuse. »Lassen Sie’s gut sein«, sagte ich müde. »Ich will nichts mehr hören. Ich will überhaupt nicht wissen, weshalb Ramses sich gezwungen sah, sich den Qualen eines Bades zu unterziehen. Ich will auch gar nicht wissen, was Professor Emerson gesagt hat, als das Wasser von seiner Decke herabrann: Geben Sie mir nur das Glas, Rose, und dann gehen Sie ganz leise hinaus.«
Der Whisky Soda war serviert worden. Die innerliche Wirkung des Getränks und die äußere des heißen Wassers weckten schließlich wieder meine Lebensgeister. Und als ich ins Wohnzimmer trat, in scharlachrote Rüschen gehüllt und – wie ich glaube – so gutaussehend wie eh und je, las ich in den lächelnden Gesichtern meiner lieben Familie, daß alles in Ordnung war.
Evelyn trug ein hellblaues Kleid, das ihre blauen Augen noch strahlender erscheinen ließ und ihr blondes Haar gut zur Geltung brachte. Das Kleid war bereits kläglich zerknittert, weil sich Kinder auf meine liebe Freundin stürzen wie Bienen auf eine Blume. Sie hielt das Baby auf dem Schoß; die kleine Amelia saß neben ihr, an ihren mütterlichen Arm geschmiegt. Die Zwillinge hockten ihr zu Füßen und zerknautschten ihren Rock. Raddie, mein ältester Neffe, beugte sich über die Lehne des Sofas, auf dem seine Mutter saß, und Ramses lehnte sich an Raddie, um dem Ohr seiner Tante so nah wie möglich zu kommen. Wie immer redete er.
Als ich hereinkam, verstummte er, und ich musterte ihn nachdenklich. Er war ungewöhnlich sauber. Hätte ich den Grund nicht gekannt, ich hätte ihn in ironischem Tonfall gelobt, denn dieser Zustand ist bei ihm unnatürlich. Aber ich hatte beschlossen, den harmonischen Abend nicht durch Anspielungen auf unangenehme Ereignisse der Vergangenheit zu verderben. Allerdings muß etwas in meinem Gesichtsausdruck Emerson meine Gedanken verraten haben. Er kam auf mich zu, küßte mich herzhaft und drückte mir ein Glas in die Hand.
»Wie hübsch du aussiehst, meine geliebte Peabody. Ist das Kleid neu? Es steht dir.«
Ich gestattete ihm, mich zu einem Sessel zu geleiten. »Ich danke dir, mein lieber Emerson. Dieses Kleid habe ich schon seit einem Jahr, und du hast es schon mindestens ein Dutzend Mal gesehen. Doch ich freue mich trotzdem über das Kompliment.«
Auch Emerson war äußerst sauber. Sein dunkles Haar legte sich in weiche Wellen, wie immer, wenn er es gerade erst gewaschen hat. Ich schloß daraus, daß ihm eine erhebliche Menge Wasser auf den Kopf getropft sein mußte. Vielleicht war sogar Putz heruntergefallen. Wenn er über den Vorfall hinwegsehen wollte, durfte ich nicht zurückstehen. Also wandte ich mich an meinen Schwager, der am Kamin stand und uns mit einem liebevollen Lächeln beobachtete.
»Ich habe heute deinen Freund und Rivalen Frank Griffiths getroffen, Walter. Er läßt dich grüßen. Außerdem soll ich dir ausrichten, daß er mit dem Oxyrynchos-Papyrus ausgezeichnete Fortschritte macht.«
Walter ist ein Gelehrter und sieht auch so aus. Die Falten in seinen mageren Wangen vertieften sich, und er rückte seine Brille zurecht. »Aber, aber, meine liebe Amelia. Versuche nicht, zwischen mir und Frank einen Konkurrenzkampf zu entfachen. Er ist ein großartiger Linguist und ein guter Freund. Ich beneide ihn nicht um seinen Papyrus; Radcliffe hat mir ganze Wagenladungen meroitischer Inschriften versprochen. Ich kann es kaum erwarten.«
Walter gehört zu den wenigen, die Emerson mit seinem Vornamen ansprechen dürfen, den er verabscheut. Er zuckte sichtlich zusammen, antwortete jedoch nur: »Also, warst du im Britischen Museum, Peabody?«
»Ja.« Ich nahm einen Schluck von meinem Whisky. »Zweifellos wird es dich sehr überraschen, Emerson, daß Budge diesen Herbst ebenfalls in den Sudan reisen will. Genauer gesagt, ist er bereits fort.«
»Hmmm«, brummte Emerson. »Ach nein! Wirklich?«
Emerson hält die meisten Ägyptologen für ausgemachte Pfuscher – was sie nach seinen strengen Maßstäben auch sind –, und Wallis Budge, der Verwalter der ägyptischen und assyrischen Altertümer im Britischen Museum, war sein Intimfeind.
»Wirklich?« wiederholte Walter. Seine Augen funkelten. »Nun, das dürfte diesen Winter noch interessanter werden lassen, Amelia. Wenn du die beiden davon abhalten mußt, einander an die Gurgel zu gehen ...«
»Pah!« stieß Emerson hervor. »Walter, ich muß dich für diese Anspielung tadeln. Wie kannst du nur glauben, ich könnte die Würde meines Berufsstandes und meine eigene Selbstachtung so weit vergessen ... Zudem beabsichtige ich gar nicht, mich in der Nähe dieses Mistkerls aufzuhalten. Und er geht mir besser aus dem Weg, sonst erwürge ich ihn.«
Evelyn, die Friedensstifterin, versuchte, das Thema zu wechseln. »Hast du etwas Neues über Professor Petries Verlobung gehört, Amelia? Stimmt es, daß er bald heiratet?«
»Ich glaube schon, Evelyn. Alle reden darüber.«
»Klatschen, meinst du wohl«, schnaubte Emerson höhnisch. »Mit ansehen zu müssen, wie Petrie, der immer mit seinem Beruf verheiratet war, sich Hals über Kopf in ein Flittchen verliebt ... Es heißt, sie sei zwanzig Jahre jünger als er.«
»Und wer verbreitet jetzt üblen Klatsch?« wollte ich wissen. »Sie ist eine anständige junge Frau, und er ist ganz vernarrt in sie. Wir müssen uns ein passendes Hochzeitsgeschenk einfallen lassen, Emerson. Vielleicht einen silbernen Tafelaufsatz?«
»Was zum Teufel soll Petrie mit einem Tafelaufsatz anfangen?« fragte Emerson. »Der Mann lebt wie ein Wilder. Wahrscheinlich würde er Tonscherben darin einweichen.«
Wir waren noch bei diesem Thema, als sich die Tür öffnete. Ich blickte auf und erwartete Rose, die die Kinder zu Bett bringen wollte. Doch es war Gargery, und auf dem Gesicht des Butlers stand ein finsterer Ausdruck, der auf eine unangenehme Nachricht hindeutete.
»Ein Gentleman möchte Sie sprechen, Herr Professor. Ich habe ihm mitgeteilt, daß Sie um diese Zeit keine Besuche empfangen, aber er ...«
»Er muß einen wichtigen Grund haben, uns zu sehen«, unterbrach ich, als ich sah, daß mein Gatte die Augenbrauen zusammenzog. »Ein Gentleman, sagten Sie, Gargery?«
Der Butler senkte den Kopf. Dann ging er zu Emerson hinüber und hielt ihm das Tablett hin, auf dem eine schlichte weiße Visitenkarte lag.
»Hmmm«, brummte Emerson und nahm die Karte. »Honourable Reginald Forthright. Nie von ihm gehört. Schicken Sie ihn weg, Gargery.«
»Einen Moment«, sagte ich. »Ich glaube, du solltest ihn empfangen, Emerson.«
»Amelia, deine unersättliche Neugier wird mich noch einmal ins Grab bringen!« rief Emerson aus. »Ich will diesen Menschen nicht sehen. Ich will meinen Whisky Soda, ich will das Beisammensein mit meiner Familie genießen, ich will mein Abendessen. Ich weigere mich ...«
In diesem Augenblick flog die Tür auf, die Gargery hinter sich geschlossen hatte. Der Butler taumelte zurück, als der Neuankömmling schwungvoll an ihm vorbeistürmte. Barhäuptig, tropfnaß und leichenblaß durchquerte er das Zimmer. Immer wieder hielt er inne, krümmte sich und schwankte, bis er vor Walter angekommen war, der ihn entgeistert anstarrte.
»Herr Professor!« keuchte er. »Ich weiß, ich störe ... Ich flehe Sie an, mir zu verzeihen ... und mich anzuhören ...«
Und dann, noch ehe Walter sich von seiner Überraschung erholt hatte und wir anderen auch nur einen Finger rühren konnten, kippte der Fremde um und stürzte bäuchlings auf den Kaminvorleger.
Kapitel 2
»Mein Sohn lebt!«
Emerson brach als erster das Schweigen.
Stehen Sie sofort auf, Sie tolpatschiger junger Esel«, fauchte er gereizt. »Noch nie habe ich so eine ungeheuerliche Unverschämtheit ...«
»Um Himmels willen, Emerson!« rief ich aus und eilte auf den Gestürzten zu. »Siehst du denn nicht, daß er ohnmächtig ist? Beim bloßen Gedanken daran, welches unvorstellbar schreckliche Ereignis ihn in diesen entsetzlichen Zustand versetzt haben muß, schaudert mir.«
»Nein, das stimmt nicht«, widersprach Emerson. »Du liebst unvorstellbar schreckliche Ereignisse. Bitte zügle deine ausufernde Phantasie. Ohnmächtig, daß ich nicht lache! Wahrscheinlich ist er betrunken.«
»Bitte sofort ein Glas Brandy«, befahl ich. Mit einiger Mühe – denn der Bewußtlose war schwerer, als sein zierlicher Körperbau vermuten ließ – drehte ich ihn auf den Rücken und legte seinen Kopf auf meinen Schoß.
Mit verschränkten Armen stand Emerson da. Ein höhnisches Grinsen verzerrte seine wohlgeformten Lippen. Ramses näherte sich mit dem Glas Brandy. Als ich es entgegennahm, stellte ich, wie erwartet, fest, daß nicht nur das Innere des Glases naß war, sondern auch die Außenseite.
»Ich fürchte, ich habe etwas verschüttet«, erklärte Ramses. »Mama, darf ich einen Vorschlag machen ...«
»Nein«, erwiderte ich.
»Aber ich habe gelesen, daß es nicht ratsam ist, einem Bewußtlosen Brandy oder eine andere Flüssigkeit zu verabreichen. Es besteht die Gefahr ...«
»Ja, ja, Ramses, ich weiß. Und jetzt sei still.«
Offenbar war Mr. Forthrights Zustand nicht ernst. Seine Gesichtsfarbe gab Anlaß zur Zuversicht, und ich konnte auch keine Verletzungen an ihm feststellen. Ich schätzte ihn auf Anfang Dreißig. Seine Züge waren eher angenehm als hübsch zu nennen: Die Augen standen unter geschwungenen Brauen weit auseinander, seine Lippen waren voll und sanft gerundet. Doch sein außergewöhnlichstes Merkmal war das Haar, das seine Oberlippe und seinen Kopf schmückte: Es war von einem leuchtenden, unmodischen, aber nichtsdestotrotz interessanten Kupferrot, mit goldenen Strähnen durchzogen, und lockte sich ganz reizend an seinen Schläfen.
Ich fuhr mit meinen Bemühungen fort, und so dauerte es nicht lange, bis der junge Mann die Augen aufschlug und mich erstaunt ansah. Seine ersten Worte lauteten: »Wo bin ich?«
»Auf meinem Kaminvorleger«, antwortete Emerson, der drohend vor ihm aufragte. »Was für eine verd... .äh ... verflixt dumme Frage. Sagen Sie, was Sie hier wollen, Sie unverschämter Wicht, ehe ich Sie hinauswerfen lasse.«
Forthright errötete heftig. »Sie ... Sind Sie Professor Emerson?«
»Einer von beiden.« Emerson wies auf Walter, der seine Brille zurechtrückte und mißbilligend hüstelte. Zugegebenermaßen entsprach er dem landläufigen Bild von einem Gelehrten mehr als mein Mann, dessen wache, blaue Augen, gebräunte Haut und – nicht zu vergessen – eindrucksvolle Muskeln in ihm eher einen Mann der Tat als des Gedankens vermuten lassen.
»Oh, ich verstehe. Ich entschuldige mich vielmals. Aber ich hoffe, Sie werden mir verzeihen und mir Ihre Hilfe nicht verweigern, wenn Sie erst einmal meine Geschichte gehört haben. Ich suche den Ägyptologen Professor Emerson, dessen Mut und Körperkraft ebenso berühmt sind wie seine intellektuellen Fähigkeiten.«
»Äh, hmmm«, brummte Emerson. »Nun, Sie haben ihn gefunden. Und wenn Sie sich jetzt bitte aus den Armen meiner Frau lösen würden, die Sie ja derart mit Blicken verschlingen, daß es Ihr anfängliches schlechtes Benehmen noch überbietet ...«
Der junge Mann schnellte hoch wie eine Feder und fing an, Entschuldigungen zu stammeln. Emerson half ihm in einen Sessel – oder besser gesagt er stieß ihn hinein – und zog mich ebenso unsanft auf die Füße. Als ich mich umwandte, bemerkte ich, daß Evelyn die Kinder um sich geschart hatte und sie nun aus dem Zimmer scheuchte. Ich nickte ihr dankbar zu und wurde wie immer mit einem liebreizenden Lächeln belohnt.
Unser unerwarteter Besucher begann seinen Bericht mit einer Frage: »Ist es wahr, Herr Professor, daß Sie in diesem Jahr eine Reise in den Sudan planen?«
»Wo haben Sie das denn gehört?« lautete Emersons Gegenfrage.
Mr. Forthright lächelte. »Was Sie tun, Herr Professor, ist stets Gegenstand des Interesses – nicht nur in Archäologenkreisen, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit. Wie es der Zufall will, gibt es zwischen mir und ersterer Personengruppe eine indirekte Verbindung. Mein Name wird Ihnen unbekannt sein, aber der meines Großvaters ist Ihnen sicherlich ein Begriff. Schließlich ist er ein berühmter Förderer der Archäologie: Baron Blacktower.«
»Guter Gott!« rief Emerson aus.
Mr. Forthright fuhr zusammen. »Äh ... wie darf ich das verstehen, Herr Professor?«
Emersons Gesicht, das rot vor Wut war, hätte wohl jeden ins Bockshorn gejagt. Allerdings war sein finsterer Blick nicht auf Mr. Forthright gerichtet, sondern auf mich. »Ich habe es geahnt«, meinte Emerson erbost. »Werde ich denn nie Ruhe vor ihnen haben? Du ziehst sie an, Amelia. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber es wird mit der Zeit zu einer unangenehmen Angewohnheit. Schon wieder ein vermaledeiter Adliger!«
Walter konnte sich ein Kichern nicht verkneifen, und ich muß zugeben, daß auch ich ein wenig amüsiert war. Emerson klang wie ein fanatischer Jakobiner, der die verhaßten Aristokraten am liebsten auf dem Schafott gesehen hätte.
Mr. Forthright blickte Emerson verängstigt an.
»Ich werde mich so kurz wie möglich fassen«, fing er an.
»Gut«, entgegnete Emerson.
»Äh ... aber ich befürchte, ich werde Ihnen einige Hintergrundinformationen nicht vorenthalten können, damit Sie verstehen, in welchen Schwierigkeiten ich stecke.«
»Verdammt«, sagte Emerson.
»Mein ... mein Großvater hatte zwei Söhne.«
»Zum Teufel mit ihm«, brummte Emerson.
»Äh ... mein Vater war der jüngere. Sein älterer Bruder, selbstverständlich der Erbe, hieß Willoughby Forth.«
»Willie Forth, der Entdecker?« wiederholte Emerson. Sein Tonfall hatte sich schlagartig geändert. »Sie sind sein Neffe? Aber Ihr Name ...«
»Mein Vater heiratete eine Miss Wright, die einzige Tochter eines reichen Kaufmanns. Auf Wunsch seines Schwiegervaters fügte er den Namen Wright seinem eigenen hinzu. Da die meisten Menschen diesen Doppelnamen ohnehin als ein Wort verstehen, erschien es mir einfacher, diese Version zu übernehmen.«
»Wie entgegenkommend von Ihnen«, meinte Emerson. »Sie ähneln Ihrem Onkel in keinster Weise, Mr. Forthright. Sie können ihm nicht das Wasser reichen.«
»Der Name kommt mir bekannt vor«, mischte ich mich ein. »War er derjenige, der endgültig nachgewiesen hat, daß der Weiße Nil im Viktoriasee entspringt?«
»Nein. Er klammerte sich stur an die Auffassung, der Lualabafluß sei Teil des Nils, bis Stanley ihn widerlegte. Er segelte tatsächlich den Lualaba bis zum Kongo und von da aus zum Atlantik hinunter.« Willoughby Forths Neffe lächelte spöttisch.
»Leider wiederholten sich solche traurigen Ereignisse in seinem Leben immer wieder. Er war stets einige Monate zu spät dran oder irrte sich um ein paar hundert Meilen. Sein größter Wunsch war es, als großer Entdecker in die Geschichte einzugehen – was er dabei entdeckte, war Nebensache. Allerdings ging dieser Wunsch nie in Erfüllung.«
»Und er kostete ihn das Leben«, ergänzte Emerson nachdenklich. »Das seiner Frau ebenfalls. Sie sind vor zehn Jahren im Sudan verschollen.«
»Vor vierzehn Jahren, um genau zu sein.« Forthright fuhr zusammen. »Ist da jemand an der Tür?«
»Ich habe nichts gehört.« Emerson musterte ihn prüfend. »Oder habe ich heute Abend etwa mit einem zweiten unerwarteten Besucher zu rechnen?«
»Das befürchte ich. Aber lassen Sie mich bitte fortfahren. Sie müssen meine Geschichte hören, ehe ...«
»Mr. Forthright, die Entscheidung darüber, was in meinem Haus getan oder nicht getan wird, überlassen Sie bitte mir«, sagte Emerson. »Ich bin kein Freund von Überraschungen und ziehe es vor, wenn meine Gäste sich ankündigen, besonders wenn es sich dabei um Adlige handelt. Erwarten Sie Ihren Großvater?«
»Ja. Bitte, Herr Professor, so lassen Sie mich doch erklären. Onkel Willoughby war immer sein Lieblingssohn. Er teilte nicht nur Großvaters Interesse an der Archäologie und Geographie, sondern verfügte auch über die Körperkraft und den Mut, die seinem jüngeren Bruder fehlten. Mein armer, lieber Vater war immer recht schwächlich ...«
An Emersons Gesichtsausdruck erkannte ich, daß er im Begriff war, etwas Unhöfliches zu sagen. Also schaltete ich mich ein. »Kommen Sie auf den Punkt, Mr. Forthright.«
»Was? Ach, ja. Verzeihen Sie bitte. Großvater hat sich nie damit abgefunden, daß sein geliebter Sohn nicht mehr am Leben ist. Aber er muß tot sein, Herr Professor! Sonst hätten wir doch schon längst eine Nachricht von ihm erhalten.«
»Allerdings hat Ihnen auch niemand Mitteilung von seinem Tod gemacht«, wandte Emerson ein.
Forthright vollführte eine wegwerfende Handbewegung. »Wie denn? Im Dschungel und in der Wüste gibt es keine Telegrafenämter. Juristisch gesehen hätte man meinen Onkel und seine arme Gattin bereits vor Jahren für tot erklären lassen können. Doch mein Großvater weigert sich, diesen Schritt zu unternehmen. Nach dem Tod meines Vaters im letzten Jahr ...«
»Aha«, meinte Emerson. »Jetzt kommen wir der Sache ein wenig näher. Solange Ihr Onkel nicht offiziell für tot erklärt ist, sind Sie nicht der rechtmäßige Erbe Ihres Großvaters.«
Der junge Mann wich Emersons höhnischem Blick nicht aus. »Wenn ich leugnete, daß ich mir auch darüber Gedanken mache, wäre ich ein Heuchler, Herr Professor. Aber ob Sie es glauben oder nicht, es geht mir nicht hauptsächlich darum. Früher oder später werde ich Titel und Vermögen ohnehin erben, da ich der einzige Nachkomme bin. Doch mein Großvater ...«
Er brach ab und blickte sich ruckartig um. Diesmal war es kein Irrtum, denn das Getöse in der Vorhalle war so laut, daß man es sogar durch die geschlossene Tür hören konnte. Gargerys entrüstet erhobene Stimme wurde durch ein Geräusch, so durchdringend und schrill wie das Trompeten eines Elefantenbullen, übertönt. Dann flog die Tür krachend auf und auf der Schwelle stand die beeindruckendste Gestalt, die mir jemals begegnet war.
Das Bild des beklagenswerten, trauernden alten Vaters, das vor meinem geistigen Auge gestanden hatte, zerbarst angesichts der Wirklichkeit in tausend Scherben. Lord Blacktower – denn nur er konnte es sein – war ein Hüne von einem Mann mit Schultern wie ein Ringer und einer struppigen roten Haarmähne. Obwohl es inzwischen ausgebleicht und mit grauen Strähnen durchzogen war, mußte es einmal geleuchtet haben wie ein Sonnenuntergang. Er wirkte viel zu jung, um der Großvater eines Mannes jenseits der Dreißig zu sein, bis man sich sein Gesicht näher ansah. Es war von tiefen Falten durchfurcht wie ein Stück sonnenverdorrte Erde – und man konnte wilde Leidenschaft und einen ungesunden Lebenswandel darin lesen.
Sein plötzliches Erscheinen und sein rücksichtslos herrisches Auftreten ließen uns alle einen Moment lang erstarren. Seine Augen schweiften durch den Raum. Mit kühler Gleichgültigkeit glitt sein Blick über die Männer hinweg und blieb schließlich an mir hängen. Er zog elegant den Hut und verbeugte sich mit einer Anmut, die ich von einem so massigen Mann nie erwartet hätte. »Madam! Ich entschuldige mich vielmals für diese Störung. Darf ich mich vorstellen? Ich hin Franklin Lord Blacktower. Habe ich die Ehre mit Mrs. Radcliffe Emerson?«
»Äh ..., ja«, erwiderte ich.
»Mrs. Emerson!« Auch wenn er lächelte, wirkte er nicht einnehmender als vorhin, denn seine Augen blieben kalt und undurchdringlich wie persische Türkise. »Schon lange freue ich mich auf das Vergnügen, Sie kennenzulernen.«
Mit würdevollen, wiegenden Schritten kam er auf mich zu und hielt mir die Hand hin. Ich reichte ihm meine und machte mich schon auf einen knochenzermalmenden Griff gefaßt. Doch stattdessen hob er meine Finger an die Lippen und drückte einen geräuschvollen, langen und feuchten Kuß darauf. »Hmmm«, murmelte er. »Ihre Photographien werden Ihnen nicht im Mindesten gerecht, Mrs. Emerson.«
Eigentlich rechnete ich damit, daß Emerson gegen diese Vorgänge Einspruch erheben würde, denn das Gemurmel und Geküsse nahm eine geraume Weile in Anspruch. Aber mein Gatte gab keinen Mucks von sich, weshalb ich meine Hand zurückzog und Lord Blacktower aufforderte, Platz zu nehmen. Dieser jedoch strafte den von mir angewiesenen Sessel mit Nichtachtung und ließ sich so heftig neben mir auf dem Sofa nieder, daß das gesamte Möbel erzitterte. Von Emerson war immer noch nichts zu vernehmen. Ebenfalls nicht von Mr. Forthright; der war wieder in den Sessel zurückgesunken, von dem er beim Eintreten seines Großvaters aufgefahren war.
»Darf ich Ihnen eine Tasse Tee oder ein Glas Brandy anbieten, Lord Blacktower?« fragte ich.
»Wie großzügig von Ihnen, Madam, aber ich habe Ihnen bereits genug Umstände gemacht. Wenn ich Ihnen nur kurz erklären darf, was der Grund meines ungehörigen Eindringens ist, werde ich mich umgehend entfernen – und auch meinen Enkel, dessen Anwesenheit die Ursache meines ungehörigen Betragens darstellt, obgleich sie keine Entschuldigung dafür ist.« Er würdigte Mr. Forthright keines Blickes, sondern fuhr, ohne Luft zu holen, fort: »Eigentlich wollte ich mich auf üblichem Wege an Sie und Ihren verehrten Herrn Gatten wenden. Nachdem ich heute Nachmittag zufällig erfuhr, daß mein Enkel beschlossen hatte, mir zuvorzukommen, sah ich mich gezwungen, rasch zu handeln. Mrs. Emerson ...« – Er beugte sich zu mir hinüber und legte mir die Hand aufs Knie. »Mrs. Emerson! Mein Sohn lebt! Finden Sie ihn. Bringen Sie ihn mir zurück.«
Seine Hand war bleischwer und kalt wie Eis. Ich betrachtete die Venen, die sich wie dicke, blaue Würmer unter der Haut ringelten, und die rötlichgrauen Haarbüschel auf seinen Fingern. Und noch immer kein Einspruch von Emerson! Ich verstand die Welt nicht mehr.
Nur das mütterliche Mitgefühl mit einem Vater, den der Verlust eines geliebten Kindes um den Verstand gebracht hat, hinderte mich daran, seine Hand wegzustoßen. »Lord Blacktower«, fing ich an.
»Ich weiß, was Sie sagen wollen.« Sein Griff wurde fester. »Sie glauben mir nicht. Reginald hat Ihnen wahrscheinlich erzählt, ich sei ein vertrottelter alter Mann, der sich an eine Wahnidee klammert. Aber ich habe Beweise, Mrs. Emerson – eine Botschaft von meinem Sohn, die Einzelheiten enthält, über die nur er Bescheid wissen kann. Ich habe sie vor einigen Tagen erhalten. Finden Sie ihn, und ich werde Ihnen geben, was Sie verlangen. Ich möchte Sie nicht beleidigen, indem ich Ihnen Geld anbiete ...«
»Das wäre auch Zeitverschwendung«, entgegnete ich kühl.
Er fuhr fort, als habe er mich nicht gehört. » ... obgleich ich es als Ehre betrachten würde, Ihre zukünftigen Expeditionen finanzieren zu dürfen, und zwar mit einer Summe in jeder beliebigen Höhe. Möglicherweise hat Ihr Gatte auch Interesse an einem Lehrstuhl in Archäologie. Oder an einem Adelstitel. Lady Emerson, klänge das nicht gut?«
Sein Tonfall war derb geworden, und seine Ausdrucksweise – ganz zu schweigen von seiner Hand – wurde zunehmend vertraulicher. Allerdings war nicht die Beleidigung seiner Frau, sondern die seiner eigenen Person Ursache dafür, daß Emerson endlich das Wort ergriff.
»Sie verschwenden immer noch Ihre Zeit, Lord Blacktower. Ich pflege nicht für Auszeichnungen zu bezahlen, und ich lasse auch nicht zu, daß ein anderer das an meiner statt tut.«
Der alte Mann lachte brüllend auf. »Ich fragte mich schon, was ich tun muß, um Sie zu provozieren, Herr Professor. Ich weiß, daß jeder Mann seinen Preis hat. Aber der Ihre ist wohl zu hoch für mich. Ich glaube, ich habe Sie ganz richtig eingeschätzt. Nichts von dem, was ich Ihnen angeboten habe, könnte Sie in Versuchung führen. Allerdings wüßte ich etwas, das auch Sie nicht abtun werden. Hier – sehen Sie sich das an.«
Er griff in die Tasche und zog einen Briefumschlag heraus. Ich strich meine Röcke glatt. Mir kam es vor, als spürte ich immer noch den Abdruck seiner Hand – brennend und gleichzeitig kalt – auf meiner Haut.
Emerson nahm den unversiegelten Umschlag entgegen. Vorsichtig, wie er es bei zerbrechlichen Antiquitäten tut, zog er einen langen, flachen Gegenstand heraus. Er war beige und zu dick, um aus gewöhnlichem Papier zu bestehen, aber es stand etwas darauf geschrieben. Ich konnte die Worte nicht entziffern.
Schweigend studierte Emerson die Schrift eine Weile. Dann kräuselte er spöttisch die Lippen. »Eine außergewöhnlich unverfrorene und schlechte Fälschung.«
»Fälschung! Dann handelt es sich also nicht um Papyrus?«
»Das schon«, räumte Emerson ein. »Und er ist vergilbt und brüchig genug, um aus dem alten Ägypten zu stammen. Allerdings ist die Schrift weder alt noch ägyptisch. Was soll dieser Unsinn?«
Der alte Mann bleckte die Zähne, deren Farbe der des Papyrus glich. »Lesen Sie es, Herr Professor. Lesen Sie die Botschaft laut.«
Emerson zuckte die Achseln. »Nun denn. ›Der junge Löwe grüßt den alten Löwen. Dein Sohn und deine Tochter leben; doch nicht mehr lang, wenn nicht bald Hilfe kommt. Blut ruft Blut, alter Löwe; ist jedoch der Ruf nicht stark genug, suche die Schätze der Vergangenheit an jenem Ort, wo ich dich erwarte‹ Von allen kindischen ...«
»Kindisch, das ist richtig. Es begann, als er ein Knabe war und Romane und Abenteuergeschichten las, und entwickelte sich zu einer Art Geheimsprache. Er schrieb sonst an niemanden so – keiner wußte davon. Und es wußte auch keiner, daß er mich den alten Löwen nannte.« In diesem Augenblick sah er wirklich aus wie ein alter Löwe – ein müder, alter Löwe mit hängendem Kiefer und Augen, die tief in runzeligen Höhlen lagen.
»Es ist trotzdem eine Fälschung«, beharrte Emerson stur. »Eine geschicktere, als ich ursprünglich glaubte, aber nichtsdestotrotz eine Fälschung.«