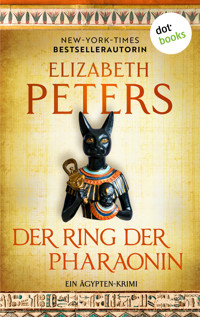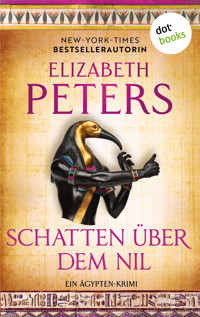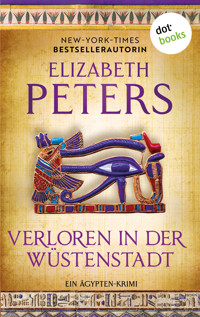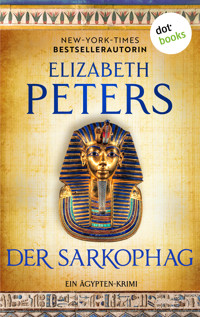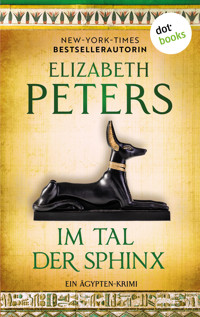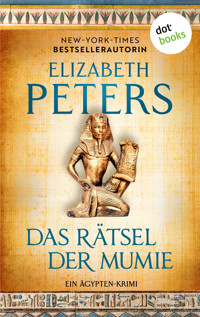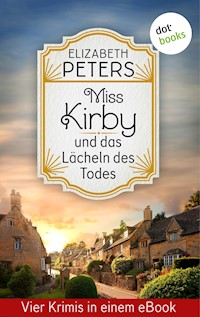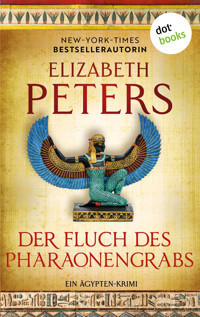
1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Amateur-Detektivin zwischen Mumien und Mordopfern: »Der Fluch des Pharaonengrabes« von Elizabeth Peters jetzt als eBook bei dotbooks. Amelia Peabodys wilde Zeiten sind vorbei, denn als Frau eines ehrgeizigen Wissenschaftlers und als Mutter des kleinen Ramses bleibt ihr im viktorianischen England keine Zeit für aufregende Exkursionen. Aber wirklich bereit für ein Leben als Hausfrau ist Amelia nicht. Da kommt ihr die Bitte der verzweifelten Lady Baskerville gerade gelegen: Ob Amelia und ihr Mann Emerson bei einer Ausgrabung in Ägypten nach dem Rechten schauen könnten? Ihr Mann sei dort unter mysteriösen Umständen tödlich verunglückt … Kaum im Tal der Könige angekommen, häufen sich die rätselhaften Todesfälle und schnell verbreitet sich das Gerücht vom Fluch des Pharaos. Doch die unerschrockene Amelia beschleicht ein ganz anderer Verdacht: Könnte ein ruchloser Mörder am Werk sein? »Ein Juwel von einer Romanreihe.« New York Times Book Review Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Ägypten-Krimi »Der Fluch des Pharaonengrabes« ist der zweite Teil der mitreißenden Amelia-Peabody-Reihe von Elizabeth Peters. Die Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Amelia Peabodys wilde Zeiten sind vorbei, denn als Frau eines ehrgeizigen Wissenschaftlers und als Mutter des kleinen Ramses bleibt ihr im viktorianischen England keine Zeit für aufregende Exkursionen. Aber wirklich bereit für ein Leben als Hausfrau ist Amelia nicht. Da kommt ihr die Bitte der verzweifelten Lady Baskerville gerade gelegen: Ob Amelia und ihr Mann Emerson bei einer Ausgrabung in Ägypten nach dem Rechten schauen könnten? Ihr Mann sei dort unter mysteriösen Umständen tödlich verunglückt …
Kaum im Tal der Könige angekommen, häufen sich die rätselhaften Todesfälle und schnell verbreitet sich das Gerücht vom Fluch des Pharaos. Doch die unerschrockene Amelia beschleicht ein ganz anderer Verdacht: Könnte ein ruchloser Mörder am Werk sein?
Über die Autorin:
Elizabeth Peters (1927 – 2013) ist das Pseudonym von Barbara G. Mertz, einer amerikanischen Autorin und Ägyptologin. Sie promovierte am berühmten Orient-Institut in Chicago und wurde für ihre Romane und Sachbücher mit vielen Preisen ausgezeichnet. Einer dieser Preise, der »Amelia Award«, wurde sogar nach ihrer beliebten Romanfigur benannt, der bahnbrechenden Amelia Peabody. Besonders ehrte sie jedoch, dass viele ÄgyptologInnen ihre Bücher als Inspirationsquelle anführen.
Die »Amelia Peabody«-Reihe von Elizabeth Peters bei dotbooks umfasst:
»Das Rätsel der Mumie«
»Der Fluch des Pharaonengrabs«
»Im Tal der Squinx«
»Der Sarkophag«
»Verloren in der Wüstenstadt«
»Schatten über dem Nil«
»Der Ring der Pharaonin«
Die »Vicky Bliss«-Reihe von Elizabeth Peters bei dotbooks umfasst:
»Vicky Bliss und der geheimnisvolle Schrein«
»Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde«
»Vicky Bliss und der blutrote Schatten«
»Vicky Bliss und der versunkene Schatz«
»Vicky Bliss und die Hand des Pharaos«
Auch bei dotbooks erscheint ihre Krimireihe um Jacqueline Kirby:
»Der siebte Sünder – Der erste Fall für Jacqueline Kirby«
»Der letzte Maskenball – Der zweite Fall für Jacqueline Kirby«
»Ein preisgekrönter Mord – Der dritte Fall für Jacqueline Kirby«
»Ein todsicherer Bestseller – Der vierte Fall für Jacqueline Kirby«
Unter Barbara Michaels veröffentlichte bei dotbooks ihre Romantic-Suspense-Romane:
»Der Mond über Georgetown«
»Das Geheimnis von Marshall Manor«
»Die Villa der Schatten«
»Das Geheimnis der Juwelenvilla«
»Die Frauen von Maidenwood«
»Das dunkle Herz der Villa«
»Das Haus des Schweigens«
»Das Geheimnis von Tregella Castle«
»Die Töchter von King’s Island«
Sowie ihre historischen Liebesromane:
»Abbey Manor – Gefangene der Liebe«
»Wilde Manor – Im Sturm der Zeit«
»Villa Tarconti – Lied der Leidenschaft«
»Grayhaven Manor – Das Leuchten der Sehnsucht«
***
eBook-Neuausgabe August 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1981 unter dem Originaltitel »The Curse of the Pharaohs« bei Mysterious Press, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2000 im Ullstein Taschenbuch Verlag
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1981 Elizabeth Peters
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)
ISBN 978-3-98952-289-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Der Fluch des Pharaonengrabs
Ein Ägypten-Krimi. Amelia Peabody 2
Aus dem Amerikanischen von Karin Dufner und Bernhard Jendricke
dotbooks.
Kapitel 1
Die Ereignisse, von denen ich nun berichten will, nahmen an einem Nachmittag im Dezember ihren Anfang, als ich Lady Harold Carrington und einige ihrer Freundinnen zum Tee eingeladen hatte.
Lassen Sie sich, werter Leser, von dieser einleitenden Bemerkung nicht in die Irre führen. Sie entspricht den Tatsachen (was bei meinen Bemerkungen stets der Fall ist). Aber wenn Sie jetzt eine Geschichte erwarten, die idyllische Szenen am heimischen Herd, aufgelockert durch ein wenig Klatsch aus dem Landadel, schildert, werden Sie eine herbe Enttäuschung erleben. Frieden und Harmonie sind meine Sache nicht, und es ist keineswegs meine Lieblingsbeschäftigung, Teepartys zu veranstalten. Ehrlich gesagt, würde ich mich lieber von einer Horde wilder, blutrünstiger Derwische durch die Wüste hetzen lassen. Ich würde es vorziehen, vor einem tollwütigen Hund auf einen Baum zu flüchten oder plötzlich vor einer Mumie zu stehen, die sich aus ihrem Grab erhebt. Lieber ließe ich mich mit Messern und Pistolen bedrohen, von Giftschlangen oder dem Fluch eines längst verstorbenen Königs.
Doch ehe man mir Übertreibung vorwirft, muß ich betonen, daß mir all diese Dinge – abgesehen von einem – bereits widerfahren sind. Allerdings merkte Emerson einmal an, im Fall einer Begegnung mit einer Horde Derwische würden nur fünf Minuten meiner Nörgelei ausreichen, daß sogar der sanftmütigste von ihnen Mordgelüste gegen mich entwickelt.
Emerson findet solche Bemerkungen witzig, und ich habe in fünf Jahren Ehe gelernt, daß man besser den Mund hält, wenn man den Humor seines Gatten nicht amüsant findet. Soll die Ehe gedeihen, ist es notwendig, sein Temperament ein wenig zu zügeln. Und ich muß zugeben, daß mir der Ehestand in vielerlei Hinsicht gefällt.
Während des besagten Nachmittagstees war ich unruhig, und das hatte auch mit Emerson zu tun. Das Wetter war abscheulich – trübes Nieseln mit gelegentlichen Graupelschauern. Deswegen hatte ich auf meinen gewohnten Spaziergang von siebeneinhalb Kilometern verzichten müssen. Allerdings waren die Hunde draußen gewesen und hatten sich im Schlamm gewälzt. Den Dreck verteilten sie auf dem Wohnzimmerteppich und auf Ramses ...
Doch auf das Thema Ramses werde ich an geeigneter Stelle noch zu sprechen kommen.
Obwohl wir schon seit fünf Jahren in Kent wohnten, hatte ich meine Nachbarinnen noch nie zum Tee eingeladen. Keine von ihnen ist in der Lage, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Sie können keine Kamares-Vase von einer prähistorischen Töpferei unterscheiden und wissen nicht, wer Sethos der Erste war. Zu diesem Anlaß jedoch war ich gezwungen, die gesellschaftlichen Formen zu wahren, was ich für gewöhnlich verabscheue. Emerson hatte ein Auge auf ein Hügelgrab geworfen, das sich auf Sir Harolds Besitz befand, und so war es nötig, daß wir – wie er es elegant ausdrückte – Sir Harold »Honig um den Bart« schmierten, ehe wir ihn um die Erlaubnis baten, Ausgrabungen durchzuführen.
Daß Sir Harold Honig brauchte, war Emersons eigene Schuld. Ich teile die Ansicht meines Gatten, daß es idiotisch ist, Füchse zu jagen, und ich mache es ihm auch nicht zum Vorwurf, daß er den Fuchs höchstpersönlich vom Feld eskortierte, als dieser kurz davorstand, gefangen oder zur Strecke gebracht zu werden, oder wie man das sonst sagt. Allerdings mache ich Emerson den Vorwurf, daß er Sir Harold aus dem Sattel gezerrt und ihn mit seiner eigenen Reitpeitsche verprügelt hat. Ein paar nachdrückliche Worte und die Entfernung des Fuchses hätten den gleichen Zweck erfüllt. Die Prügel waren überflüssig.
Ursprünglich hatte Sir Harold gedroht, Emerson anzuzeigen. Aber dann bildete er sich ein, das sei unsportlich, und sah davon ab. (Offensichtlich ist das Verfolgen eines einzigen Fuchses durch eine Horde Reiter und eine Meute Hunde nicht mit diesem Stigma belastet.) Mit körperlicher Gewalt gegen Emerson vorzugehen verbot sich aufgrund von Emersons Körpergröße und seines (nicht unverdienten) Rufs, ein Raufbold zu sein. Also mußte Sir Harold sich damit zufriedengeben, Emerson mit Nichtachtung zu strafen, wenn sie sich zufällig begegneten. Emerson fiel es nie auf, daß er mit Nichtachtung gestraft wurde, und so verlief alles friedlich, bis mein Gatte den Einfall hatte, Sir Harolds Hügelgrab auszuheben.
Es war ein recht hübsches Hügelgrab, soweit man das von einem Hügelgrab behaupten kann – etwa dreißig Meter lang und neun breit. Diese Denkmäler dienten den alten Wikingerkriegern als Begräbnisstätten, und Emerson hoffte, Grabgaben eines Häuptlings oder sogar Hinweise auf barbarische Opferriten zu finden. Da ich ein überaus ehrlicher Mensch bin, gebe ich offen zu, daß es teilweise meine eigene Versessenheit, in diesem Grab herumzuwühlen, war, die mich dazu brachte, höflich zu Lady Harold zu sein. Allerdings machte ich mir auch Sorgen um Emerson.
Er langweilte sich. Oh, wie er versuchte, es zu verbergen! Wie ich bereits gesagt habe und immer sagen werde, hat Emerson seine Fehler, doch Ungerechtigkeit gehört nicht dazu. Er gab mir nicht die Schuld an der Tragödie, die sein Leben ruiniert hatte.
Als ich ihn kennenlernte, führte er gerade archäologische Ausgrabungen in Ägypten durch. Manchen phantasielosen Menschen mag diese Beschäftigung als nicht besonders angenehm erscheinen. Krankheiten, eine unglaubliche Hitze, unzureichende oder fehlende sanitäre Einrichtungen und riesige Mengen Sand trüben bis zu einem gewissen Grad die Freude, die Schätze versunkener Zivilisationen zu entdecken. Allerdings liebte Emerson dieses Leben, und mir ging es genauso, nachdem wir uns ehelich, beruflich und finanziell zusammengeschlossen hatten. Selbst nach der Geburt unseres Sohnes gelang es uns, eine lange Saison in Sakkara zu verbringen. In diesem Frühling kehrten wir mit der festen Absicht nach England zurück, im folgenden Herbst wieder hinzufahren. Doch dann ereilte uns das Unglück in Gestalt unseres Sohnes »Ramses« Walter Peabody Emerson.
Das Kind war kaum drei Monate alt, als wir es den Winter über bei meiner lieben Freundin Evelyn ließen, die Emersons jüngeren Bruder Walter geheiratet hatte. Von ihrem Großvater, dem aufbrausenden Herzog von Chalfont, hatte Evelyn Schloß Chalfont und eine Menge Geld geerbt. Ihr Gatte – einer der wenigen Männer, deren Gegenwart ich länger als eine Stunde ertrage – war ein angesehener Ägyptologe. Anders als Emerson, der Ausgrabungen vorzieht, ist Walter Philologe und hat sich auf die Entzifferung der verschiedenen antiken ägyptischen Sprachen spezialisiert. Er hatte sich mit seiner hübschen Frau in deren Familiensitz ein glückliches Heim geschaffen und verbrachte seine Tage mit der Lektüre unleserlicher, zerbröckelnder Texte. Abends spielte er mit seiner ständig wachsenden Kinderschar.
Evelyn, die ein sehr liebes Mädchen ist, erklärte sich bereit, Ramses für den Winter zu übernehmen. Die Natur hatte soeben verhindert, daß sie zum vierten Mal Mutter wurde, also war ein neues Baby ganz nach ihrem Geschmack. Mit drei Monaten war Ramses ein recht angenehmer Zeitgenosse. Er hatte einen dunklen Haarschopf, große blaue Augen und eine Nase, die sogar damals schon versprach, sich von einem kindlichen Stupsnäschen in ein Charakterprofil zu verwandeln. Er schlief viel. (Wie Emerson später sagte, schonte er nur seine Kräfte.)
Es fiel mir schwerer als erwartet, das Kind zurückzulassen, doch schließlich war es noch nicht lange genug auf der Welt, um einen großen Eindruck auf mich gemacht zu haben, und ich freute mich besonders auf die Ausgrabung in Sakkara. Die Saison verlief sehr erfolgreich, und ich gebe offen zu, daß mir mein verlassenes Kind nur selten in den Sinn kam. Als wir uns dann im folgenden Frühling auf die Rückkehr nach England vorbereiteten, freute ich mich trotzdem ziemlich darauf, Ramses wiederzusehen, und ich glaubte, daß es Emerson genauso ging: Wir fuhren von Dover aus direkt nach Schloß Chalfont, ohne in London Station zu machen.
Wie gut erinnere ich mich an diesen Tag! Der April in England ist die schönste Jahreszeit! Endlich einmal regnete es nicht. Das ehrwürdige alte Schloß, an dessen Mauern sich wie grüne Farbtupfer wilder Wein und Efeu emporrankten, thronte inmitten eines ausgezeichnet gepflegten Parks wie eine würdevolle Matrone, die gerade ein Sonnenbad nimmt. Als unsere Kutsche hielt, flogen die Türen auf, und Evelyn kam mit ausgebreiteten Armen herausgelaufen. Walter folgte ihr: Er drückte seinem Bruder die Hand und zerquetschte mich fast in seiner brüderlichen Umarmung. Nachdem wir uns begrüßt hatten, sagte Evelyn: »Aber ihr wollt bestimmt den kleinen Walter sehen.«
»Wenn es keine Umstände macht«, antwortete ich.
Evelyn nahm lachend meine Hand. »Amelia, mich kannst du nicht hinters Licht führen. Ich kenne dich zu gut. Du kannst es doch kaum noch erwarten, dein Baby zu sehen.«
Schloß Chalfont ist ein großes Gebäude. Obwohl es von Grund auf modernisiert worden ist, sind die Wände alt und zwei Meter dick. Geräusche dringen nicht so leicht durch, aber als wir den oberen Flur im Südflügel entlanggingen, hörte ich auf einmal einen merkwürdigen Laut, eine Art Brüllen. Auch wenn es sehr gedämpft klang, vermittelte es doch einen Grad von Wildheit, daß ich mir die Frage nicht verkneifen konnte: »Evelyn, hast du dir einen Zoo angeschafft?«
»So könnte man es auch nennen«, antwortete Evelyn, wobei sie vor Lachen kaum Luft bekam.
Als wir weitergingen, steigerte sich die Intensität des Geräusches. Vor einer geschlossenen Tür blieben wir stehen. Evelyn öffnete sie, und das Geräusch drang uns mit geballter Macht entgegen. Ich wich tatsächlich einen Schritt zurück und trat meinem Gatten, der dicht hinter mir stand, kräftig auf den Fuß.
Es handelte sich um ein Kinderzimmer, das liebevoll mit all dem Komfort ausgestattet war, den man für Geld kaufen kann. Durch die hohen Fenster flutete Licht ins Zimmer; ein helles Feuer, das mit einem Kamingitter und einem Wandschirm geschützt war, milderte die Kälte der alten Steinmauern. In diesem Raum waren sie mit Holz vertäfelt und mit hübschen Bildern und bunten Stoffen geschmückt. Der Boden war mit einem dicken Teppich bedeckt, auf dem verschiedene Spielzeuge herumlagen. Vor dem Kamin saß der Inbegriff eines freundlichen, alten Kindermädchens zufrieden in einem Schaukelstuhl, Kappe und Schürze schneeweiß, das rosige Gesicht entspannt, die Hände mit einer Strickarbeit beschäftigt. An den Wänden standen in verschiedenen Abwehrhaltungen drei Kinder. Obwohl sie erheblich gewachsen waren, erkannte ich sie als Nachwuchs von Evelyn und Walter. In der Mitte des Zimmers saß kerzengerade auf dem Boden ein Baby.
Seine Gesichtszüge waren nicht zu erkennen. Man sah nur eine riesige Mundhöhle, die von schwarzem Haar umrahmt wurde. Allerdings hatte ich, was die Identität des Kindes betraf, keine Zweifel.
»Da ist er«, überbrüllte Evelyn das Geheul dieses Vulkans in Kindergestalt. »Schaut nur, wie er gewachsen ist!«
Emerson schnappte nach Luft. »Was zum Teufel ist denn los mit ihm?«
Das Kind, das – wie, kann ich mir nicht vorstellen – eine neue Stimme vernommen hatte, hörte auf zu kreischen. Das Geräusch brach so abrupt ab, daß mir noch die Ohren klingelten.
»Nichts«, antwortete Evelyn. »Er kriegt gerade Zähne und ist manchmal ein wenig schlecht gelaunt.«
»Schlecht gelaunt?« wiederholte Emerson ungläubig.
Ich betrat, gefolgt von den anderen, das Zimmer. Das Kind starrte uns an. Es saß mit ausgestreckten Beinen auf seinem Hinterteil, und mir fiel sofort seine Körperform auf, die genaugenommen rechteckig war. Wie ich beobachtet hatte, neigten die meisten Babys zur Zartheit. Doch dieses hier hatte breite Schultern, eine gerade Wirbelsäule, keinen sichtbaren Hals und ein Gesicht, dessen kantige Züge nicht einmal der Babyspeck verbergen konnte. Seine Augen waren nicht hell, wie man es bei den meisten Kindern sieht, sondern dunkel wie zwei Saphire. Berechnend, fast wie ein Erwachsener, blickte es mich an.
Inzwischen hatte sich Emerson vorsichtig von links genähert, als hätte er einen knurrenden Hund vor sich. Als das Kind plötzlich den Blick in Emersons Richtung wandte, blieb er stehen. Ein dümmlicher Ausdruck trat in sein Gesicht. »Kleiner«, säuselte er. »Wawa, Papas kleiner Wawa. Komm zum lieben Papa.«
»Du meine Güte, Emerson!« rief ich aus.
Die durchdringenden Augen des Babys richteten sich auf mich. »Ich bin deine Mutter, Walter«, sagte ich langsam und deutlich. »Deine Mama. Aber das kannst du ja wahrscheinlich noch nicht sagen.«
Ohne Vorwarnung kippte das Kind nach vorne. Emerson stieß einen Angstschrei aus, doch seine Besorgnis war überflüssig. Geschickt landete der Kleine auf allen vieren und krabbelte in halsbrecherischer Geschwindigkeit geradewegs auf mich zu. Vor meinen Füßen kam er zum Stehen, kauerte sich auf die Fersen und streckte die Arme aus.
»Mama«, sagte das Kind. Sein breiter Mund öffnete sich zu einem Lächeln, das Grübchen auf beiden Wangen zum Vorschein brachte und drei kleine, weiße Zähne sehen ließ. »Mama. Auf. Auf, auf, auf, auf.«
Die Stimme steigerte sich, und das letzte »Auf« ließ die Fensterscheiben klirren. Also bückte ich mich hastig und packte das kleine Geschöpf. Es schlang die Arme um meinen Hals und drückte sein Gesicht an meine Schulter. »Mama«, sagte es mit gedämpfter Stimme.
Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, weil die Umarmung des Kindes so heftig war, brachte ich einige Zeit kein Wort heraus.
»Er ist ein Goldstück«, meinte Evelyn so stolz, als ob es ihr Kind wäre. »Die meisten Kinder sprechen nicht, ehe sie ein Jahr alt sind, aber dieser junge Mann hat schon einen gehörigen Wortschatz. Ich habe ihm jeden Tag eure Photos gezeigt.«
Emerson stand da und sah mich mit einem eigenartig niedergeschlagenen Ausdruck an. Das Kind lockerte seinen Würgegriff und riß sich – angesichts meiner späteren Erfahrungen kann ich das nur als kaltblütige Berechnung bezeichnen – von mir los. Dann sprang es durch die Luft auf meinen Mann zu.
»Papa«, sagte der Kleine.
Emerson fing ihn auf. Einen Moment lang sahen sie einander mit einem tatsächlich identischen, dümmlichen Grinsen an. Dann warf Emerson das Baby in die Luft. Es kreischte entzückt, also warf er es wieder hoch. Evelyn tadelte ihn, als der Kopf des Kindes vor lauter väterlichem Übermut die Decke streifte. Ich sagte nichts. Mit einem seltsamen Gefühl der Vorahnung wußte ich, daß ein Krieg begonnen hatte – eine lebenslange Schlacht, in der ich von vorneherein zum Scheitern verurteilt war.
Emerson gab dem Baby seinen Spitznamen. Er sagte, es ähnele wegen seines kriegerischen Auftretens und seiner Neigung zur Herrschsucht sehr einem ägyptischen Pharao, und zwar dem zweiten Träger dieses Namens, der entlang des Nils riesenhafte Statuen von sich hatte aufstellen lassen. Ich mußte zugeben, daß eine gewisse Ähnlichkeit bestand. Ganz sicherlich hatte das Kind nichts mit seinem Namenspatron, Emersons Bruder, gemein, der ein sanftmütiger, stiller Mensch ist.
Obwohl Walter und Evelyn uns drängten, bei ihnen zu wohnen, beschlossen wir, uns für den Sommer ein eigenes Haus zu mieten. Ganz offensichtlich hatten die Kinder von Emersons jüngerem Bruder eine Heidenangst vor ihrem Vetter. Sie konnten dem aufbrausenden Temperament und den leidenschaftlichen Liebesbekundungen, die bei Ramses häufig vorkamen, nichts entgegensetzen. Wie wir feststellten, war er hochintelligent. Seine körperlichen Fähigkeiten entsprachen seinen geistigen. Mit acht Monaten konnte er in einem erstaunlichen Tempo krabbeln. Als er mit zehn Monaten beschloß, laufen zu lernen, war er in den ersten Tagen ein wenig unsicher auf den Beinen; und einmal hatte er Abschürfungen an der Nasenspitze, der Stirn und am Kinn, denn Ramses machte keine halben Sachen – er fiel hin, stand auf und fiel wieder. Allerdings lernte er es bald, und danach war er nicht mehr zu halten, außer wenn ihn jemand in den Arm nahm. Inzwischen sprach er schon recht flüssig, abgesehen von der ärgerlichen Neigung zu lispeln, was ich auf die außergewöhnliche Größe seiner Schneidezähne zurückführte, die er von seinem Vater geerbt hatte. Außerdem hatte er aus derselben Quelle eine Eigenschaft übernommen, die ich nur schwer beschreiben kann, da es in der Sprache kein Wort gibt, das drastisch genug ist, um ihr Rechnung zu tragen. »Sturheit« trifft die tatsächlichen Verhältnisse bei weitem nicht.
Von Anfang an war Emerson von dem kleinen Geschöpf hingerissen. Er nahm das Kind mit auf lange Spaziergänge, las ihm stundenlang vor, nicht nur aus Peter Rabbit und anderen Kinderbüchern, sondern aus Ausgrabungsberichten und der Geschichte des alten Ägypten, die er gerade verfaßte. Mit anzusehen, wie Ramses mit vierzehn Monaten über einem Satz wie »In der ägyptischen Theologie wirkten Fetischismus, Totemismus und Synkretismus ineinander« nachgrübelte, war gleichzeitig beängstigend und komisch. Gelegentlich nickte das Kind dabei nachdenklich.
Nach einiger Zeit hörte ich auf, Ramses im Geiste als Neutrum zu bezeichnen. Seine Männlichkeit war nur zu offensichtlich. Als der Sommer zu Ende ging, begab ich mich eines Tages zum Immobilienmakler und teilte ihm mit, wir würden das Haus für ein weiteres Jahr behalten. Kurz danach sagte mir Emerson, er habe eine Dozentenstelle an der Universität von London angenommen.
Es bestand nie die Notwendigkeit, das Thema zu erörtern. Wir konnten einem kleinen Kind nicht die Verhältnisse eines Ausgrabungslagers zumuten, und Emerson würde es nicht ertragen, sich von dem Jungen zu trennen. Und meine Gefühle? Die zählten nicht weiter. Diese Entscheidung stellte die einzig vernünftige Lösung dar, und ich bin immer vernünftig.
Also vegetierten wir vier Jahre später immer noch in Kent dahin. Wir hatten beschlossen, das Haus zu kaufen. Es war ein hübsches, altes Haus im gregorianischen Stil und von einem schön bepflanzten – abgesehen von den Stellen, wo die Hunde und Ramses ihre Ausgrabungen machten – Garten umgeben. Die Hunde an Schnelligkeit zu übertreffen fiel mir nicht weiter schwer, aber es war ein ständiger Wettlauf, die Blumen schneller einzupflanzen, als Ramses sie wieder ausbuddelte. Ich glaube, daß viele Kinder gerne im Matsch spielen, aber Ramses’ Besessenheit von Löchern im Boden war unübertrefflich. An allem war nur Emerson schuld. Er verwechselte die Liebe zum Dreck mit einer knospenden archäologischen Begabung und ermutigte das Kind.
Emerson gab nie zu, daß ihm das alte Leben fehlte. Mit seinen Vorlesungen und Veröffentlichungen war er sehr erfolgreich, aber hie und da entdeckte ich einen wehmütigen Klang in seiner Stimme, wenn er aus der Times oder der Illustrated London News über neue Ausgrabungen im Nahen Osten las. So tief waren wir gesunken – wir lasen die ILN beim Tee und stritten uns mit unseren Nachbarn wegen Kleinigkeiten. Wir, die wir in einer Höhle in den ägyptischen Hügeln gelagert und die Hauptstadt eines Pharaos rekonstruiert hatten!
An diesem schicksalsträchtigen Nachmittag, dessen Bedeutung ich erst viel später begreifen sollte, schmückte ich mich zum Opfergang. Ich trug mein bestes, graues Seidenkleid. Emerson verabscheute dieses Gewand, weil ich seiner Ansicht darin aussah wie eine würdige, englische Matrone – eine der schlimmsten Beleidigungen, die er auf Lager hatte. Ich beschloß, daß Lady Harold das Kleid, wenn es Emerson mißfiel, wahrscheinlich für angemessen halten würde. Ich ließ sogar zu, daß Smythe, meine Zofe, etwas mit meinem Haar anstellte. Diese lächerliche Person bemühte sich immer, etwas an meiner äußeren Erscheinung zu verändern. Aber ich erlaubte ihr nie, mehr als das absolut Nötige zu tun, weil ich weder die Zeit noch die Geduld für ausgedehnte Schönheitsprozeduren hatte. Smythe ergriff die Gelegenheit beim Schopfe. Wenn ich keine Zeitung zum Lesen gehabt hätte, während sie an meinem Haar zerrte und Nadeln in meinen Kopf rammte, hätte ich vor Langeweile geschrien.
Schließlich schimpfte sie: »Mit allem Respekt, Madam, aber ich kann das nicht richtig machen, solange Sie mit dieser Zeitung herumwedeln. Hätten Sie etwas dagegen, sie wegzulegen?«
Ich hatte etwas dagegen. Doch es wurde spät, und der Artikel, den ich gelesen hatte – davon an gegebener Stelle mehr – ließ mir die Aussicht auf diesen Nachmittag noch gräßlicher erscheinen. Also legte ich die Times weg und ergab mich gehorsam Smythes Folterqualen.
Als sie fertig war, sahen wir beide mein Spiegelbild mit einem Ausdruck an, der unsere jeweiligen Gefühle deutlich machte – Smythe strahlte triumphierend, und auf meinem Gesicht lag die Niedergeschlagenheit eines Menschen, der gelernt hat, sich würdevoll ins Unvermeidliche zu fügen.
Mein Korsett war zu eng, und meine neuen Schuhe drückten. Also ging ich ächzend nach unten, um das Wohnzimmer zu inspizieren.
Der Raum war so sauber und ordentlich, daß es mich deprimierte. Die Zeitungen, Bücher und Zeitschriften, die gewöhnlich überall herumlagen, waren weggeräumt worden. Emersons prähistorische Töpfereien hatte man vom Kaminsims und von der Etagere entfernt. Anstelle von Ramses’ Spielsachen stand nun ein glänzendes, silbernes Teeservice auf dem Teewagen. Zwar verströmte das helle Feuer im Kamin ein warmes Licht, aber gegen die Niedergeschlagenheit, die mich erfüllte, konnte es wenig ausrichten. Für gewöhnlich gestatte ich es mir nicht, über Dinge zu trauern, die sich nicht ändern lassen, doch ich erinnerte mich an Dezembertage unter dem wolkenlos blauen Himmel und der strahlenden Sonne Ägyptens.
Noch während ich bedrückt dastand, die Zerstörung unseres fröhlich-chaotischen Heims betrauerte und den Gedanken an schönere Zeiten nachging, hörte ich das Geräusch von Wagenrädern auf dem Kies der Auffahrt. Die erste Besucherin war eingetroffen. Also raffte ich mein Büßergewand und machte mich daran, sie willkommen zu heißen.
Die Teeparty zu schildern wäre überflüssig, denn es handelte sich nicht um ein Ereignis, an das ich mich gern erinnere. Und glücklicherweise führten spätere Vorkommnisse dazu, daß Lady Harolds Ansichten darüber an Bedeutung verloren. Sie ist nicht der dümmste Mensch, dem ich jemals begegnet bin; dieser Titel gebührt eher ihrem Gatten. Allerdings vereinen sich in ihr Böswilligkeit und Dummheit in einem Grade, wie er mir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht untergekommen war.
Bemerkungen wie: »Meine Liebe, was für ein hübsches Kleid! Ich weiß noch, wie gut mir diese Mode gefallen hat, als sie vor zwei Jahren auf den Markt kam«, waren an mich verschwendet, denn mit Beleidigungen kann man mich nicht erschüttern. Was mich jedoch erschütterte, und das mit bemerkenswerter Heftigkeit, war, daß Lady Harold diese Einladung zum Tee als Geste der Entschuldigung und Kapitulation verstand. Diese Einschätzung zeigte sich in jedem herablassenden Wort, das sie von sich gab, und in jedem Ausdruck, der über ihr aufgedunsenes, derbes und gewöhnliches Gesicht huschte.
Zu meiner Überraschung stelle ich fest, daß ich wieder wütend werde. Wie idiotisch und was für eine Zeitverschwendung! Also will ich nicht weiter darüber sprechen – obwohl ich zugeben muß, daß ich eine unwürdige Genugtuung empfand, als ich Lady Harolds unverhohlenen Neid angesichts des ordentlich aufgeräumten Zimmers, des ausgezeichneten Essens und des Geschicks bemerkte, mit dem Butler, Diener und Mädchen uns bedienten. Rose, mein Mädchen, ist immer sehr tüchtig, doch bei dieser Gelegenheit wuchs sie über sich selbst hinaus. Ihre Schürze war so gestärkt, daß sie auch von selbst stehengeblieben wäre, die Bänder ihrer Haube knisterten fast, wenn sie sich bewegte. Mir war zu Ohren gekommen, daß Lady Harold wegen ihres Geizes und ihrer spitzen Zunge Schwierigkeiten hatte, Dienstboten zu halten. Roses jüngere Schwester war einmal bei ihr in Stellung gewesen ... für kurze Zeit.
Abgesehen von diesem kleinen Triumph, der nicht mein Verdienst war, verlief das Beisammensein unbeschreiblich zäh. Die anderen Damen, die ich eingeladen hatte, um meine wahren Motive zu verschleiern, waren alle Anhängerinnen von Lady Harold; sie hatten nichts Besseres zu tun, als bei jeder ihrer dümmlichen Bemerkungen zu kichern und zu nicken. Eine Stunde verging quälend langsam. Es wurde klar, daß meine Mission zum Scheitern verurteilt war; Lady Harold tat nichts, um mir entgegenzukommen. Allmählich fragte ich mich, was wohl geschehen würde, wenn ich einfach aufstand und hinausging. Doch dann kam es zu einer Unterbrechung, die mir die Verlegenheit ersparte.
Ich hatte Ramses liebevoll dazu überredet, daß er sich an diesem Nachmittag ruhig verhielt und im Kinderzimmer blieb. Das war mir mittels Bestechung gelungen, denn ich hatte ihm versprochen, am nächsten Tag mit ihm den Süßwarenladen im Dorf aufzusuchen. Ramses konnte gewaltige Mengen Süßigkeiten verschlingen, ohne daß sein Appetit oder sein Verdauungsapparat im mindesten in Mitleidenschaft gezogen worden wären. Unglücklicherweise aber war seine Lust auf Süßes nicht so stark wie die darauf, Neues zu erfahren oder sich im Schlamm zu wälzen – je nachdem. Während ich zusah, wie Lady Harold das letzte glasierte Törtchen verschlang, hörte ich aus der Vorhalle unterdrückte Schreie. Darauf folgte ein Krachen – meine liebste Ming-Vase, wie ich später herausfand. Dann flogen die Türen des Wohnzimmers auf und eine tropfende, mit Schlamm bespritzte kleine Vogelscheuche flitzte herein.
Es reicht nicht zu sagen, daß die Füße des Kindes matschige Abdrücke hinterließen. Nein, ein ungehemmter Strom flüssigen Drecks zeichnete seinen Weg nach. Dieser ergoß sich von seinem Körper, seinen Kleidern und dem besser nicht zu erwähnenden Gegenstand, den er in der Luft schwenkte. Schliddernd kam er vor mir zum Stehen und legte den Gegenstand auf meinem Schoß ab. Der Gestank, der ihm entstieg, zeigte seine Herkunft nur allzu deutlich: Ramses hatte einmal wieder im Komposthaufen gewühlt. Eigentlich habe ich meinen Sohn sehr gerne. Auch wenn ich nicht die überschwängliche Bewunderung an den Tag lege, die für seinen Vater typisch ist, kann ich dennoch sagen, daß ich für den Jungen eine gewisse Zuneigung empfinde. Doch in diesem Augenblick hätte ich das kleine Ungeheuer am liebsten am Kragen genommen und solange geschüttelt, bis es blau anlief.
Da mich die Gegenwart der anderen Damen an diesem natürlichen mütterlichen Impuls hinderte, sagte ich nur ruhig: »Ramses, nimm den Knochen von Mamas gutem Kleid und bring’ ihn zurück auf den Komposthaufen.«
Ramses neigte den Kopf zur Seite und musterte mit nachdenklich gerunzelter Stirn den Knochen. »Ich glaube«, sagte er, »daf ift ein Oberfenkelknochen. Ein Oberfenkelknochen von einem Rhinoferof.«
»In England gibt es keine Rhinozerosse«, belehrte ich ihn.
»Ein aufgeftorbenef Rhinoferof«, beharrte Ramses.
Ein eigenartiger Keuchlaut aus Richtung der Tür sorgte dafür, daß ich mich rechtzeitig umdrehte. Ich sah, wie Wilkins die Hände vor den Mund preßte und sich plötzlich abwandte. Wilkins ist ein sehr würdiger Mann und eine Perle von einem Butler, doch ein- oder zweimal hatte ich schon beobachten können, daß sich hinter seinem gesetzten Äußeren die zarte Andeutung eines Sinns für Humor verbirgt. Bei dieser Gelegenheit konnte ich nicht umhin, mich seinem Amüsement anzuschließen.
»Dieses Wort ist nicht unpassend«, sagte ich, während ich mir mit den Fingern die Nase zuhielt. Gleichzeitig fragte ich mich, wie ich den Jungen entfernen sollte, ohne mein Wohnzimmer noch mehr zu verunstalten. Einen Diener zu rufen, damit dieser ihn hinausbrachte, kam nicht in Frage; Ramses war ein sehr bewegliches Kind und durch die Schlammschicht glitschig wie ein Frosch. Beim Versuch, dem Verfolger zu entkommen, würde er überall Spuren hinterlassen: auf dem Teppich, den Möbeln, den Wänden, den Kleidern der Damen ...
»Ein wunderschöner Knochen«, sagte ich, wobei ich mir nicht einmal Mühe gab, der Versuchung zu widerstehen. »Du mußt ihn waschen, ehe du ihn Papa zeigst. Aber vielleicht möchte ihn Lady Harold zuerst sehen.«
Mit einer ausladenden Handbewegung wies ich auf die Dame.
Wenn sie nicht so dumm gewesen wäre, hätte sie sich vielleicht etwas ausgedacht, um Ramses abzulenken. Wenn sie nicht so dick gewesen wäre, hätte sie ihm vielleicht ausweichen können. Doch wie die Dinge lagen, konnte sie nichts tun, als sich aufzublasen, zu kreischen und zu stottern. Ihre Versuche, das widerliche Ding loszuwerden (und es war sehr widerlich, muß ich zugeben), waren vergeblich. Es verlor sich in einer Falte ihres gewaltigen Rocks.
Ramses war sehr entrüstet über die geringe Wertschätzung, die sein Schatz erfuhr.
»Du fmeift ihn runter und ferbrichft ihn!« rief er aus. »Gib ihn mir furück!«
Bei seinen Bemühungen, den Knochen zurückzuholen, zog er noch eine meterlange Spur über Lady Harolds riesigen Schoß. Dann drückte er ihn an seine kleine Brust und warf Lady Harold einen verachtungsvollen Blick zu, ehe er sich aus dem Zimmer trollte.
Über die nun folgenden Ereignisse breite ich den Mantel des Schweigens. Selbst jetzt bereitet mir die Erinnerung ein unwürdiges Vergnügen, und es gehört sich nicht, sich solchen Gedanken hinzugeben.
Ich stand am Fenster und sah zu, wie die Kutschen eilends durch den Regen davonfuhren. Leise summte ich vor mich hin, während Rose sich um das Teegeschirr und die Schlammspuren kümmerte, die Ramses hinterlassen hatte.
»Am besten bringen Sie frischen Tee, Rose«, sagte ich. »Professor Emerson kommt gleich nach Hause.«
»Ja, Madam. Ich hoffe, Madam, daß Sie mit allem zufrieden waren.«
»O ja. Ich könnte nicht zufriedener sein.«
»Ich freue mich, das zu hören, Madam.«
»Dessen bin ich mir sicher. Aber Rose, geben Sie Master Ramses keine Belohnung.«
»Auf keinen Fall, Madam.« Rose machte ein entsetztes Gesicht.
Eigentlich wollte ich mich noch umziehen, ehe Emerson zurückkehrte, aber an diesem Abend kam er früher. Wie immer hatte er einen Stapel von Büchern und Papieren bei sich, die er in einem wilden Haufen aufs Sofa warf. Dann wandte er sich zum Feuer und rieb die Hände kräftig aneinander.
»Ein abscheuliches Wetter«, knurrte er. »Ein scheußlicher Tag. Warum hast du dieses gräßliche Kleid an?«
Emerson hat nie gelernt, sich vor der Tür die Füße abzutreten. Ich betrachtete die Abdrücke, die seine Stiefel auf dem soeben gereinigten Boden hinterlassen hatten. Dann sah ich ihn an, und der Tadel, der mir schon auf der Zunge gelegen hatte, erstarb mir auf den Lippen.
In den Jahren seit unserer Eheschließung hatte er sich körperlich nicht verändert. Sein Haar war ebenso dicht, schwarz und zerzaust wie immer, seine Schultern ebenso breit und seine Haltung ebenso gerade. Als ich ihn kennenlernte, trug er einen Bart. Nun war er auf meine Bitte hin glattrasiert, was ein gehöriges Zugeständnis darstellte, denn Emerson verabscheut das Grübchen auf seinem markanten Kinn von ganzem Herzen. Mir gefällt dieser kleine Schönheitsfehler; er ist das einzig Spielerische an seiner sonst so schroffen Physiognomie.
An diesem Tag waren sein Aussehen, sein Verhalten und auch seine Art zu sprechen wie immer, aber es lag etwas in seinen Augen ... Ich kannte diesen Blick. Also sagte ich nichts über seine schmutzigen Stiefel.
»Ich hatte heute Nachmittag Lady Harold eingeladen«, sagte ich als Antwort auf seine Frage. »Deshalb das Kleid. Hattest du einen schönen Tag?«
»Nein.«
»Ich auch nicht.«
»Geschieht dir recht«, meinte mein Mann. »Ich habe dich doch gewarnt. Wo zum Teufel steckt Rose? Ich will meinen Tee.«
Pünktlich erschien Rose mit dem Teetablett. Ich dachte traurig über die tragische Veränderung nach, die mit Emerson vorgegangen war. Wie jeder ganz normale Engländer verlangte er ärgerlich nach seinem Tee und jammerte über das Wetter. Sobald sich die Tür hinter dem Mädchen geschlossen hatte, kam Emerson zu mir und nahm mich in die Arme.
Nach einiger Zeit hielt er mich von sich weg und sah mich fragend an. Er rümpfte die Nase.
Ich wollte ihm schon die Ursache des Gestanks erklären, als er mit leiser, belegter Stimme sagte: »Du siehst trotz des schrecklichen Kleides heute Abend besonders aufregend aus, Peabody. Möchtest du dich nicht umziehen? Ich komme mit dir nach oben, und ...«
»Was ist denn los mit dir?« wollte ich wissen, doch er ... Ganz gleich, was er tat, aber auf jeden Fall hinderte es ihn am Sprechen und erschwerte es mir, mich zusammenhängend auszudrücken. »Ich fühle mich ganz und gar nicht aufregend, und ich stinke wie ein verschimmelter Knochen. Ramses hat wieder einmal Ausgrabungen im Komposthaufen veranstaltet.«
»Hmmm«, sagte Emerson. »Meine geliebte Peabody ...«
Peabody ist mein Mädchenname. Als Emerson und ich uns kennenlernten, verstanden wir uns überhaupt nicht. Er gewöhnte sich an, mich wie einen Mann beim Familiennamen anzusprechen – zum Zeichen seines Ärgers. Inzwischen bedeutete das etwas völlig anderes und erinnerte uns an jene ersten Tage unserer Verliebtheit.
Freudig gab ich mich seiner Umarmung hin. Aber ich war trotzdem traurig, weil ich den Grund für seinen Überschwang kannte. Der Geruch von Ramses’ Knochen hatte ihn an die Anfänge unserer romantischen Liebesgeschichte in den unhygienischen Gräbern von El Amarna erinnert.
Ich wollte schon in seine Bitte einwilligen, daß wir uns in unser Zimmer zurückzogen. Aber wir hatten zu lange gewartet. Der allabendliche Ablauf war unverrückbar festgesetzt. Man ließ uns immer einen angemessenen Zeitraum, um allein zu sein, nachdem Emerson nach Hause zurückkehrte. Dann durfte Ramses hereinkommen, seinen Vater begrüßen und mit uns Tee trinken. An jenem Abend brannte der Junge darauf, den Knochen vorzuzeigen, und deswegen kam er vielleicht früher als sonst. Jedenfalls kam es mir zu früh vor, und selbst Emerson, der den Arm immer noch um meine Taille liegen hatte, begrüßte den Jungen nicht mit der üblichen Begeisterung.
Emerson nahm seinen Sohn samt Knochen auf den Schoß, und ich setzte mich auf das Sofa. Nachdem ich eine Tasse Tee für meinen Gatten eingeschenkt und meinem Sohn eine Handvoll Kekse verabreicht hatte, griff ich nach der Zeitung. Währenddessen stritten sich Emerson und Ramses über den Knochen. Es war ein Oberschenkelknochen – in diesen Dingen bewies Ramses eine fast unheimliche Zielsicherheit –, doch Emerson behauptete, er habe einst einem Pferd gehört. Ramses war da anderer Ansicht. Da ein Rhinozeros nicht in Frage kam, schwankte er zwischen einem Drachen und einer Giraffe.
Die Fortsetzung des Berichts, nach dem ich in der Zeitung suchte, stand nicht – wie die vorangegangenen Folgen – auf der ersten Seite. Ich glaube, am besten erzähle ich, was ich damals von dem Fall wußte, so als würde ich einen Roman beginnen; ich selbst hätte die Geschichte – wäre sie nicht auf den ehrwürdigen Seiten der Times erschienen – für eines der genialen Phantasiegebilde aus der Feder von Herrn Ebers oder Mr. Rider Haggard gehalten, nach deren Romanen ich eingestandenermaßen süchtig war. Üben Sie sich deshalb in Geduld, werter Leser, wenn wir mit einer nüchternen Wiedergabe von Tatsachen beginnen, und ich verspreche Ihnen, daß Sie zum angemessenen Zeitpunkt zu Ihrem Nervenkitzel kommen werden.
Sir Henry Baskerville (von den Norfolk-Baskervilles, nicht dem Devonshire-Zweig der Familie) hatte nach einer schweren Krankheit von seinem Arzt den Rat erhalten, einen Winter im gesundheitsfördernden Klima Ägyptens zu verbringen. Weder der ausgezeichnete Mediziner noch sein wohlhabender Patient hätten voraussehen können, welche weitreichenden Konsequenzen dieser Rat haben würde; denn als Sir Henry den ersten Blick auf die majestätischen Züge der Sphinx warf, erwachte in seiner Brust ein leidenschaftliches Interesse an ägyptischen Antiquitäten, das für den Rest seines Lebens sein Handeln bestimmen sollte.
Nach Ausgrabungen in Abydos und Denderah erhielt Sir Henry endlich die Genehmigung, an der wohl romantischsten Fundstätte in ganz Ägypten – dem Tal der Könige in Theben – Ausgrabungen vorzunehmen. Hier wurden die Gottkönige der Pharaonenzeit mit dem, ihrem hohen Stand angemessenen, Prunk und Pomp zur letzten Ruhe gebettet. Ihre Mumien lagen in goldenen Särgen und waren mit juwelenbesetzten Amuletten geschmückt. In ihren geheimen Gräbern, die tief in den Stein der Hügel von Theben gehauen waren, hofften sie dem schrecklichen Schicksal ihrer Vorfahren zu entgehen. Denn zur Zeit des ägyptischen Neuen Reiches waren die Pyramiden früherer Herrscher bereits aufgebrochen und ausgeraubt worden. Die königlichen Mumien wurden zerstört, ihre Schätze in alle Welt verstreut. So viel zur menschlichen Eitelkeit! Die mächtigen Pharaonen späterer Epochen waren nicht mehr gefeit gegen die Plünderung durch Grabräuber als ihre Vorfahren. Jedes Königsgrab, das im Tal der Könige gefunden wurde, war entweiht worden. Schätze, Juwelen und Mumien waren verschwunden. Bis zu jenem erstaunlichen Tag im Juli 1881 hatte man angenommen, daß die damaligen Grabräuber zerstört hatten, was sie nicht stehlen konnten. Doch dann führte eine moderne Räuberbande Emil Brugsch vom Museum in Kairo zu einem entfernten Tal in den Bergen von Theben. Die Diebe, Männer aus dem Dorf Gurneh, hatten entdeckt, was den Archäologen so lange entgangen war: die letzte Ruhestätte von Ägyptens mächtigsten Königen, Königinnen und deren Kindern, die in den Tagen des Niedergangs der Nation von treuen Priestern versteckt worden waren.
Doch es waren nicht alle Könige des Neuen Reiches im Versteck der Diebe gefunden worden, und man hatte noch nicht jedes Grab identifizieren können. Lord Baskerville glaubte, daß sich in den kahlen Felsen des Tals weitere Königsgräber verbargen – vielleicht sogar ein Grab, das niemals geplündert worden war. Eine Enttäuschung folgte auf die andere, doch er gab seine Suche nicht auf. Fest entschlossen, ihr sein Leben zu widmen, baute er sich ein Haus am westlichen Ufer, das teils als Winterquartier und teils als Unterkunft für seine Archäologen diente. An diesen wunderschönen Ort brachte er auch seine Braut, eine hübsche Frau, die seine Pflegerin gewesen war, als er sich bei seiner Rückkehr ins feuchte englische Frühlingsklima eine Lungenentzündung zugezogen hatte.
Über die Geschichte dieser romantischen Verlobung und Hochzeit, die an das Märchen vom Aschenputtel erinnerte – denn die neue Lady Baskerville war eine junge Frau ohne Vermögen und aus einfachen Verhältnissen –, war damals in allen Zeitungen berichtet worden. Die Sache ereignete sich, bevor ich anfing, mich für Ägypten zu interessieren, doch ich hatte selbstverständlich von Sir Henry gehört. Jeder Ägyptologe kannte seinen Namen. Emerson hatte nicht viel Gutes über ihn zu sagen, doch Emerson mäkelte an allen anderen Archäologen herum, ganz gleich, ob sie diese Tätigkeit von Berufs wegen oder als Steckenpferd ausübten. Als er Sir Henry vorwarf, dieser sei nur ein Amateur, tat er dem Gentleman furchtbar unrecht, denn der Lord versuchte nie, die Ausgrabungen selbst zu leiten, sondern stellte dafür immer einen ausgebildeten Archäologen an.
Im September dieses Jahres war Sir Henry wie immer nach Luxor gereist. Er wurde von Lady Baskerville und Mr. Alan Armadale, dem verantwortlichen Archäologen, begleitet. In dieser Saison wollten sie die Arbeiten in einem Gebiet im Zentrum des Tals neben den Gräbern von Ramses II. und Merenptah beginnen, das von Lepsius im Jahre 1844 entdeckt worden war. Sir Henry war der Ansicht, daß die Schutthaufen, die diese Expedition zurückgelassen hatte, vielleicht die geheimen Eingänge zu anderen Gräbern versperrten. Also beabsichtigte er, den Boden bis zum Fels hinab freizulegen, um sicherzugehen, daß auch nichts übersehen worden war. Und tatsächlich trafen die Männer schon nach knapp drei Tagen Arbeit mit dem Spaten auf die erste Stufe einer Treppe, die in den Stein gehauen war.
(Gähnen Sie schon, werter Leser? Wenn ja, liegt das wahrscheinlich daran, daß Sie nichts von Archäologie verstehen. In den Stein gehauene Stufen im Tal der Könige können nur eins bedeuten – den Eingang zu einem Grab.)
Die Treppe führte in steilem Winkel in den Felsen und war völlig mit Steinen und Schotter zugeschüttet worden. Am folgenden Nachmittag hatten die Männer sie freigelegt und entdeckten den oberen Teil eines Türstocks, der mit schweren Steinplatten blockiert war. In den Mörtel waren die noch unverletzten Siegel der königlichen Totenstadt eingeprägt. Beachten Sie dieses Wort, werter Leser – ein ganz einfaches Wort, das doch von so großer Tragweite ist. Unverletzte Siegel bedeuten, daß das Grab seit dem Tag, an dem es die Priester des Begräbniskults feierlich geschlossen hatten, nicht geöffnet worden war.
Wie alle seine Freunde belegen konnten, war Sir Henry selbst für einen englischen Adeligen ein Mann von besonders phlegmatischem Temperament. Als einziges Zeichen der Erregung murmelte er nur: »potz Blitz«, und dabei strich er sich über den dünnen Bart. Die anderen waren nicht so unterkühlt. Bald erfuhr die Presse von dem Fund, und es wurden Berichte darüber veröffentlicht.
Sir Henry informierte die Antikenverwaltung von seinem Fund; als er zum zweiten Mal die staubigen Stufen hinunterstieg, wurde er von einer illustren Schar von Archäologen und Beamten begleitet. Hastig hatte man einen Zaun errichtet, um die Schaulustigen, Journalisten und Einheimischen abzuhalten, von denen letztere malerisch in lange, flatternde Gewänder und weiße Turbane gekleidet waren. Ein Gesicht fiel besonders auf – das von Mohammed Abd er Rasul, einem der Entdecker des Verstecks der königlichen Mumien, der seinen Fund (und den seines Bruders) an die Behörden verraten hatte. Zur Belohnung hatte er einen Posten bei der Antikenverwaltung bekommen. Augenzeugen berichteten von dem abgrundtiefen Bedauern auf seinem Gesicht und den niedergeschlagenen Blicken der anderen Mitglieder seiner Familie. Die Ausländer hatten ihnen einen Fund unter der Nase weggeschnappt und sie so einer zukünftigen Einnahmequelle beraubt.
Obwohl Sir Henry sich von der Krankheit erholt hatte, die der ursprüngliche Grund für seine Ägyptenreise gewesen war, und sich (wie sein Arzt später berichten sollte) ausgezeichneter Gesundheit erfreute, war er nicht von beeindruckendem Äußeren. Eine Photographie, die an diesem ereignisreichen Tag aufgenommen wurde, zeigt ihn als hochgewachsenen Mann mit gebeugten Schultern, dessen Haar ihm irgendwie vom Kopf gerutscht und etwas willkürlich an Kinn und Wangen hängengeblieben zu sein schien. Der Lord verfügte nicht über das geringste handwerkliche Geschick, und wer ihn besser kannte, trat unauffällig zurück, als er einen Meißel an der steinernen Barrikade ansetzte und mit dem Hammer ausholte. Der britische Konsul kannte ihn nicht. Der erste Gesteinssplitter traf den unglücklichen Herrn mitten auf die Nase. Entschuldigungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen folgten. Dann schickte sich Sir Henry – diesmal inmitten eines großen, entvölkerten Platzes – an, noch einmal zuzuschlagen. Kaum hatte er den Hammer erhoben, als aus der Menge der zusehenden Ägypter ein langgezogenes, klagendes Heulen aufstieg.
Die Bedeutung des Schreis wurde von allen verstanden, die ihn gehört hatten: So betrauern die Anhänger Mohammeds ihre Toten.
Eine Pause entstand. Dann erhob sich wieder die Stimme. Sie rief (selbstverständlich in Übersetzung): »Schändung! Schändung! Der Fluch der Götter soll auf den fallen, der die ewige Ruhe des Königs stört!«
Erschreckt von dieser Drohung, verfehlte Sir Henry den Meißel und schlug sich auf den Daumen. Ein solches Mißgeschick trägt nicht eben dazu bei, die Laune zu heben, und man kann Sir Henry nachsehen, daß er die Geduld verlor. Mit ärgerlicher Stimme befahl er Armadale, der hinter ihm stand, den Unglücksboten zu ergreifen und ihm eine ordentliche Tracht Prügel zu verabreichen. Armadale war zwar willig, doch als er sich der Menge näherte, verstummte der Prophet klugerweise und war deshalb nicht mehr auszumachen, denn seine Freunde leugneten alle, etwas über seine Identität zu wissen.
Es war ein unwichtiges Ereignis, das alle – abgesehen von Sir Henry, dessen Daumen ziemlich beschädigt war – rasch vergaßen. Wenigstens gab ihm die Verletzung einen Vorwand, die Werkzeuge an jemanden zu übergeben, der sie erfolgversprechender einsetzen konnte. Mr. Alan Armadale, ein junger, kräftiger Mann, griff sich die Gerätschaften. Mit einigen geschickten Schlägen hatte er eine Öffnung gebrochen, die groß genug war, daß Tageslicht hineindringen konnte. Dann trat Armadale respektvoll zurück, um seinem Gönner die Ehre des ersten Blicks zu überlassen.
Für Sir Henry war es ein Tag voller Mißgeschicke. Er griff nach einer Kerze und fuhr aufgeregt mit dem Arm durch das klaffende Loch. Aber seine Faust traf mit solcher Wucht auf eine harte Oberfläche, daß er die Kerze fallen ließ und die Hand zurückzog, die erhebliche Abschürfungen davongetragen hatte.
Weitere Untersuchungen ergaben, daß der Raum hinter der Tür mit Gesteinsbrocken zugeschüttet worden war. Das war nicht überraschend, da die Ägypter häufig zu dieser Methode griffen, um Grabräuber abzuschrecken. Die Zuschauer zerstreuten sich enttäuscht und ließen Sir Henry mit der Aufgabe zurück, seine geschundenen Fingerknöchel zu verarzten und über eine langwierige und ermüdende Arbeit nachzudenken. Wenn dieses Grab nach den gleichen Plänen angelegt war wie die bereits bekannten, würde man einen Gang von unbestimmter Länge freiräumen müssen, ehe man die Grabkammer erreichte. In manchen dieser Gräber war der Gang mehr als dreißig Meter lang.
Trotzdem ließ die Tatsache, daß der Gang versperrt war, den Fund noch vielversprechender erscheinen. Die Times widmete dem Bericht eine volle Spalte auf Seite drei. Allerdings machte die nächste Meldung aus Luxor Schlagzeilen auf der Titelseite.
Sir Henry Baskerville war tot. Er hatte sich (abgesehen von seinem Daumen und seinen Fingerknöcheln) in bester Gesundheit schlafen gelegt. Am nächsten Morgen hatte man ihn stocksteif im Bett gefunden. Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck grauenhafter Todesangst, und auf seiner hohen Stirn war mit einer Substanz, die zuerst wie getrocknetes Blut aussah, mit ungeschickter Hand eine Kobra aufgemalt, das Symbol des göttlichen Pharaos.
Das »Blut« entpuppte sich als rote Farbe. Aber trotzdem erregte diese Nachricht großes Aufsehen, das sich noch steigerte, als eine medizinische Untersuchung die Ursache für Sir Henrys Tod nicht ermitteln konnte.
Fälle, in denen scheinbar gesunde Menschen dem plötzlichen Versagen lebenswichtiger Organe erliegen, sind nicht unbekannt. Und anders als in Kriminalromanen sind sie nicht immer auf die Verabreichung geheimnisvoller Gifte zurückzuführen. Wenn Sir Henry in seinem Bett in Baskerville Hall gestorben wäre, hätten die Ärzte ihre Bärte gezwirbelt und ihr Unwissen hinter bedeutungslosem medizinischem Fachchinesisch verborgen. Selbst unter diesen Umständen wäre die Geschichte (ebenso wie angeblich auch Sir Henry) eines natürlichen Todes gestorben, wenn sich nicht ein umtriebiger Reporter einer der weniger angesehenen Zeitungen an den Fluch des unbekannten Pharaos erinnert hätte. Der Artikel in der Times entsprach dem, was man von einer niveauvollen Zeitung erwartet, doch die anderen Blätter waren weniger zurückhaltend. In ihren Spalten wimmelte es von Anspielungen auf Rachegeister, geheimnisvolle alte Flüche und heidnische Riten. Doch sogar diese Sensation verblaßte, als sich zwei Tage später herausstellte, daß Mr. Alan Armadale, Sir Henrys Assistent, verschwunden war – vom Erdboden verschluckt, wie der Daily Yell es ausdrückte.
Inzwischen riß ich Emerson jeden Abend, wenn er nach Hause kam, die Zeitung aus der Hand. Selbstverständlich glaubte ich nicht eine Minute lang an die absurden Geschichten über Flüche und Unheil aus übernatürlicher Quelle. Und als bekannt wurde, daß der junge Armadale verschwunden war, meinte ich, die Lösung des Rätsels gefunden zu haben.
»Armadale ist der Mörder!« rief ich Emerson zu, der gerade auf allen vieren mit Ramses »Pferdchen, lauf Galopp!« spielte.
Emerson stöhnte auf, als sich die Fersen seines Sohnes in seine Rippen bohrten. Nachdem er wieder Atem geschöpft hatte, meinte er ärgerlich: »Warum redest du so selbstverständlich von Mord? Es hat nie einen Mord gegeben. Baskerville ist an einem Herzanfall oder etwas Ähnlichem gestorben; er war schon immer recht schwächlich. Und Armadale spült seine Sorgen wahrscheinlich in irgendeinem Wirtshaus herunter. Er hat seine Stellung verloren und wird so spät im Jahr wahrscheinlich keinen neuen Auftraggeber finden.«
Auf diese lächerliche Äußerung gab ich keine Antwort. Die Zeit, so wußte ich, würde mir recht geben, und bis dahin sah ich keinen Sinn darin, meine Kraft an Streitereien mit Emerson zu verschwenden, der der starrsinnigste Mann ist, den ich kenne.
In der folgenden Woche erlitt einer der Herren, die bei der offiziellen Öffnung des Grabs dabei gewesen waren, einen schweren Fieberanfall, und ein Arbeiter in Karnak fiel von einem Pylon und brach sich das Genick. »Der Fluch ist immer noch wirksam«, verkündete der Daily Yell. »Wer wird der nächste sein?«
Nach dem Dahinscheiden des Mannes, der vom Pylon gefallen war (wo er ein Ornament abmeißeln wollte, um es an einen der illegalen Antiquitätenhändler zu verkaufen), weigerten sich seine Kollegen, sich dem Grab zu nähern. Nach Sir Henrys Tod waren die Arbeiten zum Stillstand gekommen, und inzwischen bestand anscheinend keine Aussicht, sie wieder aufzunehmen.
Das war der Stand der Dinge am Nachmittag meiner verhängnisvollen Teeparty. In den letzten Tagen war es ruhig um den Fall Baskerville geworden, obwohl sich der Daily Yell die größte Mühe gab, die Geschichte am Leben zu erhalten, indem er jeden Niednagel und jeden angeschlagenen Zeh auf den Fluch zurückführte. Vom unglücklichen (oder schuldigen) Armadale gab es keine Spur. Sir Henry hatte man neben seine Vorfahren zur letzten Ruhe gebettet; und das Grab blieb verschlossen und verriegelt.
Ich muß zugeben, daß ich mir vor allem um das Grab Gedanken machte. Schlösser und Riegel waren zwar schön und gut, aber sie würden beide den Meisterdieben aus Gurneh nicht lange standhalten können. Die Entdeckung des Grabs hatte dem Berufsethos dieser Herren, die sich bei der Entdeckung der Gräber ihrer Ahnen mehr zutrauten als den ausländischen Archäologen, einen schweren Schlag versetzt. Im Laufe der Jahrhunderte hatten sie sich als wirklich außergewöhnlich geschickt in ihrem zweifelhaften Handwerk erwiesen. Ob der Grund dafür in der Übung oder im Erbgut liegt, vermag ich nicht zu sagen. Doch nun, da das Grab entdeckt worden war, würden sie sich bald an die Arbeit machen.
Also schlug ich, während Emerson mit Ramses zoologische Streitgespräche führte und Graupelschauer gegen die Fenster prasselten, die Zeitung auf. Seit der Fall Baskerville seinen Anfang genommen hatte, kaufte Emerson außer der Times auch noch den Yell, wobei er bemerkte, daß der Kontrast der beiden journalistischen Stilrichtungen eine faszinierende Studie der menschlichen Natur darstelle. Doch das war nur eine Ausrede. Der Yell war viel unterhaltsamer zu lesen. Deshalb wandte ich mich sofort dieser Zeitung zu und stellte anhand gewisser Knitterfalten fest, daß ich nicht die erste war, die sich diesen ganz bestimmten Artikel zu Gemüte führte. Er trug den Titel: »Lady Baskerville schwört, daß die Arbeiten weitergehen werden.«
Der Journalist – »Unser Korrespondent in Luxor« – schrieb mit bemerkenswertem Einfühlungsvermögen und vielen Adjektiven über die »zarten Lippen« der Dame, die »sich wie Amors Bogen schwingen und beim Sprechen gefühlvoll zittern« und ihr »rosiges Gesicht, auf dem die enge Bekanntschaft mit dem Leid ihre Spuren hinterlassen hat«.
»Pah«, sagte ich, nachdem ich einige Absätze gelesen hatte. »Was für ein Unsinn. Emerson, ich muß sagen, daß diese Lady Baskerville wie eine vollkommene Idiotin klingt. Hör dir das mal an: ›Ich kann mir kein passenderes Denkmal für meinen verlorenen Liebsten denken als die Fortführung der großen Sache, für die er sein Leben gegeben hat.‹ Verlorener Liebster, Ha!«
Emerson gab keine Antwort. Er kauerte mit Ramses zwischen den Knien auf dem Boden, blätterte in einem riesigen, bebilderten Zoologiebuch und versuchte den Jungen davon zu überzeugen, daß sein Knochen nicht von einem Zebra stammen konnte. Denn Ramses hatte sich von Giraffen auf ein etwas weniger exotisches Tier verlegt. Leider besteht zwischen einem Zebra und einem Pferd kein großer Unterschied, und die Abbildung, die Emerson fand, wies eine große Ähnlichkeit mit Ramses’ Knochen auf. Das Kind stieß ein schadenfrohes Kichern aus und bemerkte: »Ich hatte recht, fiehft du? Ef ift ein Febra.«
»Iß noch einen Keks«, meinte sein Vater.
»Armadale wird immer noch vermißt«, fuhr ich fort. »Ich sagte doch, er ist der Mörder.«
»Pah«, entgegnete Emerson. »Irgendwann taucht er schon wieder auf. Es hat kein Mord stattgefunden.«
»Du glaubst doch nicht etwa, daß er sich schon seit zwei Wochen betrinkt?« widersprach ich.
»Ich kannte Männer, die sich über viel längere Zeiträume hinweg betrunken haben«, sagte Emerson.
»Wenn Armadale etwas zugestoßen ist, hätte man ihn oder seine sterblichen Überreste inzwischen gefunden. Die Umgebung von Theben ist durchgekämmt worden ...«
»Es ist unmöglich, die Berge im Westen gründlich abzusuchen«, fuhr Emerson mich an. »Du weißt, wie es dort aussieht – schartige Felsvorsprünge, die von Hunderten von Flußbetten und Schluchten durchschnitten werden.«
»Dann glaubst du, daß er irgendwo da draußen ist?«
»Ja. Sicherlich wäre es ein tragischer Zufall, wenn ihm so kurz nach Sir Henrys Tod etwas zugestoßen sein sollte, die Zeitungen würden bestimmt ein neues Geheul anstimmen und etwas über Flüche faseln. Aber solche Zufälle passieren eben, besonders wenn ein Mann verwirrt ...«
»Wahrscheinlich ist er inzwischen in Algerien«, sagte ich.
»Algerien! Warum dort, um Himmels willen?«
»Die Fremdenlegion. Es heißt, dort wimmelt es von Mördern und anderen Verbrechern, die versuchen, sich dem Gesetz zu entziehen.«
Emerson stand auf. Erfreut stellte ich fest, daß der melancholische Blick aus seinen Augen verschwunden war. Nun blitzten sie zornig. Außerdem bemerkte ich, daß er in den vier Jahren relativer Untätigkeit nichts von seiner Körperkraft und Energie verloren hatte. Um mit dem Jungen zu spielen, hatte er die Jacke und den gestärkten Kragen abgelegt, und wie er so zerzaust vor mir stand, erinnerte er mich unwiderstehlich an das ungepflegte Wesen, das damals mein Herz erobert hatte. Ich beschloß, daß wir noch Zeit hatten, ehe wir uns zum Essen umziehen mußten, wenn wir sofort nach oben gingen ...
»Es ist Zeit zum Schlafengehen, Ramses; das Kinderfräulein wartet schon«, sagte ich. »Du kannst ein Törtchen mitnehmen.«
Ramses bedachte mich mit einem langen, nachdenklichen Blick. Dann wandte er sich seinem Vater zu, der sehnsüchtig sagte: »Geh nur, mein Junge. Papa liest dir noch ein Kapitel aus seiner Geschichte Ägyptens vor, wenn du zugedeckt im Bettchen liegst.«
»In Ordnung«, meinte Ramses. Er nickte mir auf eine Art zu, die mich an die königliche Herablassung seines Namenspatrons erinnerte. »Kommft du Gutenacht fagen, Mama?«
»Das tue ich doch immer«, antwortete ich.
Nachdem er das Zimmer verlassen hatte, wobei er nicht nur das Törtchen, sondern auch das Zoologiebuch mitnahm, fing Emerson an, im Zimmer auf und ab zu laufen.
»Ich nehme an, du möchtest noch eine Tasse Tee«, sagte ich.
Was ich in Wirklichkeit annahm, war, daß er den Tee ablehnen würde, weil ich ihn vorgeschlagen hatte. Wie alle Männer ist Emerson sehr empfänglich für die simplen Formen der Manipulation. Doch stattdessen sagte er brummig: »Ich will einen Whiskey Soda.«
Emerson trinkt selten. Ich versuchte, meine Besorgnis zu verbergen. »Ist etwas nicht in Ordnung?« fragte ich.
»Nicht etwas. Alles. Du weißt es, Amelia.«
»Waren deine Studenten heute besonders schwer von Begriff?«
»Überhaupt nicht. Es wäre unmöglich für sie, noch vernagelter zu sein als sonst. Wahrscheinlich sind es die Zeitungsberichte über Luxor, die mich unruhig machen.«
»Ich verstehe.«
»Selbstverständlich verstehst du. Dir geht es doch genauso – du leidest sogar mehr als ich, denn ich kann mich wenigstens noch am Rande des Berufes bewegen, den wir beide lieben. Ich fühle mich wie ein Kind, das die Nase am Schaufenster eines Spielwarengeschäfts plattdrückt, aber du darfst nicht einmal am Laden vorbeigehen.«
Dieser Gefühlsausbruch war so pathetisch und unterschied sich derart von Emersons gewöhnlicher Art zu sprechen, daß ich mich nur mit Mühe zurückhalten konnte, ihn zu umarmen. Aber er wollte kein Mitleid. Er wollte eine Erlösung von seiner Langeweile, und die konnte ich ihm nicht bieten. Mit einiger Verbitterung sagte ich: »Und mir ist es nicht gelungen, dir wenigstens einen kleinen Ersatz für deine geliebten Ausgrabungen zu schaffen. Nach dem heutigen Tage wird Lady Harold uns mit der größten Genugtuung jede Bitte abschlagen. Es ist mein Fehler; ich habe die Geduld verloren.«
»Unsinn, Peabody«, knurrte Emerson. »Es ist unmöglich, jemanden, der so unbeschreiblich dumm ist wie diese Frau und ihr Ehemann, zu beeindrucken. Ich habe dir gesagt, du sollst es lassen.«
Diese anrührenden und großherzigen Worte ließen mir die Tränen in die Augen treten. Emerson, der meine Aufgewühltheit bemerkte, fügte hinzu: »Am besten suchen wir gemeinsam Trost im Alkohol. Im Allgemeinen bin ich nicht dafür, meine Sorgen zu ertränken, doch der heutige Tag war für uns beide eine schwere Prüfung.«
Als ich das Glas entgegennahm, das er mir hinhielt, fiel mir ein, wie sehr dieser weitere Beweis meiner unweiblichen Gewohnheiten Lady Harold wohl schockiert hätte. Aber es ist nun einmal Tatsache, daß ich Sherry verabscheue und Whiskey Soda gerne trinke.
Emerson hob sein Glas. Seine Mundwinkel verzogen sich zu einem zynischen Lächeln. »Prost, Peabody. Wir werden es überstehen, wie wir auch andere Schwierigkeiten überstanden haben.«
»Ganz sicher. Prost, mein lieber Emerson.«
Feierlich, fast wie bei einer Zeremonie, nahmen wir einen Schluck.
»Noch ein oder zwei Jahre«, sagte ich. »Dann können wir vielleicht daran denken, Ramses mitzunehmen. Er ist erschreckend gesund. Manchmal habe ich das Gefühl, es wäre fast unlauterer Wettbewerb, unseren Sohn gegen die Flöhe und Moskitos Ägyptens antreten zu lassen.«
Doch dieser Versuch, die Dinge mit Humor zu nehmen, brachte mir kein Lächeln meines Mannes ein. Er schüttelte den Kopf. »Wir dürfen es nicht riskieren.«
»Nun, aber der Junge muß irgendwann in die Schule.«
»Ich sehe nicht ein, warum. Von uns bekommt er mehr Bildung, als er sich von diesen fegefeuerähnlichen Pesthöhlen, die sich höhere Bildungsanstalten schimpfen, nur erhoffen könnte. Du weißt, was ich von solchen Einrichtungen halte.«
»Aber es muß doch in diesem Land auch ein paar anständige Schulen geben.«
»Pah!« Emerson trank den Rest seines Whiskeys. »Genug von diesem deprimierenden Thema. Was hältst du davon, wenn wir nach oben gehen und ...«
Er streckte die Hand nach mir aus. Ich wollte sie schon ergreifen, als die Tür aufging und Wilkins erschien. Wenn man Emerson in einer romantischen Stimmung stört, reagiert er sehr ungehalten. Er drehte sich zu unserem Butler um und brüllte: »Verdammt, Wilkins, wie können Sie es wagen, einfach so hereinzuplatzen? Was ist denn?«
Keiner unserer Dienstboten läßt sich von Emerson einschüchtern. Diejenigen, die sein Gebrüll und seine Tobsuchtsanfälle in den ersten Wochen überstehen, lernen, daß er eigentlich ein sehr gutmütiger Mann ist. »Verzeihen Sie, Sir«, antwortete Wilkins ruhig. »Aber eine Dame möchte Sie und Mrs. Emerson sprechen.«
»Eine Dame?« Wie immer, wenn er verblüfft ist, befingerte Emerson das Grübchen an seinem Kinn. »Wer zum Teufel kann das sein?«
Ein verrückter Gedanke huschte mir durch den Kopf. War Lady Harold zurückgekehrt, um Rache zu nehmen? Stand sie etwa mit einem Korb voller fauler Eier oder einer Schüssel Schlamm bewaffnet in der Vorhalle? Aber das war absurd. Sie hatte zu wenig Phantasie, um sich so etwas auszudenken.
»Wo ist die Dame?« fragte ich.
»Sie wartet in der Vorhalle, Madam. Ich wollte sie in den kleinen Salon führen, aber ...«
Mit einem leichten Achselzucken und hochgezogenen Augenbrauen beendete Wilkins seinen Satz. Die Dame hatte sich also nicht in den Salon führen lassen. Das hieß, daß sie ein dringendes Anliegen hatte, und es machte auch meine Aussicht zunichte, rasch nach oben zu schlüpfen, um mich umzukleiden.
»Führen Sie sie bitte herein, Wilkins«, sagte ich.
Das Anliegen der Dame war sogar noch dringender, als ich erwartet hatte. Wilkins hatte kaum Zeit, ihr den Weg freizumachen, so rasch stand sie im Zimmer. Sie kam bereits auf uns zu, als er sie etwas verspätet vorstellte: »Lady Baskerville.«
Kapitel 2
Mir war, als hörte ich diese Worte übernatürlich laut. Diese unerwartete Besucherin zu sehen, gerade, als ich an sie gedacht und von ihr gesprochen hatte (und das nicht sehr freundlich), erweckte in mir das Gefühl, als sei die Gestalt, die nun vor uns stand, keine wirkliche Frau, sondern die Vision eines verwirrten Geistes.