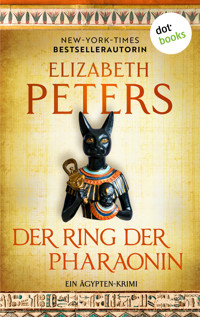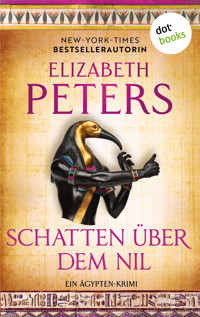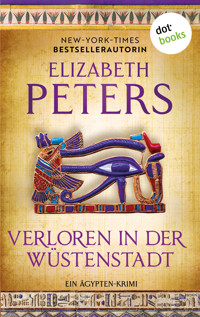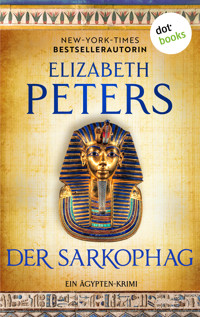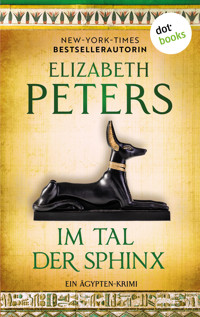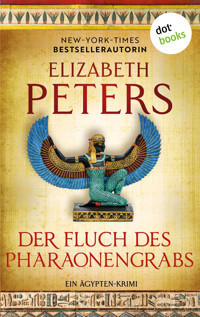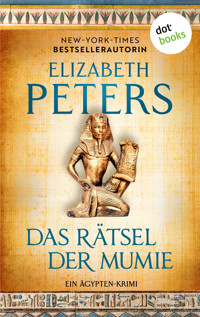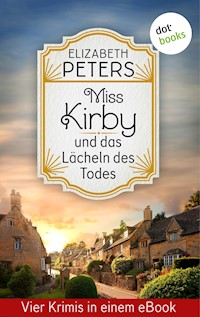6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Vicky Bliss
- Sprache: Deutsch
Die Spur führt zurück ins Dunkel der Vergangenheit: Der Kriminalroman »Vicky Bliss und der versunkene Schatz« von Elizabeth Peters als eBook bei dotbooks. Ein blutverschmierter Brief ohne Absender – Kunstexpertin Vicky Bliss weiß, sie sollte besser die Finger davon lassen … aber diese schreckliche Neugier! Tatsächlich hat es der Umschlag in sich: Vicky findet darin das Foto einer jungen Frau, erst vor kurzem aufgenommen, als Schmuck trägt sie einen Teil des sagenhaften Schliemann-Schatzes erkennt. Aber ist das kostbare Juwelendiadem aus dem alten Troja nicht angeblich seit Jahrzehnten verschollen? Vicky muss dieser heißen Spur unbedingt folgen – doch schon bald kommt ihr der Verdacht, dass sie nur eine Spielfigur in einem perfiden Plan ist … »Niemand ist besser darin, mit brennenden Fackeln zu jonglieren, während sie auf einem hohen Drahtseil tanzt als Elizabeth Peters.« Chicago Tribune Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Krimi-Highlight »Vicky Bliss und der versunkene Schatz« von Elizabeth Peters – Band 4 der Bestseller-Reihe um die Kunsthistorikerin mit dem Gespür für mörderische Fälle. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein blutverschmierter Brief ohne Absender – Kunstexpertin Vicky Bliss weiß, sie sollte besser die Finger davon lassen … aber diese schreckliche Neugier! Tatsächlich hat es der Umschlag in sich: Vicky findet darin das Foto einer jungen Frau, erst vor kurzem aufgenommen, als Schmuck trägt sie einen Teil des sagenhaften Schliemann-Schatzes erkennt. Aber ist das kostbare Juwelendiadem aus dem alten Troja nicht angeblich seit Jahrzehnten verschollen? Vicky muss dieser heißen Spur unbedingt folgen – doch schon bald kommt ihr der Verdacht, dass sie nur eine Spielfigur in einem perfiden Plan ist …
»Niemand ist besser darin, mit brennenden Fackeln zu jonglieren, während sie auf einem hohen Drahtseil tanzt als Elizabeth Peters.« Chicago Tribune
Über die Autorin:
Hinter der US-amerikanischen Bestsellerautorin Elizabeth Peters steht Barbara Louise Gross Mertz (1927–2013), die auch unter dem Pseudonym Barbara Michaels erfolgreich Krimis und Thriller schrieb. Die Autorin promovierte an der University of Chicago in Ägyptologie. So haben auch ihre über 20 Kriminalromane, für die sie zahlreiche Preise gewann, meist einen historischen Hintergrund.
Die Krimireihe um Vicky Bliss bei dotbooks umfasst: »Vicky Bliss und der geheimnisvolle Schrein – Der erste Fall« »Vicky Bliss und die Straße der fünf Monde – Der zweite Fall« »Vicky Bliss und der blutrote Schatten – Der dritte Fall« »Vicky Bliss und der versunkene Schatz – Der vierte Fall« »Vicky Bliss und die Hand des Pharaos – Der fünfte Fall«
Ebenfalls bei dotbooks erscheint die Krimireihe um die abgebrühte Meisterdetektivin Jacqueline Kirby: »Der siebte Sünder: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 1« »Der letzte Maskenball: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 2« »Ein preisgekrönter Mord: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 3« »Ein todsicherer Bestseller: Ein Fall für Jacqueline Kirby – Band 4«
Unter dem Pseudonym Barbara Michaels veröffentlichte sie bei dotbooks die folgenden Romantic-Suspense-Romane:»Das Geheimnis von Marshall Manor«»Die Villa der Schatten«»Das Geheimnis der Juwelenvilla«»Die Frauen von Maidenwood«»Das dunkle Herz der Villa«»Das Haus des Schweigens«»Das Geheimnis von Tregella Castle«»Die Töchter von King’s Island«
Sowie ihre historischen Liebesromane: »Abbey Manor – Gefangene der Liebe«»Wilde Manor – Im Sturm der Zeit«»Villa Tarconti – Lied der Leidenschaft«»Grayhaven Manor – Das Leuchten der Sehnsucht«
***
eBook-Neuausgabe Januar 2019
Dieses Buch erschien bereits 2002 unter dem Titel »Der versunkene Schatz« bei Econ.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1987 by Elizabeth Peters
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel »Trojan Gold«.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Published by Arrangement with BARBARA G. MERTZ REVOCABLE TRUST
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildabbildung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock Evannovostro / faestock / StaniG / Kokorina Mariia / Serg64 / Vadym Lavra / protasov AN
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-281-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Vicky Bliss und der versunkene Schatz« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Elizabeth Peters
Vicky Bliss und der versunkene Schatz
Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Egon Eis
dotbooks.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Lesetipps
Kapitel 1
Feuer.
Feuer auf den Dächern. Feuer über den Dächern. Feuer fällt vom Himmel.
Die Nacht wird strahlend hell. Gleißendes Weiß blendet die sterbende Stadt. Häuser stürzen ein. Menschen – tot und verwundet – liegen auf den Straßen, säumen die Fahrbahnen, bedecken das Pflaster.
Als er sich seinen Weg durch das Inferno bahnt, entgeht er nicht einmal, sondern ein dutzendmal dem Tod um einen Zollbreit.
Die Russen hatten bereits die Vorstädte erreicht. Doch obwohl auch vom Westen eine feindliche Armee anrückte, drängte die Menge der Flüchtenden ausschließlich in diese Richtung.
Seit jeher waren die Barbaren stets aus dem Osten gekommen, Hunnen, Awaren, Türken.
Die Menschen liefen um ihr Leben. Er nicht.
Sein eigenes Leben galt ihm nicht soviel wie das, was er in Sicherheit bringen wollte.
Die Stadt war verloren, und was in ihr verblieb, würde den letzten Zuckungen des Krieges weiter zum Opfer fallen. Alte Männer, Frauen, Kinder. Die Zerstörung machte auch vor Kunstwerken nicht halt. Unter den Trümmern würden unschätzbare Statuen bersten, Bilder von alten Meistern in Flammen aufgehen. Doch einen Schatz würde er retten.
Wie er das anstellen könnte, wußte er nicht. Doch er zweifelte nicht an seinem Erfolg. In dieser Stadt war er zu Hause, und wenn sich auch zwischen Häuserruinen und brennenden Straßen alle Orientierungspunkte verloren, war er sicher, den richtigen Weg finden zu können. Er würde rechtzeitig den äußeren Ring erreichen, heil durchkommen zwischen der Masse der Besiegten und der Horde der Eroberer.
War das, was er sich vorgenommen hatte, die fixe Idee eines Wahnsinnigen? Doch vielleicht konnte nur ein Verrückter das Wagnis auf sich nehmen.
Kapitel 2
... so würde ich die Niederschrift beginnen, ich würde einen Thriller schreiben und nicht eine einfache Folge von Ereignissen aufzeichnen. Wie ihm sein Unterfangen gelang, werden wir nie erfahren. Daher muß ich darauf verzichten, den Anfang der Geschichte chronologisch zu beginnen und von dem Mann zu berichten, der der brennenden Metropole zu entkommen versuchte, und wie er es anstellte.
Sicher ist nur, daß es ihm gelang.
Soweit sie mich betrifft, beginnt die Geschichte viele Jahre später und ziemlich banal: Mit einem Streit mit der Sekretärin meines Chefs.
Meistens gehe ich ziemlich gutgelaunt an meine Arbeit. Doch an diesem Montagmorgen war es anders. Ich hatte – gegen meine Gewohnheit – in der Nacht zuvor zu viel getrunken. Mein Schädel brummte, ich kam später als üblich an meinen Arbeitsplatz. Normalerweise wäre ich schweigend darüber hinweggegangen, als ich sah, was Gerda angerichtet hatte. Doch nicht an diesem Montag. Ich reagierte gereizt.
Gerda ist, wie ich schon erwähnte, die Sekretärin meines Chefs. Dieser gewichtige Mann ist Dr. Joachim Z. Schmidt, Direktor der Gräfenstein-Sammlung. Die ›Gräfe‹, wie wir sie kurz zu nennen pflegen, ist nicht besonders groß, aber exquisit. Es gibt in München eine Menge größerer Galerien, aber kaum eine mit so erlesenen Ausstellungsstücken in relativ kleinem Rahmen. Sie befindet sich in einem Palais des 18. Jahrhunderts, das der spätere Besitzer, ein bayerischer Aristokrat, der Stadt vermacht hat. Wir verfügen über eine seltene Sammlung antiken Spielzeugs, über einen großen Saal mit mittelalterlichen Kunstwerken und einen kleineren mit Gemmen. Ein Baron von Gräfenstein hat zudem einer seltsamen Laune nachgegeben und Damenunterwäsche gesammelt, aber diese Kollektion ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich und nur für Studenten der Kostümkunde einzusehen.
Unser Personalbestand ist ziemlich bescheiden. Obwohl Gerda offiziell nur dem Direktor unterstellt ist, muß sie praktisch die gesamte Schreibarbeit erledigen. Das macht ihr nichts aus, sie ist unheimlich arbeitsam. Aber auch – wie viele tüchtige Frauen – eine Wichtigtuerin. Sie ist neugierig und kümmert sich um Angelegenheiten, die sie nichts angehen. In Bayern nennt man das ›gschaftlhuberisch‹.
Ich muß zugeben, daß mein Schreibtisch selten aufgeräumt ist und nie ordentlich aussieht. Doch meine Schlamperei hat eine gewisse Methode, und es gelingt mir immer, das, was ich suche, sofort zu finden. Das kann Gerda, auf deren Schreibtischplatte die gespitzten Bleistifte wie zur Parade ausgerichtet sind, nicht verstehen. Kein Wunder, daß sie mein Zuspätkommen ausgenützt hatte, um richtig Ordnung zu schaffen, obschon ich ihr das wiederholt verboten hatte. Meine Notizen waren zu einem sauberen Haufen gestapelt, mein altes Löschpapier, auf das ich unzählige Telefonnummern gekritzelt hatte, von einem neuen ersetzt, das in makellosem Weiß erstrahlte und keinerlei Informationen enthielt. Meine Post war sauber geordnet und in der geometrischen Mitte der Schreibtischplatte platziert. Ich hatte gute Laune, Gerda zu erwürgen, doch ich beschloß, zuerst einen Kaffee zu trinken, um nicht zornig die Treppe hinunterzulaufen und mir einen Fuß zu brechen, ehe ich die Finger um ihre Gurgel legen konnte. Also schaltete ich den elektrischen Kocher ein und sah die Post durch.
Nichts Besonderes. Einladungen, Prospekte von akademischen Verlagen, Briefe von Studenten, die in der ›Gräfe‹ fotografieren wollten und um entsprechende Erlaubnis baten. Als letztes unter dem Stapel lag ein größerer brauner Umschlag. Unbeschrieben. Weder der Name des Museums noch mein eigener war zu lesen. Ich entnahm ihm eine Fotografie, die auf ein Stück Pappe aufgeklebt war.
Sie war schwarzweiß und etwas unscharf, was eine Amateur-Aufnahme vermuten ließ. Ich starrte auf das Bild, und eine vage Erinnerung wurde in mir wach. Doch mein alkoholisiertes Gehirn registrierte nicht, wo ich diese Fotografie schon einmal gesehen hatte. Aber ich wußte, daß das der Fall war.
Das Bild stellte eine Frau dar. Eine Frau in reifen Jahren, weder schön noch häßlich. Es hätte eine beliebige alternde Hausfrau sein können, wenn nicht der Schmuck gewesen wäre. Ein eingefaßtes Diadem, mehrere Zoll breit, umrahmte ihre Stirn. Metallene Schnüre und Ketten hingen an ihm herab. Schwere Ohrringe baumelten an den Ohrläppchen. Und das Oberteil des schwarzen Kleides war von mehreren Reihen solider Halsbänder verhangen, die aus Gold oder Silber zu sein schienen.
Das Foto ließ sich unschwer von der Unterlage ablösen. Doch auch die Rückseite bot keine neuen Erkenntnisse. Sie war glatt und unbeschrieben und trug keinen Stempel oder sonstiges Merkmal des Fotografen. Die etwas verhärmten Züge der Frau ließen auf eine alternde Sängerin schließen, denn der übertriebene Behang mit wahrscheinlich falschem Schmuck deutete auf eine exotische Oper wie Lakmé oder Aida.
Warum aber sollte mir jemand das Bild einer abgetakelten Opernsängerin schicken?
Der Kaffee tat schließlich seine Wirkung. Ich fand genügend Kraft, mich von meinem Stuhl zu erheben. Es wartete zwar ziemlich viel Arbeit auf mich, aber es erschien mir vordringlich, Gerda zu erwürgen.
Mein Büro liegt ziemlich hoch, in einem der Türmchen, die unser Palais schmücken. Ich habe es hauptsächlich wegen der schönen Aussicht gewählt; durch das breite Fenster kann man die Zwiebeltürme der Frauenkirche sehen und bei klarem Wetter die hundert Kilometer entfernte Alpenkette. Ein anderer Grund ist die Abgeschiedenheit. Nur wer mich dringend sehen will, entschließt sich, die steile Treppe hochzusteigen. Was mich betrifft, rede ich mir ein, Treppensteigen sei gut für die Linie.
Das Büro des Direktors befindet sich im zweiten Stock, trotzdem mußte ich bis zur Halle hinuntergehen, denn die einzelnen Treppen sind untereinander nicht verbunden. Und dann nochmals zwei Stockwerke hoch. Ich war ziemlich geladen, als ich das Vorzimmer, Gerdas Herrschaftsbereich, erreichte.
Sie hatte mich erwartet. Sie hämmerte auf ihre Schreibmaschine ein und tat, als hätte sie mich nicht bemerkt, obwohl ich durch das Zimmer stampfte. Als ich ihre Bluse sah, war ich noch mehr verärgert, denn es war eine Kopie der Bluse, die ich vergangene Woche getragen hatte.
Eigentlich sollte es mir schmeicheln, daß Gerda aussehen wollte wie ich, aber das kann nicht klappen, denn wir beide sind zu verschieden. Sie ist klein und zierlich und dunkel und ich blond und einsfünfundsiebzig groß.
Welche Frau bei klaren Sinnen könnte es wünschen, so groß zu sein? Wie kann man mit koketter Schüchternheit zu einem Mann aufschauen, wenn er bestenfalls gleich groß ist, aber meistens kleiner. Mit einer Heugabel in der Hand würde ich aussehen wie eine Bäuerin, mit einem Speer wie eine unterernährte Walküre. Ich würde gerne niedlich sein wie sie, sie eine Bohnenstange wie ich.
Ich schlug mit der Fotografie auf die Kante ihres Schreibtisches. Es klang wie ein Schuß, und Gerda sprang auf.
»Warum hast du meine Post aufgemacht«, brüllte ich. »Wie oft hab' ich dir schon gesagt, du sollst das nicht tun.«
Die deutsche Sprache eignet sich besonders gut dazu, seinem Zorn freien Lauf zu lassen. Gerda, wenn sie sich verteidigte, spricht in ihrem Schulenglisch zu mir.
»Es ist meine Pflicht, als erstes die Post durchzusehen. Ich muß doch feststellen, welche Briefe an den Direktor gehen, welche an die Verwaltung oder an die einzelnen Abteilungen ...«
So schrien wir eine Weile aufeinander ein, in einem wunderlichen Sprachgemisch. Dabei war das Ganze ziemlich sinnlos. Alle Angestellten kannten Gerdas Gewohnheiten und ihre Beharrlichkeit, und keiner von uns ließ persönliche Post ins Museum kommen. Die Szene wurde durch den Direktor unterbrochen, der aus seinem Büro kam und unserem Gebell seinen Baß hinzufügte.
»Ist das hier ein Tierpark oder ein Kunstinstitut? Kann man sich denn konzentrieren, wenn zwei Furien aufeinander losgehen? Worum geht es überhaupt?«
»Das wissen Sie doch sehr gut, Herr Direktor«, sagte ich schnell. »Selbst wenn Sie nicht an der Tür gelauscht haben. Unsere Stimmen hätten auch eine Panzertür durchdrungen.«
Dr. Schmidt zwirbelte an seinem Schnurrbart. Er ließ ihn kräftig wachsen, wahrscheinlich um den Mangel an Haar auf seinem Kopf zu kompensieren. Vielleicht war Fu-Manchu sein Vorbild, denn er hatte eine Vorliebe für Sensationsliteratur. Er war nicht viel größer als Gerda, und mit seinem Bäuchlein und seinen rosigen Wangen glich er einem liebenswürdigen Gartenzwerg.
»Also die Post! Wieder einmal die verdammte Post!« Er wandte sich herausfordernd an mich. »Ein Brief von einem Ihrer Verehrer, Miß Bliss?«
Er versuchte einen Blick auf das Foto in meiner Hand zu erhaschen. Ich gab es ihm bereitwillig.
»Ich muß Sie leider enttäuschen, Schmidt.« Wenn es nicht um dienstliche Dinge geht, darf ich auf eine formelle Anrede verzichten. »Glühende Liebesbriefe erreichen mich an meiner Privatadresse. Ich habe keine Ahnung, von wem dieses Schreiben stammt, weil Gerda den äußeren Umschlag weggenommen hat. Und auch das Begleitschreiben, falls ein solches beigelegen hat.«
Schmidt betrachtete nachdenklich die Fotografie. »Wo habe ich dieses Gesicht schon gesehen?«
»Konzentrieren Sie sich lieber auf den Schmuck«, riet ich. »Sieht aus wie Theaterschmuck. Kaum für unsere Sammlung geeignet ...«
»Nein, nein, da haben Sie ganz recht. Aber trotzdem – irgend etwas kommt mir bekannt vor ...«
Gerda räusperte sich. »Ich habe es sofort erkannt«, begann sie in ihrer bescheidenen Art. »Als ich vor zwei Jahren den Universitätskurs bei Professor Dr. Eberhardt-Simonson belegt habe – Antike Kunst in Kleinasien ...«
Ich war wütend. Sie hatte genügend Zeit gehabt, sich über das Foto den Kopf zu zerbrechen, und benutzte ihren Vorteil, sich über unsere Unwissenheit lustig zu machen. Auch Schmidt war entrüstet.
»Kommen Sie zur Sache, Gerda.«
Gerda erwiderte geziert: »Es ist Frau Schliemann, die den Schmuck trägt, den Heinrich Schliemann in Troja ausgegraben hat. Aus dem Hügel in Hissarlik, in der Türkei. 1873, glaube ich ...«
»Sie brauchen uns keinen Vortrag über Schliemann zu halten«, sagte Schmidt sarkastisch. »Wir alle haben die Mittelschule besucht. Kleinasien ist allerdings nicht mein Spezialgebiet.«
Es war auch nicht meines. Trotzdem hätte ich das Bild erkennen müssen. Jeder Kunsthistoriker hat Lesungen über die Ausgrabungen von Troja gehört, und jede Frau interessiert sich für Schmuck. Aber Gerda hatte mir in ihrer hinterhältigen Art ihre Überlegenheit unter die Nase gerieben; ich gönnte ihr den Triumph nicht, und das bewog mich, die Sache weiter zu verfolgen.
Von solchen Kleinigkeiten hängt oft unser Schicksal ab. Ohne Gerda wäre ich vielleicht achselzuckend in mein Büro zurückgegangen, hätte das Foto in den Ordner UNERLEDIGTES getan und auf eine weitere Erklärung des Absenders gewartet. Die nie gekommen wäre, denn Tote schreiben nicht.
Statt dessen fragte ich verärgert: »Was hast du mit dem äußeren Umschlag gemacht?«
Schmidt, den Blick immer noch auf das Bild geheftet, wollte wissen: »Wieso wissen Sie, daß auch ein äußerer Umschlag vorhanden war?«
»Hier – dieses Kuvert mit dem Bild ist unbeschriftet. Keine Adresse, keine Briefmarke. Sag schon, Gerda, wo ist der Umschlag?«
Gerda senkte schuldbewußt den Blick. Ich folgte seiner Richtung. Der Papierkorb. Er war nicht nur leer, sondern sauber wie mein Küchenboden. Oder sauberer – denn ich habe einen Hund.
»Du hast ihn doch nicht fortgeworfen ...?«
»Er war schmutzig«, verteidigte sie sich. »Über und über mit Dreck beschmiert.« Angeekelt verzog sie das Gesicht. »Man konnte kaum deinen Namen lesen, Vicky.«
»Und der Name des Absenders ...«
»Vollkommen unleserlich. Sonst hätte ich ...«
»Die Briefmarke? Woher kam das Schreiben? Inland? Ausland?«
Sie machte eine Geste der Hilflosigkeit. Ich ließ sie beschämt zurück und verließ das Zimmer. Schmidt folgte mir auf dem Fuß. »Ich komme mit Ihnen!«
»Wohin?«
»Zu den Aschentonnen, natürlich. Das Kuvert suchen.« Er zwinkerte mir zu. »Der verschwundene Briefumschlag! Ein glänzender Titel für einen Abenteuerroman.« Wie schon erwähnt, Schmidt hatte einen erbärmlichen Geschmack, was Literatur betraf. »Ich langweile mich. Unser letzter Fall liegt schon Monate zurück.« Sein Hunger nach Geheimnissen und Abenteuern ist unstillbar. Der ›Fall‹, auf den er anspielte, war der ungeschickte Versuch eines Besuchers, eine Gemme in seiner Jackentasche verschwinden zu lassen. Einer unserer Aufseher hatte ihn dabei ertappt. Man hatte sogar davon Abstand genommen, die Polizei zu verständigen. Aber Dr. Schmidt beharrte nach wie vor darauf, vom ›Fall der Entwendeten Gemme‹ zu sprechen. Jetzt war es ein verschwundener Briefumschlag.
Unser Pförtner war ziemlich erstaunt, als der Direktor mit mir auf den Hof hinausging. Er kam hinter uns her. Karl, ein Kriegsveteran, ist mir besonders zugetan, aber ich weiß, daß seine Bewunderung weniger meiner Person gilt als meinem Hund. Seit Karl mir einmal meine Aktentasche nach Hause gebracht hatte und vom Dobermann enthusiastisch empfangen wurde, hatte sich zwischen beiden eine starke Sympathie entwickelt.
Er besuchte Cäsar alle paar Wochen und unterließ es nie, ein passendes Geschenk mitzubringen, und sei es nur ein übelriechender Knochen.
Karls erste Frage galt der Gesundheit meines Dobermanns, erst dann erkundigte er sich nach dem Grund unseres Ausflugs in den wenig attraktiven Hof. Schmidt stellte Gegenfragen. Ja, Karl hatte Gerdas Papierkorb ausgeleert, wie jeden Morgen und jeden Abend. Nein, die Müllabfuhr war noch nicht erschienen, sie kam nur Dienstag und Freitag.
Natürlich half er uns bei der Suche, was sehr praktisch war, denn die zwei Aschentonnen waren ziemlich hoch, und Schmidt war nicht groß genug, um sich über ihren Rand zu beugen. Es war auch keine erhebende Tätigkeit, zwischen angebissenen Wurstbroten und Apfelschalen nach einem weggeworfenen Umschlag zu suchen. Und die Tonne war seit vergangenem Freitag nicht geleert worden. Schließlich aber wurde die unappetitliche Tätigkeit von Erfolg gekrönt. Ich hielt den gesuchten Gegenstand in meinen Händen.
Diesmal hatte Gerda nicht übertrieben. Das Kuvert war schmutzig. Eine schmierige braune Kruste überzog den größeren Teil des Papiers.
Schmidt war zu mir getreten. »Blut«, sagte er in einem Tonfall, der einem Shakespeare-Darsteller alle Ehre gemacht hätte. »Der Umschlag ist mit Blut verkrustet.«
»Nichts als Dreck«, erwiderte ich. »Sie lesen zu viele Kriminalromane, Schmidt.«
Wir waren enttäuscht, denn auf dem Umschlag war weder ein Absender vermerkt, noch eine Rückadresse. »Expedition erfolgreich, aber zwecklos«, entschied ich. Karl kehrte in seine Loge zurück, und Dr. Schmidt in sein Direktionszimmer. Ich ging erst in unsere Bibliothek, um ein bestimmtes Buch herauszusuchen. Dann verkroch ich mich in die Abgeschiedenheit meines Turms. Im Hof war es kalt gewesen, ich hielt meine vom Wühlen im Unrat steifgewordenen Finger an die Heizung, nachdem ich mir sehr sorgfältig die Hände gewaschen hatte.
Koffein soll helfen, verworrene Gedanken in eine gewisse Ordnung zu bringen. Also kochte ich mir neuen Kaffee, bevor ich mich an die weitere Untersuchung machte. Der Stempel auf der Briefmarke war unlesbar, aber mit Hilfe meiner Lupe konnte ich ein B und ein A ausmachen. Ein Badeort? Die Briefmarke war deutsch, der Brief nicht im Ausland aufgegeben worden. Aber das half mir wenig, denn es gibt in Deutschland mehrere Dutzend von Orten, die sich Bad nennen, mit oder ohne Berechtigung.
Auch die sorgfältigste Untersuchung brachte mich nicht weiter. Der Umschlag war aus starkem Papier und gefüttert. Dadurch waren die Flecken, die Gerda und ich für Schmutz und Dr. Schmidt für Blut gehalten hatte, nicht nach innen gedrungen. Der Brief war an mich gerichtet, aber über die Adresse des Museums. Der Absender konnte also niemand aus meinem Bekanntenkreis sein, sonst hätte er unweigerlich an meine Privatadresse geschrieben. Auch kamen mir die Schriftzüge – die Adresse war nicht getippt – in keiner Weise bekannt vor.
Als nächstes schlug ich das Buch aus der Bibliothek auf, das sich mit Schliemann und seinen Ausgrabungen beschäftigte. Mühelos fand ich das in Frage kommende Bild, es nahm eine ganze Seite ein. Sophie Schliemann, geschmückt mit den in Troja ausgegrabenen Juwelen.
Doch Sophie Schliemann war – zumindest nach dem Geschmack der damaligen Zeit – eine schöne junge Frau gewesen. Die Frau auf der mir gesandten Fotografie war hingegen ältlich, mit verbrauchten Zügen.
Gerda hatte nur zur Hälfte recht behalten. Der Schmuck und seine Anordnung waren die gleichen wie auf dem Bild der jungen Griechin, die Schliemann geheiratet hatte. Doch die Frau war eine andere. Und der Schmuck mußte falsch sein. Eine glänzende Kopie, aber doch nur eine Nachahmung. Denn hinter der Frau war unter der Lupe ein Kalender zu sehen, auf dessen Blatt ein Datum stand. Mai 1982. Die Aufnahme war also jüngeren Datums. Die Juwelen waren aber im Untergang von Berlin verlorengegangen und nie wieder aufgetaucht.
Das war im Frühjahr 1945 gewesen.
Was bedeutete das alles? Handelte es sich um einen dummen Scherz? Würde in den nächsten Tagen ein Begleitbrief eintreffen, der eine Aufklärung enthielt? Das Museum bekam oft Post, die man nicht weiter ernst nehmen konnte, weil sie von Verrückten und Spinnern geschrieben worden war. Ich erinnerte mich an eine Frau, die behauptete, vom Geist Hieronymus Boschs besessen zu sein, und unter seiner Leitung pornographische Zeichnungen anfertigte.
Ein verarmter Graf aus der Provinz hatte uns seinen minderwertigen Familienschmuck zum Gelegenheitspreis von einer Million Dollar angeboten. Und ein indischer Koch offerierte uns einen hundertkarätigen Diamanten – das Auge des Buddhas von Eschnapur. Eschnapur ist aber eine Provinz, die gar nicht existiert, sondern nur in alten deutschen Filmen auftaucht.
Ich trat ans Fenster und überlegte. Es hatte zu schneien begonnen, die Umrisse der Stadt waren kaum zu erkennen. Mehrere Jahre hindurch war ich Weihnachten nach Hause gefahren, nach Minnesota, um die Feiertage im Kreis meiner Familie zu feiern. Ich half, den Baum zu schmücken, der in der großen Halle aufgestellt wurde. Mutter und Großmutter waren in der Küche und buken Weihnachtskuchen nach alten schwedischen Rezepten, während Großvater mit Vater über Politik debattierte und auf seine ›verdammten liberalen Enkelkinder‹ schimpfte. Friede auf Erden, an dem ich diesmal nicht teilnehmen konnte, weil ich das Geld für den Flug leichtsinnigerweise anderweitig ausgegeben hatte.
Das war traurig. Noch trauriger war aber die quälende Frage, ob mich irgend jemand in meiner Heimat vermissen würde ...
Ich war allein. Allein in der Fremde, und der einzige Mann, der mir etwas bedeutete, hatte sich seit Wochen nicht blicken lassen und nicht gemeldet.
Ich zwang mich, nicht mehr an Minnesota zu denken, sondern an das längst vergangene Troja, das Schliemann, der reiche Kaufmann und Amateur-Archäologe zum Erstaunen aller Fachleute genau dort gefunden hatte, wo Homer es beschrieb. Trotzdem hatte er sich geirrt. Der ausgegrabene Schmuck stammte nicht aus der Zeit, da die heldenhaften Trojaner jahrelang der griechischen Belagerung trotzten, sondern war verblüffenderweise tausend Jahre älter.
Heute kann kein Archäologe auch nur eine Tonscherbe mit nach Hause nehmen. Das jeweilige Land, in dem er seinen Spaten ansetzt, belegt sie mit Beschlag. Doch Schliemann hatte keine Schwierigkeiten, das Gold von Troja nach Berlin zu bringen. Während des Krieges hatten die Deutschen es in Sicherheit gebracht. In vermeintliche Sicherheit. Denn seit die Russen in Berlin einmarschiert waren und sich aller Schätze bemächtigt hatten, die die ›Reichshauptstadt‹ zu bieten hatte, war es verschwunden und verschwunden geblieben.
Andere Kostbarkeiten hatten im Lauf der Jahre den Weg zurück gefunden. Der Pergamon-Altar befand sich im Museum von Ostberlin, die entführten Wissenschaftler waren freigelassen worden, nachdem sie ihre Geheimnisse den Sowjets preisgegeben hatten. Nicht so das Gold von Troja.
Hatten die Russen einen bestimmten Grund, es zurückzuhalten?
Rätsel, die nie gelöst worden waren. Ich wußte, daß die besten Köpfe der deutschen Archäologen sich mit dem Problem beschäftigt hatten. Ohne es lösen zu können.
Warum sollte dies gerade mir vergönnt sein, einer Kunsthistorikerin aus Minnesota, die sehr wenig über kleinasiatische Ausgrabungen wußte, wenn auch ziemlich viel über mittelalterliche Malerei. Konnte ich für meine Zukunft mehr erwarten als diesen meinen Platz in dem kleinen Münchner Museum? Sollte ich in meine Heimat zurückkehren und mit einer Dozentenstelle an einer mittleren Universität vorliebnehmen?
Verdammt! Die nahende Weihnachtszeit verleitet einen immer wieder, zu prüfen, was man erreicht hat, und Bilanz zu ziehen.
Kapitel 3
Das Klingeln des Telefons riß mich aus meinen trüben Gedanken.
Es war Schmidt. Er lud mich zum Mittagessen ein. Das tat er mindestens zweimal wöchentlich. Dabei war er weniger an meiner Person interessiert als an Rosanna.
Rosanna ist keine lebende Frau. Sie ist die Heldin eines Romans, an dem ich seit Jahren schreibe, ohne Hoffnung, daß er jemals gedruckt werden würde. Doch Schmidt, in seiner naiven Freude an Geheimnissen und Abenteuern, will immer wissen, wie die Geschichte weitergeht. Keine Situation ist ihm zu unwahrscheinlich, kein sexuelles Erlebnis zu trivial; er will alles erfahren und miterleben.
Ich habe in meiner freien Zeit genügend Muße, den Faden weiter und weiter zu spinnen. Rosanna ist bereits von Sultanen, Banditen und perversen Lebemännern entführt worden, doch immer wieder gelingt es ihr, im letzten Moment der Vergewaltigung zu entgehen. Im letzten, noch nicht vollendeten Kapitel hat es ganz den Anschein, als würde es Giacomo Casanova endlich glücken, sie ihrer Jungfernschaft zu berauben, und Schmidt behauptet, nicht schlafen zu können, ehe er nicht weiß, wie die Sache ausgeht. Was eine plumpe Lüge ist, denn Schmidt ist ein Typ, der bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit einschläft, selbst bei einem spannenden Vortrag über Gobelins des 15. Jahrhunderts.
Wir gingen zu unserer bevorzugten Kneipe, die ein dunkles Bier ausschenkt, dem Schmidt besonders zugetan ist. (Obwohl es wenige Sorten Bier gibt, denen er abhold ist.) Er bestellte Weißwürste, die man ihm widerspruchslos servierte, obwohl zwölf Uhr mittag bereits vorbei war – einer Münchner Tradition zufolge muß diese Spezialität vorher verzehrt werden. Dazu bestellte er einen Schweinsbraten und bestrich ein großes Stück Schwarzbrot dick mit Butter. Sein Appetit war in Ordnung. Ich nippte an meinem Weißbier und wartete darauf, daß er zur Sache kommen würde. Ich wußte, das würde nicht lange dauern. Schmidt hält sich für schlau und spitzfindig. Ein Irrtum.
Er hatte noch kaum den Zipfel seiner Serviette in den Kragen gesteckt, als er loslegte: »Ich habe Ihnen eine wichtige Eröffnung zu machen, Vicky.«
»Ich weiß.«
Er beäugte mich mißtrauisch. »Was wissen Sie? Sie können gar nichts wissen.«
»Aber doch. Ein Gelehrter Ihres Kalibers muß unterdes auch schon festgestellt haben, daß die Frau auf dem Bild nicht Sophia Schliemann ist.«
Er prustete enttäuscht. Er mag es nicht, wenn man ihm beweist, daß auch andere so klug sind wie er. »Wir sind uns also einig.«
»Inwiefern?«
»Das Foto ist gefälscht. Die Juwelen sind Bühnenschmuck. Aber der vermeintliche Schmutz auf dem Umschlag ist verkrustetes Blut.«
»Lächerlich. Es ist einfacher Dreck.«
»Blut.«
»Dreck.«
»Blut.«
»Dreck.«
Wir sind oft verschiedener Meinung und benehmen uns wie Halbwüchsige, die drohen, ihren ›großen Bruder‹ zu holen, damit dieser den Streit schlichtet. Da weder Schmidt noch ich ältere Geschwister haben, mußten wir uns auf eine andere Art Schiedsrichter einigen.
»Das Labor!«
Es war das Ei des Kolumbus. Da wir im Museum öfters den Firnis von Gemälden oder das Alter von Geweben prüfen müssen, verfügen wir über ein kleines, aber gut ausgestattetes Laboratorium.
»Einverstanden«, sagte ich. »Das Labor soll entscheiden, wer recht hat. Aber selbst wenn es Blut ist ...«
»Menschliches Blut«, ergänzte Schmidt genüßlich.
»Wir können doch nichts unternehmen. Auf dem Umschlag steht kein Absender. Nur wenn der Absender die Freundlichkeit hat, einen zusätzlichen Brief zu schreiben ...«
»Wenn er dazu in der Lage ist«, unterbrach mich Schmidt vergnügt. »Er muß eine Menge Blut verloren haben.«