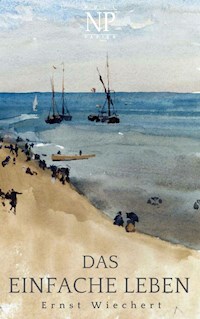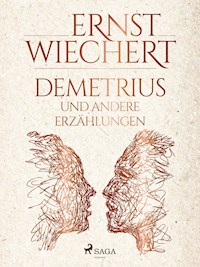Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Brüder Amadeus, Erasmus und Ägidius begegnen sich nach dem Ende des 2. Weltkrieges wieder. Die Karrieren der drei könnten unterschiedlicher nicht sein: Amadeus war in einem Konzentrationslager, Erasmus ist General und Ägidius kümmert sich um das Familiengut. Als die Förstertochter Barbara in das Leben der wiedervereinten Familie tritt, nimmt das Schicksal seinen Lauf...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Wiechert
Missa sine nomine
Roman
Saga
Missa sine nomine
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1950, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726927610
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
In jüngeren Tagen war ich des Morgens froh,
des Abends weint' ich; jetzt, da ich älter bin,
beginn' ich zweifelnd meinen Tag, doch
heilig und heiter ist mir sein Ende.
Hölderlin
1
So ging es sich also, wenn der Tod einen zwischen den Schultern berührt hatte.
Es ging sich leicht wie auf Flügeln, aber unter der Erde ging es mit, und was dort mitging unter den Füßen, war nicht leicht und wie auf Flügeln, sondern dunkel und schwer wie der Saft des Mohnes.
Aber was wußte er, der in die Nacht hineinging, vom Saft des Mohnes? Er konnte stehenbleiben, am Rand der Straße, und seinen Rücken an einen der Apfelbäume lehnen, und über ihm fiel der Tau unter dem vollen Maimond schon auf die rötlichen Blütenknospen. Er konnte die Augen schließen, und vor den geschlossenen Augen mochte wohl das Bild der roten Mohnblüten erscheinen, am Rande gelber Kornfelder, und das Bild eines Kindes, das davorstand und mit der zaghaften Hand an die Blüten wie an einen Zauber rührte.
Aber es war alles weit und unwirklich wie im Traum, der Mohn, das Feld und die Kinderhand. Es gab keine Kinderhände mehr, nirgends und niemals, und das Rot des Mohnes verwandelte sich in ein anderes Rot, das aus Flecken zusammenfloß, immer dichter, bis es den Rand des Feldes säumte, aller Felder dieser Erde, ja den Rand dieses dunklen Sternes, der lautlos in die Mainacht hineinbrauste, in die anderen Sternbilder hinein, und es war, als wichen die Sternbilder aus vor dem Stern mit dem blutigen Rand bis an die Ränder der Milchstraße hin, um ihm Raum zu geben und ihm die eisige Unendlichkeit aufzuschließen, die hinter dem Sternbild des Herakles auf ihn wartete.
Der Mann unter dem Apfelbaum öffnete die Augen und verzog die Lippen. Die Sternbilder hingen über ihm, der volle Mond und die Milchstraße. Nichts war ausgewichen vor seiner Bahn, und nichts würde jemals ausweichen. Eine Stimme begann, hinter den Feldern zu singen, aber es war die Stimme eines Betrunkenen wie die meisten Stimmen, die er an diesem Abend gehört hatte. Es war nicht die Stimme, die er zu hören erwartet hatte, jene einsame, dunkle, ferne und einmalige Stimme, die das Wort des Gerichtes über die erschauernde Erde rufen würde: »Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll wieder vergossen werden …«
Ein versunkenes Wort, ein versunkenes Feld, ein versunkenes Kind. Und niemals und nirgends würde es auferstehen.
Der Mann seufzte und trat aus dem Schatten des Apfelbaumes wieder auf die helle Straße. Es fror ihn in seinem braunen, uniformähnlichen Kleid, und er hing sich den Mantel über die gebeugten Schultern. Der Mantel war blau und weiß gestreift, ein fröhlicher Mantel, aber die Kinder wichen ihm aus, und die Erwachsenen wendeten die Gesichter ab, als sähen sie ihn nicht.
Eine Stunde später saß der Mann auf dem steinernen Rand eines Dorfbrunnens und sah dem mondbeglänzten Strahl zu, der in das Becken floß. Seine Füße schmerzten ihn in den neuen Schuhen, die er von den Siegern bekommen hatte. Er nahm das trockene Brot aus der Manteltasche und hielt es unter das fließende Wasser, ehe er es langsam aß. Dann rauchte er eine der fremden, schweren Zigaretten, mit denen man ihm die Taschen gefüllt hatte, und blickte auf die dunklen Giebel, hinter denen der Mond stand. Es war noch Licht in vielen der kleinen Fenster.
Da sitzen sie nun und warten auf die Zukunft, dachte er. Alle diese Jahre haben sie auf die Zukunft gewartet. Zuerst auf eine des Glanzes und nun auf die des Verlorenen Sohnes. Immer wartet der Mensch auf Zukunft. Der mit dem schrecklichen Begriff der Zeit Geschlagene. Das Tier kennt kein Morgen, und Gott kennt kein Morgen. Ewigkeit hat kein Morgen. Aber sie warten. So wie auch ich warte. Vielleicht bin ich geduldiger als sie, vielleicht bin ich nur böser als sie, kälter und erstorbener. Ich war tot, und deshalb weichen die Kinder mir aus. Tiere und Kinder riechen den Tod …
Er drückte die Zigarette am Brunnenrand aus und stand auf. Er hatte es nun nicht mehr weit. Er konnte das Schloß auf dem Berge hinter den Giebeln sehen. Es war erleuchtet bis in die letzten Fenster, und es fiel ihm ein, daß Belsazars Schloß so ausgesehen haben könnte. »Die Mitternacht zog näher schon …« Es fielen ihm so viele Verse ein, die er als Kind gelernt hatte. Aber es schrieb nun keine Hand mehr an weißer Wand. Nur die Flugzeuge schrieben »Buchstaben von Feuer«.
Er kannte nun jede Biegung des Weges. Er war oft hier gewesen. Er hatte die arme, düstere Landschaft geliebt, und von hier hatte man ihn auch geholt. Das, was die Menschen Zeit nannten, war vergangen, aber für ihn gab es keine Zeit mehr. Man hatte ihn aus dem feurigen Ofen genommen, und nun war er erstarrt. Aber nicht geläutert. Vielleicht war er zu früh aus der Glut gehoben worden, vielleicht zu spät. Nur die Liebe läuterte, nicht die Gewalt. Und er liebte nicht mehr. Er ging zu den hellen Fenstern hinauf, weil sie ihm gehörten. Sie waren ihm durch Erbschaft zugefallen, das hatte man ihm gesagt. Aber er wußte nicht, ob Erbschaften noch galten, nachdem alles Erbe vertan worden war. Das von Generationen und das von Jahrtausenden. Er ging nur, weil dort vielleicht ein Dach war, ein Stück Brot, ein Brunnen mit Wasser. Und wenn es dort nicht war, würde er weitergehen oder auf einer Schwelle sitzenbleiben, bis der Nachtfrost über ihn fiel.
Er blieb stehen, weil das Herz ihm Mühe machte, und wandte sich um. Das Dorf lag nun schon unter ihm im Tal, und die steilen Dächer glänzten im Mondlicht. Die Straße lief als ein weißes Band in die dunklen Hügel hinein. Ein Hund bellte in der Ferne, und es war wie eine traurige Stimme aus der Öde.
Aus solchen Dörfern sind sie geboren worden, dachte er, die den Namen des Volkes erhöht haben. Aus dem Dunklen und Stillen und Namenlosen. Und auch die anderen sind aus ihnen geboren worden, die Henker und die Mörder, und niemand weiß, ob in ihrem Blut nicht auch ein Tropfen derjenigen floß, die die großen Melodien geschrieben haben oder die Weisheit ihrer Jahrhunderte. Korn und Disteln wachsen aus demselben Feld.
Eine Sternschnuppe zog ihre Silberbahn vom Zenit in den dunklen nördlichen Horizont. Aber er hatte sich nichts gewünscht. Doch hob er nun die müden Augen zu dem schimmernden Gewölbe auf. Er fühlte die Größe und Reinheit und unsägliche Fremdheit des Raumes. Der Raum hatte nicht achtgehabt und nicht teilgenommen an dem, was geschehen war. Jahrelang geschehen, Tag und Nacht. Die Schreie hatten ihn nicht erreicht, die Flüche nicht, die Gebete nicht. Die Sternbilder waren aufgegangen und hatten sich gesenkt. Die Achse hatte sich gedreht. Und alles, was geschehen war, war mit der sich drehenden Achse lautlos hineingestürmt in den funkelnden Raum, auf das ferne Sternbild des Herakles zu.
War es schön, was er sah? Floß das Glück aus jener Ewigkeit auf seine Stirne nieder? Er hatte vergessen die Schönheit, das Glück und wahrscheinlich auch die Ewigkeit, die gar keine Ewigkeit war, sondern nur eine nicht zu messende Zeit.
Ein Vogel rief in dem hohen Wald hinter ihm, und er erschrak. Er drehte sich um, und seine rechte Hand glitt in die Tasche. Es ging wohl jemand hinter ihm, aber es war alle diese Nächte hinter ihm hergegangen, leise und verstohlen, wie die Toten gehen, die keine Schuhe mehr tragen. Er hatte sie ihm nicht ausgezogen, aber die anderen würden es wohl besorgt haben. Schuhe waren kostbar gewesen.
Er seufzte und stieg wieder hinauf. Seine Schultern schmerzten ihn von den Bändern des Rucksacks, den er trug und den man ihm mit Lebensmitteln gefüllt hatte. Aber er wußte, daß er mehr trug als Brot und Konserven. Jeder Mensch hatte eine unendliche Last zu tragen, sobald sein Haar grau wurde. Die Zeit, die Erinnerung, das Kind, das man gewesen war. Lebende und Tote. Und sie hatten gelernt, wie schwer Tote zu tragen waren. Es war nichts dazugekommen zu ihrer Substanz, und doch waren sie so schwer, als ob sie aus Stein wären.
»Setze dich ruhig hinauf«, sagte er leise. »Ich will dich schon tragen. Ich fürchte mich nicht.« Er sprach oft mit sich, die ganzen letzten Jahre, weil er sonst mit niemandem gesprochen hatte. Er wollte nicht stumm werden.
Er blieb stehen und neigte die Schultern, als wollte er es dem andern leichter machen. Aber er fühlte nichts. Auch wenn sie Steine geschleppt hatten, hatte er nichts gefühlt. Er hatte sein Herz entlassen. Und Tote fühlte man auf dem Herzen, nicht auf den Schultern.
Er stieg nun, ohne anzuhalten, hinauf, bis er vor dem steinernen Hoftor stand. Der große Bau mit den steilen Dächern leuchtete vor ihm bis in die Sterne hinauf, und aus allen Fenstern kamen Gesang, Lärm und die Musik der Lautsprecher. Aber er beachtete es nicht. Er blickte zu dem steinernen Wappen über dem Tor auf und versuchte, im Mondlicht das blaue Feld mit den goldenen Lilien zu erkennen. Es war nicht mehr da. Wahrscheinlich hatten sie mit Steinen darnach geworfen oder mit Pistolen hineingeschossen. Es war nur der graue, zerbröckelte Stein übriggeblieben. Er seufzte, aber es war ganz recht so. Wahrscheinlich war es das, was sie die »neue Zeit« nannten. Wenn sich der Mensch das Blut von den Händen wusch, nannte er es immer so.
Dann erst bemerkte er die beiden Gestalten neben dem Tor, die im Schatten der Fliederbüsche standen. Den Mann in einer weißen, nicht sehr sauberen Jacke, und das Mädchen, das eine schwere Tasche hinter sich zu verbergen suchte.
»Nun, alter Freund, was suchen wir hier?« fragte der Mann, während er eine Zigarette aus der Tasche nahm und sie anzündete.
»Die verlorene Zeit, junger Freund«, erwiderte der Angeredete.
Der Mann sah ihn aufmerksam und mißtrauisch an. Er war noch jung, und in seinem ungeformten Gesicht war nur die leise Sicherheit derjenigen zu lesen, die im Schutz der Sieger standen, gleichviel wo sie früher gestanden haben mochten.
»Da kannst du lange suchen«, sagte er nach einer Weile spöttisch. »Aber gebettelt wird hier nicht!«
»Wo gestohlen wird, wird nicht gebettelt«, erwiderte der Mann mit dem Mantel. »Laß nur deine Tasche«, sagte er zu dem Mädchen. »Ich nehme dir nichts fort.«
Das Mädchen streifte mit einem verächtlichen Blick den bunten Mantel, der dem Mann immer noch um die Schultern hing. »Das hat aufgehört, das mit dem Fortnehmen«, sagte es.
»Es hat nur gewechselt«, erwiderte der Mann. »Aber ich möchte nur wissen, wer jetzt hier wohnt«, fügte er hinzu und deutete mit dem Kopf nach den erleuchteten Fenstern.
»Und weshalb willst du das wissen?« fragte der junge Mann.
»Weil es mir sozusagen gehört, junger Freund.«
Der »junge Freund« nahm die Zigarette aus dem Mund und starrte ihn verwundert an. »Es waren schon zwei hier, die das behauptet haben«, sagte er endlich.
»Ja, und ich bin der dritte«, erwiderte der Mann mit dem Mantel. »Aber es ist schön, daß die beiden da waren. Ich wußte es nicht. Man weiß heute nicht mehr, ob noch jemand da ist.«
»Es tut mir leid, Herr Baron«, sagte der junge Mann ohne besondere Höflichkeit, »aber nun wohnen die Amis hier.«
»Wer sind die Amis?«
»Die Amerikaner, und es liegt ein ganzer Stab hier. Ich helfe in der Küche.«
»Das ist eine gute Hilfe«, erwiderte der Mann freundlich und streifte die Tasche des Mädchens mit einem Blick. »Ich will auch nichts haben. Ich habe genug. Und ihr habt wahrscheinlich lange genug gehungert.«
»Ja, weiß Gott!« sagte das Mädchen böse.
»Ich wollte es nur einmal sehen«, fuhr der Mann fort und blickte wieder nach dem zerbrochenen Wappen hinauf. »Ich bin oft hier gewesen.«
»Und dann?«
»Dann bin ich nicht mehr hier gewesen. Ich war verhindert, junger Freund. Aber die beiden, von denen du sprachst, weißt du, wo sie jetzt sind?«
Der junge Mann nahm die Zigarette aus dem Mundwinkel und deutete mit ihr über das Tor hinweg auf die bewaldeten Höhen, über denen das Mondlicht lag. »Im Schafstall, Herr Baron«, sagte er, und es war nicht zu hören, ob es ihn freute oder betrübte. »Kennen Sie den Schafstall, Herr Baron?«
»Den kenne ich gut«, erwiderte der Mann, »und das ist ein schöner Platz da oben. Ich bin gern dort gewesen, in der sogenannten verlorenen Zeit … Ich danke für die Auskunft.« Und er wendete sich zum Gehen.
Der junge Mann aus der Küche sah etwas unsicher auf die hohe, gebeugte Gestalt, die auch unter dem gestreiften Mantel so aussah, als gehöre ihr dies alles: das Wappen über dem Tor, das erleuchtete Schloß und der ferne Schafstall. Er zog eine Zigarette aus der Tasche und hob die Hand, aber dann nahm er doch mit der anderen ein geöffnetes Päckchen und reichte es dem Freiherrn. »Bedienen Sie sich, Herr Baron«, sagte er.
»Danke, junger Freund«, erwiderte der Freiherr fröhlich. »Aber man hat mir genug gegeben.«
Der junge Mann schob das Päckchen wieder in die Tasche und zuckte bedauernd die schmalen Schultern. »Vielleicht ist es ganz gut«, sagte er mit einem vertraulichen Lächeln, »wenn heute Barone für eine Weile im Schafstall leben müssen …«
Der Freiherr erwiderte das Lächeln nicht, aber er hob die Hand freundlich zum Abschied. »Besser wahrscheinlich«, antwortete er, »als wenn Schafe in Baronsschlössern leben müßten. Es würde ihnen auf die Dauer nicht wohl sein.«
Die beiden blieben nicht ohne eine leise Verlegenheit zurück, aber der Freiherr Amadeus stieg nun, am Schloßhof vorbei, den schmalen Pfad hinauf, der zu den Heiden, Mooren und Torfbrüchen führte, zwischen denen der Schafstall stand. Er erinnerte sich genau, und er würde den Pfad auch im Dunklen gefunden haben. Diese beiden jungen Leute hatten ihn nicht besonders gefreut, aber nach ein paar Schritten hatte er sie schon vergessen. Sie waren nicht anders, als was er unterwegs getroffen hatte. Kein Sieg und keine Niederlage reichte bis an die Wurzeln. An die Wurzeln reichte nur der Tod. Und auch er nur, wenn man ihn im sittlichen Kern empfing, nicht nur im Kern des Körpers.
Aber es war schön, daß der Schafstall dastand. Und schön, daß die Brüder da waren. Nicht daß sie im Schafstall waren, aber daß sie da waren. Nicht vor einer rotbefleckten Mauer geendet oder unter dem Galgen.
Der Freiherr Amadeus hatte wenig geliebt in seinem Leben. Die Heimat, die Musik, ein paar Bücher und die beiden Brüder. Das andere war nun versunken, wie Steine in ein Meer sinken. Aber die Brüder, auch wenn sie fielen, würden nur in die Tiefe seines Herzens gefallen sein. Man hatte viel über sie gelächelt, schon in ihrer Kinderzeit, und Belachtwerden verbindet fester als Beweintwerden. Die Primitiven hatten über ihre Ähnlichkeit gelächelt. Daß ihr Haar braun und weich um ihren Kopf gelegen hatte wie ein Maulwurfspelz. Und daß ihre Nasen zu lang waren und ihnen etwas schief in den schmalen Gesichtern standen. Und die anderen hatten über ihren komischen Ernst gelächelt, mit dem sie das Scherzhafte wie das Böse empfingen. Über das Unerschütterliche, das ihren jungen Gesichtern seltsam anstand. Als trügen sie das Unerschütterliche junger Märtyrer oder junger Heiliger um ihre jungen schmalen Schläfen.
Ein witziger Gutsnachbar hatte sie das »Triptychon« genannt, und so erschienen sie wohl auch allen Gedankenlosen: als schlüge man die beiden Bildflügel auf und dann ständen sie da, nebeneinander, drei Jünglingsgestalten aus einem Raum jenseits der bekannten Erde, und einer hielt wohl eine altertümliche Laute in den langen, schmalen Händen und der zweite eine Geige und der dritte etwas, das man wohl schon in den Liedern des Alten Testamentes getragen hatte. Und so wie von dorther blickten sie den Beschauer an, mit fremden, ganz gereinigten Gesichtern, ohne Lächeln, aber mit der Heiterkeit, die man wohl von Gottes Mantelsaum mitbrachte.
Und damit hatten sie nun auch früh begonnen: daß aus des Vaters abgelegenen Räumen sich jeder ein Instrument herausgesucht hatte und daß sie nun unter der unvollkommenen Leitung eines seltsamen Hauslehrers begonnen hatten, diese drei Instrumente aufeinander abzustimmen und mit einem unerschütterlichen Ernst zu handhaben. Und nach ein paar Jahren waren sie auf den Befehl ihrer Mutter zum erstenmal vor den Gästen erschienen, bei einer Geburtstagsfeier etwa, hatten sich unter den Kerzen des alten Kronleuchters schweigend niedergesetzt und mit ihren feierlichen Gesichtern und den feierlichen Instrumenten einen der alten Meister, Tartini etwa, zu spielen angefangen.
Solange bis unter den Gästen ein leises Wort oder ein leises Lächeln sich erhoben hatte und Amadeus mit seinem Cello aufgestanden war, inmitten des zarten Andante-Satzes, und nach einer ernsten Verneigung den Saal verlassen hatte, unmittelbar darauf von seinen Brüdern gefolgt. Er hatte sich über das Ereignis nicht geäußert zu diesen Brüdern; es war auch von seinem unbewegten Gesicht nichts abzulesen gewesen über die Gründe, die ihn zum Aufstehen veranlaßt hatten. Aber zu dem erbitterten Zorn der Mutter hatte er leise und höflich bemerkt, daß eben dieses Andante die musikalische Übersetzung des dreizehnten Kapitels aus dem ersten Korintherbriefe sei und daß dieses Kapitel der Frau Mutter doch wohlbekannt sein müsse.
Von da ab hatten sie niemals mehr öffentlich gespielt.
Auf der Höhe, die der Freiherr nun schon erreicht hatte, ging ein leiser Wind, der schon nach den großen Hochmooren schmeckte, und Amadeus setzte sich für eine Weile auf einen der Basaltsteine, die neben dem Fußpfad lagen. Der Wald war niedriger geworden, und das Mondlicht lag in der Ferne schon auf kahlem Fels, der wie Silber glühte.
Von dem dreizehnten Kapitel des Korintherbriefes gingen die Gedanken des Freiherrn für eine Weile zu der Gestalt der Mutter, die von den Gutsleuten nur »die Frau Gräfin« genannt wurde und die auch, ihrer Geburt entsprechend, so genannt werden wollte. Die Liljecronas, die aus schwedischem Blut stammten, waren für sie immer ein »dubioses« Geschlecht gewesen, ein Bauerngeschlecht aus dem finsteren Raum der Wikinger wahrscheinlich, und es war für sie nicht ausgeschlossen gewesen, daß sie vor ein paar hundert Jahren noch Pferdefleisch gegessen und dem einäugigen Gott Menschenopfer dargebracht hatten.
Amadeus erinnerte sich nicht, daß seine Mutter ihn jemals geküßt hätte, und er konnte sich auch nicht vorstellen, wie ihre schmalen Lippen das hätten zuwege bringen können. Geküßt hatte ihn nur die alte Kinderfrau, eine Litauerin mit dem Namen Grita, die an Feiertagen sieben Röcke übereinander trug und die unter diesen sieben Röcken mit Leichtigkeit und Bereitwilligkeit alles verbergen konnte, hinter dem die Schicksalsgöttin Laima her war, ob es nun ein junges Huhn war, das geschlachtet werden sollte, oder einer der kindlichen Heiligen aus dem Triptychon, der sich vor der Frau Gräfin verbergen wollte. Auf den Schlachtfeldern des kindlichen Lebens war Grita das »Asyl« gewesen, von dem sie in der Geschichte des Mittelalters gelesen hatten, die Kirchenschwelle, hinter die das Schwert nicht reichte, der Gottesfriede, der nicht verletzt werden durfte.
Amadeus rauchte, und die Melodien der Dainos gingen ihm durch den Sinn, der litauischen Volkslieder, die Grita am Abend zu summen pflegte, wenn die Bratäpfel in der Ofenröhre dufteten und der Faden am Spinnrad durch ihre alten, gekrümmten Hände glitt. Östliche Melodien, uralt und traurig, und Amadeus hatte sie für die drei Instrumente gesetzt, und Grita hatte dem Spiel gelauscht, den weißen Scheitel gesenkt, und dann das alte Gesicht mit den seltsamen Augen zu den Spielenden aufgehoben und gelächelt, wie nur alte Götterbilder lächeln können, und leise gesungen:
An des Njemen anderm Rand
stehn drei Ahorn frisch und grün.
Unter diesen Bäumen, unter diesen grünen,
saßen einst der Kuckucks drei.
Waren nicht der Kuckucks drei,
nicht die Vögel girrten so,
war'n drei junge Burschen unter diesen Bäumen,
stritten um ein Mädchen sich.
Sprach der erste: »Sie ist mein.«
Sprach der zweite: »Wie Gott will.«
Aber dieser dritte, aber dieser jüngste,
hat sich tief, ja tief betrübt.
Möchte ziehn wohl in die Stadt,
suchen einen Spielmann dir.
Tanze, lieber Knabe, tanze, wenn auch traurig,
denn du sollst nur fröhlich sein …
Und sie hatten gelauscht, die »drei jungen Burschen«, und es hatte sie zwischen den jungen Schultern gefröstelt, jene frühe Ahnung der Kreatur vor dem Unbeschützten der Menschenfüße. Und später, viel später war Amadeus zu der alten Kinderfrau gegangen, in der Dämmerung, wenn sie mit gefalteten Händen auf der Schwelle saß, und hatte leise gefragt: »Was ist das, Grita: ›Tanze, wenn auch traurig, denn du sollst nur fröhlich sein …‹?«
Und sie hatte das große, dunkle Schultertuch um ihn geschlungen, weil sie gefühlt hatte, wie die jungen, schmalen Schultern bebten, und leise geantwortet: »Laß es nun, junger Herr. Bis du erfahren hast, daß die Träne salzig und der Kuß süß ist. Und daß es besser ist, als wenn es umgekehrt wäre.«
Und er erinnerte sich, daß sie dies an vielen Särgen der Gutsleute gespielt hatten: »Tanze, wenn auch traurig …« Und immer hatte die Mutter sie durch ihr goldenes Lorgnon betrachtet, als wären sie drei Adoptivkinder, die sich in einer fremden Sprache unterhielten, einer indianischen oder polynesischen etwa. Aber die Frauen der Gutsleute hatten geweint, und nach einer der Beerdigungen, als sie schweigend an dem großen Fenster ihres Musikzimmers gestanden hatten, war der Vater leise hereingekommen, hatte sich hinter sie gestellt und mit seiner sanften wie aus der Ferne kommenden Stimme gesagt: »Wer den Armen eine Brücke baut, ist mehr, als wer den Königen ein Reich baut …«
Und darüber hatten sie lange nachgedacht, jeder für sich, wie sie niemals im Gespräch zusammen etwas bedachten. Und weil es so selten war, daß der Vater zu ihnen sprach.
Der Mond sank nun zum Horizont, und der Freiherr nahm eine neue Zigarette.
Ja, wie war es nun mit dem Vater gewesen, daß ihn keiner von ihnen je gekannt hatte? Ja, daß niemand ihn gekannt hatte? Und daß er ihnen doch auf eine wunderbare Weise vertraut gewesen war. Wie der Umriß eines Segels auf dem Ozean. Denn so war er wohl gewesen, und niemand hatte gewußt, wohin der Wind ihn treiben würde und ob es der Wind des Menschenschicksals war oder ein ganz und gar fremder, nie zu erkennender Wind.
Und vertraut war der Vater ihnen nicht allein deshalb gewesen, weil er das gleiche Haar und die gleiche leise unregelmäßige Gesichtsform hatte. Es war auch das Unnahbare des Gesichts gewesen, nicht etwa eine hochmütige Unnahbarkeit, sondern das Zugeschlossene des Andersseins, das Versunkene. Daß die traurigen Augen wie in der Schrift sagten: »Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken.« Aber daß sie es ohne Hochmut sagten, sondern scheu, fast ängstlich, als könnten sie nichts dafür und wüßten das.
Für die Gräfin und die wohlgegründeten Nachbarn war er nur jemand, der »nichts tat«; aber wie sollten sie wissen, womit seine Tage und Nächte gefüllt waren? Er lebte »abseits«, auch mit seinen Wohnräumen, und Amadeus erinnerte sich sehr wohl, wie er dort zum erstenmal gestanden hatte, unter Büchern, Globen, Instrumenten und Kästen mit Münzen, Steinen und Schmetterlingen. »Was tust du hier, Vater?« hatte er gefragt. Und der Freiherr, sich von einem Mikroskop aufrichtend, hatte ihn gütig angesehen und leise geantwortet: »Ich sammle, Amadeus.« – »Und was sammelst du, Vater?« – »Das Senfkorn, liebes Kind, und auch du wirst es einmal sammeln.« – »Und die Brüder, lieber Vater?« – »Auch sie, Amadeus, ihr drei. Denn alle andern hier« – und er hatte mit der Hand eine weite, alles umschließende Bewegung gemacht –, »alle andern sammeln das Fett der Erde.«
Amadeus hatte nicht weitergefragt, auch seine Brüder nicht, aber er hatte es bedacht, lange und gründlich, wie er zu denken gewohnt war. Und er war nun oft dagewesen, in den stillen, feierlichen Räumen, die etwas von einer warmen Kirche hatten, und das war das ganz Besondere gewesen, weil Amadeus nur die eisigkalte Dorfkirche gekannt hatte. Und er hatte viele Stunden vor den alten Folianten gekniet und die seltsamen Titel in sich aufgenommen, bevor er das erste Blatt umgeschlagen hatte:
»Der ganze Prophet Jeremias / Zu diesen schweren und gefehrlichen Zeiten / frommen Christen zum Unterricht und Trost / Ausgelegt. Item / der Prophet Sophonias / Ausgelegt / durch Nicolaum Selneccerum. / Luc. 13 / So ihr euch nicht bessert / werdet ihr alle auch also umbkommen. Anno 1566.«
Und dann, in ihrem letzten Schuljahr, war der Vater wohl »auch also umbkommen«. Denn von einem seiner Spaziergänge war der Freiherr nicht mehr heimgekehrt. Er war so verschwunden wie ein Segel hinter dem Horizont oder wie eine Wolke am Abendhimmel, und niemals wurde eine Spur von ihm entdeckt. Und der Freiherr hatte kein anderes Zeichen hinterlassen als einen Zettel auf seinem Arbeitstisch, und darauf hatte in seiner zierlichen, mittelalterlichen Handschrift nur dieses gestanden:
»HERR / Du hast mich überredt / und ich hab mich überreden lassen.«
Und lange nachher hatte Amadeus dieses Wort in dem »ganzen Propheten Jeremias« gefunden, auf den Seiten, über denen »Das zwanzigste Kapitel« stand.
Es hatte ein großes Aufsehen in der Landschaft gemacht, und dieses Aufsehen hatte die Gräfin als eine Schmach ohnegleichen empfunden. Man ging nicht »anonym« aus der Welt, auch nicht, wenn man nur Liljecrona hieß. Die Landstreicher oder die Heiligen taten das. »Ich glaube nicht, daß er tot ist«, sagte sie zu ihrer vertrautesten Freundin.»Dazu war er zu ungeschickt. Ich glaube, daß er bei einem Negerstamm ist, wo sie noch Menschen opfern. So wie seine Vorfahren es getan haben. Es war zuviel Bauern- und Heidenblut in ihm.«
Man suchte lange nach ihm, viele Monate, aber man fand ihn nicht.
Auch hierüber sprachen die Brüder nicht. Aber sie spielten ihre Trios nun nicht mehr in einem ihrer Knabenzimmer, sondern in der großen, verlassenen Bibliothek ihres Vaters. Der ganze »Prophet Jeremias« lag aufgeschlagen auf dem großen Eichentisch, und manchmal stand einer oder der andere von ihnen davor und ließ seine Augen über die seltsamen Worte gleiten: »Und ich hab mich überreden lassen …«
Grita lebte damals noch, und sie war die einzige, an die Amadeus einmal eine Frage richtete. »Glaubst du, daß er tot ist?« sagte er leise.
Sie lächelte und strich ihm mit der Hand über das schlichte Haar. »Wie sollte er tot sein, da er traurig war?« erwiderte sie.
Und als er sie fragend anblickte, nahm sie die gefüllte Spindel von ihrem Spinnrad und drehte sie zwischen ihren verkrümmten Fingern. »Er hat zu Ende gesponnen«, sagte sie, »und nun hat er eine neue Spindel genommen. Gott hat ihm einen neuen Faden gereicht.«
Es war ein großer Trost für Amadeus, und es schien ihm unrecht, ihn für sich allein zu behalten. Am Abend sagte er es den Brüdern.
»Ich habe immer gedacht«, sagte Erasmus, der älteste, nach einer Weile, »daß er an einem der heiligen Ströme in Indien sitzt und lächelt. Niemand konnte so lächeln wie er. So aus Gott heraus. Er hatte dieses alles durchgeschritten und gesehen, daß man noch einmal anfangen mußte.«
Und Amadeus hatte mit einem leisen Erschrecken gesehen, daß der Bruder die gleiche weite, alles umschließende Bewegung mit der Hand gemacht hatte wie der Vater damals, als er von dem »Fett der Erde« gesprochen hatte.
Immer mehr Sterne, dachte Amadeus und blickte zum Himmel auf. Als ob tausend neue dazugekommen wären in den Jahren, in denen ich keinen Stern gesehen habe … Es ist bald Mitternacht, und ich muß nun aufstehen.
Aber er blieb noch sitzen, die Hände ineinandergelegt, als ob sie noch die Fessel trügen.
Ja, sie hatten keine leichte Zeit gehabt auf der Schule. Schon ihre Vornamen waren ein Quell der Heiterkeit und wahrscheinlich auch der Abneigung. Erasmus, Ägidius, Amadeus. Wahrscheinlich hatten sie ihren Ursprung in den alten Folianten des Vaters und in seiner Ehrfurcht vor einer Zeit, in der sich Gott noch über die Schulter der Schreibenden neigte. »Er sah noch zu«, pflegte er zu sagen. »Er sah nicht fort wie heute.«
Aber sie hatten die Jahre bestanden. Wenn sie nacheinander das Klassenzimmer betraten, groß, schmal, mit ihren zugeschlossenen Gesichtern, war es den andern immer, als ob die Abgesandten eines anderen Volkes erschienen. Und als ob sie Gold und Edelsteine in den Taschen trügen. Sie antworteten, aber sie fragten nie, und auch die selbstsichersten Lehrer verloren etwas von dem Glanz ihrer Diktion, wenn diese drei Augenpaare unbeweglich auf ihnen ruhten. »Sie tun immer so, Liljecrona, als ob Sie eine Königskrone unter dem Rock trügen«, sagte einmal einer von ihnen mit einer unterdrückten Erbitterung zu Erasmus. »Holen Sie sie doch endlich heraus, damit wir sehen, ob sie von Gold oder Messing ist!«
»Wir haben keine Kronen unter dem Rock«, hatte Erasmus höflich und leise erwidert. »Und wenn wir sie hätten, würde dies wohl nicht der rechte Ort sein, sie herumzuzeigen.«
Als der alte Freiherr »zu Ende gesponnen« hatte, war man in der Schule bemüht gewesen, sie keine Neugier merken zu lassen, aber zu Beginn des Winters, als es einen Brand in dem Armenviertel der kleinen Gymnasialstadt gegeben hatte und die Schule mit einem Wohltätigkeitsabend den Geschädigten helfen wollte, hatte der Direktor sie in sein Amtszimmer kommen lassen und sie mit Freundlichkeit gefragt, ob sie nicht bei dieser Gelegenheit und zu dem guten Zweck etwas Musik machen möchten, da es doch bekannt sei, daß sie zusammen spielten.
Das würden sie tun, hatte Erasmus als der älteste erwidert, ohne seine Brüder vorher zu befragen.
Sie hatten einen langsamen und sehr feierlichen Satz von Mozart gewählt, und es war allen Zuhörern unvergeßlich geblieben, wie sie auf dem Podium gesessen hatten, Kerzen auf ihren Pulten, deren Licht über ihre schmalen und ernsten Gesichter gefallen war. Sie hatten nicht in ihre Notenblätter geblickt, sondern aneinander vorbei in eine Ferne, die mit stillen Gesichtern und Schicksalen gefüllt sein mochte, und wie sie nun ihre Bogen über die Saiten zogen und einander die einfache, ernste und wie von Gold schimmernde Melodie zureichten, die sich löste und wieder verschlang; wie sie in ihre Instrumente hineinlauschten, ohne doch ihre Haltung zu verändern, und nur wiederzugeben schienen, was eine ferne Stimme ihnen zuflüsterte; wie sie so miteinander und ineinander lebten, mit derselben Schlichtheit, mit der sie ihren Alltag lebten, und mit derselben Ferne, die sie sonst von den Menschen schied: war es doch, als ginge ein Zauber von ihnen aus, der sich über den ganzen Saal legte, über die alltäglichsten, ja über die gewöhnlichsten Herzen, weil jedermann fühlte, daß es nicht nur die Melodie des großen Toten war, die sie einspann, sondern daß die Reinheit und Schlichtheit dieser jungen Menschenherzen sie überwältigte, deren Leben vielleicht so fremdartig und seltsam war wie das Leben und das Ende ihres Vaters, aber an das keine Neugier und kein Spott rühren durfte, weil sie wie in einem Altarbild dasaßen, und es mußte doch eine fromme Hand gewesen sein, die sie gemalt hatte.
Und als sie geendet hatten und die Bogen sinken ließen und langsam aus dem Saal gingen, rührte sich keine Hand, aber der Direktor, der in der letzten Reihe saß, stand auf und verneigte sich vor ihnen, als sie vorüberkamen, und nachher sagte er zu dem Musiklehrer, der neben ihm saß: »Sie haben nicht für die Abgebrannten gespielt. Sie haben für ihren Vater gespielt.«
Und das war nun das einzige Konzert gewesen, das sie seit ihrer Kinderzeit gegeben hatten.
Immer mehr Sterne …, dachte Amadeus und faltete die Hände um die Knie. Und ich hatte doch gedacht, daß alles Licht erloschen sein würde in diesen Jahren …
Ja, und dann war Erasmus als Fahnenjunker in ein Reiterregiment getreten, und Ägidius hatte das große Gut übernommen, und er selbst hatte studiert und auf dem großen Eichentisch neben dem »ganzen Propheten Jeremias« Verse und Melodien aufgeschrieben und war langsam auf dem Wege seines Vaters fortgeschritten, »nichts zu tun«, wie die ordentlichen Leute sagten.
Und doch war so viel zu tun, so unermeßlich viele Jahre und Jahrzehnte lang, und eben, unter den schweigenden Sternen, wollte es ihm scheinen, als ob Jahrhunderte vergangen wären. Denn wenn nichts anders zu tun gewesen war, so war doch dieses zu tun gewesen: daß man versuchte, hinter den verborgenen Sinn eines Liedes zu kommen, das die Fischermädchen auf der Kurischen Nehrung sangen:
Tanze, lieber Knabe, tanze, wenn auch traurig,
denn du sollst nur fröhlich sein …
Grita hatte es noch gewußt, während sie den Faden für ihr Totenhemd gesponnen hatte. Aber er wußte es nicht, und weder die Folianten noch das Mikroskop konnten es ihm sagen. Wer mit dem Geist allein ging, mußte auf Krücken gehen, auch wenn sie mit Edelsteinen besetzt waren, und im ersten Hauch des Schicksals zerbrachen sie wie dürres Holz.
Von den Alten war nur noch Christoph geblieben, der Kutscher, und bei ihm saß er nun manchmal in der Dämmerung auf der Futterkiste. Auf den großen östlichen Gütern waren die Kutscher immer etwas Besonders gewesen, schon weil die Pferde etwas Besonderes gewesen waren. Die Kutscher waren die stillen Könige unter den Gutsleuten. Sie fuhren die Täuflinge, die Brautpaare und die Särge, und in der Dämmerung ihrer Ställe erfuhren die jungen Söhne die erste Weisheit eines langen, dienenden Lebens.
Christoph hatte hellblaue Augen und einen schmalen Bart um das glatte Kinn. Der Bart war schon damals weiß gewesen. Er war der einzige, der Amadeus »du« nannte. Er sagte, »Herr Baron«, aber dann fuhr er mit der vertrauten Anrede fort. »Du mußt dir nicht so viele Gedanken machen, Herr Baron«, sagte er und sog an seiner kurzen Pfeife, auf deren Porzellankopf ein Bild des alten Kaisers in bunten Farben leuchtete. »Auch nicht um den Herrn Vater. Dem Herrn Vater ist es wohl, denn er ist zu den Unterirdischen gegangen, verstehst du? Manche gehen zu den Überirdischen, und dann hört man sie nicht mehr. Aber die anderen, die kann man hören, wenn man sie nicht sucht.«
»Hörst du ihn, Christoph?«
Der Kutscher nahm die Pfeife aus dem Mund und nickte. »Manchmal, Herr Baron«, sagte er leise. »Da wo die drei großen Wacholder auf der Heide stehen, bevor man am Torfbruch vorüberkommt, da höre ich ihn. Die Pferde sind dann unruhig, und ich muß ihnen zusprechen, weil ein kleines Licht im Heidekraut steht. Und dann höre ich, wie er sagt: ›Wie geiht di dat, Christoph?‹ Und dann sage ich: ›Dat geiht ja nu so, Herr Baron.‹ Und dann fahren wir vorüber, und das Licht ist wieder fort. Dann ist er wieder runtergestiegen, Herr Baron.«
»Ihr könnt das noch, Christoph«, hatte Amadeus nach einer Weile gesagt. »Eure Füße reichen noch hinunter.«
Christoph hatte zweifelnd den Kopf geschüttelt und den Tabak in der Pfeife festgedrückt. »Ich weiß nicht, Herr Baron, ob es die Füße sind«, hatte er gesagt. »Es ist wohl, weil wir noch den Glauben haben. Laß dich niemals viere lang fahren, Herr Baron, wie die Frau Gräfin. Wer viere lang fährt, hat keinen Glauben mehr. Christus ist zu Fuß gegangen.«
Ja, vieles war ihm in der Kinderzeit zugeflossen, Dunkles und Ungereimtes, aber damit hatte er wohl die Jahre und Jahrzehnte überstanden, den ersten Krieg und die Revolution, den Verfall eines Volkes und den Verfall des Abendlandes. Das »Unterirdische« hatte ihn behütet, das mit dem Geist nicht zu Fassende, ja das, worüber der Geist lächelte. Das Spinnrad und die Futterkiste waren mehr gewesen als die Folianten. Lange ehe man Bücher geschrieben hatte, hatte man gesponnen. In den Märchen schon. Und dazu hatte man gesungen: »Tanze, lieber Knabe, tanze, wenn auch traurig …« Und das hatte er wohl getan, auch wenn den andern geschienen hatte, daß er nichts getan hatte …
Und nun stand er doch auf. Immer noch lag das Mondlicht über der Welt, und aus der Ferne trug der Wind mitunter ein Bruchstück der Lautsprechermelodien herüber. Es klang, als wenn ein Fieberkranker im Schlafe spräche.
Das haben sie nun behalten, dachte Amadeus, während er zwischen den Steinen hinaufstieg. Sieger und Besiegte. Daß sie tanzen. Aber nicht traurig. Nicht einmal die Besiegten sind traurig. Von der Fröhlichkeit ganz zu schweigen.
Die Luft wurde kühler, und die Wacholderbüsche standen wie dunkle Pilger im Heidekraut, jeder mit einem langen Schatten. Das Mondlicht machte es alles unwirklich. Eine beglänzte Welt, aber sie war unwirklich und wesenlos. Die Toten hatten soviel Raum in ihr wie die Lebenden, und der Freiherr hatte viele Tote gesehen.
Dann, hinter einem niedrigen Kiefernwald, war der Schafstall da. Dunkel und gewaltig, mit dem tief herabgezogenen Giebel, und das Mondlicht glänzte wie Silber auf dem Schilfdach. Amadeus hatte keine Heimat mehr und würde sie niemals mehr haben, aber es konnte doch noch ein Dach in dieser zerstörten Welt geben, und dieses sah so aus, als könnte es Raum haben, für unschuldige Tiere und für schuldige Menschen. Es war ein altes Dach, und der Schäfer hatte ein Leben darunter zugebracht. Das Dach hatte ihn mit Schweigen und mit Weisheit gefüllt, und Amadeus hatte oft mit ihm auf der Schwelle gesessen, von wo man in den großen Himmel blicken konnte, über den Vogelsberg hinaus und nach der anderen Seite über den Thüringer Wald hinaus. Es war eine arme, aber eine große und einsame Erde, und der Schäfer hatte von ihr seine Gesichte empfangen, und sein eigenes Gesicht war geformt worden von ihnen, wie das unterirdische Feuer vor Millionen von Jahren diese Felsen geformt hatte.
Und von dieser Schwelle hatte man ihn auch geholt. Das letzte, was er gesehen hatte, war die hohe, hagere Gestalt des Schäfers gewesen, wie sie den gekrümmten Stab aufgehoben hatte unter die ziehenden Wolken. Und das letzte, was er gehört hatte, war die furchtlose und feierliche Stimme gewesen, die wie aus einem erzenen Munde über sie gerufen hatte: »So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen; so jemand mit dem Schwert tötet, der muß mit dem Schwert getötet werden. Hie ist Geduld und Glaube der Heiligen.«
Zwei von ihnen hatten nur auf eine höhnische Art ihre Gesichter verzogen, aber der dritte hatte sich umgedreht und mit der Faust gedroht.
Amadeus aber hatte es vier Jahre lang gesucht: Geduld und Glaube der Heiligen. Er hatte es nicht gefunden.
Und nun würde er sie wiedersehen, die beiden Brüder, und er hatte Angst. So sehr, daß sein Herz schlug und seine Hände zitterten, als er den schwachen Lichtschein hinter dem Schilfvorhang des kleinen Fensters sah.
Er hatte aus vielen Gründen Angst, aber es war eine Angst des Herzens, und der Verstand konnte sie nicht bezeichnen. Er hatte Angst vor der Berührung mit Menschen, das war das erste, was er wußte. Nicht nur vor ihren Worten und Meinungen, ihren Blicken und Gebärden. Sondern eine rein körperliche Angst vor der Berührung mit ihnen. Wer lange Zeit mit zwei anderen auf einer Pritsche geschlafen hatte, empfand den Körper des Menschen nicht mehr als etwas Heiliges. Wenn ein dunkler und dumpfer Raum mit den Körpern, dem Atmen, Stöhnen und Fiebersprechen von Menschen gefüllt gewesen war, schauerte es einen vor dem Menschen. Außer man besaß »die Geduld und den Glauben der Heiligen«. Aber er besaß sie nicht.
Und da er sie nicht besaß, verlangte ihn nach nichts, als sich zu verbergen wie ein Tier im Gebüsch. Er war gezeichnet worden, und er war noch nicht so weit, daß er das Zeichen verwandelte.
Und er hatte Angst, weil es seine Brüder waren und weil er fühlte, daß er sie liebte. Er hatte geglaubt, daß die Liebe erstorben sei in seinem Herzen, aber nun wußte er, daß es nicht wahr gewesen war. Die scheue, wortlose Liebe der Kindheit, der Jugend, der Mannesjahre, sie brannte in seinem Herzen, sobald er den Lichtschein erblickte. Wie sie zusammen durch die ungeheure Einsamkeit des Lebens gegangen waren, und alles an ihnen war anders gewesen, die Gesichter, die Namen, die Musik, ja selbst die Art, wie sie ein Buch öffneten und schlossen.
Aber die beiden waren im Unversehrten geblieben, sonst würden sie nicht hier sein. Nicht im Ungefährdeten, aber in der Sauberkeit des alten Daseins. Man hatte ihren Körper nicht ergriffen, man hatte sie nicht gepeitscht, man hatte sie nicht gezwungen, unter die Füße getreten zu werden. Sie konnten ihren Körper ansehen, ohne sich zu ekeln. Sie waren rein geblieben. Sie konnten in den Spiegel sehen, und hinter dem Spiegel stand nichts als das Gesicht ihres Vaters und hinter diesem die Gesichter derer, die wie er gewesen waren: still, traurig, adelig und gut.
Und das war es, was er wissen mußte, ehe er über die Schwelle trat. Und, was mehr war: was sie wissen mußten, ehe sie ihm nur die Hand reichten mit dem Siegelring des Geschlechtes. Daß er nicht mehr gut war, sondern böse. Daß es ohne Bedeutung war, wenn er nicht mehr rein war, nicht unbeschädigt, nicht stolz. Sondern daß er böse war. Daß er haßte mit aller Kraft seines Blutes: die Mörder und vielleicht manche der Gemordeten. Daß es ihm nichts ausmachen würde, die Pistole gegen eines dieser Gesichter mit den starren, augenlosen Masken zu heben, gegen viele Gesichter, eines neben dem anderen aufgestellt wie auf einer Richtstätte.
Und daß er es getan hatte, seine eigene Hand. Und daß er es nicht bereute.
Er hob die Hand vor die Augen und blickte auf sie nieder. Auch im Mondlicht waren die Schwielen und Narben zu erkennen. Es war nicht mehr die Hand, die den Bogen geführt hatte, den Melodien gehorsam, die die großen Toten erdacht und niedergeschrieben hatten. Es war eine andere Hand geworden. Keine einsame Hand mehr, nur sich selbst angehörig, einem abgeschlossenen und von Schweigen erfüllten Raum. Sondern eine, die sich ausgestreckt hatte oder ausgestreckt worden war, in einen anderen Raum, in den der Gewalt und des Bösen, und in diesem anderen Raum hatte sie sich verwandelt. Man sah es nicht, aber sein Herz wußte es. Und von der Hand aus hatte die Verwandlung sich ausgebreitet bis in die Kammern des Herzens hinein.
Er war nicht unanfechtbar gewesen, sonst würde dies nicht geschehen sein. Es hatte nicht genügt, im stillen und reinen zu leben und »nichts zu tun«. Er hatte die Augen vor dem Bösen der Erde verschlossen, und so hatte das Böse ihn wehrlos gefunden. Und wenn nicht wehrlos, so doch verwundbar und verwandelbar. Er hatte nicht »den Glauben« gehabt, wie Grita und Christoph ihn gehabt hatten. Seine Wurzeln hatten bis in die Tiefe der Erde gereicht, aber nicht darüber hinaus. Und so hatte der Schlag der Axt ihn bis ins Mark getroffen.
Er blickte sich um, schnell und scheu, wie er sich vier Jahre umgeblickt hatte. Es war noch Zeit, davonzugehen. Die Brüder würden es nicht erfahren. Für sie war er tot, und das letzte Fünkchen der Hoffnung würde in ihnen erlöschen, wenn er nach ein paar Monaten nicht wiedergekommen wäre. Sie würden ihn betrauern, wie man Millionen auf der verwüsteten Erde betrauerte. Ein reines, makelloses Bild, das von einer rohen Hand zerbrochen worden war.
Er setzte einen Fuß zurück, scheu und lautlos, wie ein Tier, vor dem die Äste sich bewegen. Aber da wurde die schwere Tür des Schafstalles zur Seite geschoben, und Erasmus stand vor dem matt erleuchteten Hintergrund. Er stand wie eine Erscheinung da, aus dem Dunklen in die Wirklichkeit gehoben, und blickte ohne Bewegung auf die Gestalt im Mondlicht.
Da hob Amadeus die Hand, wie sie als Kinder einander aus der Ferne gegrüßt hatten, und Erasmus erkannte die Bewegung. »Bruder …«, sagte er leise und hob die Arme auf.
Und dann stand Amadeus auf der Schwelle.
Es war der kleine Wohnraum des Schäfers, und sie hatten vor die Tiefe des Stalles eine Holzwand gestellt und sie mit Schilfmatten verkleidet. In der Ecke stand noch derselbe Lehmherd, in dessen Glut der Schäfer Pilze gebraten hatte, und ein kleines Torffeuer brannte unter der Asche.
Aber der Raum war nicht mehr leer und kahl wie damals. Ein alter Hausrat aus vergangenen Jahrhunderten erfüllte ihn, und Amadeus erkannte, daß er aus dem Schloß stammte. Seine Augen glitten über alles hin, auch über die beiden Gesichter, die ihm wortlos zugewendet waren, und zuletzt blieben sie an den drei Notenpulten haften, auf deren einem eine Kerze brannte, und ihr stilles Licht schimmerte auf den drei Instrumenten. Auf den Pulten waren Notenblätter aufgeschlagen.
»Ihr habt …«, sagte Amadeus leise.
»Ja, Bruder«, erwiderte Ägidius. »Dies ist, was wir gerettet haben. Dies ist es fast allein …«
Und dann stand er von seinem Platz vor dem Herde auf und kam langsam auf Amadeus zu. Er berührte ihn nicht. Er glitt nur einmal mit seiner Hand an den Falten des Mantels herab, den Amadeus um die Schultern gehängt hatte. Es war der gestreifte Mantel, vor dem die Kinder sich fürchteten und von dem die Erwachsenen ihre Blicke abwendeten. Immer von neuem hob seine Hand sich, und immer von neuem glitt sie an dem rauhen und schmutzigen Stoff abwärts. Es war, als ob er etwas Lebendiges streichelte, etwas, das des Schutzes bedurfte. Ein krankes Tier etwa oder ein Kind, das man geschlagen hatte.
Und unter dieser Bewegung schloß Amadeus langsam die Augen. Er hatte sie in das Gesicht des Bruders gerichtet gehabt, das ihm ganz nahe war, in die Augen, die der Bewegung der Hand gefolgt waren. Er hatte nicht auf das grau gewordene Haar geblickt oder auf die tiefen Falten um den schmalen Mund. Nur in die Augen, und vielleicht hatte er ohne Bewußtsein gefühlt, daß er viele Jahre lang solche Augen nicht mehr gesehen hatte. Augen, die auf eine unverständliche Weise übriggeblieben waren auf dieser Welt, »Geduld und Glaube der Heiligen«.
Und als er ihren Blick aufgenommen hatte in sich, schloß er die Augen, als wollte er nun nichts mehr sehen auf dieser Erde, neigte seine Stirn auf die Schulter des Bruders und blieb nun so, indes die Hand fortfuhr, über die Falten des Mantels zu gleiten.
Es war so still, daß nichts zu hören war als diese Bewegung der Hand. Erasmus hatte die Tür wieder geschlossen und stand nun hinter Amadeus, die Fingerspitzen auf seine Schulter gelegt, und es war ihnen allen, als wären die Jahre nicht gewesen. Als wären sie noch Knaben, vom Leben kaum gestreift, und als hätten sie immer so gestanden, den jüngsten und verletzlichsten zwischen sich, damit kein Leid ihn anrühre.
Und dann, als Amadeus die Stirn hob, nahmen sie leise den Mantel und den Rucksack von seinen Schultern und führten ihn zu dem alten Lehnstuhl vor dem Feuer, und Erasmus legte Holz auf die Glut, und dann saßen sie davor, die Hände zwischen den Knien gefaltet, und blickten in die Flammen, und ihre Gesichter, zwischen Licht und Schatten, waren wieder so wie die Gesichter des »Triptychons«, die Gesichter junger Märtyrer oder junger Heiliger, fremde, gereinigte Gesichter, ohne Lächeln, nur daß man nun aus ihnen ablesen konnte, daß sie in einem »feurigen Ofen« gewesen waren.
Sie sprachen nicht, und erst nach langer Zeit, als sie die Zigaretten rauchten, die Amadeus aus seiner Tasche gezogen hatte, beugte Erasmus sich vor, legte eine dunkle, gekrümmte Wurzel in das ersterbende Feuer und sprach die Verse der Kinderzeit leise vor sich hin:
An des Njemen anderm Rand
stehn drei Ahorn frisch und grün …
Er verstummte gleich wieder, weil er die Blicke der Brüder auf sich gerichtet fühlte, und als er den Kopf hob, sah er, daß es scheue Blicke waren, mit einem kaum merklichen Vorwurf.
Da legte er die dunkle, gekrümmte Wurzel noch einmal zurecht, faltete die Hände dann wieder zwischen den Knien, und so blieben sie alle drei, bis die weiße, dünne Asche sich über die erlöschende Glut zu legen begann.
2
Amadeus weigerte sich, eines der Lager zu benutzen, das die Brüder für sich gerichtet hatten, und da er sich mit einer ihnen unverständlichen Heftigkeit weigerte und darauf beharrte, vor dem Feuer auf der Erde zu schlafen, breiteten sie ein paar Kissen auf dem Lehmboden aus und legten zwei Decken darüber.
Als sie sich zu entkleiden begannen, nahm Amadeus aus seinem Rucksack einen braunen Schlafanzug, den ihm amerikanische Soldaten geschenkt hatten, schob die schwere Tür auf und verließ den Raum. Die beiden blickten einander schnell und verstohlen an, aber sie sprachen nicht. Die Kerze gab einen so matten Schein, daß keiner den Kummer aus des anderen Gesicht ablesen konnte. Sie bedurften dessen auch nicht.
Als Amadeus wiederkam, trug er sein uniformähnliches Gewand auf dem Arm und die schweren Schuhe in der Hand. Sein Gesicht war abwesend und verschlossen, als er das Kleid sorgfältig auf einem Stuhl zusammenlegte und die Schuhe darunterstellte. Er ging noch einmal zurück, um sie so nebeneinander zu stellen, daß die Spitzen in einer Linie standen, parallel mit der Kante des Stuhles. Aber er tat es wie im Traum, und er hörte auch den leisen Seufzer nicht, mit dem Erasmus die Augen schloß.
Als er vor dem Herde lag, den Kopf in die Hand gestützt und das Gesicht der erlöschenden Glut zugewendet, löschte Erasmus die Kerze.
»Gute Nacht«, sagte Amadeus leise.
Es war nun dunkel und still, nur von den letzten Torfstücken fiel ein ganz matter Schein in den Raum, und in dem Schilfdach rührte sich leise eine Maus. Erasmus und Ägidius hatten die Augen geschlossen und atmeten tief, als ob sie schliefen. Aber sie schliefen nicht, und von Zeit zu Zeit öffneten sie die Augen und blickten verstohlen zum Herde hinüber. Die Haltung des dort Ruhenden veränderte sich nicht, nur daß er von Zeit zu Zeit die linke Hand ausstreckte, um eine Zigarette an der letzten Glut zu entzünden. Aber sie sahen dann nur den dunklen Umriß der Hand, von einem roten Schein gesäumt, und die Hand schien ihnen fremd und so für sich allein, als ob sie keinem lebenden Körper angehörte. Der Körper bewegte sich nicht, die ganze Nacht nicht.
Der schmale Balken des Lichtes, den der sinkende Mond durch das kleine Fenster warf, wurde länger und matter. Er wanderte langsam über den Lehmboden, bis er das Fußende des Lagers vor dem Herde erreichte. Dort erstarb er, und die beiden Brüder hielten ihre Augen immer noch dorthingerichtet, auch als dort nichts zu sehen war als die Schwärze des nächtlichen Raumes. Es war so still, als ob ein Toter dort läge.
Erasmus war der erste, der es nicht mehr ertragen konnte. »Du schläfst nicht, lieber Bruder?« fragte er.
»Nein«, erwiderte Amadeus leise.
Auch die beiden Stimmen hatten etwas Unwirkliches in der Dunkelheit des Raumes, als schlüge kein lebendiges Herz hinter ihnen, sondern als stiegen sie aus der Tiefe der Erde auf, die sich schweigend um das Haus breitete. Über einem Moor gab es solche Stimmen, in der Nacht, versunkene Stimmen, und der späte Wanderer hielt den Schritt an und lauschte, fröstelnd in dem Nebelhauch, der seine Stirne streifte.
»Ich will es dir nun zu erzählen versuchen, lieber Bruder«, fuhr Erasmus fort. »Das wenige, das zu erzählen ist. Man erzählt es besser in der Nacht als unter der Sonne des Tages.«
Er richtete sich nicht auf und stützte den Kopf nicht in die Hand. Er blieb so, wie er gelegen hatte, die Arme über der Decke ausgestreckt, und er sprach dort hinauf, wohin seine offenen Augen gerichtet waren: in das hohe Schilfdach, über dem die Sterne standen, die man nicht sah.
»Als du fortgingst«, sagte er, »waren sie auf der Höhe ihrer Triumphe. Es war das Zeitalter der Fanfaren. Sie versuchten immer wieder, mich in den Dienst zurückzuholen, aber ich weigerte mich. Ein Generalmajor konnte sich schon ein bißchen weigern, und es war auch kein Zweifel, daß ich nicht gesund war. Die Ärzte nennen das eine Erkrankung der Kranzgefäße. Und darauf beharrte ich. Ägidius aber hatte seine sechstausend Morgen, und das war ihnen nun doch wichtiger als ein Infanteriegewehr.
Wir sind viel um dich unterwegs gewesen, lieber Bruder, aber es war zwecklos. Was sie hatten, hielten sie wie in einem stählernen Netz. Ägidius hatte sich erboten …«
»Du sollst nur die wichtigsten Dinge erzählen«, unterbrach ihn Ägidius schnell. »Die Nacht ist bald vorüber.«
»Wie du es willst, lieber Bruder, obwohl es nichts Wichtigeres gibt, als sein Gewand zu öffnen und zu sagen: ›Adsum! Hier bin ich!‹ So wie Isaak unter dem Messer tat. Nichts Wichtigeres und auch nichts Größeres … Nun, sie lachten nur. Man könne Kleider gegen Zigaretten tauschen, sagten sie. Aber nicht Leben gegen Leben.«
»Bruder!« bat Ägidius noch einmal.
»Es ist gut«, fuhr Erasmus fort.
Amadeus streckte wieder die Hand mit einer Zigarette nach dem Rest der Glut aus, und es war Erasmus, als sei die Hand in ihrer Bewegung nicht so sicher wie bisher. Aber der Schein des Feuers war nun ganz matt geworden, und es war möglich, daß er sich täuschte. Er wartete, bis er den glühenden Punkt wieder vor dem Herde sah.
»Wir hatten viel Mühe mit der Mutter«, fuhr er fort. »Sie empfand es als eine Schmach, so wie damals, als der Vater fortgegangen war. Nicht als ein Unrecht, lieber Bruder, verstehst du? Sondern als eine Schmach. Etwas, das nur den Liljecronas widerfahren könnte, weil sie Bauern seien und keinen Sinn für Größe hätten. Für den Bauern, sagte sie, gebe es nur die Heiligkeit der Mistgabel, nicht die Heiligkeit des Schwertes. Sie hatte auch den Redestil dieser Leute angenommen.
Aber uns beiden war sie von Nutzen. Man sah uns vieles nach um ihretwillen.
Als die Fanfaren aufhörten, ging sie übrigens fort, zu ihren Leuten ins Münsterland, auf eine Wasserburg. Dort leben die ›Standesgenossen‹ noch wie zu Zeiten Karls des Großen.
Wir blieben da, bis die Panzer kamen. Man ließ uns auch nicht früher fort. Wir trieben das Vieh zusammen und beluden die Schlitten. Christoph saß auf dem vordersten, so feierlich, als ob er zur Kirche führe …«
»Christoph …«, sagte Amadeus leise.
»Ja, er war schon weit über Siebzig, vielleicht war er schon achtzig. Aber sein Kinn war sauber ausrasiert, und er trug den großen Wolfspelz, den schon der Großvater getragen hatte. Wir hatten fünfundzwanzig Grad Frost, und der Schnee trieb von Osten über das Land.
Wir fuhren einen Tag, und dann waren die Panzer über uns. Es war so dunkel wie im Grab, aber sie hatten die Scheinwerfer angemacht und fuhren über die Schlitten hinweg, über das Vieh, über Frauen und Kinder. Sie fuhren vorwärts und rückwärts, ein paar Male. Es hörte sich an, wie wenn ein Rad über feuchtes Reisig geht. Sie feuerten aus allen Rohren, weil ein paar Schlitten im Graben lagen und ein paar auf das freie Feld entkommen wollten.
Wir verloren einander. Wir liefen auf einen Wald zu, der mitunter im Licht der Scheinwerfer auftauchte. Wir stürzten, und dann liefen wir wieder. Und im Walde verloren wir einander ganz. Wir verirrten uns und fanden die Straße nicht wieder, auch im Morgengrauen nicht.
Aber ich fand Ägidius. Er hatte einen Schuß durch die linke Schulter und war am Erfrieren. Er sagte es mir erst am Abend, daß er verwundet war und als es fast zu spät war.
Wir sind dann langsam hierhergekommen. Es hat fast drei Monate gedauert. Ich hatte gedacht, wir würden hier jemanden finden, von unterwegs. Sie wußten es alle, daß sie hierher sollten. Aber es war niemand da …«
»Die Toten stehen langsam auf heute«, sagte Amadeus nach einer Weile. »Und die Lebenden wahrscheinlich auch.«
Erasmus schwieg, und dann fuhr er mit einer veränderten, leisen Stimme fort: »Ich bin wohl kein Held gewesen, Bruder«, sagte er. »Ich hätte nicht laufen sollen, außer als letzter. Es kommt immer darauf an, als der wievielte man läuft. Aber der Ton hat mich wohl verstört, mit dem die Raupenketten über die Schlitten fuhren …, und sie schrien so, Bruder, sie schrien so entsetzlich …, auch die Pferde schrien …«
»Wir haben es verlernt, Bruder, dort«, sagte Amadeus wieder nach einer Weile, »uns unter ein Rad zu werfen, freiwillig. Das Rad holt uns schon ein, wenn Laima es will. Auch wenn wir auf einem Turm sitzen.«
»Aber sie rufen«, sagte Erasmus nun ganz leise. »Ich höre sie rufen. Jede Nacht. ›Herr Baron!‹ rufen sie. Und manchmal rufen sie noch anders. ›Ja‹, sage ich. ›Ich komme ja.‹ Aber ich komme nicht. Es ist zu spät. Ich habe sie verlassen. Der Vater würde sie nicht verlassen haben.«
»Wir wissen nichts vom Vater«, sagte Ägidius. »Wir wissen nur, daß er gut war. Gut sein und sich opfern ist nicht dasselbe.«
Ein ganz leises frühes Licht fiel durch das Fenster, und sie hörten den ersten Kuckuck draußen über dem Moor. Es war wie der Klang einer fernen Glocke, als würde das Sakrament durch die Frühe getragen. Sie lauschten alle drei, und zum erstenmal ließ Amadeus sich auf sein Lager zurücksinken und verschränkte die Arme unter dem Kopf.
Wie anders das alles ist bei ihnen, dachte er. Wie ganz anders … Das waren zehn oder zwanzig, und der Krieg hat sie genommen, wie der Blitz einen Baum nimmt … Aber die anderen, die Millionen wahrscheinlich, die man geschlachtet hat, wie man Vieh in einem Schlachthaus schlachtet …, und man kann es ihnen nicht sagen, weil sie sonst denken, daß man die Toten nach der Zahl mißt …, und auch alles andere kann man ihnen nicht sagen … Ägidius sagt auch nicht, daß er sich opfern wollte für mich … »Adsum! Hier bin ich!« Das ist etwas Großes …, aber ich kann nun nicht jede Nacht hier liegen und darüber sprechen … Das fanden wir doch unter des Vaters Papieren: »Derjenige, der weiß, spricht nicht. Derjenige, der spricht, weiß nicht.« Es hat ihn getroffen, an der Wurzel, daß er auf das Feld gelaufen ist. Es wird ihn vielleicht zerstören. Er denkt noch wie ein Edelmann, und wer heute so denkt, wird zugrunde gehen. Er ist der Letzte des Geschlechtes, nicht Ägidius, nicht ich. Er ist der Wehrlose. Alle Adeligen sind wehrlos heute. Der Tank ist das Sinnbild der Zeit, nicht das Schwert. Der Tank und die Peitsche …
Der Kuckuck rief immer noch, und Amadeus stand auf. Er nahm eine Büchse mit Kaffee aus dem Rucksack und stellte sie auf den Herd. Dann nahm er seine Kleider und Schuhe und ging hinaus.
Der Morgen blendete ihn, und er blieb eine Weile stehen, den Rücken an die Wand des Stalles gelehnt. Daß die Erde so neu sein konnte jeden Morgen, so auferstanden aus der Nacht wie aus einem Grabe! Das Moor dampfte in der Morgensonne. Die Felsen dahinter leuchteten wie fließendes Gold. In den niedrigen Kiefern schimmerte das Netzwerk der Spinnen. Nichts bewegte sich als der erste Bussard, der über den Torfhügeln seine Kreise zog. Hier war kein Böses gewesen, nicht gestern, nicht vor tausend Jahren. Das Harte der Natur und der Geschöpfe war gewesen, immer, aber nicht das Böse des Menschen. Es war zu einsam gewesen hier für das Böse.
Nur der Schäfer war gewesen, und er war zu alt gewesen für Menschenrache. Es hatte nicht gelohnt mit ihm. Und seitdem sie ihn, Amadeus, fortgeführt hatten von hier, war dies alles unberührt geblieben. Wie ein Bad, das die Engel bereitet hatten für alle, die noch einmal auferstanden waren. Auch für die Geschlagenen und Gezeichneten, ja, für sie am meisten.
Aber gab es das Heilende in der Natur? Gab es überhaupt ein Heil auf dieser Erde? Ja, wenn Christoph gerettet worden wäre, das würde es leichter gemacht haben. Er hatte »den Glauben« gehabt. Man brauchte nicht denselben Glauben zu haben, aber es war schön, jemanden anzusehen, der ihn hatte. Jemanden, der keinen Stab brauchte, keine Philosophie, aber der das kleine Licht im Heidekraut sah. Für den keine Grenzen zwischen dem Unterirdischen und dem Überirdischen waren. Der eingeschlossen war in den großen Kreis und der überall und zu jeder Stunde sagen konnte: »Hier bin ich, Herr!«
Der es auch sagen konnte, wenn die Eisenbänder über seine Augen rollten und seinen Leib zerbrachen. Der nicht zu fragen brauchte: »Weshalb bin ich fortgelaufen?« Sondern der nur zu sagen brauchte: »Hier bin ich, Herr!«
Amadeus seufzte und ging langsam durch den niedrigen Wald zu dem kleinen Wasser, das am Rande des Moores lag. Der Tau näßte seine bloßen Füße, und er spürte die Kühle der Erde bis an sein Herz. Er sah sich lange um, ehe er das Nachtkleid abstreifte und in das Wasser stieg. Der Grund war sandig und weich, und erst ein Stück vom Ufer entfernt schimmerte er dunkel und moorig aus der Tiefe.
Der Kuckuck rief noch immer, aber Amadeus zählte die Jahre nicht, die er ihm versprach. Das Leben zählte nicht mehr nach Jahren.
Man muß ihm helfen, dachte er. Ehe es sich weiterfrißt in ihm und die Wurzeln zerstört. Man muß ihm sagen, daß ich, ohne die Hand zu rühren, Tausende habe sterben sehen. Daß man aufhören muß zu fragen: »Wo ist dein Bruder Abel?« Weil es Millionen Brüder geworden sind. Ja, daß man wahrscheinlich überhaupt aufhören muß zu fragen, statt nur zu sein, still und ohne Frage zu sein. Das Fragen hat die Welt verdorben, seitdem die Schlange die erste war, die gefragt hat …