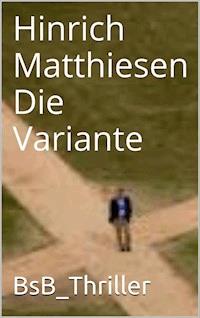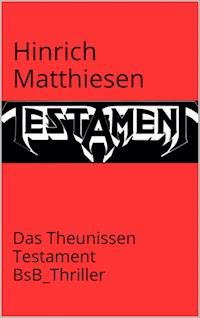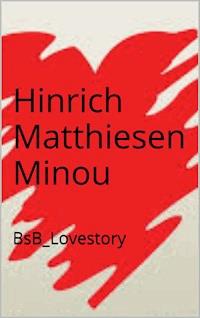Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Best Select Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hinrich Matthiesen Werkausgabe Die Romane
- Sprache: Deutsch
Das Thema ist Dynamit. Marion, 14, ist abends vom Spielen nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei fahndet, ohne Erfolg. Die Mutter sucht und findet ihr totes Kind im kalten Wasser. Für die Polizei fast ein Routinefall, für Marions Mutter Trauer und Verzweiflung. Doch bald kennt Hanna Degner nur noch ein Gefühl: Rache. Mit dem Instinkt einer Raubtiermutter, der man das Junge genommen hat, nimmt sie die Spur zum Täter auf, kreist die Bestie ein, lauert ihr auf. Selbstjustiz ist ein brisantes Thema. Hinrich Matthiesen hat es schon in seinen Romanen 'Brandspuren' und 'Der Skorpion' behandelt. Diesmal zeichnet er das Psychogramm einer Mutter, die Rache will. Die es nicht erträgt, dass der Mörder ihrer Tochter weiterhin seinen Garten pflegt, seinen Hund streichelt, sich zu seiner Frau legt… Hinrich Matthiesen will nicht Gesetz und Ordnung in Frage stellen, es geht ihm darum aufzuzeigen, dass privates Schicksal oft nicht in Paragraphen zu fassen und nicht nach Paragraphen zu sühnen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinrich Matthiesen
Jahrgang 1928, auf Sylt geboren, wuchs in Lübeck auf. Die Wehrmacht holte ihn von der Schulbank. Zurück aus der Kriegsgefangenschaft, studierte er und wurde Lehrer, viele Jahre davon an deutschen Auslandsschulen in Chile und Mexico. Hier entdeckte er das Schreiben für sich.
1969 erschien sein erster Roman:MINOU. Dreißig Romane und einige Erzählungen folgten. Die Kritik bescheinigte seinem Werk die glückliche Mischung aus Engagement, Glaubwürdigkeit, Spannung und virtuosem Umgang mit der Sprache. Die Leser belohnten ihn mit hohen Auflagen.
Immer stehen im Mittelpunkt seiner Romane menschliche Schicksale, Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Hinrich Matthiesen starb im Juli 2009 auf Sylt, wo er sich Mitte der 1970er Jahre als freier Schriftsteller niedergelassen hatte.
»Zum literarischen Markenzeichen wurde der Name Matthiesen nicht zuletzt durch die Kunst, in eine pralle Handlung Aussagen zu verweben, die außer dem aktuellen stets auch einen davon unabhängigen Bezug haben. Gedankliche Strenge, sprachliche Disziplin und ein offensichtlich unauslotbarer verbaler Fundus lassen Matthiesen zu einem Kompositeur in Prosa werden.«
Deutsche Tagespost
»Matthiesen ist zu beneiden um seine Fähigkeiten: Kompositionstalent, menschliche Einfühlung, scharfe Beobachtungsgabe – und vor allem um seinen Stil«
Deutsche Welle
»Matthiesen ist für seine genauen Recherchen bekannt. Seine Bücher weichen nicht einfach in exotische Abenteuer aus, sondern befassen sich immer wieder mit deutscher Vergangenheit und Gegenwart. Unterhaltsam sind sie allemal. «
FAZ-Magazin
Werkausgabe Romane Band 11
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Der Roman
Das Thema dieses Romans ist Dynamit – auch 30 Jahre nach seinem ersten Erscheinen 1983. Marion, 14, ist abends vom Spielen nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei fahndet, ohne Erfolg. Die Mutter sucht und findet ihr totes Kind im kalten Wasser. Für die Polizei fast ein Routinefall, für Marions Mutter ein Abgrund aus Trauer und Verzweiflung. Doch bald kennt Hanna Degner nur noch ein Gefühl: Rache. Mit dem sicheren Instinktverhalten einer Raubtiermutter, der man das Junge weggenommen hat, spürt sie der Bestie hinterher, kreist sie ein, lauert ihr auf ...
Selbstjustiz ist ein brisantes Thema. Hinrich Matthiesen hat es schon in seinen Romanen »Brandspuren« und »Der Skorpion« behandelt. Diesmal zeichnet er das Psychogramm einer Mutter, die Rache will. Die es nicht erträgt, dass der Mörder ihrer Tochter weiterhin seinen Garten pflegt, seinen Hund streichelt, sich zu seiner Frau legt, als sei nichts gewesen...
Titelverzeichnis der Werkausgabe in 31 Bänden am Ende des Buches
Hinrich Matthiesen
Mit dem Herzen einer Löwin
Roman
:::
BsB_BestSelectBook_Digital Publishers
Werkausgabe Romane
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Band 11
1.
Hans Severin wäre gern an den kleinen Verkaufsstand getreten, um etwas Heißes zu trinken, aber er hatte Bedenken, sich zu den anderen unter die rote Markise zu stellen, mitten ins Licht. Er wusste nicht, wie der Abend verlaufen würde, ob erfolgreich oder nicht, ob glatt oder mit Komplikationen, und so hielt er es für besser, dass sich später niemand an ihn erinnerte, weder einer der vielen, die mit dampfendem Atem von der Eisbahn heraufkamen, um sich zu stärken, noch die beiden Verkäuferinnen, die Punsch und Grog ausschenkten und heiße Würstchen feilboten. So blieb er im Dunkel, sah wieder auf die Eisbahn hinunter, wo im Licht der Uferlampen die Schlittschuhläufer ihre Bahnen zogen, suchte inmitten des Getümmels nach der roten Pudelmütze, die in unregelmäßigen Abständen auftauchte und wieder in der Menge verschwand. Einmal war das Kind bis auf fünf, sechs Schritte an ihn herangekommen, und nichts hatte ihm die Sicht verstellt, sodass er von dem leuchtenden Rot bis hinunter zu den altmodischen Schlittschuhen das ganze Mädchen vor sich hatte. Der Anblick der schlanken, im Lauf leicht vorgebeugten Gestalt hatte ihn erregt.
Er kannte die Vierzehnjährige. Erst vor acht Tagen war sie in seinem Haus gewesen, auf der Geburtstagsfeier seines Sohnes, der die ganze Schulklasse eingeladen hatte. Das Mädchen war ihm unter den vielen Halbwüchsigen als etwas Besonderes aufgefallen. Ernste Kinderaugen und dazu ein Frauenmund. Langes, dunkles, gepflegtes Haar. Nichts Grobes im Gesicht, wie die Natur es dieser Altersstufe so oft auflädt. Ein Körper, nicht derangiert vom physischen Umbruch, sondern die fraulichen Formen ganz zart angedeutet. Sie hatte zu ihrer Jeans eine weiße Bluse angehabt, und hin und wieder, in der Turbulenz der Spiele, war deutlich geworden, dass sie unter der Bluse nichts weiter trug. Am Abend hatte er sie, zusammen mit ein paar anderen Kindern, nach Hause gefahren. Sie hatte neben ihm gesessen, und ihre Nähe war beglückend gewesen. In den folgenden Tagen und Nächten hatte er immer wieder an sie denken müssen, ja, er war sogar mehrere Male in die Nähe ihres Hauses gefahren in der Hoffnung, eine Begegnung inszenieren zu können, die für sie als Zufall gegolten hätte. Heute Nachmittag endlich hatte er sie mit den umgehängten Schlittschuhen herauskommen und zum Bus gehen sehen. Es war nicht nötig gewesen, dem Bus zu folgen, denn er kannte das Ziel. Er war zum Bredenbeker Teich gefahren, und eine Weile später war auch sie dort erschienen. Er sah auf die Uhr. Es war halb sieben. Er überlegte sich, wie er vorgehen sollte. Meistens, das hatte er beobachtet, lief sie in der Gesellschaft einiger Jungen und Mädchen ihrer Klasse. Das eine oder andere Gesicht war ihm von der Geburtstagsfeier her in Erinnerung geblieben. Es würde also auf den Nachhauseweg ankommen, denn aus einer ganzen Schar könnte er Marion Degner nicht herauslocken. Dann würde er sein Vorhaben eben verschieben müssen. Irgendwann, dachte er, erwische ich sie auch mal, wenn sie allein ist.
Hans Severin war auf halbwüchsige Mädchen fixiert. Was den Umgang mit Frauen betraf, steckte er schon seit langem in einer resignativen Phase, allzu früh mit seinen dreiundvierzig Jahren. Die Ursache war ihm bekannt. Sein Arzt hatte sie ihm unverhohlen genannt: »Der Sex ist heute für jedermann so leicht und geheimnislos zu bewerkstelligen wie Eisessen oder Ins-Kino-Gehen oder wie das schnelle Bier im Lokal um die Ecke. Er ist nicht mehr aufregend, und wo die Aufregung fehlt, klappt’s auch nicht mehr mit der Anregung.« Natürlich wusste Hans Severin, dass es eine Binsenweisheit war, die der Arzt da von sich gegeben hatte. Mit der Befreiung im Sexuellen war eine Menge Reiz geschwunden. Es war möglich, den Weg zur Arbeit für ein paar Minuten zu unterbrechen und zwischen Apotheke und Konditorei ein Lokal zu betreten, in dem nackte Frauen zur Schau lagen. Für eine Mark. Für ein paar Mark mehr durfte man sie auch anfassen.
Es war möglich, im Anzeigenteil der Tageszeitung zwischen Gebrauchtwagen, Nähmaschinen und Mastgänsen die Offerten der Frauen zu studieren und sich, ganz nach eigenem Geschmack, zu entscheiden: blond, dunkelhaarig, Rotschopf, Hausfrau, Schülerin, Studentin, Polin, Spanierin, Dänin. Die Inserate lasen sich wie ein Katalog für alle Wünsche. Jede Altersstufe ab achtzehn, jede Hautfarbe, jede Körperform. Auch das Ausgefallene: Leder, Französisch, Griechisch. Und das Arrangement war kein Problem. Man rief an oder fuhr hin oder ließ kommen. Fast alles war möglich geworden, und die Magazine, Filme und Videobänder, die in jeder Stadt zu haben waren, sorgten für den Rest.
Vier oder fünf Jahre lang war er ein undisziplinierter Konsument dieses ausgeuferten Marktes gewesen, der ihm jeden Wunsch erfüllte, und damit hatte das Wünschen aufgehört. Die Phantasie war arbeitslos geworden, und das war der Tod der Lust, jedenfalls bei ihm. Mit einer Ausnahme. Den ganz jungen Mädchen, fand er, haftete noch Geheimnis an, und so waren sie es, diese eben an der Schwelle ihres Aufblühens angelangten Geschöpfe, diese Kindfrauen, die Sehnsucht, ja Begierde, immer noch möglich machten.
Dafür gab es in seinem Leben ein gutes Dutzend Beispiele, aber nur bei der Hälfte davon war das Einverständnis der Beteiligten vorhanden gewesen, sei es, dass Geld oder Geschenke sie willfährig gemacht, sei es, dass Alkohol oder Drogen ihre Hemmungen weggeschwemmt hatten. Einmal schien es tatsächlich so etwas wie Liebe gewesen zu sein. Eine Fünfzehnjährige. Die Tochter eines seiner Angestellten. Die Eltern hatten sie auf ein Betriebsfest der Firma mitgenommen, und zu vorgerückter Stunde, seine Frau war schon nach Hause gefahren, hatte Hans Severin ihr sein Büro gezeigt. Dabei war es dann geschehen. Auf dem Teppich. Vor dem Schreibtisch. Und noch jetzt erinnerte er sich ihrer ins Dunkel geflüsterten Worte: »Ich habe dich schon den ganzen Abend beobachtet und darauf gewartet dass du mich zum Tanzen holst, und jetzt ist es viel mehr als bloß Tanzen.« Danach hatten sie sich noch mehrmals heimlich getroffen, aber dann war das Mädchen mit der Schule fertig gewesen und hatte irgendwo in Süddeutschland eine Lehre angetreten.
Waren schon die einvernehmlichen Begegnungen kein Ruhmesblatt für ihn, so hätte die andere Handvoll ihn bei Bekanntwerden vor den Richter gebracht. In einem Falle hatte er eine junge Anhalterin, nachdem sie sich im Auto gegen seine Zudringlichkeit gewehrt hatte, mit einer Wasserpistole ins Kornfeld getrieben, hatte gedroht, sie zu erschießen, wenn sie sich ihm verweigerte. Sie war dreizehn Jahre alt gewesen. Ihre Eltern hatten Anzeige erstattet, aber ohne Erfolg. Es hatte zu wenig Anhaltspunkte gegeben, denn alles war im Dunkeln geschehen, und auch beim Wegfahren hatte er das Licht nicht eingeschaltet, sodass die Kleine, die am Straßenrand zurückgeblieben war, das Autokennzeichen nicht hatte lesen können. In zwei anderen Fällen hatte er den Kindern im dunklen Park aufgelauert, sie ins Gebüsch gezerrt und sich an ihnen vergangen. Die Eltern hatten in beiden Fällen die Polizei eingeschaltet, aber für die Verfolgung des Täters hatte es wiederum nicht genügend Spuren gegeben und so war die Angelegenheit im Sande verlaufen. Und dann war da noch die Kleine vom letzten Sommer... Ja, er hatte schon seine Vergangenheit, aber bis jetzt war es ihm immer gelungen, sie zu verbergen, vor seiner Frau, seinem Sohn, seinen Mitarbeitern, seiner Umwelt. Er war ein Wolf im Schafspelz, und nun gab es da, fast zum Greifen nah, wieder so eine Kindfrau. Und was für eine! Keine dreckige, ohnehin versaute Göre, wie man sie abends im Bahnhofsviertel aufgabeln konnte, sondern ein Elitegeschöpf!
Aber kurz vor sieben schien sich für ihn eine Enttäuschung anzubahnen. Neben dem Verkaufsstand, dessen Markise schon eingerollt wurde, tauchte noch einmal die rote Pudelmütze auf, und er wollte schon aus dem Schatten treten, um Marion Degner anzusprechen, da sah er, dass sie nicht allein war. Mehrere Mädchen standen um sie herum, und er hörte eines von ihnen sagen: »Kommt, wir gehen noch zu mir nach Haus!«
Er gab sofort auf, hoffte auf einen anderen Abend, ging zu seinem Volvo, den er entfernt geparkt hatte, stieg ein, fuhr los. Kurz darauf befand er sich auf der verkehrsreichen von Westen her in die Stadt einmündenden Straße, passierte gerade die Endstation der Buslinie, und plötzlich war alle Verheißung wieder da: An der Haltestelle entdeckte er das Mädchen mit der Pudelmütze, und die Umstände geboten es ihm geradezu, anzuhalten, zurückzusetzen und in die Schleife hineinzufahren, denn er hatte Marion Degner laufen und winken sehen. Dem Busfahrer war das wohl entgangen, oder er hatte nicht noch einmal halten wollen. Jetzt jedenfalls stand das Mädchen, die Schlittschuhe in der Hand, allein unter dem Wetterdach, stampfte mit dem Fuß auf und sah dem davonfahrenden Bus nach.
Er hielt am Bordstein, stieg aus und begrüßte sie mit den Worten: »Nicht die Nerven verlieren! Nun wirst du sogar bis vor deine Haustür gebracht!«
»Oh, Herr Severin! Der rechte Mann zur rechten Zeit am rechten Ort!«
Dieser kesse Kommentar beflügelte ihn, ließ Bedenken nicht aufkommen. Das Mädchen stieg, man kannte sich ja, in sein Auto, zog den Anorak aus, legte ihn sich auf den Schoß und die Schlittschuhe obendrauf.
Der Volvo rollte aus der Schleife, aber dann ging es nicht stadteinwärts, sondern stadtauswärts.
»Nanu? Ich wohne aber...«
»Ich muss nur eben tanken. Hab’ grad gesehen, dass da vorn noch geöffnet ist. Dauert nur ein paar Minuten.«
Doch er fuhr an der Tankstelle vorbei, bog rechts ab in einen Waldweg, und als er kurz darauf anhielt, sagte Marion Degner, und es klang nicht nach Panik, klang nicht einmal ängstlich: »Herr Severin, das sollten Sie nicht tun!«
Wieder verkannte er die Worte, hielt sie nur für einen vorsätzlich schwachen Ausdruck der Gegenwehr. In der Dunkelheit blieb ihm verborgen, dass sie blass geworden war und vor Angst zitterte. Aber er nahm wahr, wie sie nach dem Türgriff suchte, ihn nicht finden konnte und dann ganz schnell das Fenster herunterkurbelte. Er wollte verhindern, dass sie sich hinausbeugte und um Hilfe rief, zog sie an sich, griff unter ihren Pullover, bekam den Schlüssel zwischen die Finger, den sie um den Hals trug, griff noch einmal zu und fühlte für den Bruchteil einer erregenden Sekunde die kleine knospenhafte Brust. Marion Degner stieß ihn zurück, schlug um sich, versuchte, sich seiner zu erwehren, aber es gelang ihr nicht.
»Du kleine Raubkatze!«, sagte er, und ehe sie ein zweites Mal nach dem Türgriff tasten konnte, beugte er sich über sie und drehte in Windeseile an dem kleinen Handrad, das sich neben ihrem Sitz befand. Die Lehne senkte sich, und als aus Rückenpolster und Sitz ein schmales Bett geworden war, drückte er sie hinunter, warf sich auf sie. Sie wehrte sich verzweifelt, wehrte sich mit Armen und Beinen, Das brachte ihn auf. Er schlug zu. Zweimal traf seine Rechte ihr Gesicht. Sie weinte, bebte am ganzen Körper, begriff nicht, dass da ein Mann, der noch vor ein paar Tagen mit väterlicher Fürsorge Mohrenköpfe verteilt und lustige Kinderspiele ausgerichtet hatte, so hemmungslos und brutal über sie herfiel.
Seine Hände gerieten in eine fieberhafte Tätigkeit. Er riss ihr die Skihose herunter, den Slip, wollte ihr zwischen die Beine greifen, aber sie ließ es nicht zu, presste sie fest gegeneinander und drehte sich auf die Seite. Sein stoßweiser Atem kam ihrem Ohr ganz nah, hörte sich an wie das Hecheln eines Hundes. Sie ekelte sich wie nie zuvor in ihrem Leben. Noch einmal der Zugriff, aber sie gab nicht nach, presste ihre Schenkel noch gespannter gegeneinander. Er wurde zornig, packte sie. Da sie schön auf der Seite lag, war es ihm ein Leichtes, sie weiter herumzudrehen und sie bäuchlings auf die Polster zu drücken. Dann warf er sich auf sie, löste seinen Gürtel, streifte die Kleidung herunter, schob seinen Leib gegen die kühle, samtene Wölbung, drängte, drängte, drang ein. Sie schrie auf, und sofort schlug er wieder zu. Und dann ging ihr leises Wimmern in seinem Stöhnen unter. Als ihn der Schauer erfasste, drückte er sein Gesicht in ihr langes, weiches Haar. Er richtete sich auf, ordnete seine Kleidung, setzte sich wieder auf den Fahrerplatz. Wie in Trance kam auch sie nun hoch, beugte sich weit vor. Er glaubte, sie suche nach ihrer Skihose, aber sie tastete den Fußboden ab, packte einen ihrer Schlittschuhe, warf sich herum, und dann stieß sie mit aller Kraft, derer sie fähig war, die spitze Kufe in sein Bein. Er geriet außer sich vor Schmerz, packte sie bei den Schultern, schleuderte sie zurück, und die Wucht, mit der ihr Nacken gegen den Fensterrahmen stieß, war tödlich, zerbrach ihr das Genick.
Er sah es nicht, aber er hörte und spürte, dass sie in sich zusammensank, mit dem Kopf gegen die Konsole fiel und vom Sitz glitt. Er stieg aus, lief um den Wagen herum, öffnete die Beifahrertür, zog das Mädchen heraus, legte es in den Schnee.
»Marion!« Und dann noch einmal, lauter jetzt: »Marion!«
Er hielt ihren Kopf, bewegte ihn, ließ ihn los, sodass er zurückfiel in den Schnee, hob ihn ein zweites Mal hoch, tastete den Nacken ab, und mit seinen bebenden Händen spürte er: Der Kopf pendelte hin und her wie ein aus seiner Halterung gerissener Gegenstand.
»Aber... aber das hab’ ich nicht gewollt! Nicht das! Glaub mir.« Doch da war kein Ohr für seine gestammelten Worte. Als er begriff, dass sie ungehört verklungen waren, erschreckte ihn, im Nachhinein, seine eigene Stimme. Er stand auf, wurde sich erst jetzt seiner Verletzung wieder bewusst. Ihm war, als stecke das Eisen noch immer in der Wunde, so heftig war der Schmerz. Er untersuchte das Bein, so gut es im Dunkeln möglich war, spürte das viele Blut, versuchte ein paar Schritte, ging fast bis an die Straße, sah auf den vorbeiflutenden abendlichen Verkehr, dachte: Und in den muss ich jetzt rein! Aber was mach ich mit ihr? Ich kann sie doch nicht im Wald liegenlassen! Vielleicht hat jemand meinen Wagen einbiegen sehen...
Er kehrte zurück, beugte sich wieder über das immer noch halbentblößte Kind, tastete, obwohl er wusste, dass es sinnlos war, nach dem Puls, ließ die leblose Hand zurückfallen.
Dann wusch er Marion Degner, wusch ihr Blut weg und die Spuren seines Spermas. Immer wieder nahm er eine Handvoll Schnee auf und rieb damit über Haut und Kleidung. Danach ging er zum Wagen, säuberte den Sitz, so gut es ging, dachte: Ich werde nachher die Heizung voll aufdrehen, damit es trocknet.
Er zog das Mädchen wieder an, hob es auf, legte es auf den Rücksitz, holte eine Decke aus dem Kofferraum und breitete sie über die Tote, setzte sich ans Steuer, fuhr los, fuhr ohne Ziel durch die Straßen, im Rücken die Tote, im Bein den bohrenden Schmerz und im Kopf das Chaos. Es wunderte ihn, dass er in der Lage war, seinen Wagen zu lenken und auf Ampeln und Schilder zu reagieren, aber gerade diese mechanischen Verrichtungen und das Sich- Einfügen in das seit zwanzig Jahren befolgte Reglement bewirkten, dass er ganz allmählich, wenn auch nicht zur Ruhe, so doch zu klarer Überlegung kam. Nachdem er eine halbe Stunde durch die Stadt gefahren war, hatte er einen Entschluss gefasst.
Bei der nächsten roten Ampel beugte er sich nach rechts hinüber, tastete auf der Fußmatte nach den Schlittschuhen des Mädchens, hob sie auf, legte sie neben sich, hob auch den heruntergefallenen Anorak auf, suchte in den Taschen, fand den Schlittschuhschlüssel und den Personalausweis des Mädchens, steckte beides in die Jacke zurück. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr er weiter. Er dachte: Ich habe keine Wahl. Sie wird dann eben, wenn man sie findet, auf dem Eis verunglückt sein. Aber ich werde sie nicht zum Bredenbeker Teich zurückbringen, da sind jetzt noch zu viele Leute, und das Ufer ist erleuchtet. Ich nehme die Eisbahn am anderen Ende der Stadt, den Hamfelder See, denn da müsste es jetzt dunkel sein und leer.
2.
Hans Severin sah den Hang hinunter. Fahles Mondlicht erhellte die Rodelbahn. Auch hier hatten bei Tage Hunderte von Schlittenkufen die Schneedecke zu einer harten, glatten Schicht zusammengepresst. Die Strecke war achtzig bis hundert Meter lang, und sie hatte einen Neigungswinkel von etwa dreißig Grad. Wo sie endete, begann der Hamfelder See.
Er wusste, die Mutigeren unter den Kindern und Jugendlichen die sich hier in ihrer freien Zeit zum Rodeln einfanden, benutzten die Uferkante als Sprungschanze, flogen, wenn sie genug Schwung hatten, mit ihren Schlitten ein Stück durch die Luft, setzten auf der Eisdecke des Gewässers ihre Fahrt fort und kamen dabei nicht selten den Schlittschuhläufern ins Gehege. Wer weniger Mut hatte, bremste kurz vor der Kante ab. Er hatte beide Temperamente oft genug beobachtet, hatte, wie am Bredenbeker Teich, manchmal ganze Nachmittage auch an diesem Ufer gestanden und mit wachen Blicken die herabsausenden Schlitten verfolgt, vor allem die, auf denen die Mädchen saßen.
Nun war es Abend, und die Bahn war leer. Soweit er sich auf das Mondlicht verlassen konnte, befand sich auch unten auf dem See niemand mehr. Das beruhigte ihn.
Aber die Wunde machte ihm zu schaffen. Er stand, leicht vorgebeugt, ganz oben an der Böschungskante und umklammerte mit beiden Händen seinen rechten Oberschenkel. Er hatte die Handschuhe ausgezogen und spürte nun den klebrigen Hosenstoff zwischen den Fingern. Vorhin, im Auto, hatte es weniger stark geblutet. Er presste die Daumen auf das Bein, um den Schmerz zu drosseln. Im Moment brachte das Linderung, aber er wusste, der Schmerz würde gleich erneut und heftiger als vorher einsetzen. Doch für das, was er jetzt vorhatte, brauchte er beide Hände und die Beine dazu. Und Eile war auch geboten.
Er nahm seinen Schal ab, einen langen Schal aus feiner weißer Kaschmirwolle, schlang ihn um das verletzte Bein, machte einen Knoten. Dann ging er den Hang hinunter, aber nicht über die glatte Rodelstrecke, sondern an ihrem Rand entlang, stapfte durch den Schnee.
Der Weg bergab brachte das Blut noch mehr in Gang, tief im Fleisch pochte die Wunde bei jedem Tritt, und in Wellen strömte der Schmerz weiter bis ins Knie und bis in die Leistengegend. Dieses verfluchte Biest!, dachte er. Wie soll ich nun zu Haus das Loch in meinem Bein erklären? Und einen Arzt brauche ich natürlich auch. Aber was sag’ ich ihm? Mir muss etwas einfallen. Was Plausibles. Vielleicht: Ich stand an der Bodentreppe, und meine Frau wollte mir unseren schweren Werkzeugkasten herunterreichen. Er fiel ihr aus den Händen, und eine der scharfen eisernen Ecken schlug mir ins Bein. Ja, das müsste den Arzt überzeugen. Und für Gudrun muss ich mir etwas anderes ausdenken.
Er kam nur langsam voran, brauchte für den Abstieg mehrere Minuten. Als er unten angekommen war, setzte er sich auf die Kante der kleinen Sprungschanze, ließ sich dann vorsichtig hinab, betrat den See.
Es herrschte mäßiger Frost. Er schätzte die Temperatur auf drei, höchstens fünf Grad unter Null. Auch an den Tagen davor hatte es kaum niedrigere Temperaturen gegeben, aber da es eine Periode mit Dauerfrost gewesen war, hatte das ausgereicht, den Kindern der Stadt auf fast allen Gewässern der Umgebung die Winterfreuden zu bescheren. Für norddeutsche Klimaverhältnisse war es ein früher Kälteeinbruch gewesen, denn der Dezember hatte gerade erst begonnen.
Severin machte ein paar Schritte. Dort, wo die Schlitten nach ihrem kurzen Flug gelandet waren, hatten die Kufen die Eisdecke aufgeraut. Er konnte die einzelnen Schürf- und Schlagstellen nicht erkennen, sah aber die Verfärbung im Ganzen und spürte die Unebenheit unter seinen Schuhsohlen. Er kniete sich hin, zog unter dem Mantel seinen Wagenheber hervor, schlug damit auf das Eis ein. Es dauerte lange, bis er es durchstoßen hatte. Er vergrößerte das Loch, tastete den Rand ab, stellte fest, dass die Schicht eine Stärke von etwa zehn Zentimetern hatte, hielt das für zu viel. So verwarf er den Plan, diese Stelle, die ihm wegen ihrer außergewöhnlichen Beanspruchung als besonders geeignet erschienen war, zu benutzen, richtete sich wieder auf.
Er ging ein Stück weiter auf den kleinen See hinaus, fast bis zur Mitte, blieb stehen, stieß mit dem Fuß auf, hörte das Knacken ringsum und spürte das leichte Schwingen des Untergrunds, war erleichtert, kniete sich sofort wieder hin und schlug mit seinem Werkzeug auf das Eis. Die Öffnung
entstand schneller als beim ersten Mal. Wieder prüfte er die Stärke der Schicht. Sie war geringer als in Ufernähe. Hier also, dachte er, hier wird es sein!
Er zog seinen Mantel aus, legte ihn ab, um die Stelle leichter wiederfinden zu können, ließ auch das Werkzeug da, kehrte zum Ufer zurück und erklomm den Hang, ging dann noch etwa hundert Schritte weiter, dorthin, wo er unter schneebedeckten Kiefernzweigen seinen Volvo abgestellt hatte. Er schloss den Wagen auf, setzte sich hinters Steuer und zündete sich eine Zigarette an, drückte sie aber schon nach ein paar Zügen wieder aus. Noch einmal tastete er durch den Schal und den Hosenstoff hindurch die Wunde ab. Möglich, dass der Blutfluss nun weniger stark war, aber der Schmerz hatte nicht nachgelassen. Die Wunde war, so schätzte er, mindestens drei Zentimeter tief. Wie eine Spitzhacke war ihm die Schlittschuhkufe in den Schenkel gefahren. Wenn sie wenigstens rund gewesen wäre!, dachte er. Dann hätte ich jetzt höchstens einen blauen Fleck, und die Haut wäre etwas abgeschürft. Warum, zum Teufel, musste sie mit diesen altmodischen Dingern unterwegs sein, wo doch ihre Eltern so viel Geld haben, dass sie ihr welche aus Gold kaufen könnten! Diese Oldtimer haben bestimmt mal ihrer Großmutter gehört.
Er nahm die beiden Schlittschuhe vom Beifahrersitz, stieg aus, öffnete eine der hinteren Türen des Wagens. Er schlug die Wolldecke zurück, beugte sich über die Tote, zog den Körper ein kleines Stück vor, sodass die Füße über die Sitzfläche hinausragten und im Freien hingen. Es war mühsam, die Schlittschuhe an die hellen, bis über die Waden reichenden Schnürstiefel zu schrauben. Als sie endlich festsaßen, steckte er den Schlüssel ein. Er wusste nicht mehr, welcher Schlittschuh ihn getroffen hatte, wischte beide mit seinem Taschentuch ab. Dann zog er dem Mädchen den Anorak an, lud es sich auf die Schulter, verbiss den Schmerz, der unter dem zusätzlichen Gewicht verstärkt einsetzte, schloss den Wagen ab, ging.
Als er die Rodelbahn erreichte, überlegte er, ob er sich den Abstieg erleichtern und die Last den Hang hinabrollen lassen sollte, entschied sich dann aber doch für die anstrengendere Methode. Bei aller Rigorosität, mit der er vorging, scheute er sich, die Tote einfach hinunterzukippen. Erst als er den schwierigen Abstieg zur Hälfte bewältigt hatte, kam ihm der Gedanke, dass er auch vom Strategischen her die richtige Methode gewählt hatte. Wer weiß, dachte er, wie viele Purzelbäume es gegeben hätte und wie viele zusätzliche Blessuren dabei entstanden wären! Und später dann die vielen feindseligen Theorien oder vielmehr, die eine feindselige, die auf gar keinen Fall entstehen darf!
An der Uferkante legte er seine Last für eine Weile ab, ruhte sich aus, blieb mehrere Minuten sitzen, presste mit beiden Händen seinen Oberschenkel. Schließlich stand er wieder auf, war bereit, nun auch das letzte Stück Weg hinter sich zu bringen.
Als er bei seinem Mantel angekommen war, legte er das Mädchen auf das Eis. Erst jetzt wurde ihm klar, dass sein Vorhaben weit schwieriger zu bewerkstelligen war, als er anfangs angenommen hatte. Nun da es an die eigentliche Arbeit ging, sah er den Ort mit den Augen derer, die morgen oder in ein paar Tagen den See aufsuchen und auf die Einbruchstelle stoßen würden. Experten, so überlegte er, können womöglich eine gerissene Eisdecke von einer absichtlich durchschlagenen unterscheiden! Aber dann tröstete er sich mit der Hoffnung, dass der Frost die Konturen der Öffnung verwischen würde. Schon im nächsten Moment hatte er einen anderen schwachen Punkt in seinem Plan entdeckt: Was, wenn es im Umfeld der Bruchstelle keinerlei Spuren von Schlittschuhkufen gab? Ob das zutraf, konnte er im schwachen Licht des Mondes nicht erkennen, aber er entsann sich, während der Nachmittage, die er hier am See verbracht hatte, so weit draußen keine Schlittschuhläufer gesehen zu haben. Alle hatten nur in Ufernähe ihre Bahnen gezogen, und dort hatte denn auch das Eis ausgesehen wie ein riesiger Schnittmusterbogen. Also gab es hier, mitten auf dem See, wahrscheinlich keine einzige Kufenspur. Das musste auffallen und den ganzen bedrohlichen Fahndungsapparat in Gang setzen.
So stand ihm ein neues Stück Arbeit bevor, sogar Beinarbeit, und die fiel ihm im Augenblick besonders schwer. Wie gut, dachte er, dass ich wenigstens den Schlüssel eingesteckt habe! Sonst hätte ich den ganzen verdammten Weg zum Wagen und zurück noch einmal machen müssen.
Er schraubte dem toten Mädchen die Schlittschuhe wieder ab, befestigte sie an seinen eigenen Schuhen, stand mühsam auf, zog ein paar Bahnen übers Eis, lief bis an die Fläche heran, auf der sich tagsüber die Jugend austobte, kehrte zurück. Ihm kam eine zweite Idee, die er sofort in die Tat umsetzte: Er schraubte der Toten nur einen der Schlittschuhe wieder an, warf den anderen aufs Eis. Ein Indiz mehr, das für den Unfall sprechen würde: Marion Degner hatte mitten im schnellen Lauf den Schlittschuh verloren, war daraufhin gestürzt und infolge des heftigen Aufpralls eingebrochen. Das wäre logisch. Alles ginge gut ineinander, das Loch im Eis, ganz in der Nähe der einzelne Schlittschuh und am Ufer ihr vor dem Start abgelegter Anorak. Auch die Verletzung müsste sich in dieses Schema einfügen lassen: Das Mädchen ist hintenübergefallen, mit dem Kopf aufgeschlagen und hat sich dabei das Genick, gebrochen. Ja, so etwa wird man es rekonstruieren, jedenfalls solange es kein Anzeichen für einen Tod von fremder Hand gibt.
Er machte sich wieder an die Arbeit, nahm den Wagenheber zur Hand, legte sich auf den Bauch und vergrößerte die Öffnung, achtete sorgsam darauf, dass er nicht selbst in die Gefahr kam, einzubrechen.
Seine Hände waren eiskalt, aber er arbeitete weiter, wusste genau, dass er die Sache nun schnell zu Ende bringen musste. Marion Degner wohnte zwar weit entfernt vom Hamfelder See, am entgegengesetzten Ende der Stadt, und zu ihrer Gegend gehörte die andere Eisbahn, aber mit jeder Viertelstunde, die verging, wuchs die Gefahr, dass man alle Gewässer der Umgebung nach ihr absuchen und also irgendwann auch hierherkommen würde.
Je größer die Öffnung wurde, desto leichter gab das Eis nach. Zum Schluss brachen faustgroße Brocken schon nach wenigen Schlägen von der Kante ab. Endlich war das Loch groß genug. Er kroch zu dem Mädchen hinüber. Er wagte nicht, sich aufrecht hinzustellen und dann noch die Leiche aufzunehmen. Eine solche Doppelbelastung auf kleinstem Raum, so nahe der Öffnung, würde das Eis nicht aushalten. In liegender Position zog er ihr den Anorak aus, nahm ihr auch die Mütze ab, brachte schließlich den leblosen Körper zwischen sich und das Eisloch, schob ihn vor sich her. Fast lautlos glitt die Tote ins Wasser. Er kroch noch weiter nach vorn, drückte sie nun gänzlich unter das Eis.
Dann schob er sich zurück, stand auf, zog seinen Mantel an, nahm das Werkzeug auf, hängte sich die Jacke des Mädchens über den Arm. Die Mütze, die wollene rote Pudelmütze, warf er in die Nähe des Schlittschuhs.
Als er die Uferkante erreicht hatte, legte er die Jacke in den Schnee und steckte den Schlittschühschlüssel in eine ihrer Seitentaschen Der Aufstieg ging nur mühsam vonstatten. Er fühlte sich schwach, schwankte manchmal sogar, dachte: Wahrscheinlich hab’ ich viel Blut verloren.
Im Auto stärkte er sich mit einem Schluck Cognac aus seiner Reiseflasche, fuhr dann los. Zehn Minuten später hatte er den Stadtrand erreicht. Er hielt vor einer Telefonzelle, rief seine Frau an, sagte ihr, er habe eine Panne gehabt, an einer Tankstelle aber noch jemanden gefunden, der den Schaden behebe, gegen elf sei er zu Haus.
Er blieb noch eine Weile in der Telefonzelle, schrieb aus dem Branchenverzeichnis die Adressen einiger Ärzte heraus. Dann machte er sich auf die Suche.
Der vierte, an dessen Tür er klingelte, hatte seine Praxis im Privathaus und war auch bereit, ihn zu behandeln. Statt der Geschichte mit dem Werkzeugkasten erzählte er nun doch lieber eine andere, vor allem, um nicht preisgeben zu müssen, dass er in dieser Stadt lebte. So berichtete er auch hier von einer Panne, sagte, er habe unter seinem Auto gelegen und plötzlich sei der Wagenheber verrutscht. Beim Zurückfallen des Hecks sei ihm ein scharfkantiges Eisenteil gegen das Bein gestoßen.
Der Arzt säuberte und nähte die Wunde, verband sie, gab ihm eine Tetanusspritze und auch ein paar Schmerztabletten, von denen er sofort zwei herunterschluckte. Auf die Frage nach der Krankenkasse sagte er, während er in seine zerrissene Hose schlüpfte: »Ich zahle Ihnen das lieber gleich, bin nur auf der Durchreise. Ich lebe in Spanien, brauche darum auch keine Rechnung von Ihnen.«
Der freundliche, schon etwas ältere Arzt sagte darauf: »Dann betrachten wir’s als einen Samariterdienst. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte.«
»Aber nein!« Severin zog seine Brieftasche heraus, legte einen Hundertmarkschein auf den Tisch. »Ich habe ohnehin ein schlechtes Gewissen, so spät bei Ihnen hereingeplatzt zu sein.«
»Machen wir’s mit der Hälfte«, sagte der Arzt und gab ihm fünfzig Mark heraus. »Die chemische Reinigung und das Kunststopfen wird Sie auch noch einiges kosten. Ist denn wenigstens Ihr Auto wieder heil?«
»Ja. Gott sei Dank kam bald so ein gelber Engel der Landstraße vorbei.«
»Sie sollten heute nicht mehr weiterfahren. Die Wunde braucht Ruhe, außerdem werden die Tabletten Sie bald müde machen.«
»Ich gehe in ein Hotel und fahre morgen früh weiter. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!«
Der Arzt brachte ihn bis zur Gartenpforte. Der Volvo stand ein gutes Stück entfernt, sodass das Nummernschild nicht zu sehen war.
Severin überquerte die Straße. Den Schal hätte er am liebsten weggeworfen, aber dann sagte er sich: Nachher liest da jemand wer weiß was aus dem Blut heraus! Außerdem ist er gut zum Vorzeigen für zu Hause, denn jetzt, wo die Wunde so schön verpackt ist, sieht es nach nichts aus. Also kann mir dieser rote Lappen bei Gudrun vielleicht ein bisschen Teilnahme und Fürsorge sichern.
Als er wieder hinter dem Steuer saß, spürte er, wieviel Kraft ihn die letzten Stunden gekostet hatten. Er war erschöpft, hätte hinsinken und auf der Stelle einschlafen können. Wahrscheinlich, dachte er, hat überdies die Wirkung der Tabletten schon eingesetzt. So hätte er sich allzu gern für eine Weile auf dem Rücksitz ausgestreckt, aber er wollte seine Frau nicht noch länger warten lassen. Es war zwanzig Minuten vor elf. Er startete, fuhr langsam durch die zu dieser Stunde wenig belebten Straßen und kam zur angegebenen Zeit zu Hause an.
3.
Sie winkte dem davonfahrenden Freund nach, öffnete die Pforte, ging durch den Vorgarten.
Sie war nicht ganz sicher auf den Beinen, kam sogar vom Plattenweg ab und versank mit dem Fuß im Schnee, sodass ihr Schuh steckenblieb. Sie zog ihn heraus, schlüpfte wieder hinein, spürte gar nicht, dass er innen nass geworden war, ging weiter, auf die Treppe zu, schwankte leicht auf den sechs großen steinernen Stufen. Vor der Tür blieb sie stehen, öffnete ihre Handtasche, suchte lange darin herum, fand endlich den Schlüssel und schloss ihr Haus auf.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!