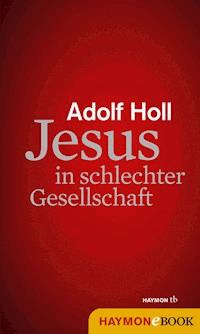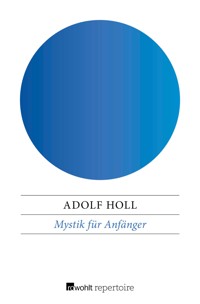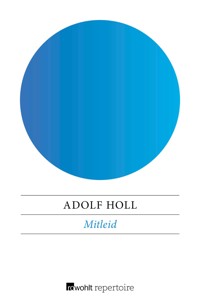
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Diese Ausgabe meines Buches über Mitleid sollte möglichst gebrauchsfreundlich gestaltet werden: Durch die Gliederung in vier Teile und die Hinzufügung von Kapitelüberschriften wird die Orientierung erleichtert; die Literaturhinweise am Schluß nennen die wichtigsten Quellen der verwendeten Zitate; der neue Titel verdeutlicht die Absichten des Autors. Am ursprünglichen Text wurde wenig verändert [...]" Wien, im September 1990 A.H. Religion und Nächstenliebe Philosophie und Humanität Psychologie und Mitempfinden Politik und Solidarität
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Adolf Holl
Mitleid
Plädoyer für ein unzeitgemäßes Gefühl
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
■Religion und Nächstenliebe
■Philosophie und Humanität
■Psychologie und Mitempfinden
■Politik und Solidarität
Über Adolf Holl
Adolf Holl, geboren 1930 in Wien, Doktorate der Theologie und Philosophie, Universitätsdozent für Religionswissenschaft. Von 1953 bis 1972 Kaplan und Religionslehrer. 1973 kirchliches Lehrverbot, 1976 als Priester suspendiert. Lebt als freier Schriftsteller in Wien.
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung zur Taschenbuchausgabe
Diese Ausgabe meines Buches über Mitleid sollte möglichst gebrauchsfreundlich gestaltet werden: Durch die Gliederung in vier Teile und die Hinzufügung von Kapitelüberschriften wird die Orientierung erleichtert; die Literaturhinweise am Schluß nennen die wichtigsten Quellen der verwendeten Zitate; der neue Titel verdeutlicht die Absichten des Autors.
Am ursprünglichen Text wurde wenig verändert. Da und dort mußten neue Entwicklungen berücksichtigt werden, beispielsweise die Exilierung Baby Doc Duvaliers von Haiti oder der Verkauf der österreichischen «Arbeiter Zeitung». Einen Augenblick lang habe ich überlegt, ob ich den Satz «und Sankt Petersburg heißt jetzt Leningrad» vorsichtshalber streichen soll. Aber noch kann er stehen bleiben.
Unberücksichtigt ließ ich die weiteren Lebensschicksale der Personen aus meinem Bekanntenkreis, die im Buch auftreten. (Paranoia hat das Meditationszentrum verlassen, war kurzfristig in psychiatrischer Behandlung und engagiert sich zur Zeit gegen die Apartheid in Südafrika. Riki hat geheiratet. Fips ist Vater zweier Kinder geworden.) Immerhin sei erwähnt, daß die Rolle des verstorbenen Herrn Müller im Leben des Autors durch einen Sozialhilfeempfänger übernommen wurde, der völlig vereinsamt lebt und sich für Literatur interessiert. Er hat häufig Selbstmordgedanken.
Wien, im September 1990
A.H.
Erster Teil: Religion und Nächstenliebe
Auf den alten Bildern ist ein Soldat eben dabei, mit dem Kurzschwert die Pelerine zu durchschneiden, die er sich von den Schultern gezogen hat. Er sitzt auf dem Pferd, unten erhebt ein nackter Mann flehend die Hände.
Martin wird die eine Hälfte des Mantels dem Armen geben und sich selbst mit der anderen umhüllen. Darüber werden einige, die die Szene beobachtet haben, lachen müssen, weil der Anblick Martins auf sie komisch wirkt. Andere werden ein schlechtes Gewissen haben, weil ihnen der Bettler gleichgültig war. In der folgenden Nacht wird Martin im Traum den Christus sehen, angetan mit der verschenkten Hälfte des Mantels.
In der Lebensbeschreibung Martins, verfaßt von einem gewissen Sulpicius Severus, steht eine seltsame Bemerkung. Man liest, Martin habe beim Anblick des Bettlers erkannt, daß dieser Mensch ihm bestimmt sei.
Um das zu verstehen, muß man wissen, daß Martin mit den Menschen im Grunde nichts zu tun haben wollte. Bereits im Alter von zwölf Jahren sehnte er sich danach, Einsiedler zu werden. Sein Vater, ein hoher Offizier von vornehmer Abstammung, zwang ihn zum Militärdienst, mit Ketten gefesselt wurde Martin zur Truppe gebracht. Aber auch in Uniform blieb Martin in sich gekehrt wie ein Mönch, ohne Interesse an den Zerstreuungen des Soldatenlebens. Diesem menschenscheuen Weltflüchtling wurde der anonyme Bettelmann in den Weg geworfen, mitten im strengen Winter, vor dem Stadttor von Amiens in der Provinz Gallien, wo Martin stationiert war.
Es ist auffällig, wie unpersönlich und flüchtig die Begegnung des unfreiwilligen Soldaten mit dem Vertreter des Elends verläuft. Wortlos und sachlich wird die Ungleichheit zwischen den beiden beseitigt, durch die Teilung des Mantels. Hernach kann man sich wiederum trennen, für immer. Martins Regung, den Bedürftigen als seinesgleichen zu behandeln, ist mit Liebe nicht ohne weiteres zu verwechseln.
Martin war einer von denen, die vor der sinnlichen Liebe zurückschrecken. Eine Familie mochte er nicht gründen, und die Interessen, die zwei Körper vertraglich aneinander binden, blieben ihm fremd und verächtlich.
Von solcher Strenge ging eine starke Wirkung aus. Bald nach dem Jahr 360 setzte Martin seinen Willen durch und wurde Einsiedler. Sein Beispiel wurde nachgeahmt. Er starb als Bischof der Stadt Tours, und an seinem Begräbnis sollen Tausende von Mönchen und Jungfrauen teilgenommen haben.
Martins Hemmung, sich mit leibhaftigen Menschen näher einzulassen, in Freundschaft und Liebe, hat ihn zum Mitleidspatron disponiert. Im entscheidenden Traumgesicht in der Nacht nach der Mantelspende ist der wirkliche Bettler bereits verschwunden, er hat sich in eine allgemeine Bedeutung verwandelt, die des göttlichen Menschen. Dessen verklärter Leib, den Martin beglückt betrachtet, ist lautere Hilfsbedürftigkeit in der Aura des Gottes.
Fortan wird Martin den Menschen als Missionar und Heiler gegenübertreten. Ihre Seelen und Leiber verlangen nach Rettung, sie warten auf ihn, alle.
Als unbekümmerten, zum Lachen geneigten Mann kann man sich Martin schwer vorstellen. Gern möchte man ihn fragen, warum sich die Nächstenliebe, die er geübt hat, mit Zärtlichkeit so gar nicht vertragen will. Aber Martin schweigt stille. Das Reden war nie seine starke Seite.
1. Ein Tag im Leben eines Schriftstellers
Die uneigennützigen Menschen, die ihr Leben gleich Martin den Bedürftigen weihten, haben die Welt mit Hospizen, Spitälern, Waisenhäusern, Aussätzigenheimen überzogen. Ohne sie gäbe es kein soziales Gewissen, keine Hilfssendungen in Katastrophengebiete. Ihre beständigen Appelle an die Hilfsbereitschaft sind so selbstverständlich geworden, daß man sich ihnen kaum zu entziehen vermag. Eine besonders peinliche Szene wird immer wieder gespielt, in einem beliebigen Lokal. An den Tisch der behaglich Speisenden tritt ein Heilsarmist mit der Bitte um eine milde Gabe. Schon ist die vergnügte Stimmung gestört, und einen Augenblick lang kann man die Schreie hören, die aus der äußeren Finsternis kommen.
Dieser Augenblick, in dem noch alles in der Schwebe bleibt, ist wie ein schweigender Kampf mächtiger Energien, außerhalb von Zeit und Raum. In den winzigen Explosionen der nervösen Nachrichtenübermittlung im Gehirn der Betroffenen werden Programme miteinander verglichen, Erinnerungen aus dem Gedächtnis geholt, Autoritäten befragt, mit der Geschwindigkeit des Lichtes.
Wollte jemand versuchen, all das irgendwie aufzuschreiben, er käme so leicht nicht ans Ende. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft würden ihm durcheinandergeraten, weil die Entscheidungsprozesse, die er zu Protokoll bringen will, einen Vernetzungsgrad haben, der mit der linearen Chronologie nicht erfaßbar ist. Persönliche und unpersönliche, ja überpersönliche Informationen würden einander wegkürzen, weil sie in der soundsovielten Dimension belanglos werden. Mit Einteilungen, Aufzählungen, Definitionen käme er auch nicht weiter, weil die Abläufe, denen er nachdenkt, fließend sind und verschlungenen Wegen folgen. Außerdem gibt es die Endlosschleifen, die immer dieselbe Nachricht wiederholen, wie die Zehn Gebote zum Beispiel es tun.
Wer oder was wird schließlich darüber bestimmen, ob der oder die Angesprochene ablehnend den Kopf schüttelt oder zum Geld greift? Werden zwei unter zehn Personen spenden oder acht? Wird das Gute in der Welt siegen?
Im Nachtgeschäft, unter Taxifahrern, Prostituierten und Heilsarmisten gibt es eine Erfahrung: Betrunkene geben am meisten.
Ich weiß bis heute nicht, warum ich im Januar 1981 eine junge Frau, die offenkundig unter Paranoia litt, bei mir drei Wochen lang beherbergt habe. War es Mitleid oder Neugier oder Höflichkeit oder Sex? Hat sie meine väterlichen oder brüderlichen Gefühle aktiviert? Wenn ich es wüßte, würde ich kein Buch über das Mitleidigsein schreiben.
Ein Tag im Leben eines Schriftstellers. Das Telefon läutet, Holl hebt ab und vernimmt eine unbekannte weibliche Stimme, die ihn um eine Unterredung bittet und etwas von Obdachlosigkeit und Drogenentzug sagt. Es ist zwei Uhr nachmittags. Um drei Uhr erzählt die junge Frau bereits ihre Geschichte, in Holls Wohnzimmer. Auf ihrem letzten Posten als Sekretärin in einem Forschungsinstitut sei sie mit allen möglichen Giften vollgepumpt worden, gegen ihren Willen und ohne ihr Wissen, alle Geheimdienste seien hinter ihr her, jetzt leide sie unter Entzugserscheinungen, ein Versuchskaninchen sei sie gewesen für Drogenexperimente, sie habe sich bereits an den Bundeskanzler gewandt, damit den Leuten in diesem Institut endlich das Handwerk gelegt wird.
Vor dem Eintreffen der Paranoikerin hat Holl ein wenig telefoniert, mit einem Dienst für Drogensüchtige. Ob es möglich wäre, jemanden mit Entzugserscheinungen kurzfristig irgendwo unterzubringen.
Wenn sie unter Schweißausbrüchen leidet, sagt die Telefonstimme, dann ist der Pavillon 10 Am Steinhof zuständig. Am Steinhof, das ist das Irrenhaus Wiens.
Am Steinhof bin ich auch schon gewesen, sagt Paranoia zu Holl, dort haben sie mir Elektroschocks gegeben. Sie werden sich vielleicht nicht an mich erinnern, aber wir haben einander einmal bei dem Schriftsteller Gustav Ernst getroffen.
Aber sie hat ja gar keine Entzugserscheinungen, denkt Holl, sie bildet sich das alles nur ein, sie hat in Wirklichkeit einen ausgewachsenen Verfolgungswahn. Ich kann ihr sicher nicht helfen, denkt Holl, da sind andere dafür zuständig, aber Steinhof wäre brutal, da darf man sie nicht hinschicken, dort kriegt sie vielleicht wirklich Elektroschocks, und außerdem ist sie schon dort gewesen und hat immer noch ihren Verfolgungswahn.
Ja, und warum sind Sie dann eigentlich zu mir gekommen, sagt Holl.
Ich hab meine Wohnung verloren, ich weiß nicht, wo ich heute nacht schlafen soll, und da sind Sie mir eingefallen, vielleicht kann ich bei Ihnen übernachten, eine Woche, bis ich etwas anderes gefunden habe.
Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit sind: 1. den Hungrigen zu essen geben, 2. den Durstigen zu trinken geben, 3. die Fremden beherbergen, 4. die Nackten kleiden, 5. die Kranken besuchen, 6. die Gefangenen erlösen, 7. die Toten begraben.
In der Zeit, als die Liste der barmherzigen Werke allgemeine Verbreitung fand, erzählten die Wüstenväter einander diese Geschichte:
Der Teufel aber nahm die Gestalt eines herrlich geschmückten Weibes an und klopfte an die Tür der Zelle, in welcher sich der Mönch aufhielt. Als dieser öffnete, sprach die Erscheinung also: Ich werde von meinen Gläubigern schuldlos verfolgt. Nimm mich auf bei dir, heiliger Mann, nur kurze Zeit, bis ich unbehelligt weiterwandern mag! Der Mönch ließ sie ein. Alsbald wurde er von heftigem Verlangen ergriffen und trat auf das Weib zu, es zu umarmen. Da schlug ihn der Teufel, der Mönch stürzte zu Boden und blieb einige Tage wie tot liegen. Als er wieder zu Sinnen gekommen war, begab er sich zum seligen Vater Pachomius und gestand unter verzweifeltem Stöhnen und entsetzlicher Furcht sein Vergehen.
Auf die Frage, wovon sie lebe, antwortet Paranoia, sie habe einen Antrag auf Sozialhilfe gestellt.
In Österreich wird von zwei «Netzen» sozialer Sicherheit gesprochen: (a) Sozialversicherung und (b) Sozialhilfe. Für die Sozialhilfe ist das Sozialamt zuständig. Anspruch auf Sozialhilfe hat, wer seinen Lebensbedarf nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften beschaffen kann. Von den Hilfesuchenden verlangt das Sozialamt, daß sie zunächst alle anderen Möglichkeiten ausprobiert haben müssen, um zu ihrem Geld zu kommen (Ansprüche gegenüber dem Arbeitsamt, der Pensionsversicherungsanstalt, unterhaltspflichtigen Angehörigen). Ferner muß nachgewiesen werden, daß der Antragsteller arbeitswillig ist. Davon ausgenommen sind Personen, die in einer Erwerbsausbildung stehen, die das 60. (Frauen) bzw. das 65. Lebensjahr (Männer) erreicht haben, Erwerbsunfähige und Mütter im Interesse einer geordneten Erziehung ihrer Kinder.
Österreich ist ein Sozialstaat.
Zur Antragstellung auf Sozialhilfe muß ein Meldezettel vorgelegt werden. Dies deshalb, weil sich die Zuständigkeit des Sozialamtes nach dem Wohnsitz richtet. Ohne ordentlichen Wohnsitz gibt es keine Sozialhilfe.
Falls es Paranoia nicht bald gelingt, einen ordentlichen Wohnsitz zu haben, fällt sie durch die beiden sozialen Netze und wird zu einer nicht seßhaften Person, einer «Sandlerin» (österreichischer Sprachgebrauch) oder «Gammlerin». Zu einer «Hauslosen» (buddhistischer Sprachgebrauch).
Die ersten Buddhisten, die ersten Derwische, die ersten Franziskaner waren freiwillige Sandler oder Gammler. Jesus war ein freiwilliger Gammler. Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester, der Menschensohn aber hat nicht, wohin er sein Haupt legen kann. Die Menschentochter hat nicht, wohin sie ihr Haupt legen kann. Ihr Name: Paranoia. Sie wird verfolgt von erbarmungslosen Gläubigern, jetzt treten Tränen in ihre Augen, und sie sagt: Ich hab niemandem etwas zuleide getan.
An dieser Stelle darf Herrn Müllers gedacht werden. Vielleicht habe ich Paranoia deshalb bei mir aufgenommen, weil ich vermeiden wollte, ihr nachblicken zu müssen, wie sie enttäuscht die Stiege hinuntergeht. Herr Müller ging vor Jahren enttäuscht die Stiege von meiner Wohnung hinunter, ein alter heruntergekommener alkoholischer Mann ohne ordentlichen Wohnsitz. Die Sekunde des Nachblickens vor dem Schließen der Wohnungstür hat sich mir eingeprägt, der Blick auf die Schulter des Herrn Müller, wie er langsam die Treppe hinuntersteigt.
Ja, dir geht‘s gut, sagte Herr Müller öfters zu mir.
Hast einen Wein, fragte Herr Müller. Hast Zigaretten, fragte Herr Müller, eine warme Unterhose brauchert ich auch.
Herr Müller ging mir gelegentlich auf die Nerven, seine Stimme am Telefon war mir nicht immer willkommen. Schon wieder der Müller. Und dann einmal hinausgeschmissen den Müller, abgewiesen den Müller, laß mich in Ruh, ich hab keine Zeit, allerweil kommst daher, ich bin nicht die Caritas.
Vor dem Krieg war ich in Venezuela am Bau, erzählte Herr Müller, hab gut verdient damals. Wenn sich meine Alte nicht hätte scheiden lassen von mir, hätt ich eine Wohnung. Aber so hab ich ausziehen müssen, jetzt schlaf ich im Telefonhäusl.
Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen dürfte Herr Müller nicht mehr unter den Lebenden weilen, ein gutes halbes Jahr schon hat er sich nicht mehr gemeldet. Sozialstaatlich gesehen war er eine Ausnahme, man stelle sich vor: ein Bettler in Österreich, das ist beinahe schon eine Attraktion für die Touristen. Auf Wunsch werden sie in eine bestimmte Gasse geführt, ein schlampig gekleideter Mensch tritt auf sie zu mit der Frage:
Alter, hast einen Schilling?
Vielleicht wäre es hier angebracht, dem Publikum die Geschichte der Wohltätigkeit zur Kenntnis zu bringen. Vergleiche die umfassende Studie von Bolkestein, «Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum», außerdem Lieses «Geschichte der Caritas», ferner D.J. Constantelle, «Byzantine philanthropy and social welfare», sowie Uhlhorns «Christliche Liebestätigkeit in der Alten Kirche» und Ratzingers «Geschichte der kirchlichen Armenpflege». Für die neuere Zeit ist wichtig Oppenheimers «Soziale Frage» und Muckles «Geschichte der sozialistischen Ideen».
Aber diese Geschichten sind eintönig, weil sie nach immer demselben Muster verlaufen. Irgendein gewalttätiger und schlauer Mensch eignet sich ein Stück Boden an, indem er erklärt: Betreten verboten! Dann beschließt er, den Besitz seinem ältesten Sohn zu vererben und die anderen Söhne und Töchter leer ausgehen zu lassen, damit der Besitz nicht geteilt werden muß. Schon gibt es Minderbemittelte. Privateigentum, Erbrecht und Schuldrecht haben seit eh und je die öffentliche Armut erzeugt, und die Obrigkeiten sahen sich gezwungen, die wütenden Habenichtse irgendwie im Zaum zu halten, mit Brot und Spielen beispielsweise wie im alten Rom oder durch ein Arbeitsbeschaffungsprogramm wie in den Tagen des Perikles oder durch Armengesetze wie unter Karl dem Großen. Bismarck hat seine Sozialgesetze durchs Parlament gebracht, um die Arbeiter mit dem kapitalistischen Staat zu versöhnen und den Sozialdemokraten das Wasser abzugraben. Dieselbe alte Leier, seit es die großen politischen Reiche gibt. Vor ihrer Entstehung bedurfte es keiner öffentlichen Wohltätigkeit.
An Stelle einer ausführlichen Darstellung der Geschichte der Wohltätigkeit erinnere ich mich also an meine Empfindung beim Anblick des enttäuschten Herrn Müller, als er langsam und traurig die Treppe von meiner Wohnung hinunterging, und drücke mein Gefühl mit einer altertümlichen Redewendung aus:
Der Anblick schnitt mir durchs Herz.
Luther hätte geschrieben: Mich jammerte sein.
Das Wort «Mitleid» existierte zur Zeit Luthers noch nicht; es kam erst vor 200 Jahren auf, als Kürzung des älteren Wortes «Mitleiden», das von den deutschen Mystikern in Gebrauch genommen wurde, im Sinn des seelischen Mitdurchlebens eines fremden Leidens, desjenigen des Jesus Christus zum Beispiel.
Um 1250 erschien der Mechthild von Magdeburg der leidende Heiland, zeigte ihr sein verwundetes Herz und sprach: Sieh, wie weh man mir getan hat!
Mechthild: Ach Herr, warum leidest du so große Not?
Der Heiland: Da mein Herzblut zur Erde niederrann, da wurde der Himmel aufgetan.
Von Stund an verharrte Mechthild im Eingedenken des süßen gebrochenen Herzens ihres Herrn Jesus.
Also gut, sprach Holl zu Paranoia, von mir aus können Sie einziehen, ich geb Ihnen den Schlüssel.
Danke, erwiderte Paranoia. Sie wirkte erleichtert. Dann ging sie ihre Sachen holen, die sie irgendwo untergestellt hatte. Draußen war Winter. Trüber Himmel, Nieselregen mit Schnee vermischt, zwei Grad Celsius.
Man darf sich darüber wundern, daß die modernen Gesellschaftswissenschaften mit Vorliebe die Erforschung des Bösen betreiben. Das Gute scheint sie kaum zu interessieren. 5000 Bücher über Aggression, noch mal soviel über Angst, dazu noch die Literaturen über Gewalt, Terror, Wahnsinn, Verbrechen, Faschismus, Konzentrationslager, Krieg, Folter, Selbstmord, Alkoholismus, Asyle, Prostitution, Slums, Geldwesen, Rüstungsindustrie, Umweltverschmutzung, Arbeitslosigkeit, Vorurteile, Imperialismus, Antisemitismus, Depression, Geheimdienste, Kolonialismus, Krisen und so weiter. Es sieht so aus, als ob die meisten Sozialwissenschaftler darauf aus wären, irgendeine neue Schweinerei zu entdecken. Sie überlassen das Gute dem Roten Kreuz und der Religion.
Was für ein Versehen, das Gute als langweilig zu empfinden! Betrachte das Gute respektlos, betrachte es als eine seltene Verrücktheit, und schon wirst du auf die merkwürdigsten Geschichten kommen.
Für sein Benehmen während der Gespräche mit Paranoia hat sich Holl vorgenommen, die Behauptungen der jungen Frau über die Gemeinheiten ihrer Verfolger wie die Reden einer afrikanischen Hexe anzuhören. Wir leben in verschiedenen Welten, sagt er zu Paranoia. Schauen Sie sich meine Hände an, sagt Paranoia und hält ihre Handflächen unter das Licht der Lampe in Holls Arbeitszimmer. Diese kleinen glänzenden Kristalle in meiner Haut, das ist das viele Gift, das man in mich hineingetan hat. Jetzt kommt es allmählich heraus, können Sie es sehen. Nein, sagt Holl, eigentlich nicht, oder jedenfalls nicht genau, vielleicht glänzt hier doch etwas wie ein kleinwinziger Kristall, ich bin mir nicht sicher. Am Abend, wenn ich allein in Ihrer Wohnung bin, sagt Paranoia, sitze ich in diesem Stuhl hier und kann dann durch die Balkontüre ein Fenster dort drüben sehen. Wenn ich Licht mache, wird auch das Fenster hell, wenn ich das Licht abdrehe, erlischt auch im Fenster drüben das Licht. Einer mit einem Gewehr kann mich ohne weiteres von dort drüben erschießen, sagt Paranoia. Ich habe mich deshalb an einen anderen Platz gesetzt.
Ja.
Sie glauben mir nicht.
Ich gebe mir Mühe, die Art und Weise zu respektieren, wie Sie die Welt sehen, sagt Holl. Aus den Büchern, die ich gelesen habe, weiß ich darüber Bescheid, daß es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Welt zu sehen. Eine afrikanische Hexe sieht die Welt anders als ich. Ich gebe mir Mühe, die Weltsicht der afrikanischen Hexe nicht als eine minderwertige einzustufen. Auch die Ihrige möchte ich nicht als minderwertig auffassen. Sie ist mir fremd, und als solche nehme ich sie zur Kenntnis. Außerdem leiden Sie, sagt Holl zu Paranoia, es geht Ihnen nicht besonders gut.
Was ich verlange, das ist Gerechtigkeit, sagt Paranoia. Ich habe niemandem etwas zuleide getan. Wie komme ausgerechnet ich dazu, mit Gift vollgepumpt und von den Geheimdiensten belästigt zu werden?
Der einzige Arzt, zu dem Paranoia damals noch ein gewisses Vertrauen hatte, heißt Vogt. Er ist der Auffassung, daß Paranoia ins Spital gehört, daß etwas mit ihr geschehen muß. Er ist ein kritischer Mediziner, er hat zum Beispiel gegen die landläufige Psychiatrie starke Vorbehalte. Ich habe ein Bett für Sie, sagte Vogt zu Paranoia, ich garantiere Ihnen, daß Sie dort anständig behandelt werden.
Dieses Gespräch fand um elf Uhr nachts statt, in Holls Wohnung. Rufen Sie den Vogt an! So spät? Ein paar Gäste sind da, Paranoia holt den Holl in die Küche, sie weint, sie legt seine Hand auf ihren Bauch, ganz aufgedunsen ist er, das müssen Sie doch merken, rufen Sie den Vogt an, ich halt’s nicht mehr aus.
Ich garantiere Ihnen, daß Sie dort anständig behandelt werden, sprach Vogt zu Paranoia. Und ab mit Paranoia ins Spital, sie will eigentlich nicht, sie weint, sie ist völlig fertig. Wie wenn man sie ins KZ bringen würde, so führt sie sich auf, sagte Holl und war erleichtert, aber er hatte sich zu früh gefreut, denn eine Stunde später war Paranoia schon wieder zurück, mit dem Taxi, sie wollte nicht im Spital bleiben.
Man könnte denken, Holl habe etwas mit Paranoia gehabt, sie hat eine gute Figur und ein ebenmäßiges Gesicht, aber Paranoia war damals hauptsächlich eher mit dem Baden und Waschen ihres Körpers beschäftigt, stundenlang weilte sie im Badezimmer, um das viele Gift irgendwie von ihrem Leib herunterzubekommen. Was dazu führte, daß von dem Gepritschel ein feuchter Fleck im Stiegenhaus ebendort sichtbar wurde, wo innen das Badezimmer von Paranoia benutzt wurde. Herr Holl, haben Sie einen Wasserrohrbruch? Herr Holl, warum beherbergen Sie Narren?
Holls Güte darf respektlos betrachtet werden, stets ist er freundlich zu alten Damen, Narren, verhinderten Schriftstellern, Weltverbesserern, frustrierten Hausfrauen. Sie rufen ihn an, verabreden sich mit ihm zu einer Aussprache. Warum tut er das? Einerseits gehen ihm diese Menschen schon gelegentlich auf die Nerven, behauptet Holl, andererseits ist er neugierig darauf, was sie alles erzählen. Ist es das Exotische, das Afrikanische an Paranoia, das Holl bewogen hat, sie zu beherbergen, das ihn neugierig gemacht hat? Überlebt etwas von dem, was Freiheit einstmals war und was sie sein könnte, paradoxerweise im Laster, im Wahnsinn, in den Perversionen und selbst im Verbrechen? Ist es dieses Moment der Ungezwungenheit, das uns veranlaßt, die gesellschaftlichen Außenseiter mit ängstlicher Neugierde zu betrachten, ja uns mit ihnen abzugeben?
Gestehe deine Langeweile, Holl, deine Melancholie als Schriftsteller. Beklage dich nicht über sie, du teilst sie mit vielen Braven, die zur Leidenschaftslosigkeit fader Sonntage verurteilt sind. Beachte die Verbindung zwischen dieser Langeweile und deinem Interesse an Abweichlern, Oppositionellen und Ketzern. Erkläre, warum du seit zwanzig Jahren in deinen Schriften außenseiterische Themen behandelt hast, warum du Jesus Christus als Kriminellen bezeichnest.
Das hat bereits Nietzsche getan.
Das stimmt. Nietzsche war ein großartiger Paranoiker, er spürte das Gift in seinem Leib, er fühlte die Macht des alten Zauberers, der hinter ihm her war. Ihm fiel auf, mit welcher Inbrunst der Christenmensch sich den Geschwüren der Bettler, dem Gestank der Krüppel, dem Geschrei der hungrigen Kinder, den blassen Gesichtern der verdorbenen Mädchen nähern muß, wie unter einem Zwang. Das ist doch pervers, sagte sich Nietzsche, das ist dekadent, das kann doch nicht wahr sein.
Und wenn ich Paranoia hinausgeschmissen hätte?
Dann hättest du Schuldgefühle gehabt. Egal. Mitleid ist nur ein Wort. Auf die richtigen Regungen kommt es an, die hilfreichen, die zartfühlenden! Wenn der Polizist und der Demonstrant einander plötzlich in die Augen schauen und der Polizist läßt den Knüppel sinken, dieses eine Mal.
O die mageren Ärmchen, die sich dir entgegenstrecken.
O die großen Augen, wie sie dich anschauen.
Danke schön, junger Mann, das war sehr lieb, vielen herzlichen Dank, jetzt kann ich schon wieder allein weiter. Aber keine Ursache, das war doch selbstverständlich.
Ging ein Mensch von Jerusalem hinunter nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die plünderten ihn aus, schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Ging ein Priester denselben Weg hinab, sah ihn und ging vorüber. Kam ein Levit an der Stelle vorbei, sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der des Weges zog, kam vorbei, und da er ihn sah, jammerte ihn sein, trat hinzu, verband seine Wunden und goß Öl und Wein darauf. Keine Ursache, das war doch selbstverständlich.
Merkwürdiges trug sich damals in Holls Wohnung zu, als es der Zufall wollte, daß während der Anwesenheit Paranoias ein gewisser Herr O. zu Besuch kam. Überdurchschnittlich intelligent, war er nach einem Selbstmordversuch mit anschließendem Aufenthalt in einer Nervenklinik ein wenig ruhiger geworden, obgleich seine Beschäftigungslosigkeit ihm Sorgen bereitete. Während man plauderte, kam Paranoia aus dem Badezimmer heraus, und so ergab sich ein Gespräch zwischen den beiden Leidenden, in welches sich einzumischen der Hausherr wenig Veranlassung hatte. Herr O. sprach artig, beinahe zeremoniös, befangen durch die Gegenwart der jungen Frau, die ihrerseits bald dazu überging, Herrn O. über die Machenschaften in jenem Institut aufzuklären, wo man sie eineinhalb Jahre hindurch als Versuchskaninchen ohne ihr Wissen mit diversen gefährlichen Giften vollgepumpt habe. Herr O., der sehr schnell den wahnhaften Charakter der Erzählung Paranoias erkannt hatte, vermied seinerseits jegliche Andeutung über seine eigenen Ängste und Verfolgungsideen, die ihn dazu gebracht hatten, seinem Leben ein Ende bereiten zu wollen. Eine Verständigung über den wahren Charakter der Feinde des Herrn O. und Paranoias kam daher nicht zustande, wie überhaupt das ganze Gespräch zwischen den beiden Leidenden nicht die leiseste Spur des Eingehens des einen auf den anderen erkennen ließ. Unverbundene Monologe, ohne den sonst üblichen Anschein höflicher Anteilnahme, ohne die gewohnte Heuchelei. Merkwürdig deshalb, weil die scheinbare Kälte zwischen dem O. und Paranoia ein wortloses Einverständnis zwischen den beiden nicht ausschloß. So jedenfalls erschien es dem Hausherrn, und er dachte bei sich: Mitleid brauchen die zwei jedenfalls nicht miteinander zu haben.
Während Paranoia und Herr O. nur kurzfristige Aufenthalte in der Nervenklinik auf sich nehmen mußten, weilten Fips und Riki, ebenfalls Bekannte Holls, längere Zeit in einer geschlossenen Anstalt. Epi, der letzte in dieser Reihe, leidet an der Fallsucht, wie sein Name signalisiert. Nein, sagen sie alle zu mir, während ich sie zu Papier bringe, wir wollen kein Mitleid!
2. Der barmherzige Samariter
Epi, wie wir ihn hier nennen müssen, hatte seinen ersten Anfall im Alter von zwölf Jahren. Es war Krieg, und er lebte mit seinen Eltern unter mißlichen Umständen in Wien. Die mißlichen Umstände: Epis Vater war Jude. Weil er mit einer Christin verheiratet war, einer nach den damaligen Rassegesetzen «arischen» Christin, blieb er am Leben, und Epi auch.
Epis bevorzugte Lokale, sein Liebesleben, sein Beruf, die Einrichtung seiner Wohnung, sein Familienstand, die Farbe seiner Augen und seiner Haupthaare, seine Art, sich zu kleiden, die eine oder andere kleine Narbe, die er vielleicht im Gesicht hat, herrührend von Stürzen während eines Anfalls – solche und andere Details, welche aus Epi eine brauchbare Romanfigur machen würden oder den Gegenstand einer Reportage oder eine Bühnenrolle, müssen hier weggelassen werden, weil Epi sich genieren würde, identifiziert werden zu können. Sozialstaat hin, Sozialstaat her, in bezug auf Epileptiker sind die Leute irgendwie heikel; sie haben ein Vorurteil, sagen die Soziologen, was die Sache auch nicht besser macht. Immer wieder sagt Epi zu Holl:
Gelt, das bleibt aber unter uns.
Die Umstände der Anfälle, die Epi erzählt, erinnern mich an die Visionen der Mechthild von Magdeburg. Als sein Blut zur Erde niederrann, da wurde der Himmel aufgetan. Und es kam eine Ambulanz, die brachte Epi ins Spital, wo selbst eine Rißquetschwunde ärztlich versorgt wurde.
Epi hat Holl auf ein lehrreiches Buch zum Thema Mitleid aufmerksam gemacht. Es ist von dem Philosophen Hermann Cohen (1848–1918) und trägt den Titel «Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums».
Cohen ist das hebräische Wort für Priester.
Das hebräische Wort für Mitleid lautet Rachamim. Das ist ein sogenannter Abstraktplural. Das Wort Rechem, mit dem er verwandt ist, bedeutet:
Mutterschoß, Eingeweide.
Auf diesen Umstand wies Cohen in seinem Buch ausdrücklich hin, leider nur flüchtig. Im übrigen vertrat er die Ansicht, daß die Entdeckung des Menschen als des Mitmenschen, also die Humanität, ihre Quelle im Judentum hat.
Wie es dazu kam, daß die alten Juden den Menschen als Mitmenschen erfanden, kann man in dem Buch von Cohen und in anderen einschlägigen Büchern nachlesen. Ursprünglich, so wird man belehrt, waren die Juden keine Juden, sondern diverse Nomadensippen westsemitischer Herkunft. Die eine oder andere Sippe wanderte, zum Beispiel wegen einer Dürreperiode, ins Land Ägypten und fand dort Arbeit an öffentlichen Baustellen. Unter ihrem Führer Moses kehrten diese Leute dann Ägypten den Rücken und wanderten nach Kanaan (Palästina), wo sie sich als Bauern niederließen. Mit anderen Sippen verschworen sie sich zu einer Eidgenossenschaft, deren Name von einem Scheich herrührt, dessen Sippe eine führende Rolle spielte: Israel.
Die Erinnerung an die Zeiten, in denen sie heimatlos umherwandernde Fremdlinge waren, war unter den Söhnen und Töchtern Israels lebendig gelieben. In ihrem Gesetzbuch, der Thora, steht deshalb das ausdrückliche Gebot, den Fremdling wie einen Stammesgenossen zu behandeln. Wörtlich: Du sollst ihn lieben, er ist wie du.
Die Begründung für diese Vorschrift, ebenfalls wörtlich: Auch ihr wart Fremdlinge im Land Ägypten.
So einfach beginnt die Geschichte der «Nächstenliebe» (englisch: charity; französisch: charité), wie wir sie heute nennen. Sie gilt als christliche Tugend. In ihr werden die Umgangsformen, wie sie unter Verwandten und Freunden üblich sind, auf fremde (dahergelaufene, unbekannte, gefährliche, feindselige, lästige, zudringliche, elende, bedürftige, armselige, ekelhafte, verrückte) Menschen aller Art ausgedehnt, ohne Einschränkung.
Theoretisch. Praktisch gibt es nur wenige Menschen, die sich in ihrer Lebensführung uneingeschränkt an die Nächstenliebe halten. Im Jahr 1938 zum Beispiel, nachdem die Soldaten Hitlers in Österreich einmarschiert waren, wurden in Wien viele Juden gezwungen, mit ihrer Zahnbürste den Gehsteig zu reinigen. Das war nicht besonders nächstenliebend, obwohl Österreich ein katholisches (christliches) Land ist.
Längst wurde die Stephanskirche, die im Jahr 1945 ausgebrannt war, wunderschön renoviert. Niemand ist auf den Gedanken verfallen, sie als Ruine stehenzulassen, damit es den Leuten hie und da auf den Kopf regnet, wenn sie ihre Gebete verrichten, zur Erinnerung an das Jahr 1938.
Im Jahr 1938 wurde in Wien noch viel gejüdelt, zum Beispiel im zweiten Bezirk, der Leopoldstadt, wo viele Juden wohnten, darunter auch Epis Eltern. Sie wurden von den Nazis gezwungen, die Wohnung mit anderen «rassisch belasteten» Familien zu teilen. Epi erzählt, es sei recht eng gewesen. Er selbst hat nie richtig jüdeln gelernt, so wie die aus Osteuropa zugewanderten Juden es konnten. Immerhin hat Epi aus seiner Kindheit noch die eigentümliche Sprechmusik im Ohr, die das Jüdeln kennzeichnet, und vielleicht auch das eine oder andere Wort hebräischen Ursprungs, das die Juden in die landesübliche Umgangssprache mischten, aus alter Gewohnheit.
Zum Beispiel: Rachmones.
Rachmones bedeutet soviel wie Mitleid, Barmherzigkeit.
Rachmones kommt vom hebräischen Rachamim; Rachamim kommt von Rechem; Rechem bedeutet: Mutterschoß, Eingeweide.
Der Ausdruck «die Eingeweide des Mitleids», den ich im Lukasevangelium gefunden habe (I. Kapitel, Vers 78), ist eine typisch semitische Redefigur. Sie erinnert an den urtümlichen Zusammenhang zwischen den weiblichen Organen und den Regungen der Menschenfreundlichkeit.
Ob dieser Zusammenhang zwischen dem Unterleib und dem Mitgefühl auch heute noch gilt, ist eine bedenkenswerte Frage.
Im Lukasevangelium gibt es eine weitere Stelle, die unsere Gedanken in das Innere des Leibes lenkt. Das Lukasevangelium ist wie alle Texte der Christenbibel in der griechischen Sprache verfaßt worden. Das Wort im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Luther mit «da jammerte ihn sein» übersetzte, verweist im Griechischen auf die inneren Organe. Offenbar hat der Autor versucht, den semitischen Originalton des Gleichnisses möglichst genau zu treffen, so wie Jesus es erzählt hatte. Man darf annehmen, daß Jesus eine mit Rechem verwandte Zeitwortform benutzt hat, als er die menschenfreundliche Regung des barmherzigen Samariters ausdrücken wollte. (Rechem bedeutet: Mutterschoß, Eingeweide).
Die Spur, die wir verfolgen, führt zu wirklichen, fühlbaren Empfindungen im Unterleib, nicht zu Moralprinzipien. Sie führt zu den Regungen einer Mutter, deren Kind in Gefahr gerät.
In einer bekannten biblischen Geschichte erscheinen zwei Dirnen vor dem König Salomo und streiten um ein Neugeborenes, das jede der beiden als ihr eigenes bezeichnet. Daraufhin läßt der König ein Schwert bringen und erteilt den Befehl, das Neugeborene in zwei Hälften zu teilen und jeder Frau eine Hälfte zu geben. Sofort bittet die wirkliche Mutter um Schonung des Kindes, denn «mächtig regten sich ihre Eingeweide für ihren Sohn».
Hier ist der Aufruhr in den weiblichen Innereien, diese plötzliche Hitze im Unterleib, ganz und gar dasselbe wie die sogenannten edleren Regungen, nämlich Liebe und Erbarmung. Das, was sich so heftig rührt, ist schon die Sache selbst, es gibt ihr den Namen.
Daß auch Männer so fühlen können, wird im ersten Buch Moses erzählt, im 43. Kapitel. Hauptperson ist der ägyptische Joseph, der nach langer Trennung seine Brüder wiedersieht. «Als er seine Augen erhob und seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, sah, sagte er, das ist wohl euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt? Und eilte hinweg, denn seine Eingeweide rührten sich beim Anblick des Bruders, und er mußte sich ausweinen.» Die tiefe, also körperlich spürbare Erregung, von der hier die Rede ist, verdankt sich den Banden des Blutes, nämlich der Tatsache, daß Joseph und Benjamin dieselbe Frau zur Mutter haben. Die warme Höhle, in der sie beide neun Monate gelegen haben, heißt im Hebräischen: Rechem.
Aber wir müssen hinaus in die kalte Welt, und manchmal ergeht es uns schlecht in ihr. Wie schön ist es dann, wenn ein gütiger Mensch seine Hand auftut und uns hilft. Nicht nur im Jüdischen, auch in anderen semitischen Sprachen klingt der warme Mutterleib in den Wörtern des Erbarmens fort, beispielsweise im Arabischen:
Bismillah rachmani rachim!
Im Namen Allahs, des barmherzigen, mitleidvollen!
Die nachdrückliche Verdoppelung des Wortes, das an den Leib der Mutter erinnert, versetzt die Gläubigen in eine umgreifende Geborgenheit letzter Instanz. Fünfmal am Tag, zu den Gebetszeiten, dürfen sie sich ihr überlassen.
Der handgeschriebene Koran aus Kabul, den die Paranoikerin ihrem Gastgeber schenkte, als sie eine andere Bleibe gefunden hatte, steht auf einem kleinen geschnitzten Holzgestell in Holls Wohnung. Paranoia war früher einmal in Kabul. Den Koran hat sie bei einem Händler erstanden. Die ersten beiden Seiten in Paranoias Koran sind mit bunten Malereien verziert. Auf ihnen steht die erste Sure geschrieben. Jeder Muslim kennt sie auswendig. Sie ist eine Lobpreisung Gottes, des barmherzigen, mitleidvollen.
Wenn ich ein theologisches Buch schreiben wollte, dann wäre es jetzt an der Zeit, eine Frage zu stellen. Warum hat der Allmächtige und Barmherzige gegen die Leiden Epis und Paranoias nichts unternommen?
Wenn ich ein politisches Buch schreiben wollte, dann wäre es jetzt an der Zeit, die Gegensätze zwischen den Israelis, den Moslems und den Christen im Nahen Osten zu analysieren, ohne dabei die Interessen der Amerikaner und der Russen zu vergessen.