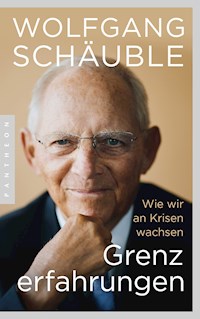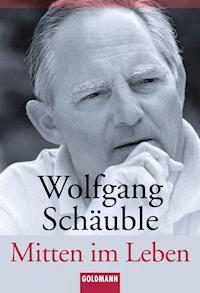
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Finanzaffäre der CDU hat nicht nur die Partei und die demokratische Kultur der Bundesrepublik in eine ihrer tiefsten Krisen gestürzt, sondern war auch der Auslöser für Wolfgang Schäubles Verzicht auf eine weitere Kandidatur als Parteivorsitzender. Im Rechenschaftsbericht über die Zeit seit der desaströsen Wahlniederlage der CDU von 1998 liefert er seine persönliche, aber zugleich objektiv nachvollziehbare Sicht der Dinge. Vor allem der Bruch und die Rivalität mit Helmut Kohl kommen zur Sprache, darüber hinaus beschreibt Schäuble schonungslos und selbstkritisch die sechzehn Monate seines Parteivorsitzes bis zum bitteren Ende. Er analysiert Veränderungen, Versäumnisse und Fehleinschätzungen der CDU und erläutert seine Vorstellungen über die Zukunftsperspektiven einer zur Mitte hin integrierenden Volkspartei im Rahmen des gesamteuropäischen Wertekonservatismus. Das Zusammenwachsen der Welt stellt schwerwiegende gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und kulturelle Herausforderungen an Politik und Staat – Wolfgang Schäuble liefert mit seinem Buch einen der wichtigsten Beiträge von konservativer Seite zu ihrer Diskussion und langfristigen Bewältigung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2002
Ähnliche
Wolfgang Schäuble
Mitten im Leben
Copyright
Inhaltsverzeichnis
VorwortI. Vor der Wahl 1998 – Der Weg in die Niederlage1. 16 Jahre Regierungszeit fordern ihren Tribut2. Ermüdungsprozesse in der Koalition3. Reformpolitik und SPD-Blockade4. Leipziger Parteitag 1997: Wie man eine Reformdebatte verhindert5. Kanzlerkandidat Schröder6. Zukunftsprogramm – oder: Wie man eine Chance vernichtet7. Letzte Versuche, die Niederlage abzuwenden.8. In Sorge um die CDU –Überlegungen für die Zeit nach der WahlII. Nach der Bundestagswahl – Eine Volkspartei auf der Intensivstation1. Vom Wahlabend zur Kandidatur2. Die Zeit der Besserwisser – Ratschläge und Forderungen3. CDU und CSU – ein pflegebedürftiges Verhältnis4. Bewahren und Erneuern – Die Führungsaufgabe5. Düstere Perspektiven für das Wahljahr 19996. Personelle Erneuerung in Fraktion und Partei7. Parteitag November 1998 – Start in die OppositionIII. Erste Schritte – Die Zeit der Rekonvaleszenz1. Die Wiederentdeckung des politischen Gegners2. Der Doppelpass – Steilvorlage aus der rot-grünen Koalition3. Die Unterschriftenaktion – Integration konkret4. Der Überraschungscoup: Dagmar Schipanski kandidiert gegen Rau5. Erneuerung in den Ländern: Die CDU macht mobilIV. Hessen als Zäsur – Es geht wieder aufwärts1. Das Ende des Doppelpasses und die Chaostage der Regierung Schröder2. Lafontaines Rücktritt3. Krieg im Kosovo: Die Union hält Linie4. Vor der Europawahl – Fallgruben für Regierung und Opposition5. Triumph für die Union – Die Europawahl und die Folgen6. Der Erfurter Parteitag – Arbeitsprogramm für die Opposition7. Schröders »Neue Mitte«: Überholt die CDU links?V. Erfolge im Herbst – Der Siegeszug der CDU1. Elefant im Brüsseler Porzellanladen – Schröders Rücksichtslosigkeiten2. Rot-Grün in der Krise3. Auf der Welle des Erfolgs – CDU im Überschwang. Wende bei der SPD4. Die neue Macht der Opposition – Strategien für den BundesratVI. Die Krise1. Der Paukenschlag – Eine Million im Koffer und die Folgen2. Die Schatten der Vergangenheit – Enthüllungen über »schwarze Kassen«3. Kohl, Terlinden und das Weyrauch-System4. Stochern im Nebel – Nach Kohls Fernsehgeständnis5. Die Krise in der Krise – Schreibers 100000-DM-Spende6. Erste Zuspitzung – Das Ende eines Ehrenvorsitzes7. Nervöse Partei: Die Krise frisst sich festVII. Ende und Neuanfang – Der See rast und bekommt sein Opfer1. Keine Chance für Politik – Immer wieder Schreiber2. Sensationelle Enthüllungen: Weyrauch und Lüthje packen aus3. Zweite Zuspitzung. Der Autoritätsverlust ist nicht zu stoppen4. Entscheidung – Der Rückzug von Fraktions- und Parteivorsitz5. Weichenstellungen I – Neuanfang in der Fraktion6. Weichenstellungen II – Der Weg zum Essener Parteitag7. Die CDU am Rande des Ruins – Konsequenzen aus der Finanzaffäre8. Abschied – Die letzte Rede als Parteivorsitzender9. Zwangsläufigkeiten – Das Problem der politischen Führung10. Mediale Prozesse – Kritische Anmerkungen aus gegebenem AnlassVIII. Die Tagesordnung der Zukunft – Warum die Union gebraucht wird1. Neue Fragen – welche Antworten?2. Schicksal Europa: Wir brauchen die öffentliche Debatte3. Gemeinsame Verantwortung für gemeinsame Sicherheit4. Migration und Einwanderung – Ein deutsches Intermezzo5. Europa richtig machen – Subsidiarität und Verfassungsfrage6. Deutsche Hausaufgaben – Föderalismus im Reformstau7. Die neue soziale Frage – Bildung, Familie und Generationenvertrag8. Maß und Mitte – Der Auftrag der CDUPersonenregister
Vorwort
Es ist fast genau zwei Jahre her, dass die CDU die schlimmste Wahlniederlage in ihrer Geschichte erlitt. Sie war seit Monaten absehbar gewesen, und sie war nicht mehr zu verhindern. Zu vieles hatte sich nach 16 Jahren erfolgreicher Regierungszeit aufgestaut – bei den Wählern und in den Koalitionsparteien CDU, CSU und FDP –, um das Wunder eines durchschlagenden Stimmungsumschwungs noch einmal schaffen zu können. Der Abschied aus der Regierungsverantwortung bedeutet nicht nur für die CDU Deutschlands einen wesentlichen Einschnitt. Die Monate danach waren voll Turbulenzen. Der Union wurden düstere Prognosen gestellt über ihr Schicksal. Machtkämpfe würden sie lähmen, erbitterter Streit über Kurs und Inhalte sie zerreißen. Und sollte sie das alles einigermaßen glimpflich überstehen, würde sie doch auf lange Sicht keine Chance mehr haben, die Regierungsverantwortung zurückzuerobern.
Jetzt, im Spätsommer 2000, intonieren die Kommentatoren und Leitartikler eine ähnlich klingende Melodie. Und das Studium der Meinungsumfragen scheint tatsächlich den Schluss nahe zu legen, die Union stehe wieder dort, wo sie nach der Bundestagswahl war. Doch die Parallelität der Zahlen erlaubt nicht ohne weiteres die Vergleichbarkeit der Situationen. Zu viel ist seit der Bundestagswahl geschehen, zu unterschiedlich waren die Entwicklungen davor und danach, um nun lediglich einen Status quo ante zu diagnostizieren.
Denn obwohl uns nach dem schlechtesten Wahlergebnis seit 1949 schwere Zeiten vorhergesagt wurden, gelangen uns – nicht nur wegen der Anfangsfehler der rot-grünen Regierungskoalition – 1999 von wenigen für möglich gehaltene Erfolge: Spektakuläre Wahlsiege in Serie, und im Herbst des Jahres Umfragezahlen, wie sie noch nie von einer Partei erreicht wurden. Dann kam die Krise um das Finanzgebaren des früheren Bundeskanzlers, und die Karten wurden neu gemischt. Dazwischen lagen der Krieg im Kosovo und das Ringen um die politische Struktur einer größer werdenden Europäischen Union.
Die Vielfalt von Informationen und Medien führt dazu, dass sich öffentliche Aufmerksamkeit und Erregung immer mehr auf jeweils ein Thema konzentrieren, wobei die Themen oft wechseln. Das für wichtig Gehaltene gewinnt zeitweise sogar Ausschließlichkeitscharakter, um dann genauso abrupt wieder aus der allgemeinen Wahrnehmung zu verschwinden. Als Folge davon leidet das öffentliche Gedächtnis. Deshalb scheint mir wichtig, Erfahrungen aus der Perspektive eines unmittelbar Beteiligten festzuhalten und zu versuchen, die rasch wechselnden Erregungszustände in Entwicklungslinien einzuordnen und zu bewerten. Das ist ein Anliegen dieses Buches.
Die andere Absicht, die ihm zugrunde liegt, speist sich aus der Sorge um Rolle und Zukunft der Union in der deutschen Demokratie und deren europäischem Schicksal. Das war die zentrale Frage, vor der ich am Anfang meiner Amtszeit als Parteivorsitzender stand, und die sich an deren Ende vor der Folie der existenziellen Krise und des Vollzugs des Neuanfangs in der CDU mit neuer Intensität stellte. Die Integrationskraft der großen Volkspartei CDU wird gebraucht, auch wenn manche ihrer Gegner, die plötzlich neue Chancen wittern, das anders sehen. Durch vordergründige Medieninszenierungen einer scheinbar neuen Mitte ist diese Integrationskraft jedenfalls nicht zu ersetzen. Klientelorientierter Opportunismus lässt sich nicht einfach in einen auf Mäßigung zielenden Ausgleich unterschiedlicher Interessen umwidmen. Insofern ist die Union nicht zu ersetzen, ja nicht einmal zu kopieren, weil das, was sie aus ihren Wurzeln heraus bündelt und entwickelt, nur durch dieses Wurzelwerk möglich wird.
Auf einer festen Grundlage immer neue Antworten auf die sich rasant verändernde Lebenswirklichkeit zu suchen und so die Gestaltungskraft einer auf Werte gegründeten, zur Mitte hin integrierenden Volkspartei zu erhalten, das war mein Anliegen nicht nur in den 16 Jahren unionsgeführter Bundesregierung, sondern vor allem auch angesichts der sich abzeichnenden Wahlniederlage und der neuen Aufgabe in der Opposition. Auch dieses Buch soll dazu einen Beitrag leisten.
Die Höhen und Tiefen, welche die CDU und auch ich persönlich seit dem 27. September 1998 durchlaufen haben, die dramatischen Ereignisse der Finanzaffäre, Entwicklungen, die sich plötzlich miteinander verschlingen und zuspitzen, und nicht zuletzt die Erkenntnis, dass sich historische Prozesse im Alltag immer scheinbar zufällig, manchmal auch ganz banal vollziehen, haben für dieses Buch nur die Form eines Berichts zugelassen. Er ist – zwangsläufig – subjektiv, dabei aber in dem steten Bemühen geschrieben, sich streng an die objektiv überprüfbaren Fakten zu halten und Mutmaßungen – wenn überhaupt – nur dort anzustellen, wo sie zur Einordnung des Sachverhalts unverzichtbar sind. Er enthält die Gedanken und Überlegungen des verantwortlichen Politikers angesichts zu lösender Probleme ebenso wie die Schilderung von Ereignissen und Geschehensabläufen. Es ist – kurzum – ein Bericht, der politisch wie menschlich »mitten im Leben« spielt, in all seinen Facetten, positiven wie negativen.
Walter Bajohr, der mir achteinhalb Jahre ein vorzüglicher Pressesprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war, hat mir wieder mit kritischen Korrekturen und Ergänzungen geholfen.
Gengenbach / Berlin, im September 2000
Wolfgang Schäuble
I. Vor der Wahl 1998 – Der Weg in die Niederlage
1. 16 Jahre Regierungszeit fordern ihren Tribut
Als am 27. September 1998 um Punkt 18 Uhr die Prognosen der Meinungsforschungsinstitute zum Ausgang der Bundestagswahl über die Fernsehschirme flimmerten, wurde es zur Gewissheit: Die CDU hatte die Wahl verloren – nach 16 siegreichen Jahren das erste Mal. Dass es so kam, war für mich zwar nicht mehr überraschend. Doch mit dem Ausmaß der Niederlage hatten nur wenige gerechnet. In der Schlussphase des Wahlkampfs hatten die Umfragen eine Aufholjagd der Union signalisiert, in den Medien wurde über ein Kopf-an-Kopf-Rennen spekuliert, und viele Wahlkämpfer klammerten sich an den Strohhalm, das Wunder, gemeinsam mit der FDP erneut eine Mehrheit zu erzielen, sei doch noch zu schaffen. Zumindest könnten CDU und CSU knapp vor der SPD landen, das hielten selbst seriöse Kommentatoren für nicht ganz ausgeschlossen. Folglich strapazierten sie bis zum Wahltag mit Verve ihr Lieblingsthema »große Koalition«.
Meine Skepsis gegenüber den Zahlenspielereien wich jedoch nicht. Da auch nach dem 27. September mit fünf Fraktionen im Bundestag zu rechnen war, hätte es schon einen enormen »last minute swing« geben müssen, um die Union in die Lage zu versetzen, den Kanzler stellen zu können. Und davon war trotz einer guten Schlussmobilisierung unserer Anhänger nichts zu spüren. So kam es, dass wir das schlechteste Wahlergebnis seit 1949 einfuhren. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde ein Regierungswechsel unmittelbar durch eine Wahl ausgelöst.
Es war also völlig klar, dass dieser 27. September 1998 eine tiefe Zäsur markierte, deren Auswirkungen zunächst gar nicht voll zu übersehen waren, die aber die CDU auch über das Jahr 2000 hinaus noch beschäftigen werden. Die Niederlage beendete 16 Jahre Regierungsverantwortung, eine für westliche Demokratien ebenso ungewöhnlich lange wie erfolgreiche Zeit. In der ersten Hälfte dieser 16 Jahre hatten wir mit den klassischen Mitteln der sozialen Marktwirtschaft eine wirtschaftliche Dynamik in Gang gesetzt, die zu großen Erfolgen am Arbeitsmarkt und bei der Geldwertstabilität führte. Der europäische Einigungsprozess gewann gegen verbreitete Skepsis neue Fahrt und steuerte mit der 1986 verabschiedeten Einheitlichen Europäischen Akte die Vollendung des Binnenmarkts an, die nächste Etappe auf dem Weg zum ehrgeizigen Ziel der Wirtschafts- und Währungsunion. Die atlantische Solidarität wurde vor allem durch unseren unbeirrbaren Kurs in der Nachrüstungspolitik der NATO deutlich gestärkt und führte zusammen mit der Überlegenheit freiheitlicher Ansätze in der Wirtschaft und im gesellschaftlichen System des Westens zur Implosion des kommunistischen Herrschaftsbereichs. Der Kalte Krieg wurde friedlich entschieden. Kulminationspunkte dieser sich immer mehr beschleunigenden Entwicklung waren der symbolträchtige Fall der Mauer und die deutsche Wiedervereinigung.
Die zweite Hälfte der sechzehnjährigen Regierungszeit der Union stand im Zeichen der Vollendung der deutschen Einheit, des weiteren Ausbaus der europäischen Einigung und der mühsamen Suche nach einer neuen Weltordnung. Der Sieg der Freiheit, das Ende der Bipolarität eröffneten eine Welt mit ganz neuen Chancen. Aber damit einher gingen in den Neunzigerjahren auch dramatische Veränderungen in dieser entgrenzten Welt, beschrieben mit dem Begriff »Globalisierung«. Revolutionäre Entwicklungen in Wissenschaft und Forschung, insbesondere bei den Kommunikationstechnologien mit kaum zu überblickenden Folgen für Märkte und Arbeitswelt, schufen neben all den positiven Möglichkeiten auch zunehmend Verunsicherung bei vielen Menschen. Allein die neuen Kommunikationsformen, symbolisiert durch den atemberaubenden Siegeszug von Handy und Internet, erzeugten einen sich verstärkenden Modernisierungsdruck, der mit immer größerer Wucht auf die eher behäbigen und teilweise sogar beharrenden gesellschaftlichen Befindlichkeiten drückte. Zwar nahm das kollektive Bewusstsein, in einem enormen Reformstau zu stecken, in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre rapide zu. Doch zugleich wehrte man sich im Alltag gegen Veränderungen. Daraus entwickelte sich eine diffuse Grundstimmung, das eigentliche Übel sei die Politik, die nichts zuwege bringe und schlicht reformunfähig sei. Zusammen mit einem zunehmenden Überdruss an »immer denselben Gesichtern« an der Spitze der Regierung wuchs allmählich die Bereitschaft zum politischen Wechsel samt Quittung für alle Unzufriedenheiten. Der 27. September 1998 wurde zum Zahltag.
2. Ermüdungsprozesse in der Koalition
Das Wahlergebnis war im Grunde also für die Union ebenso vorhersehbar wie unvermeidlich. Alarmzeichen hatte es ja schon viel früher gegeben. Bereits in der Mitte der Legislaturperiode 1990 bis 1994 war die Koalition von CDU/CSU und FDP in ein tiefes Meinungsloch gefallen. Der anfängliche Wiedervereinigungsbonus schmolz wie Schnee in der Sonne, Enttäuschungen vor allem in den neuen Bundesländern machten sich breit. Hinzu kamen wirtschafts- und finanzpolitische Probleme, die nicht nur, aber doch zum überwiegenden Teil mit den enormen Folgelasten von 40 Jahren Teilung und Sozialismus zusammenhingen. Nach einer dramatischen Aufholjagd, die durch schwere Fehler des damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Scharping begünstigt wurde, gelang es der Koalition, die Bundestagswahl doch noch zu gewinnen, allerdings nur mit hauchdünnem Vorsprung. Lediglich durch Überhangmandate konnten wir uns einen Zehn-Stimmen-Vorsprung im Bundestag sichern – eine Mehrheit, die keineswegs so komfortabel war, wie sie auf den ersten Blick aussah. Im Gegenteil, angesichts der enormen Probleme, die es zu lösen galt, begann damit ein permanenter Stresszustand, weil diese knappe Mehrheit bei oft widerstreitenden Interessen im Regierungslager immer wieder neu organisiert werden musste. Wer aus Erfahrung lernen wollte, konnte damals nachträglich die Lage der spd-FDP-Koalition von 1969 studieren mit ihrer ähnlich schmalen Mehrheit.
Der Wahrheit halber muss noch angemerkt werden, dass die Regierungszeit der Union mit allergrößter Wahrscheinlichkeit bereits 1990 geendet hätte, wenn nicht der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung die Karten völlig neu gemischt hätten. Gleichwohl machte uns die Verantwortung für die deutsche Einheit unter dem Gesichtspunkt politischer Stimmung schon wenige Jahre nach der Einheit nicht mehr nur eitel Freude. Die Mühen um den Aufbau Ost und die vielfältigen Enttäuschungen und Brüche in Ost und West haben auch in der Legislaturperiode bis 1998 die Zustimmung zur Politik der Bundesregierung immer wieder eingetrübt.
Unser eigentliches Problem jedoch waren die ansteigenden Arbeitslosenzahlen. Bei den vielen Diskussionen um Lösungswege gerieten immer wieder die Sozialpolitiker mit den Wirtschaftsliberalen aneinander. Die Konfliktlinien liefen sowohl quer durch die Unionsfraktion als auch zwischen CDU/CSU und FDP. In der Presse wurde häufiger prognostiziert, der »Vorrat an Gemeinsamkeiten« in der Koalition sei aufgebraucht, das Regierungsbündnis werde sich nicht mehr lange halten können. Und umgehend stieg wieder das Gespenst der großen Koalition aus seiner Modergruft. Ich habe das immer für Unsinn gehalten, vor allem, weil es nach wie vor zwischen CDU/CSU und FDP eine Übereinstimmung in den grundsätzlichen Fragen unserer Politik gab. Dass die Nerven dennoch öfter blank lagen, ist allerdings auch wahr, und das hatte etwas damit zu tun, dass die Akzeptanz dessen, was wir auf den Weg brachten, in der Öffentlichkeit nicht besser werden wollte. Zwar wurde in der Legislaturperiode 1994 bis 1998 eine Vielzahl von Reformen auf den Weg gebracht (Einkommensteuer, Gesundheit, Rente, Lohnfortzahlung, Kündigungsschutz), und der Zuwanderungsdruck mit all den heiklen Folgen für die innenpolitische Diskussion beruhigte sich weitgehend, nachdem die Änderung des Asylrechts ihre Wirkungen entfaltete. Auch die Verstetigung des Aussiedlerzugangs trug zur Entspannung einer wenige Jahre zuvor noch äußerst labilen und deshalb nicht ganz ungefährlichen Stimmungslage bei. Immerhin hatten wir es geschafft, die jährliche Zuwanderung von Aussiedlern auf maximal 200000 zu begrenzen, wobei die tatsächlichen Zugangszahlen im Laufe der Neunzigerjahre weiter zurückgingen. Aber dennoch standen wir vor dem Phänomen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung unsere Reformansätze einerseits als zu spät oder zu zögerlich eingeschätzt wurden, andererseits aber fast jeder konkrete Reformschritt den meisten Menschen schon wieder zu weit ging. Was erfolgreich zustande gebracht worden war, wurde in der Öffentlichkeit als erledigt betrachtet, ohne dass uns daraus ein längerfristig wirksamer Bonus erwachsen wäre. Dafür wirkten die ungelösten Probleme zusammen mit dem subjektiven Ärger über die eine oder andere Belastung infolge der beschlossenen Reformen massiv gegen uns.
Es war wohl unser größter Fehler in diesen vier Jahren, dass wir es nicht geschafft hatten, unsere Reformen in einen den Menschen plausiblen Gesamtzusammenhang zu stellen. Immer wieder waren wir konfrontiert mit enervierenden und die Ressourcen bindenden Detaildebatten. Über die Frage einer äußerst maßvollen Besteuerung von Spitzenrenten brachten es unsere eigenen Leute fertig, den großen Wurf unseres Petersberger Steuerreformkonzepts – Reduzierung aller Steuersätze um zirka ein Drittel bei Abschaffung zahlreicher Ausnahmen von der Besteuerung und einer Nettoentlastung in einer Größenordnung von 30 bis 40 Milliarden Mark – schon gleich zu Anfang kaputtzureden. Die Zuzahlung bei Medikamenten auf Rezept, eine wesentliche Voraussetzung, aber insgesamt nur ein Teil unseres Gesamtkonzepts für den dringend erforderlichen Einspareffekt im Gesundheitswesen, war nicht nur der Boulevardpresse dicke Schlagzeilen wert, sodass wir auch hier ständig in Abwehrkämpfen gegen Unterstellungen und andauernden Erklärungszwängen standen. Dies sind nur zwei Beispiele, die zeigen, wie eine an vielen Problemstellen ansetzende und in eine Gesamtkonzeption eingebettete Reformpolitik im öffentlichen Kleinkrieg zerschlissen werden kann.
Außerdem kamen wir mit unseren Reformkonzepten erst in der Mitte der Legislaturperiode über. Nach der Wahl 1994 hatten wir in den Koalitionsverhandlungen Zeit verloren. Um die Neuordnung des Staatsangehörigkeitsrechts hatten wir buchstäblich bis zur Erschöpfung gerungen, mit der Folge, dass sich niemand an die Umsetzung des erarbeiteten Kompromisses machen wollte. Eine große Steuerreform mochte Theo Waigel 1995 noch nicht in Angriff nehmen, weil zunächst durch ein Verfassungsgerichtsurteil die Steuerfreiheit des Existenzminimums und des Familienlastenausgleichs zum 1. Januar 1996 in Kraft treten musste. Waigel fürchtete zu Recht, dass diese Operation – es handelte sich immerhin um ein Finanzvolumen von rund 30 Milliarden DM – im Bundesrat an der rot-grünen Mehrheit scheitern würde, wenn zusätzliche Reformelemente damit verbunden würden. Lafontaine, damals Wortführer der SPD-geführten Landesregierungen, der so genannten »A-Länder«, warnte nämlich vorsorglich schon vor einem »Draufsatteln«. Und schließlich stritten wir innerhalb der Union und in der Koalition kräftig um die Berücksichtigung ökologischer Elemente in der Steuerpolitik. Weil Reformen in der Politik immer zunächst auf Widerstand stoßen, wurde der Zeitverlust innerhalb der Legislaturperiode zum zusätzlichen Problem – sowohl innerhalb der Regierungskoalition als auch hinsichtlich der verbesserten Chancen der rot-grünen Mehrheit im Bundesrat, gegen Ende der Legislaturperiode eine Blockade durchzuhalten.
Viel Kraft kostete uns zudem die Diskussion um die Einführung des Euro. Der Abschied von der D-Mark war ein Prozess, in den sich viele Menschen gerade in den neuen Bundesländern, aber natürlich auch in der älteren Generation nur mühsam einfanden. Das latente Misstrauen in der Bevölkerung blieb nicht ohne Wirkungen in der Union. Insbesondere der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber mahnte eindringlich vor einer zu schnellen Einführung, weil er fürchtete, dass die eher lasche Haushaltspolitik einiger Beitrittsaspiranten den Euro auf Kosten der D-Mark zur Weichwährung machen und damit erst recht das breite Wasser der Vorbehalte in Deutschland auf die Mühlen rechtsradikaler Kräfte lenken könnte. Der CSU-Vorsitzende und Finanzminister Theo Waigel geriet dadurch ein ums andere Mal intern wie international in unangenehme Zwickmühlen, die er schließlich nur dadurch umgehen konnte, dass er in zäh und mit bewundernswerter Zielstrebigkeit geführten Verhandlungen mit den europäischen Partnern einen Stabilitätspakt zustande brachte, der die Euro-Teilnehmer auch nach der Erfüllung der zur Teilnahme berechtigenden Stabilitätskriterien zur stringenten Haushaltspolitik verpflichtete.
Theo Waigel gehörte ohnehin zu den am meisten geplagten und geprügelten Politikern der Koalition. Durch die enormen Transferleistungen für den Aufbau Ost, die zunehmend kritischere Situation der Sozialversicherung wegen der hohen Arbeitslosenzahlen und die Auswirkungen der schwierigen Konjunkturlage auf das Steueraufkommen waren die Finanzspielräume der Bundesregierung gleich null. Wenn gespart werden muss, finden das zwar grundsätzlich alle gut, nur nicht die, bei denen dann tatsächlich gespart wird. Waigel konnte es zwangsläufig niemandem recht machen, und so war er bald ins Fadenkreuz aller Kritik geraten, die auf uns einprasselte.
Natürlich hatte sich die Staatsverschuldung im Zuge der Aufbauleistungen für die neuen Bundesländer erhöht. Die Ministerpräsidenten hatten den Bund beim Solidarpakt, der die Verteilung der Sonderlasten für den Aufbau Ost zwischen Bund und Ländern samt Gründung des Fonds Deutsche Einheit und der Einführung des Solidaritätszuschlags regeln sollte, regelrecht über den Tisch gezogen, sodass wir eher mehr denn weniger in die Finanzklemme gerieten. Außerdem hatte der staatliche Zuschuss zur Sozialversicherung wegen der stark angestiegenen Arbeitslosenzahlen und aus strukturellen Gründen nie gekannte Höhen erklommen. Die heftige öffentliche Debatte traf uns umso unangenehmer, als mit dem Thema Staatsverschuldung ein Markenzeichen der Union, nämlich die finanzielle Solidität, in seinem Kern angegriffen wurde.
Es erhielt schon deshalb immer wieder neue Nahrung, weil andauernd darüber spekuliert wurde, ob Deutschland angesichts seiner Schuldenlage die Maastricht-Kriterien bei der Neuverschuldung erfüllen würde, ohne die es keinen Start in die Währungsunion geben konnte. Den – allerdings nicht nur daraus – resultierenden Sparzwang hatten wir 1993 insoweit institutionalisiert, als wir beschlossen, die Ausgaben des Bundeshaushalts Jahr für Jahr zu reduzieren. Das allerdings bescherte uns bei jeder Haushaltsaufstellung heftige interne Diskussionen, weil sich natürlich die Gestaltungsspielräume ständig verminderten. Trotz aller Einsicht in die Notwendigkeiten gab das immer wieder Anlass zu Missmut, der sich vorrangig gegen den Finanzminister richtete. »Sparen für Maastricht«– diese vergiftete Formel fiel auch bei manch einem frustrierten Fraktionskollegen auf nicht ganz unfruchtbaren Boden und machte die Lage nicht leichter.
3. Reformpolitik und SPD-Blockade
Viel stärker wurde die Situation noch dadurch erschwert, dass auch unsere sozialpolitischen Reformdebatten in diese kurzsichtige Optik gerieten. Mit dem ebenso unzutreffenden wie wirkungsvollen Argument von der falschen Finanzierung der deutschen Einheit und der wohlfeilen Erinnerung an das gebrochene Versprechen von 1990, die Wiedervereinigung ohne Steuererhöhungen bewältigen zu können, das die SPD geradezu gebetsmühlenartig wiederholte, wurde in der Öffentlichkeit der Eindruck befördert, die finanzielle Malaise sei nicht aus strukturellen Gründen entstanden, sondern alleinige Schuld falscher Regierungspolitik. Finanzminister Waigel nutzte jede sich bietende Gelegenheit, die Haushaltsspielräume zu vergrößern, insbesondere durch Privatisierungserlöse, wohlwissend, dass sie nur einmal zu Buche schlagen. Der Versuch jedoch, Anfang Mai 1997 über eine maßvolle Neubewertung der Goldreserven der Bundesbank finanzpolitische Handlungsspielräume zu erschließen, wurde zum Desaster. Schon Tage vorher quoll die Gerüchteküche über, die Bundesregierung wolle sich »wegen Maastricht« am Bundesgold »vergreifen«.
Dabei war die Entscheidung sachlich wohl begründet. In Vorbereitung auf die dritte Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mussten die Währungsreserven der Bundesbank ohnehin entsprechend den vom Europäischen Währungsinstitut entwickelten Grundsätzen neu bewertet werden. Das lag schon deshalb nahe, weil die meisten anderen europäischen Zentralbanken ihre Goldreserven längst wesentlich höher bewerteten als die Bundesbank. Die Koalition war der Auffassung, dass Deutschland mit der notwendigen Anpassung nicht bis zum Jahr 1999 warten, sondern schon im Frühjahr 1997 damit beginnen und die dadurch frei werdenden Finanzmittel an den Erblastentilgungsfonds weiterleiten sollte. Durch die Verringerung der Lasten, die der Bund hier zu tragen hatte, wären wir der Erfüllung der Maastricht-Kriterien für den Eintritt in die Währungsunion ein gutes Stück näher gekommen.
Aber dieses Vorhaben war offensichtlich schwer zu vermitteln. Und als der Zentralbankrat sich trotz vorheriger Sondierung quer legte, war es geradezu hoffnungslos. Dennoch eilte unmittelbar nach dem entsprechenden Kabinettsbeschluss Theo Waigel in einem überstürzten Hubschrauberflug nach Frankfurt zum Zentralbankrat, um ihm den Wunsch der Regierung zu erläutern, obwohl die Sache bereits gescheitert war. Die Aktion löste einen Aufschrei in den Medien aus. Waigels Hubschrauberflug wurde zum »Raubzug« stilisiert, der Vorgang bescherte den Karikaturisten ein äußerst dankbares Sujet und kostete die Union weiteres Vertrauen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde mir deutlich, dass nicht nur in den Medien, sondern auch in der Mehrheit der Bevölkerung sich langsam aber sicher eine regelrechte Abneigung gegenüber der regierenden Koalition und ihren führenden Repräsentanten festzusetzen begann.
Umgekehrt war es Lafontaine nach dem Putsch auf dem Mannheimer Parteitag im November 1995 gelungen, die SPD wieder zu konsolidieren. Zwar neigte auch ich anfangs zu der Einschätzung, ein bekennender Linker an der Spitze der SPD würde für uns manches leichter machen. Doch Lafontaine schlug nicht so sehr auf die altsozialistische Ideologenpauke, sondern verstand es geschickt, die SPD als Wächter der sozialen Gerechtigkeit zurechtzuschminken, was ihm angesichts des Diffamierungspotenzials, das unsere Reformpolitik zwangsläufig enthielt, erlaubte, hinter dieser Maske pure Destruktion zu betreiben. Der Generalverdacht der sozialen Schieflage war nun mal unser Problem.
Mit der ihm eigenen Rücksichtslosigkeit nutzte er die rot-grüne Mehrheitsposition im Bundesrat, um den Eindruck von Reformstau und Bewegungsunfähigkeit der Regierung zu verstärken. Lafontaines Strategie war ebenso einfach wie riskant: Je weniger an Reformen, die in der CDU-/CSU-FDP-Koalition ohnehin stets unter Schmerzen geboren wurden, tatsächlich zustande kam, desto stärker würde der Unmut in der Bevölkerung werden, weil nichts voranging. Die politisch spannende Frage war, ob die Verantwortung dafür eher der SPD wegen ihrer Blockade angelastet würde, oder mehr der Regierung wegen der Unfähigkeit, den Reformstau zu überwinden. Von Monat zu Monat wurde sichtbar, dass – unbeschadet der Zuordnung von Verantwortung – jedenfalls in der politischen Wirkung die Strategie Lafontaines zu Lasten der Regierungskoalition aufging. Aus den Ingredienzien Arbeitslosenzahlen, magere Wachstumsziffern, Reformstau und Streit um soziale Gerechtigkeit, projiziert auf die Folie einer ungewöhnlich lange amtierenden Regierung Kohl, entstand eine für die Koalition und insbesondere die Union am Ende tödliche Melange –Überdruss.
Versuche, die Blockadeposition der SPD aufzulösen oder zu umgehen, scheiterten schon innerhalb der Koalition. Vor allem aber witterten unsere eigenen Leute, stets bereitwillig unterstützt durch die Unkenrufe der FDP, hinter allem Entgegenkommen gegenüber der SPD sofort die heimliche Bereitschaft zu einer großen Koalition. Wenn selbst unverbindliche Sondierungsgespräche mit meinem Fraktionsvorsitzendenkollegen Scharping derart diskreditiert werden konnten, dann musste daraus angesichts der fragilen Machtbalance zwischen CDU und CSU und nicht zuletzt auch innerhalb der CSU ein unüberwindliches Hindernis erwachsen. Den damit verbundenen Verdacht gegen meine Person habe ich ertragen, wenn auch oft genug mit Groll.
Doch auch die Schwäche der FDP verringerte unsere Handlungsspielräume. Dass sie ein ums andere Mal bei Landtagswahlen nicht mehr in die Parlamente zurückkehrte, führte zu heftigem internen Richtungsstreit zwischen den verschiedenen Flügeln. Zuerst musste Kinkel, der deshalb entnervt den FDP-Vorsitz aufgab, dann Gerhardt alle verfügbare Kraft aufbringen, um die Partei einerseits von unüberlegten Selbstmordversuchen abzuhalten, andererseits aber das nötige Maß an Disziplin zu garantieren, ohne das die Mehrheit für die Koalition nicht organisierbar war. Nahezu alle, auch eher unwichtige von der Koalition zu treffende Entscheidungen mutierten für die FDP zur Nagelprobe auf das liberale Profil. Das machte die Entscheidungsfindung gerade in Detailfragen auch für unsere Leute oft genug zur nervenfressenden Feilscherei. Angesichts des seit jeher in der FDP-Fraktion gepflegten Individualismus mit der Gefahr abweichenden Stimmverhaltens im Bundestag waren infolge unserer knappen Mehrheit die Erpressungspotenziale nicht unbeträchtlich, was wiederum auf die Unionsfraktion zwar nicht schulbildend, aber doch frustrierend wirkte. Insbesondere beim Komplex Staatsbürgerschaftsrecht führte das dazu, dass die Koalition nichts Gescheites zu Stande brachte (vgl. auch Kap. III. 2).
Zwar gelang es 1996, im Rahmen unseres Programms für mehr Wachstum und Beschäftigung eine Vielzahl von Gesetzen, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedurften, mit der so genannten Kanzlermehrheit zur Beschleunigung der Entwicklung von Wirtschafts- und Arbeitsmarkt durchzusetzen. Sie führten auch zu einer spürbaren Minderung der Arbeitslosenzahlen, insbesondere im Verlauf des Jahres 1998. Doch es waren immer wieder Kraftakte, die umso mehr Energie kosteten, je unpopulärer sie waren.
Im Juli 1997 einigten wir uns endlich nach langem Widerstand von Norbert Blüm, die Probleme der Rentenversicherung durch Einführung eines demographischen Faktors strukturell anzugehen. Dieser revolutionäre Schritt, der nach Meinung aller Rentenexperten unabdingbar war, wenn man die umlagefinanzierte Rente auf absehbare Zeit erhalten wollte, bot dem politischen Gegner erneut reichlich Möglichkeiten zur Diffamierung. Dass die Renten auch in Zukunft weiter steigen würden, aber nicht mehr so stark wie bis dato, ging im politischen Sperrfeuer unter. In der Logik dieser Reform lag, dass das Rentenniveau innerhalb von zirka 15 Jahren auf etwa 65 Prozent absinken würde. Daraus machte die SPD eine »Rentenkürzung«, was von vielen Medien undifferenziert übernommen wurde und natürlich zu großer Beunruhigung bei den Rentnern führte. Zu erklären, warum eine allmähliche Absenkung des Rentenniveaus keine Rentenkürzung ist und die aktuellen Rentner selbst dadurch keinen Pfennig weniger Rente bekämen, fiel wegen der komplizierten Sachzusammenhänge nicht leicht. Was aber nicht so einfach ist wie ein Kampfbegriff à la Rentenkürzung, konnte in der allgemeinen Aufgeregtheit nicht durchdringen. Also verließ bereits wenige Wochen später die Union wieder teilweise der Mut. Auf dem für September 1997 turnusmäßig angesetzten Strategiegipfel der Unionsschwestern, der diesmal in der Idylle von Kloster Andechs stattfand, verabredete die Führung von CDU und CSU, diese Reform nicht, wie vorgesehen, schon zum 1. Januar 1998, sondern erst nach der Bundestagswahl zum 1. Januar 1999 in Kraft zu setzen. Ich war nicht in der Lage, diese Kehrtwende zu verhindern, weil mich ausgerechnet zwei Tage vorher eine Erkrankung dazu zwang, meine Teilnahme abzusagen – bei einem vergleichbaren Anlass das erste und einzige Mal in 16 Jahren. Allerdings hatte ich auch nicht mit einer solchen Volte gerechnet. Umso größer war mein Ärger. Die Bevölkerung von der alternativlosen Notwendigkeit dieser Rentenreform überzeugen zu wollen, ohne den Mut zu haben, sie auch schon vor der Wahl auf den Weg zu bringen, erschien mir ziemlich aussichtslos. Ja, ich war überzeugt, dass uns das in unseren Chancen zurückwarf, weil wir exakt vorexerzierten, was der Regierung in der Öffentlichkeit immer wieder vorgeworfen wurde: nämlich Führungsschwäche. Ich war so aufgebracht, dass ich nach meiner Genesung wenige Tage später eine schwere und lautstarke Auseinandersetzung im Kreis der Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Koalition suchte, um meine Überzeugung zu vertreten, dass auf diesem Wege die Bundestagswahl 1998 verloren gehen müsse.
Auch die Steuerreform entwickelte sich zu einem Drama, dessen Ende allerdings nicht von uns, sondern dank Lafontaines Blockadestrategie von der SPD-Mehrheit im Bundesrat bestimmt wurde. Um zu verhindern, dass überhaupt nichts zustande kam, schlug ich vor, die Mehrwertsteuer um ein Prozent zu erhöhen, das entsprechende Aufkommen zur Senkung des Rentenversicherungsbeitrags zu verwenden und wenigstens Teile des Steuerreformkonzepts zusammen mit einer weiteren Absenkung der Sozialversicherungsbeiträge über eine höhere Mineralölsteuer konsensfähig zu machen. Das war nicht ganz aussichtslos, weil die SPD sich in Sachen Lohnnebenkosten ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hatte und deshalb unter Umständen zu ködern war, zumal die Erhöhung der Mineralölsteuer ihrem Fetisch Ökosteuer entsprach. Doch alle Versuche, in die ich viel Mühe investierte, führten nur zur Anhebung der Mehrwertsteuer und zur entsprechenden Senkung des Rentenversicherungsbeitrags, wobei die SPD unsere Rentenreform mit der demographischen Komponente zwar nicht mittrug, daran aber den Kompromiss – höhere Mehrwertsteuer gegen Beitragssenkung – nicht scheitern ließ. Dagegen gelang eine Einigung über die Steuerreform und die Mineralölsteuer nicht einmal teilweise. Auf Seiten der Koalition war erst Waigel zögerlich, weil der Preis, die Erhöhung der Mineralölsteuer, im Flächenland Bayern viel Ärger versprach. Das überlegt sich ein CSU-Vorsitzender, auch wenn er Finanzminister ist, mindestens zweimal. Als er dann schließlich überzeugt war, hatte sich in der FDP bei Fraktionschef Solms und dem Parteivorsitzenden Gerhardt die Überzeugung durchgesetzt, dass eine Fortsetzung der Konfrontation zwischen Koalition und rot-grüner Opposition den Liberalen für die Wahl 1998 die bessere Überlebensperspektive bot als eine teilweise Auflösung von Bundesratsblockade und Reformstillstand.
Zwar kam es im Dezember 1997 noch zu Gesprächen mit der SPD, die Scharping und ich am 24. November initiiert hatten und für die er sich während des SPD-Parteitags (2. bis 5. Dezember in Hannover) die Legitimation von Lafontaine holte. Doch diesem schwebte kein positives Ergebnis vor, sondern ein weiterer Stillstandsbeweis. In diesem Sinne legten Frau Matthäus-Maier und der damalige hessische Ministerpräsident Eichel, die neben Scharping die SPD vertraten, die Latte für eine Einigung so hoch, dass Waigel, Glos und ich die Skepsis von Gerhardt und Solms nicht mehr ausräumen konnten. Solms teilte mir schließlich am Telefon mit, dass eine Erhöhung der Mineralölsteuer mit der FDP-Fraktion unter keinen Umständen zu machen sei. Damit war mir der Schlüssel für einen Kompromiss endgültig aus der Hand geschlagen.
Immerhin blieb unser Petersberger Steuerreformkonzept, das wir seit dem Steuerparteitag der CDU in Hannover 1996 erarbeitet und im Bundestag nach manchen internen Auseinandersetzungen beschlossen hatten, ein Reformansatz, der auch heute noch den Steuerkonzepten von Eichel überlegen ist. Aber dafür konnten wir uns im Blick auf die Bundestagswahl nichts kaufen, denn in Kraft getreten ist das Gesetz mangels Zustimmung des Bundesrates nicht, und die politische Last des Scheiterns trug jedenfalls im Wahlkampfjahr 1998 nicht mehr die SPD.
4. Leipziger Parteitag 1997: Wie man eine Reformdebatte verhindert
Das Bedürfnis nach Reformen war auch in der Union groß. Aber es ging unseren Mitgliedern offenbar wie den meisten Menschen: Sie sahen zwar den einzelnen Schritt, nicht aber immer den Gesamtzweck, und deshalb waren sie genauso anfällig für Detailkritik, die dann schnell zur generellen Politikschelte wurde. Dass das starke Bedürfnis nach Reformen und ihr Verständnis durchaus in Einklang zu bringen war, zeigte der Leipziger Parteitag im Oktober 1997. Als Fraktionsvorsitzender hatte ich satzungsgemäß einen Rechenschaftsbericht über die Arbeit der Fraktion zu erstatten. Diesmal nutzte ich die Gelegenheit, die beschlossenen Gesetze und Reformkonzeptionen in einen systematischen Zusammenhang zu stellen. Die Reaktion auf dem Parteitag und in der Öffentlichkeit war überschwänglich. Die stellvertretende Parteivorsitzende Angela Merkel, die neben mir auf dem Podium saß, meinte nach der Rede, nun wisse sie wieder, warum sie in der CDU sei. Und ein Mitarbeiter sagte mir anschließend zu meiner Verwunderung, er habe das Gefühl gehabt, dass die Leute erstmals verstanden hätten, was wir da eigentlich so trieben. Aber wahrscheinlich war es genau das: Was für viele wie Flickwerk ausgesehen hatte, bekam durch die Art der Darstellung plötzlich Sinn und Ziel. Man erkannte mit einem Mal eine Perspektive für die Zukunft. Und danach sehnten sich alle.
Die Reaktion von Kohl allerdings zeigte die spezifischen Fähigkeiten, mit denen er in der Folgezeit – vor und nach der Bundestagswahl 1998 – allen vermeintlichen oder tatsächlichen Ansätzen entgegenwirkte, die seinen beherrschenden Einfluss damals als Bundeskanzler und Parteivorsitzender unmittelbar auf die Geschicke des Landes, später mittelbar auf die Union zu relativieren oder gar einzuschränken schienen. Ich war sofort nach dem Ende des Parteitags gut gelaunt zum Flughafen gefahren, wo ich zusammen mit der damaligen Umweltministerin Angela Merkel und einigen Bundestagskollegen in einer Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr auf den Rückflug nach Bonn wartete. Doch die Maschine stand und stand, und nachdem ich mich erkundigt hatte, was der Grund für die Verzögerung sei, erfuhr ich, dass wir erst abfliegen dürften, wenn auch die Maschine des Kanzlers gestartet sei. Das war Sicherheitsvorschrift: Sollte nämlich die Kanzlermaschine aus irgendeinem Grund ausfallen, musste eine Ersatzmaschine unmittelbar zur Verfügung stehen. Wir saßen schon über eine halbe Stunde in der Maschine, als endlich die Wagenkolonne des Kanzlers auftauchte und auch wir starten konnten.
Erst als ich am späten Nachmittag in meinem Bonner Büro saß und mein Pressesprecher mir mit bedenklichem Gesicht einige frische Agenturmeldungen hereinreichte, erfuhr ich den Grund für die Verzögerung. Kohl hatte, nachdem die Parteitagsdelegierten sich auf den Heimweg gemacht hatten, ein Fernsehinterview gegeben. Darin hatte er verkündet, dass er mich als seinen Nachfolger im Amt wünsche. Obwohl er das nicht zum ersten Mal in mehr oder weniger offener Form gesagt hatte, wirkte diese Äußerung unter dem Eindruck des beendeten Parteitags auf die Journalisten wie eine Sensation. Meine spontane Einschätzung war, dass er sich und mir damit keinen Gefallen getan hatte. Vor allem er würde sich ab sofort bohrenden Fragen ausgesetzt sehen, wann denn der Wechsel stattfinden werde. Und für mich sah ich natürlich vorher, dass ich nun permanent in der Verlegenheit war, dazu irgendwie Stellung zu beziehen.
Ich rief ihn an und fragte unter Hinweis auf die zu erwartenden Folgen, ob er sich das eigentlich gut überlegt habe. Kohl meinte, er sehe da überhaupt kein Problem. Doch einen Tag später bekundete er öffentlich, bei der Bundestagswahl im September 1998 selbstverständlich für die vollen vier Jahre einer Legislaturperiode antreten zu wollen. Eine Nachfolge fünf Jahre später? Ich hatte jeden Anschein eines »Kronprinzenschicksals« schon seit 1991 entschieden von mir gewiesen. Außerdem war ich der festen Überzeugung, dass Kohl letzten Endes niemals freiwillig abtreten würde. Umso mehr empfand ich den Vorgang als abträglich für ihn und unsere Wahlchancen. Bereits 1994 hatte es kurz vor der Bundestagswahl eine Parallele mit schädlichen Wirkungen gegeben. Damals hatte Kohl, offensichtlich unbedacht, in einem Fernsehinterview angekündigt, dass er eigentlich nicht die ganze Legislaturperiode im Amt bleiben wolle. Zwar sprach er nicht über einen Nachfolger, doch das Echo war auch so problematisch: Kohl als Kanzler auf Abruf.
Die Äußerungen nach dem Leipziger Parteitag ordnete ich zunächst in die Kategorie »Gut gemeint!« ein. Obwohl in der Presse anschließend des Langen und des Breiten über Sinn und Hintersinn der Kohl-Worte spekuliert wurde und auch der Gedanke auftauchte, er habe mich in Wahrheit nach dem großen Erfolg meiner Parteitagsrede wieder einfangen und zeigen wollen, wer der Chef sei, konnte ich mir eine bewusst intrigante Aktion Kohls nicht vorstellen. Andere allerdings urteilten anders und härter.
Für mich hatte die ganze Geschichte die unangenehme Folge, dass nahezu alles, was ich von da ab unternahm oder öffentlich äußerte, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt geprüft wurde, ob ich damit meine Kanzlerkandidatur vorbereite. Jedes Wörtchen wurde auch parteiintern auf der Goldwaage gewogen, und ich musste höllisch aufpassen, nicht plötzlich durch unbedachte Äußerungen in die Rolle des potenziellen Königsmörders zu geraten. Dass ich spätestens seit Leipzig als Hoffnungsträger der CDU galt, fand ich demgegenüber unproblematisch, weil davon auszugehen war, dass sich das eher positiv für die Partei insgesamt auswirkte.
Angesichts deprimierender Umfrageergebnisse in den ersten Monaten des Jahres 1998 nahmen in den Medien die Spekulationen zu, ob die Union nicht doch mit einem anderen Kandidaten in die Wahl gehen werde. Kohl verkündete daraufhin offiziell auch auf Drängen der CSU aus seinem Osterurlaub, dass er erneut anzutreten gedenke. Er hatte mir das vorab telefonisch mitgeteilt. Die CSU war schon deshalb gegen die Festlegung auf einen Kanzlernachfolger aus der CDU, weil sie sich eigene Optionen für diesen Fall nicht von vornherein nehmen lassen wollte. Außerdem hatte sie zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht die geringste Lust, sich mit der Frage überhaupt ernsthaft auseinander zu setzen. Kohls Ankündigung fand in der CDU nicht nur ungeteilten Beifall. Dennoch: Zu einer intensiven Personaldebatte kam es im Vorfeld der Bundestagswahl nicht. Biedenkopf und Geißler haben es versucht, das Resultat war vorhersehbar. Biedenkopf war äußerst ungehalten darüber, dass Kohl seine Kandidatur im Urlaub verkündet hatte, ohne dies vorher zum Thema in den Führungsgremien zu machen. In einem Brief an das Parteipräsidium beklagte er, dass vor dem Hintergrund der langen Regierungszeit eine Entscheidung von solcher Tragweite zumindest im Präsidium hätte sorgfältig beraten werden müssen. Vor allem vermisste er eine mit dem Kandidaten verknüpfte programmatische Perspektive. Der Brief wurde den Mitgliedern des Präsidiums zur Kenntnis gegeben. Eine Diskussion darüber erfolgte nicht.
Meine Überzeugung war immer, dass Kohl aus seiner Partei heraus nicht ohne zerstörerische Folgen gestürzt werden konnte – und wegen dieser Folgen auch nicht gestürzt werden durfte. Darüber hinaus hatte Kohl auch die Koalition immer zusätzlich zu seiner Machtabsicherung eingesetzt. Vor 1998 waren Diskussionen über einen personellen Wechsel sofort als Koalitionsdebatte – weg von der FDP, hin zur großen Koalition – interpretiert worden. Deshalb waren die Liberalen für Kohl immer eine sichere Bank. Aber selbst wenn die Koalitionsfrage davon nicht berührt gewesen wäre, hätte man das Risiko einer geheimen Kanzlerwahl im Bundestag angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse niemals vertreten können. Als schließlich führende FDP-Politiker 1998 angesichts der düsteren Aussichten für die Bundestagswahl dann doch über einen Personalwechsel an der Regierungsspitze nachzudenken begannen, wäre eine solche Debatte vielleicht mit der CDU, mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt aber nicht mit der CSU zu führen gewesen.
5. Kanzlerkandidat Schröder
Die SPD hatte den für sie gefährlichen Teil der Blockadestrategie gut verkraftet. Der Wahlkampf 1998 stand zu kurz davor, als dass aus dem Scheitern aller Einigungsbemühungen Ende 1997 noch viel Schaden hätte entstehen können. Außerdem war die Landtagswahl in Niedersachsen am 1. März 1998 zum Plebiszit über den sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten ausgestaltet worden. Die Art, wie es Lafontaine und Schröder gelang, ihre persönliche Rivalität und gegenseitige Abneigung über Monate hinweg in der Öffentlichkeit beiseite zu schieben, gehört zu den großen Leistungen vor allem von Lafontaine auf dem Weg zum rot-grünen Wahlsieg im September 1998. Dabei stellten sie die vermeintlich ehernen Erfahrungsgrundsätze aller Wahlstrategen, dass Personalspekulationen schädlich sind, weil sie nach Streit riechen, geradezu auf den Kopf. Denn im Gegenteil führte die ungeklärte Kanzlerkandidatenfrage der SPD zu einem permanent hohen und grundsätzlich freundlichen Aufmerksamkeitspegel. Die Frage, wer am Ende aus dem Rennen als Sieger hervorgehen werde, machte die SPD interessant. Mit der Zuspitzung auf das niedersächsische Wahlergebnis – wie viel muss Schröder holen, um antreten zu können – wurde es geradezu spannend. Dass Lafontaine bei dieser Strategie seine eigenen Chancen marginalisierte, gehört für mich zu den ungelösten Rätseln dieses sonst so durchsetzungsfähigen Politikers. Lafontaine wurde im Gegensatz zu Schröder von der Partei geliebt. Hätte er seinen Anspruch rechtzeitig offen angemeldet, wäre ihm die Kanzlerkandidatur kaum streitig zu machen gewesen. Indem er jedoch die Niedersachsenwahl als vorentscheidendes Datum akzeptierte, war er ein Gefangener von Umständen, die er nicht mehr unmittelbar beeinflussen konnte. Der Ärger über seine eigene Fehleinschätzung könnte eine erste Ursache für seinen abrupten Rückzug aus der Politik ein Jahr später gewesen sein.
Jedenfalls markiert das Datum der Niedersachsenwahl den Beginn eines gewaltigen Aufschwungs der SPD und ihres von da ab feststehenden Kanzlerkandidaten Schröder. Die Meinungsumfragen dokumentierten es zu unserem Leidwesen von Woche zu Woche. Irgendwie gefälliger modern, der Eindruck von Bewegung ohne zu sagen wohin, ein weniger verbrauchtes Gesicht – das alles passte zu dem aufgestauten Bedürfnis nach Veränderung, nach Wechsel, gegen das die Union nach 16 Jahren Regierungsverantwortung letztlich machtlos war. Münteferings Wahlkampagne hat diese Grundstimmung zwar aufgenommen, in der Substanz aber viel weniger zum Stimmungsumschwung beigetragen, als öffentlich gemutmaßt wird. Die »Kampa-Legende« besteht darin, dass es die Wahlkampfzentrale Kampa gab. Allein ihre Existenz und weniger, was dort ausgebrütet wurde, war Anlass für ständige Medienberichterstattung und deshalb ein Wert an sich. Programmatik spielte eine völlig untergeordnete Rolle. Es kam auf Äußerlichkeiten, auf Verpackung, auf Inszenierung an. Die Medien wollten Bilder haben. Insoweit war die Kampagne dann symptomatisch nicht nur für Schröders Wahlkampf.
Höhepunkt war Schröders Nominierungsparteitag. Eine unter Showgesichtspunkten perfekte Inszenierung mit detaillierten Regieanweisungen für die Matadore (»Winken bis zum Ende der Musik«) überschritt zwar für meinen Geschmack die Grenze zur Lächerlichkeit. Doch die Wirkung der Bilder im Fernsehen war eine andere. Was auch manche Kommentatoren in den Medien eher peinlich berührte, kam dennoch an, weil es irgendwie zum Neuen, zum Modernen, zum propagierten Wechsel passte. Als Schröder einige Tage später im Bundestag auftrat, erlitt er einen deutlichen Rückschlag. Eine hölzern vorgetragene, an Plattitüden und Sprechblasen reiche, an inhaltlicher Substanz umso ärmere Rede konnte ich genüsslich und zum großen Vergnügen nicht nur der Regierungsfraktionen auseinander pflücken. Das Presseecho war für den frisch gebackenen Kanzlerkandidaten wenig erfreulich. Aber wieder einmal machten wir die Erfahrung, dass der Eindruck im Plenarsaal des Bundestages nicht notwendig mit dem öffentlichen Bewusstsein deckungsgleich ist. Schröder traf ein Gefühl, und das fragte nicht nach seinen politischen Lösungsvorschlägen.
6. Zukunftsprogramm – oder: Wie man eine Chance vernichtet
Dem vorherrschenden Eindruck von Reformstau und der anwachsenden Wechselstimmung nach 16 Jahren Regierungszeit versuchten wir mit einem Zukunftsprogramm entgegenzuwirken, das unter meiner Leitung in einer Parteikommission erarbeitet wurde. Es sollte auf dem Parteitag in Bremen im Mai als Grundlage für unser Regierungsprogramm verabschiedet werden. Es war der Versuch einer politisch nicht ganz ungefährlichen Gratwanderung. Denn einerseits wollten wir nach 16 Jahren Regierungszeit auf eine allzu selbstgerecht erscheinende Erfolgsbilanz verzichten – was für ein Parteiprogramm ja eher untypisch ist. Andererseits durften wir aber auch den für die Zukunft notwendigen Reformbedarf nicht als Kritik an unseren bisherigen Leistungen oder Unterlassungen erscheinen lassen. Deshalb gingen wir einen konzeptionell neuen Weg. Zunächst versuchten wir, die moderne Wirklichkeit und die rasanten Veränderungen in ihr ohne Beschönigungen zu beschreiben, womit zugleich aus der Realität der Moderne heraus der tatsächliche Reformbedarf ehrlich und ungeschminkt erläutert werden konnte. Das war vor allem der erste, »narrative« Teil des Programms. Darauf aufbauend leiteten wir dann aus unseren Grundwerten Antworten für die künftige Richtung unserer Politik ab, ohne dabei den ohnedies unglaubwürdigen Anspruch perfektionistischer Lösungen durch staatliche Regulierung zu erheben. Mit dieser realistischen Beschreibung der modernen Wirklichkeit, ihrer rasanten Veränderungen und der Begrenztheit staatlicher Lösungsmöglichkeiten ließ sich überzeugend unser stärkeres Vertrauen auf subsidiäre Selbstregulierung einer wertegebundenen, freiheitlich verfassten Gesellschaftsordnung begründen. Damit hatten wir einen weitaus substanzielleren Lösungsansatz für die anstehenden Probleme als unsere politische Konkurrenz.
Schon während der Kommissionsberatungen hatten wir zunehmend das Gefühl, dass da etwas bemerkenswert Gutes im Entstehen war. Am Ende unserer letzten Sitzung klatschten die Beteiligten spontan Beifall, und wir gingen in dem Bewusstsein auseinander, ganze Arbeit geleistet zu haben. In der öffentlichen Kritik wurde denn auch kaum bestritten, dass unser Zukunftsprogramm substanzieller und moderner war als die Angebotspalette der Konkurrenz.
Aber auch bei diesem viel gelobten Zukunftsprogramm kam es bei der Präsentation zu überflüssigen Irritationen, die freilich nicht der reine Zufall waren. Wir standen ein wenig unter Zeitdruck, weil wegen der einzuhaltenden Fristen das Programm rechtzeitig in die Parteigliederungen gegeben werden musste, damit es im Mai beschlossen werden konnte. Das hieß konkret, dass es noch vor Ostern verschickt werden musste. Mit der CSU hatten wir vereinbart, im Sommer eine gemeinsame Wahlplattform auszuarbeiten, die sowohl auf unserem Zukunftsprogramm als auch auf einem von der CSU noch zu beschließenden Papier basieren sollte. In der letzten Sitzungswoche vor Ostern übergab ich dem CSU-Vorsitzenden Waigel ein Exemplar unseres frisch gebackenen Zukunftsprogramms und teilte ihm in Absprache mit Helmut Kohl mit, dass ich es in einigen Tagen der Öffentlichkeit präsentieren wolle, weil es dann ohnehin verschickt werden müsse. Waigel hatte keine Einwände.
Obwohl die Journalisten das Papier erst bei der überfüllten Pressekonferenz in die Hand bekamen, wurden zu meiner Verwunderung gleich die ersten Fragen zu einem auf Seite 35 versteckten Halbsatz gestellt, in dem es mit nahezu deckungsgleichen Formulierungen aus der Koalitionsvereinbarung vom Herbst 1994 um ökologische Elemente in der Steuerpolitik ging. Insbesondere interessierten sich die fragenden Journalisten dafür, ob dieser Punkt mit der CSU abgestimmt sei. Da wir darüber nicht gesprochen hatten, beschränkte ich mich auf den Hinweis, dass natürlich die Präsentation des Programmentwurfs dem CSU-Vorsitzenden bekannt, im Übrigen die konkrete Sachfrage nichts Neues sei. Dennoch beschlich mich ein ungutes Gefühl, zumal die zufrieden lächelnden Mienen der Fragesteller den Schluss nahe legten, dass sie nicht von selbst auf diese Fragen gekommen sein konnten.
Tatsächlich entwickelte sich innerhalb weniger Tage eine völlig verquere Nachrichtenlage, die in Überschriften wie »Schäuble will Ökosteuer« und »Riesenkrach in der Union« gipfelten. Postwendend hatte nach der Pressekonferenz der Generalsekretär der CSU öffentlich wissen lassen, mit ihnen sei eine Ökosteuer nicht zu machen. Andere in der CSU wurden mit Vermutungen zitiert, ich plane einen Linksruck der CDU und eine Annäherung an die SPD. Spätestens als dann auch noch Äußerungen in den Zeitungen zu lesen waren, eine Kanzlerkandidatur Schäubles werde von der CSU nicht mitgetragen, war mir klar, dass die Erregung in der Sache vorgeschoben war.
Die »Osterfestspiele« taten ihre Wirkung. Das Zukunftsprogramm ging erst einmal unter. Kommentatoren, für die die plötzliche Personalisierung des völlig überflüssigen Krachs ein gefundenes Fressen war, stellten die scheinheilige Frage: »Was will Schäuble?« Auch in der CDU wurden einige nervös, und es erhoben sich hier und da kritische Stimmen gegen eine Ökosteuer, so als sei das die Hauptaussage des Programms. Dafür hielten sich diejenigen in der CDU, vor allem die Mitglieder der Zukunftsprogrammkommission, die mich hätten verteidigen können und müssen, über die Ostertage auffällig zurück. Auch von Helmut Kohl war kein Wort zu vernehmen. Erst in der Bundesvorstandssitzung am 20. April kritisierte Kohl die »ebenso schädliche wie unsinnige« Diskussion der letzten Wochen und stellte fest, es habe für die CSU nicht den geringsten Grund gegeben, eine derartige Entwicklung in Gang zu setzen. Die anderen Bundesvorstandsmitglieder gaben ihrem Ärger noch weit drastischer Ausdruck. Insbesondere erschien allen das Faktum als absurd, dass von der Schwesterpartei und aus der Koalition heraus zu Beginn des Wahljahres ein Streit mit all den hineingepackten Verdächtigungen über eine Frage vom Zaun gebrochen worden war, die wir schon 1994 einvernehmlich in der Koalition besprochen hatten. Später wurde mir berichtet, Mitarbeiter aus dem Kanzleramt hätten zwei der Journalisten, die dann auf der Pressekonferenz fragten, einen Tag vorher mit einem Textentwurf versorgt und darauf aufmerksam gemacht, dass die Sache mit den ökologischen Elementen auf entschiedenen Widerstand der CSU stoßen würde. Und am Vorabend der Pressekonferenz, so hieß es weiter, sei genau das in einem Hintergrundgespräch des CSU-Generalsekretärs mit einigen wenigen, darunter auch diesen beiden Journalisten, ausdrücklich bestätigt worden. Sie seien also offensichtlich munitioniert gewesen.
Was immer von wem mit welcher Zielrichtung tatsächlich beabsichtigt gewesen sein mag oder nicht – dass mir wieder einmal irgendwelche Hintergedanken unterstellt worden waren, ärgerte mich weniger als die Tatsache, dass das hervorragende Zukunftsprogramm durch den Hauskrach die erhoffte Wirkung verfehlte. Die positive Botschaft, die wir so dringend benötigten, ging in der hitzigen Debatte zwischen CDU und CSU unter. Nur der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass natürlich auch die FDP vehement gegen »Ökosteuern« polemisierte, und so wiederholte sich fast deckungsgleich die interne Debattenlage vom Dezember 1997, als an ebendiesem Punkt wegen Meinungsverschiedenheiten in der Koalition die letzten Einigungsbemühungen mit der SPD in Sachen Steuerreform scheiterten. Als das Zukunftsprogramm unter vielen Lobesworten in Bremen verabschiedet wurde, musste ich wehmütig daran denken, welche große Chance wir uns selbst kaputtgemacht hatten. Es war letzten Endes auch Ausdruck von innerer Erschöpfung einer Koalition, die in 16 Jahren angesichts schwindender Wahlaussichten müde geworden war.
7. Letzte Versuche, die Niederlage abzuwenden.
Seit der Nominierung Schröders zum Kanzlerkandidaten der SPD entwickelten sich die Umfragewerte für uns noch schlechter als zuvor. Wir gaben uns in der Öffentlichkeit weiter zuversichtlich, dass wir natürlich die Bundestagswahl gewinnen würden. Doch der Glaube daran schwand in den Führungsgremien der Partei immer mehr. Nur wurde darüber nie offen geredet. Als im späten Frühjahr die Perspektiven für den Wahlausgang ziemlich trostlos aussahen, kam es innerhalb der CDU noch einmal zu Erörterungen, ob nicht die Ankündigung eines Kanzlerwechsels nach der Wahl das Blatt doch noch wenden könnte. Manche sprachen sich sogar dafür aus, schon auf den Wahlplakaten ein neues Gesicht zu zeigen. Für alle war klar, dass eine solche Entscheidung nur von Kohl selbst ausgehen konnte, und viele waren dafür, mit ihm zu reden, wobei als geeigneter Zeitpunkt und Anlass die endgültige Entscheidung des Europäischen Rates über die Einführung des Euro erschien. Allerdings wollte niemand von denen, die plötzlich auf radikale Veränderung drängten, selbst zu Kohl gehen. Stattdessen klopften sie der Reihe nach bei mir an und deponierten ihre Sorgen auf meinem Schreibtisch.
Da auch mich selbst der drohende Wahlausgang und die sich daraus ergebenden Folgen für die Union umtrieb, nahm ich es schließlich auf mich, mit dem Kanzler zu reden. Aber das Gespräch bestätigte schnell meine Vermutung, dass eine Bereitschaft geschweige denn Initiative, das Feld zu räumen, von ihm überhaupt nicht zu erwarten war. Auf meine Aussage, mit ihm als Kandidat sei die Bundestagswahl für die Union nicht mehr zu gewinnen, antwortete er – gegen seine Gewohnheit ohne Umschweife –, er sei im Gegenteil ganz sicher zu gewinnen. Und er fügte sofort hinzu, die unterschiedliche Beurteilung dieser einen Frage werde ja wohl an der Loyalität unserer Zusammenarbeit nichts ändern. Womit er, wie er wusste, Recht hatte.
Für mich blieb als offene Frage, wie es dennoch gelingen könnte, auch mit dem Kandidaten Kohl den Schröder-Nimbus des Neuen, Modernen, Unverbrauchten einigermaßen zu kontern. In Absprache mit Kohl entwickelte ich im Bundesvorstand eine mit Beifall akzeptierte Linie, die der durchgestylten Lächeloffensive des SPD-Kandidaten eine seriöse politische Substanz der CDU entgegensetzte. Es war völlig klar, dass nach 16 Jahren eine auf Kohl zugespitzte Personalisierung, wie sie 1994 im Wahlkampf noch gelungen war, diesmal nicht mehr ziehen konnte. Im »Kampf der Gesichter« musste er gegenüber Schröder den Kürzeren ziehen. Da es Schröders Problem war, dass er mit der spd-Programmatik kaum in Deckung gebracht werden konnte, bestand unsere einzige Chance, das Blatt noch einmal zu wenden, darin, seine inhaltlichen Defizite bloßzulegen. Der Angriff musste also auf die Substanzlosigkeit des SPD-Kandidaten zielen. Gleichzeitig musste es unser Bestreben sein, den zukunftsorientierten Reformansatz unserer Politik so griffig in Wort und Bild zu kleiden, dass Seriosität und Solidität des Unionsangebots eine hinreichende Attraktivität entwickelten. Zu meiner Überraschung sah ich kurze Zeit später meine Ausführungen vor dem Bundesvorstand in voller Länge im Spiegel dokumentiert, versehen mit der redaktionellen Kommentierung, die CDU glaube nicht mehr daran, mit Kohl die Wahl gewinnen zu können. Da allerdings auch der Spiegel erste Zweifel an Schröders Showkampagne hegte, konzedierte er immerhin, dass die skizzierte Alternativlinie der CDU eine gewisse Logik für sich habe. Kohl rief mich ziemlich ungehalten an und wollte wissen, wie der Text in das Magazin – das er niemals las – hineingeraten sei. Da ich es nicht wusste, konnte ich die Frage auch nicht beantworten. Aber ich spürte ein unverhohlenes Misstrauen.
Das Echo auf die Spiegel-Veröffentlichung bestärkte mich in meiner Einschätzung, dass wir richtig lagen. Doch schon die mühsame Formulierung der gemeinsamen Wahlplattform mit der CSU desillusionierte mich, weil wieder einmal sorgfältig alle unbequem erscheinenden Wahrheiten vermieden wurden und am Ende ein glatt geschliffenes Durchschnittsprodukt übrig blieb, das die öffentliche Auseinandersetzung kaum lohnte. Als in der Phase der konkreten Wahlkampfvorbereitung dann nicht einmal die Entwürfe der Wahlplakate der CDU-Führungsspitze zur Begutachtung präsentiert wurden, bestand kaum noch ein Zweifel, dass ein enger Beraterzirkel um Kohl einen Wahlkampf vorbereitete, der mit der von mir vorgeschlagenen Linie nicht mehr viel gemein hatte.
Da die Perspektiven für den Wahlausgang gleichmäßig schlecht blieben, befassten sich öffentliche und interne Diskussionen zunehmend mit den Folgen für den Fall, dass es der Koalition nicht mehr zur Mehrheit reichen werde. Die meisten Wetten standen auf einer großen Koalition, eine rot-grüne Regierung folgte mit Abstand. Ich hielt die große Koalition, für die sich von Spiegel über Stern bis Zeit und Woche selbst Chefredakteure die Finger wund schrieben, für sehr unwahrscheinlich. Sie hätte ein Wahlergebnis vorausgesetzt, bei dem weder die alte Koalition noch Rot-Grün eine Mehrheit gehabt hätten, die PDS-Stimmen also den Ausschlag hätten geben müssen. Doch selbst in diesem Falle wäre es noch entscheidend darauf angekommen, ob CDU/CSU oder SPD stärkste Fraktion würden, also den Anspruch auf den Kanzler anmelden könnten. Kohl hatte es immer weit von sich gewiesen, Kanzler einer großen Koalition sein zu wollen. Ich war mir da nicht so sicher. Würde die Union stärkste Fraktion, ohne dass es mit der FDP zur Mehrheit reichte, hätte es mich nicht überrascht, wenn Kohl in einer großen Koalition mit der SPD weitergemacht hätte. Ob allerdings Schröder darauf verzichtet hätte, notfalls auch mithilfe der PDS-Stimmen gegen Union und FDP Nummer eins zu werden, bezweifelte ich doch sehr. Den anders lautenden Beteuerungen im Wahlkampf glaubte ich jedenfalls nicht. Insofern hätte es uns nichts genutzt, wenn wir – was äußerstenfalls denkbar gewesen wäre, aber eben höchst unwahrscheinlich erschien – mit knappem Vorsprung vor der SPD gelegen hätten. Würde umgekehrt die SPD stärkste Kraft, war nach meiner Einschätzung eine rot-grüne Mehrheit schon deshalb wahrscheinlich, weil die Grünen vorhersehbar stärker als die FDP abschneiden würden. Jede für CDU und CSU theoretisch denkbare Regierungskonstellation mit der SPD, dessen war ich mir sicher, hätte zu einer Zerreißprobe mit kaum absehbaren Folgen zwischen den Schwesterparteien geführt, weil die CSU gegenüber CDU und SPD schon nummerisch drastisch an Bedeutung verlieren würde. Dass die Union sich als Juniorpartner an einer großen Koalition beteiligen könnte, war im Übrigen auch für mich keine verlockende Vorstellung. Ich hielt ein solches Wahlergebnis auch nicht für wahrscheinlich. Immerhin, die öffentlichen Spekulationen konzentrierten sich auf diese Variante und in der Konsequenz auf die Frage, wer bei der CDU auf Kohl folge. Es ging immer nur um zwei Namen: Volker Rühe und mich. Beide hatte Kohl ja auch schon Anfang der Neunzigerjahre abwechselnd zum Nachfolger ausgerufen.
8. In Sorge um die CDU –Überlegungen für die Zeit nach der Wahl
Am 21. August 1998 setzten wir beide uns in Hamburg zusammen. Unser Anliegen war, die Union nach jedem denkbaren Wahlergebnis als große integrierende Volkspartei der Mitte zukunftsfähig zu halten. Für den vorhersehbaren Fall einer Niederlage und den damit verbundenen Gang in die Opposition war klar, dass die Lage der Union sehr viel kritischer als 1969 sein würde. 1969 war die CDU/CSU als klar stärkste Fraktion (knapp unterhalb der absoluten Mehrheit) durch die beiden anderen Parteien SPD und FDP von der Regierung verdrängt worden. Außerdem verfügte die Union damals im Bundesrat über eine starke Position. 1998 hingegen hatten wir neben der CSU-Regierung in Bayern nur noch die CDU-FDP-Koalition in Baden-Württemberg, eine CDU-Regierung in Sachsen und vier große Koalitionen in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Bremen, die letztere SPD-geführt. Mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg standen in allen diesen Ländern bis Ende 1999 Landtagswahlen an (Mecklenburg-Vorpommern wählte bereits am Tag der Bundestagswahl). Die Aussichten im Sommer 1998 konnten uns also nicht sehr fröhlich stimmen. Außerdem hatte sich unsere strategische Lage gegenüber 1969 auch im Bundestag erheblich verschlechtert. Seinerzeit gab es nur drei Fraktionen, sodass Mehrheitsbildungen entweder durch die FDP oder durch eine absolute Mehrheit zustande kamen. 1998 war aber mit fünf Fraktionen im Bundestag zu rechnen, wobei die SPD mit jeder der anderen Parteien (CSU ausgenommen) in mindestens einem Bundesland koalierte, die CDU aber neben den großen Koalitionen nur mit der FDP. Unsere Optionen waren also sehr beschränkt. Die Chancen für eine absolute Mehrheit waren bei fünf Fraktionen und den großen strukturellen Unterschieden im Wählerpotenzial im wiedervereinten Deutschland gleich null.
Was uns zusätzlich große Sorgen machte, war die finanzielle Lage der CDU. Der Spendenzufluss hatte sich seit Jahren zu einem immer schmaleren Rinnsal entwickelt. Wenn wir die Wahl verlieren würden, war nicht zu erwarten, dass die Quellen wieder stärker sprudelten, im Gegenteil. Außerdem bedeutete eine Niederlage am 27. September niedrigere Wahlkampfkostenerstattung, eine sogar erhebliche, je nachdem wie schlecht unser Ergebnis sein würde. Und schließlich standen wir vor der unerfreulichen Tatsache, dass offensichtlich keinerlei finanzielle Vorsorge für künftige Zeiten getroffen worden war. Zwar hatten die Mitglieder der Führungsgremien der CDU noch nie wirklich reinen Wein in Sachen Parteifinanzen eingeschenkt bekommen, doch so viel war für uns auch damals erkennbar. Umso mehr beunruhigte es uns, dass auch im Wahlkampf 1998 keinerlei Rücksicht auf die klamme Finanzlage genommen und die finanziellen Ansätze für den Wahlkampf offensichtlich bei weitem überschritten wurden.
Volker Rühe und ich hatten vor diesem in jeder Beziehung trostlosen Hintergrund wenig Probleme, uns über unsere Aufgaben nach dem 27. September 1998 zu verständigen. Es ging für den wahrscheinlichen Fall der Wahlniederlage und einer rot-grünen Regierung um nicht weniger als um den Erhalt einer großen, potenziell mehrheitsfähigen Union als Volkspartei der Mitte. Sie musste auch nach dem Verlust der Regierungsverantwortung genügend Integrationskraft entwickeln, um das Aufkommen radikaler Parteien am rechten Rand des politischen Spektrums zu verhindern. Die Erfahrungen in anderen europäischen Ländern mussten uns alarmieren. Dabei dachte ich weniger an Italien, weil die Strukturen und Prozesse, die dort zum Zerfall der Democrazia Cristiana und zur Zerstörung des italienischen Parteiensystems der Nachkriegszeit geführt hatten, spezifische Ursachen hatten. Auch die französische Entwicklung mit dem langen Leidensweg christlich-demokratischer Parteien schien mir nicht übertragbar, wenngleich die Schwäche des bürgerlichen Lagers und der Erfolg Le Pens genügend Stoff zum Nachdenken auch für uns bot. Österreich war da schon eher mit unserer Situation vergleichbar, wobei allerdings die Lehre insbesondere die war, dass eine lang andauernde große Koalition, in der die Christdemokraten lediglich Juniorpartner sind, einer bürgerlichen Partei nicht gut bekommt und populistische Protestströmungen hochzüchtet. Am meisten beschäftigte mich die Erfahrung der Niederlande, wo nach jahrzehntelanger maßgeblicher Regierungsverantwortung die Christdemokraten in der Opposition auf einen Wähleranteil von unter 20 Prozent abgefallen waren und sich, nach außen kraftlos und nach innen streitsüchtig, einem wenig amüsierten bürgerlichen Publikum zunehmend entfremdeten. Dass sich unsere Freunde in den Niederlanden mittlerweile schon über Wahlergebnisse von 24 Prozent wieder freuen können, sei ihnen herzlich gegönnt. Vorbildfunktion für die CDU konnte das nicht haben.
Wie auch immer Ursachen und Konstellationen in den einzelnen europäischen Ländern sind, Deutschland ist das einzige europäische Land, in dem eine Volkspartei der Mitte, gegründet auf einem am christlichen Menschenbild orientierten Fundament, über alle Zeitstürme hinweg mehrheitsfähig geblieben war. Die Bundesrepublik Deutschland, ja die europäische Nachkriegsgeschichte wäre ohne die Stabilität des deutschen Parteiensystems anders, im Zweifel weniger glückhaft verlaufen. Dieses Parteiensystem ist zu einem wesentlichen Teil durch CDU und CSU geprägt worden. Die Größe und die Schwierigkeit unserer Aufgabe bestanden darin, auch nach einer Wahlniederlage diese stabilisierende Funktion der Union für die Zukunft zu erhalten. Wir durften auf keinen Fall in eine Entwicklung hineinschlittern, in der die Union sich durch interne Auseinandersetzungen selbst um ihre Integrationskraft bringen und damit in einen kaum aufhaltbaren Abwärtsstrudel geraten würde. Die Bewältigung dieser Aufgabe musste notwendigerweise vor allem denjenigen obliegen, die in den 16 Jahren Regierungsverantwortung eine maßgebliche Rolle gespielt hatten und gleichzeitig noch in der Lage waren, unter veränderten Rahmenbedingungen Führungsverantwortung für die Union zu übernehmen.
Es ging uns dabei überhaupt nicht um die Frage, wer nächster Kanzler oder Kanzlerkandidat der Union sein würde. Unser Thema war, wie verhindert werden konnte, dass aus einer Wahlniederlage der Union eine dauerhafte Schwächung nicht nur der CDU werden würde.