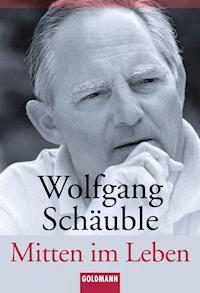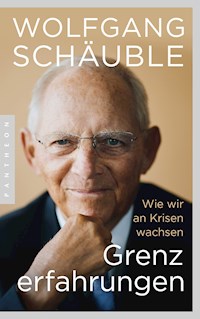29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Mit Wolfgang Schäuble haben wir einen großartigen Menschen und leidenschaftlichen Politiker verloren, der Historisches für unser Land erreicht hat.« Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident Wolfgang Schäuble war eine politische Ausnahmeerscheinung. Nur wenige haben die Bundesrepublik in vergleichbarem Maße geprägt. Die unmittelbar vor seinem Tod fertiggestellten »Erinnerungen« bieten einen einzigartigen Einblick in die Geschichte unseres Landes und in die verborgenen Mechanismen des politischen Betriebs. Sie sind die Bilanz eines politischen Lebens, ein Vermächtnis der Werte und Haltungen, für die Wolfgang Schäuble ein Leben lang stand. Keiner gehörte länger dem deutschen Bundestag an. In seinem politischen Wirken spiegelt sich die Geschichte eines halben Jahrhunderts und der Weg von der Bonner zur Berliner Republik. Der ehemalige Bundesminister, Parteivorsitzender der CDU und Bundestagspräsident erzählt von den Anfängen einer Karriere, von Erfolgen und Niederlagen. Wolfgang Schäuble lässt ein einzigartiges politisches Leben Revue passieren: seine Jugend- und Lehrjahre, die Zeit als engster Weggefährte Helmut Kohls und als Architekt des Einigungsvertrages, den Schicksalsschlag des Attentats, das Drama der Spendenaffäre und das unglaubliche Comeback als mächtiger Minister während Angela Merkels Kanzlerschaft, in der er als Erfinder der »schwarzen Null« und wichtiger Akteur in der Euro- und Griechenlandkrise hervorstach. Er verbindet seine Betrachtungen mit pointierten Porträts seiner Vorbilder, Weggefährten, Rivalen und Freunde. Wolfgang Schäubles »Erinnerungen« sind gelebte deutsche und europäische Geschichte und der Erfahrungsschatz eines wahrhaft politischen Lebens im Dienst der Bundesrepublik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1083
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wolfgang Schäuble
Erinnerungen
Mein Leben in der Politik
Mitarbeit Hilmar Sack und Jens Hacke
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Gaeb & Eggers
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg unter Verwendung einer Abbildung von © Steffen Roth
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-98704-1
E-Book ISBN 978-3-608-12329-6
Siebte Auflage, 2024
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Über Kreise, die sich schließen – Ein Vorwort
I.
Was nachwirkt: Herkunft – Prägungen – Überzeugungen
Heimat Schwarzwald und der Halt in der Familie
Über Generationen und was sie verbindet
Schatten der Vergangenheit
Unsere Geschichte als bleibende Verantwortung
Meine Nähe zu Israel und Frankreich
Ein Kind des Kalten Krieges
Meine parteipolitische Heimat: Konservativ? Christdemokrat!
Mein »Konfirmandenglaube«: Nimm dich nicht zu wichtig
Kirche als Heimat
Schulzeit – und eine abgebrochene journalistische Karriere
Hinaus ins Leben: Studium in Freiburg und Hamburg
Colloquium politicum
Heißes Pflaster Freiburg – Achtundsechzig und der
RCDS
Entfremdung von der Adenauer-
CDU
Doch ein »Vatermord«? Revoluzzer in der
CDU
II.
Erlebter Parlamentarismus – Erste Jahre in Bonn
Wahlkampf ’72 – »Willy wählen«
Bonner Perspektiven
Ost- und Deutschlandpolitik
Steiner/Wienand-Ausschuss – Fast ein Schallplattenvertrag
Mit Leidenschaft für den Sport
Über Grenzen: Mit Frankreich für Europa
Wahljahr 1976
Helmut Kohls schwieriger Start in Bonn
Staatsfinanzen, ein Lebensthema
Bleierne Zeit im »deutschen Herbst«
Strauß’ Pyrrhussieg und Kohls Kalkül
III.
Aufstieg im »System Kohl«: Aus dem Parlament ins Kanzleramt
Vorbereitungen des Wechsels
Durchbruch bei Kohl
Geistig-moralische Wende – Das unverdiente Schicksal eines Schlagworts
Erster Parlamentarischer Geschäftsführer
Frischer Wind und neue Sitten: Die Grünen im Parlament
Schwierige Anfangszeit der Koalition
Kießling-Affäre
Amnestie als Makel, Flick-Affäre – und eine Fraktionskasse
Unverhoffte neue Aufgabe im Maschinenraum der Macht
Vorzimmergespräche und Ratschläge eines Altkanzlers
Im Kanzleramt
Das Küchenkabinett
Politik gestalten
Erschöpfung
Steinige Wege in die Zukunft: Umweltschutz und Kernkraft
Cordes-Entführung und besondere Ministerverantwortung
Stühlerücken im Kabinett
Sommer 1989
IV.
Zuständig für »ein fernes Land«: Deutschlandpolitik am Ende des Kalten Krieges
»Prominenz 9« – Wandern mit der Stasi
Verworrene ministerielle Zuständigkeiten
Mit George Bush frierend auf dem Roten Platz
In den Häusern der Macht
Gorbatschow und Kohl – Kein immer einfaches Verhältnis
Illusionslos und pragmatisch: Meine deutschlandpolitischen Prämissen
Kein Gang nach Gera
Freiheit ist der Kern der deutschen Frage
Getrennt feiern – Der Sonderstatus Berlins
Deutschlandpolitischer Minimalismus?
Meine offiziellen Kontakte: Honecker und das Politbüro
Franz Josef Strauß und der Milliardenkredit
Antrittsbesuch in München
Vertrauen gegen Vertrauen – Mein Gesprächskanal nach Ost-Berlin
Störfeuer im eigenen Lager
Moralischer Ausverkauf? Die Asylverhandlungen mit der
DDR
Der Besuch Honeckers 1987
Glanzvoll scheitern: Verhandlungsmarathon um Transitpauschale und Elbgrenze
Letzte Begegnungen mit »Schneewittchen«
Nicht nur schwärmen, sondern gut handeln! Eine Bilanz
V.
Neun Tage im Oktober – Deutsche Einheit und Attentat
»Obervolta mit Raketen« – Weltpolitische Veränderungen bahnen sich an
Das schönste Jahr der
DDR
»We are flying into history« – Der 9. November
Grenzenlose Freude: Ein deutsches Wochenende
Herausforderung Übersiedler
Beschleunigung: Zehn-Punkte-Plan und Kohl in Dresden
Neue Erfahrung: Wahlkampf im Osten
Entscheidung für Artikel 23 – Der Ausgang der Volkskammerwahl
Die internationale Perspektive
Die Idee zum Einigungsvertrag
Günther Krause und die Grundlagen der Verhandlungen
Prinzipienfragen und Rechtsprobleme in den Verhandlungen
Fahrplan zur Einheit
Wann und wie wählen? Juristische Finessen auf dem Weg zum gesamtdeutschen Bundestag
Streitthemen
Wie umgehen mit dem Erbe der Diktatur?
Einheit im Kronprinzenpalais
Eine Frage als Wiedergänger: Ging das nicht alles viel zu schnell?
Die unvollendete Revolution – und ihre Folgen
Das Unglück vom 12. Oktober 1990
Zurück ins Leben
Zurück in die Politik
Der Rollstuhl als Imageträger – und seine Folgen in der Politik
Das Problem falscher Erwartungen
VI.
Reformwille und Blockaden – Die Jahre im Fraktionsvorsitz
Die Faszination der Kunst: Christos Reichstagsverhüllung
Zurück in die Fraktion – Eine Herzensaufgabe
Alte und neue Asylfragen
Widerstände innerhalb der eigenen Partei
Auf der Zielgeraden zum Asylkompromiss
Nation und Europa: Rückkehr in die Geschichte
Europa – Vertiefung und Erweiterung
Steiniger Weg zu blühenden Landschaften
Bundespräsidentensuche: Richard Schröder und Steffen Heitmann
Koalitions- und Parteienkrisen allenthalben
Oskar Lafontaine – Schicksalsgenosse und Widerpart
Und es bewegt sich nichts
Schwarz-grüne Gedanken
Nachfolgedebatten
Wahlniederlage 1998: Ende einer Ära
Ein letzter Abend im Kanzlerbungalow
VII.
Oppositionsführer, Sturz und Neuanfang
1998 – Neuanfang in der Opposition
Erste Schritte und Fehlstart von Rot-Grün
Unterschriftenaktion in Hessen
Rot-Grün in erster Krise: Lafontaines Rückzug und Kosovokrieg
Konsolidierung und der Herbst des Erfolgs
Spenden, Koffer, Konten
Dialektik der Aufklärung
Die Schreiber-Spende
Eine letzte Unterredung
Regeneration nach dem Absturz
Entzweiung des Westens – Neue außenpolitische Herausforderungen
Merkels Weg zur Kanzlerschaft
Das Ende von Rot-Grün
VIII.
Kein »Ende der Geschichte« – Neue Herausforderungen als Innenminister
Der Weg zur großen Koalition 2005
Altes Amt, neue globale Herausforderungen
»Die Welt zu Gast bei Freunden« – Die
WM
2006 und mein Einsatz für den Sport
Reale Gefahr: Kofferbomben und Sauerland-Gruppe
Mit Michael Chertoff das Mögliche denken, um das Schlimmste zu verhindern
Die Internationalisierung der Innenpolitik
Reformerfolge dank Europäisierung
Die Erweiterung des Schengen-Raumes 2008
Freiheit und Sicherheit – Zwei Seiten einer Medaille
Populär, aber Zielscheibe der Kritik
Begrenzungen eines Bundesministers: Das Verhältnis zu den Ländern
Auf dem rechten Auge blind? Das Versagen beim
NSU
-Komplex
»Muslime in Deutschland – Deutsche Muslime«: Die Islamkonferenz
Erdoğan, die Türkei und die privilegierte Partnerschaft
Jahrhundertaufgabe Asyl und Migration
Bilanz einer Amtszeit
IX.
Rendezvous mit der Globalisierung: Als Finanzminister im Zentrum neuer Krisen
Wahlsieg 2009 – am Ziel?
Angela Merkels Bitte
Die Herausforderung des Amtes
Finanzwelt
Im Finanzministerium
Im Kampf gegen die Neuverschuldung
Schwieriges Fahrwasser für die Union
Mit der Kanzlerin im Kino
Auf dem Weg zur »schwarzen Null«
Warum es in Deutschland so schwer ist, Geld vernünftig auszugeben
2010 –
annus horribilis:
Griechische und persönliche Fieberkurven
Die tieferen Ursachen der Krise
Als Jurist unter Ökonomen
»Halber Herkules«?
Europäischer Währungsfonds
Denken in Alternativszenarien
Mein Eintreten für einen Schuldenschnitt
»Whatever it takes« – »Zauberlehrling« Mario Draghi und die
EZB
Erfolge auf dem Weg zu mehr Stabilität
Das Gezerre um eine Finanztransaktionssteuer
CumEx und CumCum
Steuersündern auf der Spur – Die Schweiz und ihr Bankgeheimnis
Reformerfolge und Reformmüdigkeit
»We agree to disagree«: Die Episode Yanis Varoufakis
Teamgeist in der Eurogruppe
»ISCH OVER«? Auf dem Weg zum Showdown
Flüchtlingskrise: Willkommenskultur, Lawinen und bayerische Putschisten
Schiffbruch – Von Kommunalfinanzen und Hebesätzen
Im Regen stehen gelassen: Sechzehn Ministerpräsidenten und ein Schäuble
Bilanz bewegter Jahre
X.
Demokratie und offene Gesellschaft im Stresstest: An der Parlamentsspitze
Von der Macht lassen – Meine Kandidatur als Parlamentspräsident
Das Scheitern von Jamaika – Lieber als Minderheit regieren als eine große Koalition bilden
Weltweites Novum: Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung
Fürsprecher für die osteuropäische Perspektive
Zoff ums Wahlrecht
Populismus im Parlament – Die Krise der Repräsentation
Befriedeter Raum – und kein Ort plakativer Aktionen
Von der Regierungsbefragung bis zum Bürgerrat – Neues wagen
Das Parlament in der Pandemie – Hochzeit des Parlamentsrechts
Recht auf Leben
Turbulenzen in der
CDU
– Ende der Ära Merkel
Niederlage bei der Bundestagswahl
Bilanz einer Ära
XI.
Verwegenheit stiften – Was bleibt
Editorische Notiz
Anhang
Zeittafel
Auswahlbibliografie
Monografien
Aufsätze, Interviews, Gesprächsbände
Biografische Interviews
Biografien
Festschrift
Bildnachweis
Personenregister
Mitarbeit
Über Kreise, die sich schließen – Ein Vorwort
Das Gemälde aus der Serie Ouroboros – Im Kreise gehen hing in Wolfgang Schäubles letztem Bundestagsbüro.
Optimismus ist Pflicht.
Karl Popper(1)
Während ich an diesen Vorbemerkungen schreibe, blicke ich von meinem Schreibtisch auf Günther Ueckers(1) Kunstwerk aus beigem Wüstensand – allerdings nicht wegen der für mein Alter passenden Metapher von der Zeit, die einem wie Sand durch die Finger rinnt. Wissenschaftler haben vielmehr herausgefunden, dass Menschen ungewollt irgendwann im Kreis laufen. Anfang und Ende: Dazwischen liegt nicht zwingend eine lineare Strecke. Umwege erkennen wir im Nachhinein besser, Abwege oft zu spät. Und manchmal kehrt man eben an seine Anfänge zurück. Dann schließt sich ein Kreis. Meine Kreise werden kleiner: Das ist eine Erfahrung, die ich derzeit mache, ein Empfinden, das Ueckers(2) Bild in mir weckt – und das mir einen Anstoß dazu gab, dieses Buch zu schreiben.
Mit dem Wahlausgang im September 2021 habe ich als »einfacher« Abgeordneter erneut das Bundestagsbüro bezogen, in dem ich vor über zwei Jahrzehnten als Oppositionsführer neben kurzen Höhenflügen persönlich die bittersten Stunden meiner politischen Karriere erlebte. Ich habe sogar im Plenum des Bundestags wieder dort Platz genommen, wo ich vor über fünfzig Jahren meine parlamentarische Karriere begonnen habe: auf den Hinterbänken. Von dort schaue ich auf die zuletzt viel zu zahlreich gewordenen Abgeordnetenreihen vor mir, auf die Kolleginnen und Kollegen, bei denen ich häufig den Eindruck habe, sie könnten nicht mehr nur meine Kinder(1)(1)(1)(1), sondern längst meine Enkel sein.
So muss es Ludwig Erhard(1) ergangen sein, als ich 1972 mit gerade dreißig Jahren das erste Mal in den Bundestag gewählt wurde – wenn er den badischen Jungspund überhaupt wahrgenommen hat. Erhard gehörte zu denen, die noch im 19. Jahrhundert geboren waren, im Kaiserreich. Für mich damals ferne Geschichte. Heute sind die jungen Abgeordneten nach dem Fall der Berliner Mauer geboren, die jüngste sogar zwei Jahre nach der Abwahl Helmut Kohls(1), und ich vermute, dass ihnen meine Erfahrungen einer Kindheit in der Nachkriegszeit und das Aufwachsen in einer Welt des Kalten Krieges ähnlich weit entfernt erscheinen müssen. Und mir selbst? Was verbindet mich noch mit dem jungen Mann, der ausgerechnet im retrospektiv so wild erscheinenden »Achtundsechzig« seine parteipolitische Karriere in der badischen CDU begann? Es gibt Prägungen, die einen ein Leben lang begleiten, davon wird in diesem Buch noch zu reden sein.
Aber trennt uns denn eigentlich wirklich so viel von früher? Vergleicht man die beengte Lebenswelt meiner Nachkriegsjugend im Schwarzwald mit der globalisierten Mobilität, mit der die junge Generation heute aufwächst: Wer wollte es bestreiten? Auch im Parlament sehe ich die veränderten Lebensstile. Da, wo ich noch das Bild vom sitzungsleitenden Präsidenten im bundestagseigenen formellen Cut vor Augen habe, geht es heute ungezwungener zu, mitunter reichlich unkonventionell. Vor allem sehe ich bedeutend mehr weibliche Abgeordnete als 1972, selbst wenn es noch immer zu wenige sind. Und wo im Plenumsbetrieb früher das Gespräch mit dem Sitznachbarn oder die Zeitungslektüre über zähe Momente hinweghalf, ist heute das Handy nicht mehr wegzudenken. Angela Merkel(1) machte es als Kanzlerin(2) zum zentralen Medium ihrer Kommunikation – und auch meine Freude am Sudoku-Spiel ließ sich so nicht lange vor der neugierigen Öffentlichkeit verbergen.
Und doch: Selbst wer sich aus den Volksvertretungen des 19. Jahrhunderts in den Bundestag verirren würde, müsste nicht zwangsläufig die Regeln des Parlamentarismus neu erlernen. Den Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition, das Prinzip von Rede und Gegenrede, die Entscheidung durch die Mehrheit – das alles würde er wiedererkennen. Dass er sich allerdings bei einem Wortbeitrag etwa über komplizierte steuerrechtliche Probleme auf zwei bis drei Minuten Redezeit beschränken müsste, würde ihn schon irritieren. Die dreiviertel Stunde, die ich noch in einer meiner ersten Reden als junger Parlamentarier eingeräumt bekam, erreichen manche Abgeordnete heute in der ganzen Legislaturperiode nicht. Das muss kein Schaden sein.
Zu den aufwühlenden Erfahrungen meiner Arbeit an diesem Buch gehört, dass während ich daran schrieb, längst vergangen Geglaubtes wieder auf die Vorderbühne der Politik drängte. Wie die meisten hätte ich doch im Leben nicht geglaubt, dass Krieg mitten in Europa wieder bittere Realität werden könnte. Dass Grenzen noch einmal gewaltsam verschoben würden und dass sich zwischen dem Westen und Russland erneut ein Vorhang senkt, der ganz plötzlich den Kalten Krieg zum Bezugspunkt unserer Analysen werden lässt. Aufs Neue stellen sich sicherheits- und verteidigungspolitische Fragen in Deutschland und Europa, die mich seit Langem bewegen. Ein Kreis schließt sich in gewisser Weise auch hier.
Auf die Zäsurerfahrung der Pandemie sattelte sich 2022 mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine das Bewusstsein, eine Zeitenwende zu erleben. Und so sehr wir einerseits damit beschäftigt sind, lange überfällige Fragen endlich anzugehen, so sehr öden mich die rückblickenden persönlichen Schuldzuweisungen an. Es zählt zu den bemerkenswerten Momenten im Entstehungsprozess dieses Buches, dass in Teilen der Öffentlichkeit, ausgerechnet als ich mich noch einmal selbstkritisch mit der – wie zu zeigen sein wird – viel zu späten Einsicht meiner Partei in die visionäre brandtsche(1) Politik des Wandels durch Annäherung befasste, diese Grundidee der deutschen Ostpolitik in Bausch und Bogen verdammt wird. Im Nachhinein unbedingt besser zu wissen, wie politisch hätte gehandelt werden können, gehört zu der Form von Klugscheißerei, die schon im Privaten nur schwer erträglich ist. Dass in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht wurde, ist offensichtlich. Ein anklagender Moralismus bleibt jedoch im Ausblenden aller Zeitumstände unhistorisch und ist dadurch oft selbstgerecht. Demgegenüber erscheint mir zwingend, politisches Handeln in seiner jeweiligen Epoche nachzuvollziehen, sich die Spielräume und Alternativen zu vergegenwärtigen, die es damals realistisch gegeben hat. Das versuche ich, jedenfalls soweit ich die Dinge übersehe, wobei auch ich im Wissen um den späteren Geschichtsverlauf manchmal zu neuen Einschätzungen komme.
Natürlich bedeuten meine Erinnerungen eine subjektive Sicht auf die vergangenen fünfzig Jahre unseres Landes. Auf den wechselvollen Weg von der Bonner zur Berliner Republik. Dass der Blick aus meinem Büro auf die Rückseite des Reichstagsgebäudes fällt, unmittelbar dorthin, wo vor über drei Jahrzehnten noch die Berliner Mauer nicht nur eine Stadt, sondern den ganzen Kontinent teilte, zeigt mir: Veränderung war immer – und vieles wird im Übrigen in der Rückschau anders bewertet als mitten im Streit. Auch deshalb, weil ich aus eigenem Erleben weiß, dass Erregung und Krisengefühle nichts Neues sind, schätze ich Gelassenheit als Tugend. Das Gefühl zu Beginn des Ukrainekriegs allerdings, nicht die Spur einer Ahnung, geschweige denn eine eigene Antwort zu haben, wie wir aus dem gewaltsamen Konflikt mit Russland wieder herauskommen können, gehört zu den beunruhigendsten Erfahrungen meines politischen Lebens.
Die Zumutungen der Welt spüren wir heute drängender, unmittelbarer. Vieles wandelt sich zu schnell, ist zu komplex, um es noch zu durchdringen. Zu viel scheint kaum noch in unserer Kontrolle zu liegen. Das macht Angst, weil es dem menschlichen Bedürfnis widerspricht, Zusammenhänge zu erkennen und Erklärungen zu suchen. Wo scheinbar oder tatsächlich keine Zusammenhänge existieren, akzeptiert der Mensch eine dürftige Erklärung eher als gar keine. Wir wollen den Dingen in der Welt einen Sinn geben, selbst wenn es sich um Koinzidenzen und nicht um Kausalitäten handelt.
Im Blick auf das eigene Leben gilt das erst recht. Oft genug drehen wir uns nur um uns selbst, manchmal schließt sich auch – wie gesehen – ein Kreis. Und in seltenen Fällen macht man die Erfahrung, dass es zumindest scheinbar nicht nur ein Leben gibt. Dass man gelegentlich die Chance zum Neuanfang erhält – oder auch gezwungen wird, sein Leben ganz neu einzurichten. Zwei Leben hat ein Biograf sein Buch über mich einmal betitelt, was richtig und falsch ist. Denn so sehr sich mein Leben vor und nach dem Attentat auch unterscheidet, am Ende ist es doch nur das eine Leben, das ich führen darf. Von ihm handelt dieses Buch.
Es ist ein Leben über Jahrzehnte in der Politik und für die Politik – für Außenstehende natürlich weit mehr als für mich persönlich. Vorrangig von diesem politischen Leben werde ich erzählen. Da wir aber noch immer in einer Welt leben, in der weder Maschinen noch Algorithmen Politik machen, werden die Leser und Leserinnen am Ende meiner Streifzüge durch die bundesrepublikanische Geschichte so auch etwas mehr von mir als Mensch erfahren haben. Von dem, was mich antreibt, was mir Halt gab und gibt und was mir die Zuversicht verleiht, ohne die ich Politik nicht machen könnte. Ohne die mir die menschliche Existenz an sich unvorstellbar erscheint.
Wenn ich mich und mein Handeln erklären soll, bleibt es bei meiner – für einen Konservativen vielleicht überraschenden – Grundhaltung, wonach Leben Bewegung bedeutet. Ständige Veränderung. Leben vollzieht sich vor allem in der Begegnung mit Menschen. Deshalb wird auch in diesem Buch viel von ihnen die Rede sein, von spannenden Begegnungen, von bereichernden Gesprächen, aber auch von menschlichen Enttäuschungen und von Verletzungen, wie sie eben nur Menschen einander zufügen können.
Sich politisch zu engagieren, sich öffentlich zu exponieren, ist mit viel Ärger und mit noch mehr Kritik verbunden. Wer aber das Gefühl hat, er opfere sich für die Politik, sollte dringend damit aufhören. Ich habe das nie so empfunden. Im Gegenteil. Politik ist ein Wettbewerb um Macht, bedeutet Kampf um Einfluss, gibt Gestaltungsmöglichkeiten. Politik unterliegt Regeln und Gesetzmäßigkeiten, aber sie verlangt auch Kreativität und Imagination. Es braucht Geduld. Fehlt es an Gespür für das richtige Timing, scheitert man selbst mit dem, was durchsetzbar wäre. Mangelt es wiederum an Einsicht dafür, wo der Kampf nicht lohnt, läuft man Gefahr, bloß mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Ich kenne beides, aber ich bin auch dankbar und zufrieden mit dem, was mir, wie ich finde, ganz gut gelungen ist. Davon werde ich natürlich besonders gerne erzählen, ohne auszusparen, welche Mühen es teilweise gekostet hat. In der Gesamtschau werden manche dann vielleicht besser verstehen, warum mir Politik auch nach fünf Jahrzehnten im Parlament noch immer Freude macht. Andere werden vermutlich erst recht mit dem Kopf schütteln. Als Erklärung für mich habe ich dazu einmal von Camus(1) das Bild des glücklichen Sisyphos entliehen.
Der Kreis schließt sich – für mich heißt das in der Rückschau: aus Wagemut wird Erfahrung. Und am Ende steht die nur vordergründig banale Einsicht, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist – und das Leben voller Kompromisse. Bei dem, was ich in einem halben Jahrhundert Politik erlebt habe, ging es ausreichend bunt zu, es fehlte weder an Licht noch Schatten. Mich daran erinnernd, sehe ich zwangsläufig vieles von dem, was früher war, heute anders, durch die angehäuften Erfahrungen hindurch, durch den Schleier zwischen gestern und heute. Ich habe über all die Jahre keine persönlichen Aufzeichnungen geführt, genaue zeitliche Abläufe erschließen sich mir deshalb allenfalls durch Terminkalender, die meine treuen Mitarbeiterinnen geführt haben, in Bonn lange Helga Heyden(1) und die letzten zwei Jahrzehnte in Berlin Nicole Gudehus(1). Dass ich dabei manches Mal selbst verblüfft bin, wie dieses Pensum an Terminen, noch dazu über viele Jahre auf internationalem Parkett, zu stemmen war, ist das eine. Das andere ist die Einsicht, wie schnell die eigene Erinnerung der Selbsttäuschung unterliegt. Wiederholt machte ich die Erfahrung, wie unzuverlässig das eigene Gedächtnis ist.
Als Jurist ist mir die Gefahr der Selbsttäuschung in Zeugenaussagen vor Gericht natürlich bekannt. Und auch wenn ich nicht die Absicht habe, in diesem Buch mit mir ins Gericht zu gehen: Beim Erarbeiten habe ich mir ganz bewusst zwei Co-Autoren an die Seite geholt, die mir, wo ich mir unsicher war oder mich zunächst partout nicht mehr zu erinnern vermochte, durch das Graben in alten Reden, unzähligen Interviews und anderen Archivalien, aber auch durch die Erkenntnisse der Wissenschaft auf die Sprünge halfen. Vieles habe ich mir auf dieser Quellenbasis so selbst wieder rekonstruieren können. Und wenn die beiden es dabei mit eigenen Fragen und korrigierendem Nachbohren doch einmal zu weit trieben, half der ebenso freundliche wie nachdrückliche Hinweis, dass es am Ende immer noch meine Erinnerungen seien, die wir da verfassen. Dennoch hat so manche Information, von der ich erst bei der Arbeit an diesem Buch aus den Erinnerungen anderer und der wissenschaftlichen Literatur erfuhr, auch meinen Blick und meine Einschätzung verändert.
Denn Memoiren zu schreiben, ist eine Begegnung mit sich selbst. Viele Bewertungen der Wissenschaft und Beobachtungen in klugen wie weniger klugen Porträts, die in den vergangenen fünfzig Jahren über mich publiziert wurden, habe ich zum ersten Mal gelesen, sei es, weil ich damals nicht die Zeit hatte oder weil ich einfach nicht die Lust verspürte, sie zu lesen. Bleibenden Eindruck hinterließ vor allem, wie sehr auch enge Weggefährten Dinge anders in Erinnerung behalten haben als ich – oder schlicht vergessen zu haben scheinen, was ich selbst als ganz zentral ansehe. Neben solch interessanten Einsichten boten sich mir teils erstaunliche Urteile, die meinen Widerspruch provozierten – so bleibt sogar der Blick auf das eigene Leben streitbar und bisweilen überraschend, immer aber lohnend. Nach wie vor treibt mich vor allem die Neugierde an, die Lust darauf, immer weiter zu lernen. Und so war die intensive Arbeit an diesem Buch zuallererst eine bereichernde Selbsterfahrung, nicht selten angeregt durch das reibungsvolle Gegenüber von Fremd- und Selbstwahrnehmungen.
In der Rückschau neigt man vermutlich dazu, sich im Zweifel besser zu machen, als man war. Ich habe ja auch nicht von Anfang an alles so gesehen, wie ich es heute sehe. Ich habe Fehler gemacht – wenn auch manchmal andere als die, die mir meine Kritiker öffentlich vorhielten. Ich habe Entwicklungen falsch eingeschätzt, Alternativen nicht wahrgenommen oder nicht sehen wollen. Auch davon wird selbstkritisch die Rede sein. Aber zur großen, letztlich überzogenen Geste des mea culpa tauge ich nicht. Wenn früher in Interviews allzu forsch Selbstkritik eingefordert wurde, pflegte ich gern zu erwidern: »Wir sind hier nicht im Politbüro.« Der Zwang zur öffentlichen Selbstkritik verträgt sich nicht gut mit unserem freiheitlichen Verfassungsverständnis. Deshalb kennt unsere Ordnung auch das Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen. Dass ich im Übrigen jungen Journalisten den Witz mit dem Politbüro heute vermutlich erklären müsste, zeigt nur noch einmal, wie grundlegend sich die Zeiten verändert haben. Zum Glück!
Wenn es mir dennoch gelungen sein sollte, in meinen Erinnerungen nicht allzu selbstgerecht geblieben zu sein, dann deshalb, weil ich ehrlich darum bemüht war, mich an Worten Helmut Schmidts(1) zu orientieren. Sie haben mich bereits als junger Abgeordneter tief beeindruckt, als ich sie im »deutschen Herbst« 1977 im Bundestag hörte. Ihre über diese Ausnahmesituation weit hinausweisende, lebenskluge Bedeutung sehe ich am Ende meines politischen Wirkens noch viel deutlicher. Schmidt(2) sagte damals: »Wer weiß, dass er so oder so, trotz allen Bemühens, mit Versäumnis und Schuld belastet sein wird, wie immer er handelt, der wird von sich selbst nicht sagen wollen, er habe alles getan und alles sei richtig gewesen. Er wird nicht versuchen, Schuld und Versäumnis den anderen zuzuschieben, denn er weiß: Die anderen stehen vor der gleichen unausweichlichen Verstrickung. Wohl aber wird er sagen dürfen: Dieses und dieses haben wir entschieden, jenes und jenes haben wir aus diesen oder jenen Gründen unterlassen. Alles dies haben wir zu verantworten.«
In diesem Sinne will ich berichten von dem, was ich in fünfzig Jahren Politik gestalten konnte. Was ich erreicht habe und woran ich gescheitert bin. Was ich getan und was ich unterlassen habe. Kurz: Was ich zu verantworten habe.
I.
Was nachwirkt: Herkunft – Prägungen – Überzeugungen
WM-Finale 1974 in München: Hinter Franz Beckenbauer steht Wolfgang Schäuble mit seiner Ehefrau. Links neben ihm Fritz Walter. Am rechten Bildrand: Pélé.
4. Juli 1954. Bern, Stadion Wankdorf. Zur selben Zeit in Hornberg im Schwarzwald – aus dem Radio eine aufgeregte Stimme: »Bozsik(1), immer wieder Bozsik(2), der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball – verloren diesmal, gegen Schäfer(1). Schäfer nach innen geflankt. Kopfball – abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn(1) schießen – Rahn(2) schießt – Tooooor! Tooooor! Tooooor! Tooooor!«
Ist es zu klischeebehaftet, die Schilderung einer deutschen Nachkriegsjugend mit dem »Wunder von Bern« zu beginnen? Wie immer liegt auch in diesem Klischee mehr als ein Körnchen Wahrheit. Der Sieg über Ungarn im Finale der Fußballweltmeisterschaft 1954 war das prägende Erlebnis meiner Jugend. Auch Jahrzehnte später, und wäre die Nacht nach stundenlangen Verhandlungen in Brüssel noch so kurz gewesen, hätte ich die Namen der Mannschaft von Sepp Herberger(1) im Schlaf aufsagen können.
An diesem 4. Juli ’54 tat ich vor Spielbeginn lautstark kund, dass wir natürlich gewinnen würden, ein Optimist war ich schon als Kind. Von solchen Prophezeiungen hielt mein Vater(1) gar nichts. Als die Ungarn schnell 2:0 in Führung gingen, verlor er, völlig ungewöhnlich für ihn, die Beherrschung und klebte mir eine, mit dem lauten Ausruf: »Das hasch jetzt davon!« – als wäre ich an den Gegentoren schuld gewesen. Das Gebrüll, das ich danach anstimmte, kippte bald in Triumphgeheul um, weil ich doch recht behielt und »wir« gegen die hochfavorisierten Ungarn tatsächlich Weltmeister wurden.
Fußball, Sport im Allgemeinen, war mir damals furchtbar wichtig – und ist es mir ein Leben lang geblieben. Immer wieder blitzen in diesem Buch große Sportmomente auf, die sich mir ins Gedächtnis gebrannt haben und die nicht selten mein Erinnern strukturieren. In meiner Kindheit wurde nach der Schule mit meinen beiden Brüdern(1)(1) und Freunden draußen gekickt, wenn ich Torwart spielte mit Knieschützern, die mir meine Mutter(1) gestrickt hatte. In der Jugend geht es im Fußball schon ziemlich robust zur Sache. Einer der älteren Mitspieler gab mir einmal zu verstehen: »Du musst selber austeilen. Denn wenn du selbst austeilst, musst du weniger einstecken.« Diesen Ratschlag habe ich nicht vergessen – und ich habe die Erfahrung gemacht, dass er manchmal auch außerhalb des Platzes zutrifft.
Ich war schnell, kam über die Flügel, da ich aber relativ klein und schmächtig bin, war ich schon körperlich nicht der beste Fußballer und sicher kein Führungsspieler. Das gehört wohl leider zu den Defiziten meiner Biografie. Ehrgeiz zeigte ich dennoch schon damals. Die kolportierte Geschichte, dass ich bei einer drohenden Niederlage einfach den Ball, der mir gehörte (ein Privileg!), unter den Arm nahm und nach Hause ging, mag ich aber nicht bestätigen. Ich widerspreche allerdings auch meinem jüngeren Bruder(2) nicht, der gesagt hat, sollte die Geschichte nicht stimmen, sei sie zumindest gut erfunden.
Als Kind war mir natürlich überhaupt nicht bewusst, dass der Titelgewinn 1954 im kollektiven Empfinden zu einer mythischen Gründungserzählung der Bundesrepublik taugte. Ich hätte es auch nicht verstanden, für mich war es einfach Fußball. Die private Erinnerung und ein sich über Generationen verfestigendes Geschichtsbild müssen eben nicht deckungsgleich sein. Dass individuelles Erinnern und kollektives Gedächtnis sogar ein ungemein spannungsreiches Verhältnis eingehen können, ist eine Erfahrung, die wir Deutschen im Umgang mit unserer wechselhaften Geschichte immer wieder machen.
Prominente Vorbilder hatte ich in meinem Leben keine, wenn es aber ein Idol meiner Jugend gab, dann war es Fritz Walter(1), der Kapitän der Weltmeistermannschaft. Genau zwanzig Jahre nach dem ersten Titel, als Deutschland in München wieder im Endspiel einer Fußballweltmeisterschaft stand, saß ich im Olympiastadion ausgerechnet neben ihm. Obwohl noch ein junger Abgeordneter in der ersten Legislaturperiode, durfte ich als Obmann meiner Fraktion im Bundestagssportausschuss auf der Ehrentribüne Platz nehmen. So saß ich da in einer Reihe nicht nur mit Fritz Walter(2), sondern auch mit Pélé(1). Zu meinen Teamkollegen im FC Bundestag, der Abgeordnetenfußballmannschaft, in der ich mitspielte, sagte ich später gern scherzhaft: »Da saßen die bedeutendsten drei Fußballer in einer Reihe …« Es war ein unvergessliches Erlebnis, der Jubel nach dem Schlusspfiff groß. Auf Fotos von der Pokalübergabe an Franz Beckenbauer(1) ist im Hintergrund neben mir auch meine Frau(1) zu sehen. Sogar mein Sohn(2) war damals dabei – noch in ihrem Bauch. Die Fußballbegeisterung, die er mit mir teilt, wird hier ihren Ausgang genommen haben.
Ich hatte Fritz Walter(3) als Schüler angeschrieben und um ein Autogramm gebeten. Den handschriftlichen Briefentwurf bewahrte meine Mutter(2) lange auf, deshalb konnte ich ihn Fritz Walter(4) später zeigen, als sich unsere Wege in meiner Zeit als für den Sport zuständiger Bundesinnenminister erneut kreuzten. Der kindliche Brief rührte ihn sichtlich – so wie es mich bewegt hat, als er mich 1990 nach dem Attentat in der Klinik anrief. Er hatte mich sogar besuchen wollen, was ihm gesundheitlich jedoch nicht möglich war, wenigstens mit mir telefonieren wollte er aber unbedingt. Das WM-Finale ’74 habe ich also nicht allein wegen des gewonnenen Titels in Erinnerung. Unvergessen bleibt mir, wie Fritz Walter(5) mit den Spielern auf dem Rasen des Münchner Olympiastadions mitfieberte. Im Triumphzug war er ’54 durch Deutschland gefahren, durch ein geteiltes Land. Das »Wunder von Bern« – man muss sich das immer wieder bewusst machen – vollzog sich kein Jahrzehnt nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem Fritz Walter(6) Soldat gewesen war. Die bedingungslose Kapitulation hatte er im Kriegsgefangenenlager nahe der Ukraine erlebt. Obwohl furchtbar geschwächt, soll er dort mit Lagerpolizisten Fußball gespielt haben, die ihn vor dem Abtransport nach Sibirien bewahrten. Reich geworden ist keiner der Helden von ’54. Von den beiden Torschützen eröffnete Max Morlock(1) einen Kiosk für Tabak und Zeitschriften in Nürnberg, der »Boss« Helmut Rahn(3) wurde Gebrauchtwagenhändler. Fritz Walters(7) Bruder Ottmar(1) betrieb eine Tankstelle in Kaiserslautern. Und nun fieberte dieser grundbescheidene Mann mit Beckenbauer(2), Netzer(1) & Co, alles begnadete Fußballer – und längst abgebrühte Profis, internationale Stars. Was für ein Unterschied, dachte ich mir schon damals. Was für eine unglaubliche Entwicklung – auch wenn die goldene Generation der Siebziger noch weit entfernt war von der Abgezocktheit des Milliardengeschäfts heute. Vor allem aber: was für ein Wandel, den dieses Land in so kurzer Zeit, von einer Generation zur nächsten, vollzogen hatte.
Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft, der Wille zum Erfolg, aber auch Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit, Bescheidenheit – und vor allem Anstand: Das alles verbinde ich mit Fritz Walter(8). Es sind prägende Werte, die auch meinen Eltern(2)(3) wichtig waren. Als Anspruch und Leitwerte haben sie mich ein Leben lang begleitet – selbst wenn ich bestimmt nicht allen immer gleichermaßen gerecht wurde. Wer und was wir sind, speist sich ganz wesentlich aus den Erfahrungen und Erzählungen in unseren Familien. Auch davon soll im Folgenden die Rede sein, wenn ich auf meinen Weg in die Politik zurückblicke. Es geht – nicht streng chronologisch, sondern mehr in Schlaglichtern – um Prägungen durch meine Herkunft und durch das, was in meiner Familie vorgelebt wurde. Um Überzeugungen, die sich aus den Zeitumständen herausgebildet haben, und um das, was Halt im Leben gab und Orientierung für ein politisches Leben gibt.
Heimat Schwarzwald und der Halt in der Familie
Der Schwarzwald hat mich geprägt – es ist nicht zu leugnen: bis in meine Sprachfärbung. Er ist meine Heimat. Dieser sehr deutsche Begriff drückt viel von dem aus, was mir wichtig ist: Herkunft, Nähe und Vertrautheit, Tradition. Der aufopferungsvolle Kampf, den die Ukrainer derzeit für ihre Heimat führen, hat mir noch einmal bewusst gemacht, dass wir alle, die wir in den vergangenen 75 Jahren in Deutschland aufwuchsen, zu glücklichen Generationen zählen. Denn wir durften in Zeiten leben, in denen uns der äußerste Einsatz für die Heimat erspart geblieben ist. Es würde mir sehr schwerfallen, auf meine Heimat verzichten zu müssen – auch wenn ich stets versuche, mir auch die Neugier auf das Fremde zu bewahren. Aber der Mensch braucht Wurzeln.
Ich bezeichne mich gern als ein Kind des ländlichen Raumes. Lärmende Metropolen wie New York oder Paris faszinieren mich, aber dauerhaft leben wollte ich dort nicht. Aufgewachsen bin ich in Hornberg, einer Kleinstadt mit 4000 Einwohnern. Das Städtchen ist allenfalls durch das berühmte »Hornberger Schießen« bekannt, bei dem der Legende nach statt scharfer Munition ein kernig gerufenes »Piff Paff« zum Einsatz kam, und über das ich deshalb gern als erste Abrüstungsinitiative der Weltgeschichte spotte. Die kleinstädtische Gesellschaft Hornbergs war eine begrenzte Welt. Großstadt – das war damals für uns Kinder schon, wenn wir zu Onkel und Tante nach Mannheim fuhren. Da gab es Eisdielen und Partys in Kellern. Und Luzern, wo ich einmal die Schulferien bei einer Tante verbringen durfte, hatte für uns schon etwas von Hollywood. Angesichts der vernetzten Welt meiner Enkel wird mir erst richtig bewusst, wie klein und beengt die Welt meiner Kindheit und Jugend war.
Ich bin darin behütet aufgewachsen. Vielleicht ging mir deshalb das Kosmopolitische immer etwas ab. Andere mögen weltoffener sein, mobiler, mehrere Sprachen sprechen – dafür habe ich, was mich erdet: das Vertrauen zueinander und den Zusammenhalt in einem bekannten und geliebten Umfeld. In existenziellen Krisen rückt die Familie in den Mittelpunkt. Als ich nach dem Attentat im Krankenhaus lag, haben mir meine Eltern(3)(4) jeden Tag eine Karte geschrieben. Das war alles, was sie in dieser Situation tun konnten, aber sie taten es jeden Tag. Ein starker Familienverbund ist für mich eine Kraftquelle. Dass es meiner Frau(2) und mir gelungen ist, seit dem Attentat mit unseren Kindern(2)(3)(2)(2) und später den Enkeln jährlich zusammen an der Nordsee Urlaub zu machen, und mir meine Kinder trotz der häufigen Abwesenheit, die meine politische Karriere mit sich brachte, heute sagen, ich sei da gewesen, wenn es nötig war: Das macht mich glücklich und – obwohl meine Frau(3) für den Zusammenhalt der Familie immer entscheidend gewesen ist – auch ein wenig stolz.
Meine Familiengeschichte ist für das 20. Jahrhundert recht charakteristisch. Meine Eltern(4)(5) gehörten in der frühen Bundesrepublik zu den typischen Aufsteigern aus der Mittelschicht. Mein Vater(5) stammte aus bescheidenen Verhältnissen. Sie ließen nicht zu, dass er, obwohl ein begabter Schüler, Abitur machen konnte. Die Schule verließ er nach der Mittleren Reife, um eine kaufmännische Lehre zu absolvieren. Bei der Buntweberei Hornberg arbeitete er sich bis zum kaufmännischen Leiter hoch. Die Krise der Weberei hat er früh antizipiert und neben seinem Beruf eine Ausbildung zum Helfer in Steuerangelegenheiten gemacht. Mitte der fünfziger Jahre wagte er sich mit einem Kundenstamm aus Kleinbetrieben, Handwerkern und Gaststätten in die Selbstständigkeit. Am Ende schaffte er es mit Fleiß und harter Arbeit über den Steuerbevollmächtigten bis zum Steuerberater. Es ist eine echte Aufstiegsbiografie der Wirtschaftswunderjahre, die mir rückblickend noch mehr imponiert als damals schon.
Von der Entnazifizierung war mein Vater(6) nicht betroffen. Für die Nazis hatte er keine Sympathien, Widerstand hat er allerdings auch nicht geleistet. Er versuchte wohl, so gut es in diesen Zeiten ging, ein anständiges Leben zu führen. Gesprochen haben wir darüber wenig. Nach dem Krieg schloss er sich der neu gegründeten Vorläuferpartei der CDU an, wurde in Hornberg für Jahrzehnte ihr Vorsitzender und 1947 in den damals noch badischen Landtag gewählt. Für meine Mutter(6) war es nicht einfach mit einem so vielbeschäftigten Mann, an dessen Seite sie die klassisch-bürgerliche Rolle der Hausfrau übernahm. Sie war Tochter eines schwäbischen Kupferschmiedemeisters in Owen/Teck – ein Sozialdemokrat, der Mitglied im Kreistag war. Dort verbrachten wir Kinder oft die Schulferien. Das Energische und Aufrichtige hat meine Mutter(7) wohl von ihm geerbt.
Als wir Kinder aus dem Haus waren, suchte sie nach einer eigenen Aufgabe. Später habe ich verstanden, dass es schon in ihrer Generation der Wunsch vieler Frauen war, nicht lebenslang auf die Rolle von Hausfrau und Mutter beschränkt zu bleiben. Vielleicht lag darin sogar ein Grund dafür, warum ich ab 1976 in der Enquetekommission des Bundestags »Frau und Gesellschaft« mitarbeitete, in der es um die tatsächliche Verwirklichung der Gleichberechtigung ging. Damals allerdings, in den frühen sechziger Jahren, lehnten wir Söhne ihre Vorstellung ab, in einem Modegeschäft als Verkäuferin zu arbeiten. Heute wundert mich das selbst. Offenbar verstiegen wir uns in dem Glauben, das als Familie nicht nötig zu haben, womöglich dachten wir sogar, etwas Besseres zu sein. Dabei spürte ich in meiner kurzen Zeit am Gymnasium in Triberg genauso, was uns von den wohlhabenden Familien der Schüler, die dort im Internat waren, unterschied. Immerhin hatten wir ein Kindermädchen, und wir wussten durchaus, dass wir zum Bürgertum gehörten – auch wenn meine Mutter(8) gerne dafür warb, dass das Handwerk einen goldenen Boden habe.
Heute sehe ich vieles klarer. Das gilt auch dafür, dass meine Mutter(9) nach meiner ersten Bundestagskandidatur einige Zeit nicht mehr mit mir geredet hat. Ich habe das, so beschäftigt wie ich immer war, zunächst gar nicht bemerkt. Später hat sie mir deutlich gemacht, dass sie böse auf mich gewesen sei. Schließlich hätte ich wissen müssen, was ich meiner Frau(4) und meiner Familie mit meiner Kandidatur antat – meine erste Tochter(3) war da gerade erst geboren. Ihren Ärger habe ich inzwischen verstanden, und so idyllisch, wie ich mein Aufwachsen in Hornberg in Erinnerung habe, war die Zeit für meine Mutter(10) offenkundig nicht. Von uns Kindern hat sie das aber ferngehalten und uns so eine behütete Kindheit ermöglicht.
Mein Vater(7) war unser Vorbild. Die Integrität, für die er über Parteigrenzen hinweg respektiert wurde, kommt schon darin zum Ausdruck, dass er für den Schwarzwälder Boten die Berichte aus dem Stadtrat schrieb – obwohl er ihm selbst angehörte. Seine Darstellungen waren offenbar nicht parteilich, sondern objektiv. Er war eben ein korrekter, anständiger Mann. Was sich gehört und was nicht, solche bürgerlichen Werte wurden bei uns zu Hause hochgehalten. Eine von mir häufig erzählte Anekdote gibt einen Eindruck davon: Meine Mutter(11) hat recht spät, mit etwa fünfzig Jahren, den Führerschein gemacht. Als sie einmal mit dem Auto in die Stadt fuhr, hatte sie das nötige Kleingeld für die Parkuhr nicht dabei und musste deshalb verbotenerweise parken. Am Folgetag fuhr sie wieder hin und warf nachträglich zwanzig Pfennig ein. Wir Kinder haben uns damals amüsiert, heute berührt mich dagegen, wie ernst es meine Mutter(12) damit meinte, dass man nicht klaut, nicht betrügt, auch im Kleinen nicht.
In der wohlgeordneten Welt meines bürgerlich-protestantischen Elternhauses gab meine Mutter(13) den Ton an. Sie war allerdings öfters krank, und dann fielen mir lästige Haushaltsaufgaben zu. Mein jüngerer Bruder(3) hat es einmal so zusammengefasst: Beim Kochen von Linsen und Spätzle gab ich die erstklassige Hausfrau. Ansonsten taugte ich auch für die Rolle der strengen Mutter. Wir waren drei Brüder: Frieder(2), fünf Jahre älter als ich, Thomas(4), sechs Jahre jünger. Der Mittlere von dreien zu sein, ist nicht immer einfach. Heute heißt das »Sandwich-Kind«. Ich habe mich immer als »SAB« bezeichnet, den »Seggel am Bahnhof«, den man stehen gelassen hat. Im Schwäbischen ist »Seggel« ein Schimpfwort, und meine Mutter(14) hätte es als unanständig nie in den Mund genommen. Aber es passte. Ich war wohl ziemlich frech damals und habe oft widersprochen. Und ich war ein furchtbarer Rechthaber – manches ist eben früh angelegt. Meinen selbstbewussten Durchsetzungswillen hat sicher geschärft, dass ich in der Regel der Jüngste war, weil ich früh eingeschult wurde.
Wenn Thomas(5) in einer Biografie über mich mit den Worten zitiert wird, das Hauptproblem meiner Kindheit und Jugendzeit sei die Existenz des älteren Bruders Frieder(3) gewesen, der mehr und anderes durfte als ich, dann ist da etwas Wahres dran. Aus Sicht der Familie wurde der schwelende Konflikt zwischen uns beiden einmal so dargestellt: Der Ältere konnte nur schlecht verlieren – und ich war ein schlechter Gewinner. Was das für den Frieden in einem sportbegeisterten Haus bedeutete, kann man sich ausmalen. Für mich blieb Frieder(4) gleichwohl immer der große Bruder – bis zu seinem Tod. Dass er mich allein gelassen hat in dieser Welt, trage ich ihm nach. Aber so ist nun mal das Leben. Ich habe auch Thomas(6) überlebt. Nach meiner lebensgefährlichen Verletzung 1990, die mich in den Rollstuhl zwingt, hätte wohl keiner gedacht, dass ausgerechnet ich der letzte von uns dreien sein würde. Die Abwesenheit beider Brüder(5)(7) schmerzt.
Über Generationen und was sie verbindet
Ich bin im Krieg geboren, am 18. September 1942. Ein paar Tage zuvor hatte der deutsche Angriff auf Stalingrad begonnen, der zum Wendepunkt im Kriegsverlauf wurde. Ich habe nicht einmal schemenhafte Erinnerungen an die ersten Jahre, mein Bild des Krieges ist das der Erzählungen in der Familie. Unsere Mutter(15) verbrachte mit uns Kindern wohl eine Reihe von Nächten im Luftschutzbunker, bis die Familie wegen der ständigen Luftangriffe auf einen Bauernhof mitten im Wald evakuiert wurde. Und ausgerechnet über diesem Hof entledigte sich ein angeschossener Flieger der Luftwaffe, der notlanden musste, seiner Bombenlast. Das Gehöft brannte lichterloh, und alle mussten so schnell wie möglich raus. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, aber plötzlich schrie jemand: »Wo ist denn unser Wolf?« Mein älterer Bruder(6) fand mich unter einigen Wolldecken, die schon ein bisschen angekokelt waren und leicht rauchten. Wenn wir uns später wieder einmal stritten, hieß es deshalb gern, mit dieser Heldentat habe er wohl einen schweren Fehler begangen.
Wir hatten unheimliches Glück, weil mein Vater(8) keinen Kriegsdienst leisten musste. Die Hornberger Buntweberei war als kriegswichtiger Betrieb eingestuft, was ihn davor bewahrte, in die Wehrmacht eingezogen zu werden. Vom Kriegsende, das wir bei den Großeltern am Fuß der Schwäbischen Alb erlebten, schilderten mir später meine Eltern(9)(16), wie die Amerikaner mit ihren Panzern ins Dorf gerollt kamen. In der Kupferschmiede meines Großvaters hatten sich mit einer Panzerfaust bewaffnete Jugendliche versteckt, um die Amerikaner anzugreifen. Mein Großvater entdeckte sie und schickte sie nach Hause, da er sich bewusst war, dass ein einziger Schuss das Dorf in Schutt und Asche legen könnte. Dieser Mut hätte ihn fast noch das Leben gekostet, als einer der selbst ernannten Helden ihn standrechtlich erschießen wollte. Er wurde von den anderen in letzter Minute zurückgehalten.
In den Nachkriegsjahren ging es uns objektiv nicht schlecht. Wir litten keinen Hunger. Mein Vater(10) ging zu umliegenden Bauernhöfen, um Stoff aus der Weberei für Lebensmittel einzutauschen. Geredet wurde darüber nicht. Sein Trachtenjanker, den er dann anzog, trug bei uns allerdings den Titel »Hamster-Kittel«. Das in Anwesenheit Fremder zu sagen, war aus guten Gründen natürlich untersagt. Das Umland der Stadt war nach dem Krieg überlebenswichtig. Hornberg besaß recht viel Industrie und außerdem eine Eisenbahnbrücke, mit der die Schwarzwaldbahn ein Tal überquerte. Beides war zum Ziel alliierter Bombardements geworden, die Stadt daher 1945 ziemlich zerstört. Das weiß ich allerdings nur von Fotografien, denn zu meinem eigenen Erstaunen erinnere ich mich überhaupt nicht an die Trümmerlandschaften, die unser kollektives Bild von der Nachkriegszeit prägen. Wenn ich Aufnahmen aus der Zeit sehe, denke ich bisweilen: So zerstört war das? Und ich gehörte zu denen, die darin lebten und aufwuchsen? Es hatte damals gar nichts Bedrückendes für mich. Wenn ich zurückdenke, war auch der Anblick der vielen Kriegsversehrten unter den Heimkehrern so selbstverständlich, dass man sie gar nicht wirklich wahrnahm. Eher schon bemerkten wir die Flüchtlinge, die beim Hornberger Schloss untergebracht waren. Von ihnen hielten wir uns fern.
1950 war ein Drittel aller Arbeitslosen in der Bundesrepublik Flüchtlinge oder Vertriebene. Mit offenen Armen wurden die wenigsten von ihnen empfangen. Die Einheimischen waren damit beschäftigt, selbst über die Runden zu kommen, und neue Nachbarn bedeuteten, noch enger zusammenrücken zu müssen. Mitgefühl gab es da wenig. Als »Rucksack-Deutsche« seien sie noch lange nach ihrer Ankunft in der neuen Heimat ausgegrenzt worden, erinnert sich mein Kollege Volker Kauder(1). Seine Eltern waren als Donauschwaben aus Jugoslawien geflohen. Die Vertriebenen waren in der frühen Bundesrepublik zwar vielerorts nicht willkommen, aber sie hatten politisches Gewicht. Weil sie sich engagierten und weil sie sich als Teil des neuen Gemeinwesens sahen und daran teilhaben wollten. Ich habe erst lernen müssen, welche Verletzungen der Verlust der Heimat für diese Menschen bedeutete, mich dann aber später politisch dafür starkgemacht, den Erlebnissen der Betroffenen und ihrer Trauer um die eigenen Opfer und die verlorene Heimat angemessen Raum zu geben.
Wenn ich mich mit Jahrgangsgenossen über unsere Kindheit in Hornberg unterhalte, wird nie schlecht über diese Zeit geredet. Nicht einmal von denen, die in Nachkriegsbaracken aufwachsen mussten. Es gehört wohl zu den erstaunlichsten Fähigkeiten des Menschen, sich den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Dazu fällt mir die Geschichte ein, die Vernon Walters(1), der amerikanische Botschafter in Bonn zur Zeit von Mauerfall und Wiedervereinigung, gern erzählte. Als er 1945 in Begleitung eines US-amerikanischen Generals durch eine der zerstörten Ruhrgebietsstädte fuhr und diesen auf eine Blechdose mit Schnittblumen in der Fensterhöhle einer Ruine hinwies, kommentierte der das mit den Worten: »Dieses Volk wird nicht untergehen. Wer in einer solchen Ruinenlandschaft Blumen in eine Blechdose stellt, glaubt an die Zukunft.« Mir zeigt die Erfahrung meiner Jugend, wie relativ Zufriedenheit doch ist. Im Übrigen: Zu spüren, wie wenig das eigene Erleben mit dem Bild übereinstimmt, das von dieser Zeit gemeinhin gezeichnet wird, sensibilisiert dafür, dass es immer sehr unterschiedliche Erfahrungsräume gibt.
Ich bin zwar im Krieg geboren, aber von der Generation der eigentlichen Kriegskinder trennen mich entscheidende Jahre. Helmut Kohl(2), Heiner Geißler(1) oder Kurt Biedenkopf(1) gehörten zu dieser »vergessenen Generation«. Wie prägend die jugendliche Kriegserfahrung war, konnte ich an Kohl(3) sehen, der seine Politik regelmäßig nicht allein aus der Geschichte, sondern aus dem eigenen Erleben von Krieg und Gewaltherrschaft ableitete. An seinen im Krieg gefallenen Bruder erinnerte er häufig. Gerade vor diesem biografischen Hintergrund habe ich nie begriffen, wieso seine Formulierung von der »Gnade der späten Geburt« so missverstanden wurde. Die Wendung ist ja nicht falsch, sie wurde nur missgünstig ausgelegt. Kohl(4) wollte sagen, dass wir später Geborenen manche Versuchung nicht hätten aushalten müssen, und das sei eine Gnade. Kohl(5) gehörte zur »skeptischen Generation« (Helmut Schelsky(1)) der Flakhelfer, die ihr Verantwortungsgefühl für den Frieden und ihr politisches Handeln aus einem historischen Bewusstsein heraus begründete: aus der Erfahrung von Krieg und dem Jahr 1945 als Zusammenbruch und Nullpunkt.
Bei Helmut Schmidt(3) und Richard von Weizsäcker(1) spürte ich vor allem im höheren Alter das Verbindende der Kriegsgeneration über die Parteigrenzen hinweg. Sie hatten den »Scheiß Krieg«, wie Schmidt(4) ohne hanseatische Noblesse oft zischte, nicht nur als Kind erlebt, sondern waren selbst Soldaten gewesen. Aus ihren späteren Reden, etwa bei Gelöbnissen vor Rekruten, war das herauszuhören. Schmidt(5) hat nach dem Krieg und der Gefangenschaft sehr schnell Karriere gemacht, durch unglaublichen Fleiß und auch mit echtem Bildungshunger, der viele seiner Generation kennzeichnete, die verlorene Zeit nachgeholt. Er war nicht nur ein Politiker, der sich früh für sicherheitspolitische und strategische Fragen interessierte – und darüber lange vor seiner Zeit als Verteidigungsminister Bücher schrieb. Er war auch ein versierter Pianist, Musikkenner, noch dazu bewandert auf dem Gebiet der bildenden Künste. Seine im besten Sinne kleinbürgerlich-sozialdemokratische Aufstiegsgeschichte, geprägt von der NS- und Kriegserfahrung, und der in seinen Büchern aufleuchtende, sich leidenschaftlich erschlossene umfassende Bildungshorizont haben mir imponiert.
Ich selbst habe nie nach dem Verbindenden in »meiner« Generation gesucht. Ein besonderes Gruppenbewusstsein habe ich nicht entwickelt. Im Bundestag bin ich heute ein Unikum, denn es ist um mich mit den Jahren einsamer geworden. Wer so lange dabei ist, hat viele kommen und gehen sehen. Irgendwann fehlten die Kollegen, mit denen ich den politischen Aufstieg zusammen erlebt hatte, diejenigen, mit denen ich in Regierungsverantwortung stand. Vieles von dem, was manche junge Abgeordnete heute wichtig finden, ist mir fremd. Die öffentliche Dauerpräsenz in Echtzeit, bei der man mehr durch Pose denn mit Argumenten auffällt, schätze ich nicht und muss ich auch nicht mehr lernen. Bewahrt habe ich mir aber die Neugierde darauf, was die jungen Kolleginnen und Kollegen bewegt. Wenn ich mich etwa mit der früheren JUSO-Chefin Jessica Rosenthal(1) oder der damals jüngsten Grünen-Abgeordneten Emilia Fester(1) zum Interview treffe, ist das ein anregender Gedankenaustausch – bei dem allerdings beide Seiten die Erfahrung machen, wie viel unsere Generationen voneinander trennt. So wäre mir als junger Abgeordneter nie in den Sinn gekommen, Politik nur oder vor allem für meine eigene Generation machen zu wollen. Mein Verständnis als Abgeordneter war immer, wie es Artikel 38 unseres Grundgesetzes bestimmt, Abgeordneter des »ganzen Volkes« zu sein.
Schatten der Vergangenheit
Geprägt hat mich weniger die Erfahrung, noch im Krieg geboren zu sein, als vielmehr das Aufwachsen in der frühen Bundesrepublik – und dabei vor allem das Grundgefühl, dass es damals immer aufwärtsging. Das Wirtschaftswunder war in meiner Jugend mit Händen zu greifen. Vielleicht ist in dieser Erfahrung mit angelegt, warum ich mir in allen Situationen des Lebens, auch den schwersten, die Zuversicht immer bewahren konnte. Dabei hatte sich der demokratische Neubeginn nach 1945 unter schwierigen Bedingungen vollzogen. Es galt, eine stabile Verfassung ins Werk zu setzen und die zersplitterte Gesellschaft zusammenzuführen, eine Gesellschaft aus Nazis und Mitläufern, Verfolgten und Verfolgern, Soldaten, Ausgebombten und Flüchtlingen, Katholiken und Protestanten, Versehrten und Davongekommenen, Bürgerlichen und Arbeitern, Deutschnationalen, Zentrumsanhängern und Liberalen, Menschen, die von Politik nichts mehr wissen, und Menschen, die die Politik vor Radikalen schützen wollten. Wie tief die Gräben zwischen all denen waren, die für die Demokratie gewonnen werden sollten, machen wir uns nur selten bewusst. Unser heutiger Pluralismus ist zwar etwas völlig anderes, doch auch damals stand man vor der gewaltigen Aufgabe, die Gesellschaft zu einen und eine neue demokratische Kultur zu verankern. Dass dies unter den damaligen Bedingungen gelungen ist, kann uns ermutigen, in unserem Bemühen nicht nachzulassen, Vielfalt zuzulassen und gleichzeitig im Pflegen des Verbindenden ein Mehr an Gemeinsamkeit zu schaffen.
Zur Zeit der Entnazifizierung kamen am Wochenende häufig Besucher zu uns nach Hause. Dort hielt mein Vater(11) in unserem Wohnzimmer seine Bürgersprechstunde als Abgeordneter ab. Er hörte sich die Anliegen der Bürger an und half, wo er konnte. In der Welt eines Kindes gibt es wenig Raum für Zwischentöne, kein Grau. Es gibt hell und dunkel, gut und böse. Und auch wenn ich erst, als ich viel älter war, wirklich begriff, was Deutsche Juden und auch anderen in ganz Europa angetan haben, hatte ich als Kind offenbar dennoch ein Gefühl von Gerechtigkeit. Denn meinen Vater(12) fragte ich damals verdutzt, wieso er sich auch für die einsetze, die doch böse gewesen waren – Nazis. Ich bekam dann meine erste Lehrstunde darin, dass man bei allem differenzieren müsse. Dass es mächtige Menschen gegeben hatte, böse und wahnsinnige, und Menschen, kleine, einfache Leute, die ihnen auf den Leim gegangen waren. Täter, die schuldig sind, und Mitläufer, die zu schwach waren, um dagegenzuhalten, was man ihnen nachsehen müsse. Es war eine kindgerechte Erklärung, aber sie ist bezeichnend für das Dilemma nach 1945, in und mit einer Gesellschaft von Tätern den demokratischen Neuanfang zu wagen.
Die »Stunde Null« ist deshalb ein missverständlicher Begriff. Personell und strukturell musste an so vieles angeknüpft werden, darüber ist viel und kontrovers geschrieben worden. Während die Mitscherlichs(1)(1) in den sechziger Jahren die »Unfähigkeit zu trauern« brandmarkten, sprach der Philosoph Hermann Lübbe(1) Anfang der achtziger Jahre vom »kommunikativen Beschweigen«, das überhaupt erst ermöglichte, die Deutschen so unmittelbar nach dem Zivilisationsbruch in einen demokratischen Staat zu integrieren. Täter und Mitläufer wollten nicht darüber reden (wussten aber natürlich übereinander Bescheid), Kriegsheimkehrer konnten es meist nicht, weil sie im Krieg zu viel Entmenschlichung erlebt hatten. Nicht darüber reden zu können, betraf vor allem die Opfer der Verbrechen. Ignatz Bubis(1) hat mir eindrücklich davon erzählt. Bei anderen, die wie Ruth Klüger(1) oder Jorge (1)Semprún spät die Kraft fanden, doch noch Zeugnis über ihr Schicksal im Holocaust abzulegen, ist es nachzulesen.
In meiner Erinnerung wurde von Diktatur und Nationalsozialismus nicht viel geredet – aber wir haben auch nicht gefragt. Welche Vorgeschichte etwa unsere Lehrer hatten, spielte keine Rolle. Im Nachhinein wurde mir klarer, was wir damals allenfalls dunkel ahnten: dass für manche unter ihnen die Jahre der Diktatur kein Ruhmesblatt waren. Warum uns die nahe Vergangenheit so wenig interessiert hat, wundert mich heute selbst. Immerhin ist mir ein sozialdemokratischer Geschichtslehrer im Gedächtnis geblieben, der die Jahre der Diktatur im Unterricht thematisierte.
Dass Deutsche versucht hatten, alle Juden zu vernichten, war uns als Verbrechen, wenn auch abstrakt und schemenhaft, durchaus präsent. Im Alltag gab es keine Juden. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich in meiner Kindheit und Jugend jemals einen Juden gesehen hätte. Deshalb hat mich 2022 bei der Gedenkstunde des Deutschen Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus sehr ergriffen, als die Zeitzeugin Inge Auerbacher(1) von ihrer Kindheit in dem badischen Dorf Kippenheim erzählte. Ich habe sie kurz darauf noch einmal in unserer gemeinsamen badischen Heimat zum Gespräch getroffen. Auerbacher blieb lange das letzte jüdische Kind, das dort geboren wurde. Als Vierjährige erlebte sie die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938, und ihre noch halbwegs heile Kinderwelt brach zusammen. Die Synagoge des Ortes wurde nur deshalb nicht niedergebrannt, weil die christlichen Häuser in der Nachbarschaft Feuer hätten fangen können. Auerbacher berichtete zwar auch von der Unterstützung christlicher Freunde im Ort, vor allem aber von Ausgrenzung und Verfolgung – bis zu dem Moment ihrer Deportation nach Theresienstadt, als ihr ein Aufseher eine Holzbrosche entriss und zurief: »Du brauchsch des ned, wo du nagosch.«
Auschwitz wurde mir frühestens im Studium zu einem Begriff, insbesondere durch die juristische Aufarbeitung dieser Jahre. Neben dem Jahrhundertprozess gegen Adolf Eichmann(1) 1961 in Jerusalem brachten Mitte der sechziger Jahre die Verfahren gegen Angehörige der KZ-Wachmannschaften die Verbrechen in den Vernichtungslagern zu Bewusstsein. Welchen Anfeindungen der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer(1), von dem ich damals nicht viel wusste, ausgesetzt gewesen war, habe ich erst später verstanden. Ebenso die wirkliche Bedeutung der Prozesse, die über die juristische Aufarbeitung hinaus vor allem darin lag, dass der Zivilisationsbruch, als den wir den Nationalsozialismus und den Holocaust heute erkennen, erstmals in der Breite der Gesellschaft Namen und Gesichter bekam – von Opfern wie von Tätern.
Prägend wurden für mich die zeitgleichen Debatten über die Verjährung von NS-Verbrechen, die nach geltendem Recht mit dem 8. Mai 1965 eintrat. Diese Auseinandersetzung hat das ganze Jahrzehnt und noch weit darüber hinaus die Gemüter bewegt. Nicht nur aus Sicht eines angehenden Juristen war das eine brisante Angelegenheit. Es ging um die Frage, wie wir als Gesellschaft mit der dunklen Vergangenheit umgehen wollen – in einer Zeit, als auf das einvernehmliche Beschweigen der offene Generationenkonflikt folgte. Die moralische Empörung war groß, dass zwanzig Jahre nach den entsetzlichen Taten die Verjährung greifen und Täter gerade in dem Moment der Verfolgung entgehen sollten, als die Öffentlichkeit für diese Verbrechen sensibel wurde. Gleichzeitig war es ein Dilemma, denn die Frage der Verjährung tangierte formaljuristisch das hohe Gut der Rechtssicherheit. Die Aufhebung der Verjährungsfristen bedeutete einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot: Nulla poena sine lege – so lautet der rechtsstaatliche Grundsatz, dass die Strafbarkeit zum Zeitpunkt der Tat bestimmt sein muss. Mit diesen juristischen Prinzipien ließ sich der Holocaust aber nicht bewältigen. So habe ich das damals empfunden, und so sah es nach eindrucksvoller Debatte auch die Mehrheit des Bundestags. Dennoch einigte man sich zunächst nur darauf, den Beginn der Verjährungsfrist auf den 1. Januar 1950 festzulegen. FDP-Bundesjustizminister Ewald Bucher(1), der als junger Mann NSDAP- und SA-Mitglied gewesen war, hatte sich vehement gegen eine Verlängerung ausgesprochen und trat von seinem Amt zurück. 1969 wurde die Verjährung für Völkermord schließlich aufgehoben, 1979 auch für Mord.
Beeindruckt hat mich und meine Freunde damals vor allem die Rede von Ernst Benda(1) im Deutschen Bundestag. Benda war ein vergleichsweise junger Abgeordneter der CDU, noch dazu Mitbegründer des RCDS, des »Ringes Christlich-Demokratischer Studenten«. Sein Satz, das Rechtsgefühl eines Volkes werde in unerträglicher Weise korrumpiert, wenn Morde ungesühnt bleiben müssten, obwohl sie gesühnt werden könnten, und sein Eintreten dafür, dass sich die Deutschen um ihrer selbst willen von den Mördern unter ihnen befreien müssten, machten ihn zum »Helden« einer jüngeren Generation mit ihrem Anspruch auf Aufarbeitung. Für Benda(2) erwies sich die Rede als Karrieresprungbrett. Sein Weg führte in kurzer Folge vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium über das Ministeramt am Ende der Kanzlerschaft Kiesinger(1) zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts 1971.
Für die in den sechziger Jahren aufbrechende, heftige Auseinandersetzung um die deutsche Vergangenheit steht symbolisch die Ohrfeige, die Beate Klarsfeld(1) 1968 Kurt Georg Kiesinger(2) wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft auf offener Bühne gab. Ich war damals im Saal anwesend und bekam in den hinteren Reihen der Berliner Kongresshalle zumindest mit, dass etwas geschehen war, ohne jedoch Einzelheiten zu erkennen. Dabei war der Parteitag in der von den Studentenprotesten aufgeputschten Stimmung aus guten Gründen hermetisch abgesichert worden. Dass Klarsfeld(2) im anschließenden Prozess von Horst Mahler(1) vertreten wurde, der zunächst als RAF-Mitglied und später dann als Neonazi und Holocaust-Leugner wiederholt im Gefängnis saß, lässt einen ob der Wendungen, die das Leben schreibt, nur staunen. (1)Ihr Mann, der Holocaust-Überlebende Serge Klarsfeld, hat die Aktion einmal als Ohrfeige einer Tochter für den Vater bezeichnet. Sie habe symbolisch die Abrechnung der deutschen Jugend mit der Vätergeneration ausgedrückt, es sei ein Akt der Befreiung gewesen. Mir blieb das fremd – nicht nur weil ich den tätlichen Angriff auf den Kanzler(3) ablehnte und wenig davon hielt, eine Person stellvertretend für andere anzuklagen. Ich hatte vor allem das Glück, zu meinem Vater(13) ein ungebrochen gutes Verhältnis zu haben. Im Privaten machte er, der in der christlichen Arbeiterbewegung aktiv gewesen war, keinen Hehl daraus, wie fern ihm die Nazis im Habitus und mit ihrer unchristlichen Ideologie standen. Den mädchenhaften Schwärmereien meiner Mutter(17) und ihrer zwei Schwestern für das Regime trat er gemeinsam mit seinem künftigen Schwiegervater, dem sozialdemokratischen Schmiedemeister, früh entgegen.
Die heftigen Konflikte, die Teile meiner Generation und viele Jüngere nicht nur gesellschaftlich, sondern gerade im Privaten austrugen, habe ich also nicht erlebt. Ich stand nie in Opposition zu meinen Eltern(14)(18). Die familiäre Entfremdung und bleibenden Verletzungen, die diese Auseinandersetzungen vielfach hinterließen, kenne ich deshalb nur aus Erzählungen. Dass aber mein Erleben der Nachkriegszeit nicht die Erfahrung aller war, lernte ich auch bei Heinrich Böll(1). Das Katholisch-Rheinische in seinen Werken blieb mir zwar immer unzugänglich, mich faszinierte jedoch das Gebrochene seiner Generation, das sich in den Figuren seiner Romane spiegelt: durch Krieg, Verstrickung, Hunger. All das, was ich so nicht erleben musste.
Unsere Geschichte als bleibende Verantwortung
Je älter ich werde, umso unfassbarer ist es für mich, dass eine hochzivilisierte Gesellschaft, und eben nicht nur ein paar Verbrecher, zu solchen Verirrungen wie die Deutschen im Nationalsozialismus fähig ist. Mein Interesse an Geschichte war schon als Gymnasiast ausgeprägt, und es verstärkte sich im Laufe meines Lebens kontinuierlich, weshalb ich hier zeitlich etwas aushole. Doch Wissen ist das eine, das Empfinden an den Orten der Verbrechen etwas völlig anderes. Ich bin spät, erst nach 2002, nach Israel gereist, aber schon der erste Besuch in Yad Vashem hat mich nicht mehr losgelassen. In meiner zweiten Amtszeit als Innenminister entstand dann eine bis heute andauernde Freundschaft mit meinem damaligen israelischen Kollegen Avi Dichter(1), einem Kind von Shoah-Überlebenden. Mit ihm besuchte ich in Berlin das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas, und ich vergesse nie, wie er in Tränen ausbrach, als er mir im »Ort der Information« die Namen seiner im Holocaust ermordeten Familienmitglieder zeigte.
Als Bundestagspräsident habe ich dort im Jahr 2021 mit meinem israelischen Kollegen Yuli-Yoel Edelstein(1) einen Kranz niedergelegt – nicht etwa jeder einen, sondern gemeinsam einen, dessen Schleife die Farben beider Staaten trug. Das hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Edelstein(2), der mich zuvor bei meinem offiziellen Besuch anlässlich des siebzigsten Jahrestags der Gründung Israels vor der Knesset mit militärischen Ehren empfangen hatte, ist wie Dichter(2) ein Sohn von Holocaust-Überlebenden. Am Mahnmal, neben dem Brandenburger Tor und in Sichtweite des Reichstagsgebäudes, sprach er von seinem zerrissenen Herzen, an diesem Ort zu stehen und der Millionen ermordeten Juden Europas zu gedenken. Das hat mich tief berührt, und ich empfand es als eine Geste großen Vertrauens in unseren Staat. Ich bin überzeugt, dieses Vertrauen konnte über den Abgründen unserer Geschichte überhaupt nur wachsen, weil wir Deutschen uns zur Schuld, die unser Land trägt, bekennen. Es ist beschämend und manchmal zum Verzweifeln, dass Ewiggestrige dies immer noch nicht verstanden haben.
Zum zentralen Ort für das Bekenntnis zu unserer besonderen Verantwortung sind seit 1996 die Gedenkstunden im Deutschen Bundestag geworden. Als Fraktionsvorsitzender hatte ich 1995 eine Anregung von Gregor Gysi(1) aufgegriffen und Bundespräsident Roman Herzog(1)