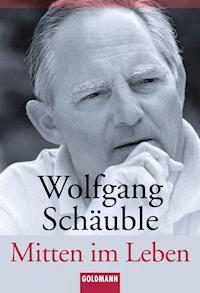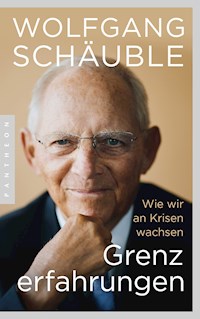
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Vermächtnis des großen Politikers: Wolfgang Schäuble ermutigt, über die Zukunft zu streiten
Die Pandemie hat vieles, was uns selbstverständlich erscheint, in Frage gestellt. Welchen Preis hat der Schutz des Lebens, wenn zugleich die Grundrechte eingeschränkt werden? Wie balancieren wir die verschiedenen Bedürfnisse in einer Gesellschaft, so dass alte Menschen besonders geschützt und zugleich die Zukunftschancen der nachfolgenden Generationen gewahrt bleiben? Was heißt europäische Solidarität im Lockdown? Wolfgang Schäuble erkundet die politischen Grenzerfahrungen in einem Krisenjahrzehnt und scheut sich nicht davor, auch unbequeme Debatten anzustoßen. Zugleich diskutiert er seine Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit – ob Schutz der Lebensgrundlagen, Umgang mit begrenzten Ressourcen, Exzesse der Globalisierung oder Migration – mit Persönlichkeiten wie Rutger Bregman, Ralf Fücks, Maja Göpel, Sylvie Goulard, Diana Kinnert, Ivan Krastev und Armin Nassehi. Das Buch stößt die Debatte darüber an, was es wertzuschätzen gilt und wo wir unserem Denken und Handeln eine neue Richtung geben sollten.
- Mit einem neuen Vorwort zur Paperback-Ausgabe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Ob es um den Schutz des Lebens, den Umgang mit begrenzten Ressourcen oder Exzesse der Globalisierung geht: Das letzte Krisenjahrzehnt war für die Politik immer wieder von Grenzerfahrungen geprägt. In diesem Buch erkundet Wolfgang Schäuble die großen Fragen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, und scheut sich nicht davor, auch unbequeme Debatten anzustoßen – in sieben Essays und in intensiven Gesprächen mit Vordenkern wie Rutger Bregman, Ralf Fücks, Maja Göpel, Sylvie Goulard, Diana Kinnert, Ivan Krastev und Armin Nassehi. Eine Anstiftung, über die Zukunft zu streiten, und eine Ermutigung, das Bewährte zu wahren und Neues zu wagen.
Die Autoren
Wolfgang Schäuble, Jahrgang 1942, zählt zu den wichtigsten deutschen Politikern der letzten vierzig Jahre. Er ist seit 1972 Mitglied des Deutschen Bundestags, war Fraktionsvorsitzender der Union und Vorsitzender der CDU und hatte zudem über drei Jahrzehnte hinweg wichtige Regierungsämter inne, darunter Kanzleramtsminister, Bundesinnenminister und Bundesfinanzminister. Seit 2017 ist er Präsident des Deutschen Bundestags. Zu seinen Veröffentlichungen zählen: Der Vertrag. Wie ich über die deutsche Einheit verhandelte (1991), Mitten im Leben (2000) sowie Scheitert der Westen? (2003). Hilmar Sack, Historiker, arbeitete für die Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland« und leitete das Referat der Redenschreiber bei den Bundestagspräsidenten Norbert Lammert und Wolfgang Schäuble. Seit 2019 ist er Leiter des Präsidialbüros mit dem Stabsbereich des Bundestagspräsidenten. Jacqueline Boysen, Journalistin und Historikerin, langjährige Korrespondentin des Deutschlandradios, war Studienleiterin für Politik und Zeitgeschichte an der Evangelischen Akademie zu Berlin und arbeitet als Redenschreiberin in der Verwaltung des Deutschen Bundestages.
Besuchen Sie uns auf www.pantheon-verlag.de
WOLFGANGSCHÄUBLE
Grenzerfahrungen
Wie wir an Krisen wachsen
Mitarbeit: Jacqueline Boysen und Hilmar Sack
Pantheon
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2022 by Pantheon Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Copyright © 2021 by Siedler Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt
Coverabbildung: © Bundesministerium der Finanzen, Foto: Ilja C. Hendel
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN978-3-641-27587-7V004
www.pantheon-verlag.de
Inhalt
Vorwort zur Paperback-Ausgabe
Politische Grenzerfahrungen – und warum wir sie nicht fürchten müssen
1
Grenzenlos glücklich? Der Mensch zwischen Freiheit und Begrenztheit
Gespräch mit Rutger Bregman
2
Begrenzte Handlungsspielräume: Zur Verantwortung der Politik in der Demokratie
Gespräch mit Ralf Fücks
3
Grenzen des Wachstums? Über nachhaltiges Wirtschaften in Zeiten der Globalisierung
Gespräch mit Maja Göpel
4
Grenzen der Vielfalt? Über Nation, Identität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt
Gespräch mit Armin Nassehi
5
Überwundene Grenzen? Zur Zukunft Europas
Gespräch mit Sylvie Goulard
6
Grenzenlos gültig? Über westliche Werte und unsere Verantwortung in der Welt
Gespräch mit Ivan Krastev
7
Vergangene Zukunft? Wo Erinnerung befreit und Geschichte begrenzt
Gespräch mit Diana Kinnert
Dank
Leseempfehlungen
Die Gesprächspartner und Moderatoren
Personenregister
Vorwort zur Paperback-Ausgabe
Alles gleich, nur eben anders? Diese Frage habe ich unter dem Eindruck der Pandemie vor einem Jahr in diesem Buch gestellt. Sie beantwortet sich mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine an dem Tag, an dem ich die Druckfahnen für die Paperback-Ausgabe in den Händen halte, auf unerwartete Weise eindeutig. Die Ordnung, die Europa nach Ende des Kalten Krieges eine relativ verlässliche Sicherheit gewährte, ist vorbei. In diesem Moment ist die ganze Welt aufgerufen, gerade auch China, sich für Mäßigung und Gewaltfreiheit einzusetzen. Aber die Konsequenzen für den Weltfrieden und das internationale Mächtesystem sind unabsehbar – auch im Hinblick auf die weltwirtschaftliche Entwicklung und die Auswirkungen der Flüchtlingswellen auf die innere Stabilität der westlichen Staatengemeinschaft. Und das in einer Zeit, in der die Pandemie unsere demokratischen Gesellschaften weiterhin massiv herausfordert!
Als ich dieses Buch 2021 abschloss, erlebten wir die zweite Welle der Pandemie. Ein vorsichtiger Optimismus hatte die Menschen ergriffen, weil ein in Deutschland in beispiellosem Tempo entwickelter Impfstoff den Ausweg versprach. Seitdem sehen wir uns in immer neue, noch heftigere Wellen gestoßen – zunehmend zermürbt von immer feindseliger geführten Debatten. Erst über notwendige Priorisierungen bei den Risikogruppen, weil es den meisten mit dem Impfen gar nicht schnell genug gehen konnte. Später über eine Pflicht zum Impfen qua Gesetz, weil es dann doch zu vielen aus sehr unterschiedlichen Motiven – Misstrauen in die moderne Medizin oder den Staat, »Gottvertrauen« in die eigene Unverwundbarkeit oder schlicht Bequemlichkeit – an der Einsicht fehlte, dass eine Impfung nicht nur sie selbst, sondern auch andere schützt. Wo zu Beginn der Pandemie ein lange nicht gekanntes Maß an Solidarität beeindruckte, manövriert sich unsere vielfach beklagte digitale Erregungs-Öffentlichkeit immer tiefer in ein hysterisches Debattenklima hinein, das nur Freund und Feind kennt – was längst auch für die Diskussion über andere große Themen unserer Zeit gilt.
Krise der Demokratie?
Die Pandemie führt an Belastungsgrenzen und in manchen Bereichen auch weit darüber hinaus. Kritik am Krisenmanagement von Bund und Ländern, an Blockaden, Versäumnissen und auch Fehlentscheidungen ist berechtigt – und sie ist notwendig, um an Fehlern zu lernen. Der internationale Vergleich lehrt zugleich Demut, denn die deutsche Nabelschau führt oft zu überzogenen Erwartungen. Zu einer nüchternen Zwischenbilanz der Ausnahmesituation gehört nämlich, dass sich unsere politische Ordnung nach zwei Jahren Pandemie im Ganzen bewährt hat. Der Deutsche Bundestag blieb auch unter Corona-Bedingungen arbeitsfähig, konnte unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen gesetzgeberische Grundentscheidungen verlässlich treffen und so allen Unkenrufen zum Trotz den Rahmen für das Handeln der Exekutive setzen. Es wurden zwar demokratische Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt, wir haben aber keine institutionelle Krise der Demokratie erlebt.
Der Rechtsstaat zwingt die Verantwortlichen zur Begründung ihrer Entscheidungen, und er lässt im Rahmen der Gesetze Spielraum für Korrekturen und Kurswechsel. Das unterscheidet ihn von autoritären Herrschaftssystemen – ebenso die Möglichkeit, gerichtlich gegen Entscheidungen staatlicher Institutionen vorzugehen. Seit Beginn der Pandemie sind an den Verwaltungsgerichten tausende Entscheidungen ergangen. Manche Freiheitseinschränkungen wurden in der Phase sinkender Infektionszahlen von Richtern gekippt. Auch deren Arbeit unter erschwerten Pandemiebedingungen widerlegt den oft leichtfertig erhobenen Vorwurf des »kompletten Staatsversagens« oder einer »Corona-Diktatur«. Angesichts solcher Behauptungen gerade von den Rändern der Gesellschaft kommt mir das schneidende Wort Wolf Biermanns über die »fatalen Unglücksidioten« in den Sinn, die die Demokratie im Namen der Demokratie und die Freiheit im Namen der Freiheit verachten. Wobei sie, wie der diktaturerfahrene Poet süffisant anmerkt, ihr »Maulheldentum« in der Freiheit überhaupt nichts kostet.
Den inflationär verwandten Vorwurf des »Versagens« halte ich auch deshalb für überzogen, weil er suggeriert, es habe in der Pandemie immer einen klar erkennbaren Weg gegeben, den die Politik nur hätte beschreiten müssen. Tatsächlich aber ist die Herausforderung, mit der uns das Coronavirus konfrontiert, für unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht neu.
Politischer Handlungszwang, wissenschaftliche Logik und die moralische Pflicht des Einzelnen
Politik muss immer ins Ungewisse hinein handeln. Ohne Rat von Experten geht das nicht. Zu Beginn der Pandemie war der Stand der medizinischen Wissenschaft aber noch unsicher und im weiteren Verlauf blieb ihr Rat nicht selten widersprüchlich. Letzte Gewissheit kann auch die Wissenschaft ebenso wenig liefern, wie es in der Demokratie die eine richtige politische Entscheidung gibt. Die wissenschaftliche Logik, die auf Ambiguität, Zweifel und Widerspruch beruht, gerät zwangsläufig in ein Spannungsverhältnis zu den politischen Notwendigkeiten. Parlament und Regierung müssen handeln – und im Wissen um die Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis rasch Entscheidungen treffen. In der Pandemie haben wir dazu die unterschiedlichen Argumente von Interessengruppen und – vielleicht zu spät – die Meinungen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen einbezogen: von Juristen und Soziologen ebenso die von Ökonomen, Psychologen und Pädagogen.
Verantwortungsvolle Politik kommt nicht umhin, die ethisch-moralische Dimension und die verfassungsrechtlichen Aspekte jeder Maßnahme mit zu bedenken und das eigene Handeln zu erklären, um das Vertrauen in der Bevölkerung zu erhalten. Sonst kann sich die Pandemie sehr wohl zu einer Krise unseres politischen Systems auswachsen. Die frappierende Abkehr von der Ratio, die sich im Frontalangriff auf wissenschaftliche Erkenntnis zeigt, und die vielfach offen zur Schau gestellte, teils gewaltsame Ablehnung unseres politischen Systems in einem bereits seit der Flüchtlingskrise 2015 wachsenden Teil der Gesellschaft ist erschreckend, gerade weil es sich dabei um eine politisch-ideologisch und soziokulturell heterogene Gruppe von Menschen handelt, die einer sehr differenzierten Ansprache bedarf.
Schwer wiegt, dass es nicht gelungen ist, Handlungsziele und auch -zwänge überzeugend zu kommunizieren. Dass wir als politisch Verantwortliche nicht ausreichend damit durchdrangen, dass Eigenverantwortung etwas anderes ist, als Impf-Gegner behaupten. Dass ohne Empathie für unser Gegenüber eine freiheitliche, humane Gesellschaft unmöglich ist. Die Freiheit des Individuums darf sich nicht selbst genügen, sie schließt immer die Verantwortung für andere ein: für ihr Leben, ihre Gesundheit, die berufliche Existenz oder die Zukunftschancen der ins Homeschooling verbannten Kinder. Wir haben es nicht geschafft, alle davon zu überzeugen, die individuelle Freiheit als Verantwortung zu begreifen, die Freiheit aller zu sichern. Deshalb wird nicht zu Unrecht auf die knappe Fernsehansprache Helmut Schmidts im Terror-Herbst 1977 verwiesen, als der damalige Bundeskanzler glasklar die »moralische Pflicht« des Einzelnen formulierte, seinen Beitrag für die Sicherheit der Gemeinschaft zu leisten.
Ob aber ein solch schnörkelloses Einfordern individueller Pflichterfüllung heute nicht doch verhallen würde? Es wäre nicht allein der Politik anzulasten. Vielmehr sehen wir eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, in der sich das Individuum mit seinem Empfinden, seinen Wünschen und Ansprüchen zunehmend absolut setzt und dabei die natürliche Begrenzung seiner Freiheit durch die Freiheit der anderen schleift. Wie Politik und Zivilgesellschaft dem entgegenwirken können, ist für mich eine der großen Fragen unserer Zeit – zumal wir in den vielen Jahrzehnten relativer Sicherheit und Stabilität den Umgang mit wirklich existenziellen Herausforderungen, die uns alle treffen und die wir nur gemeinschaftlich bewältigen können, ein Stück weit verlernt zu haben scheinen.
Raus aus dem Tunnelblick der Pandemie
Wir lernen gerade erst, mit dem Virus zu leben – was das heißt, wusste ich beim Verfassen des Manuskripts noch nicht. Insofern sind die Passagen zur Pandemie auch ein zeithistorisches Dokument über die damaligen Hoffnungen und Erwartungen, die bislang unerfüllt blieben. Die erstaunliche Beweglichkeit, die unser Land anfänglich gezeigt hatte, geriet schnell ins Stocken, bürokratische Auflagen und ein übertriebener Perfektionismus behinderten wirksame Maßnahmen gegen die Pandemie wie die Corona-Warn-App und strangulierten vielfach die Eigeninitiative von Bürgern. Umso wichtiger wird es, diese Kräfte in unserer Gesellschaft jetzt wachzurufen – um die Zuversicht zurückzugewinnen, die es für echte Veränderungen braucht.
Dieses Buch lädt dazu ein, darüber nachzudenken, wie wir auch an dieser Krise wachsen und gestärkt für die anderen großen Herausforderungen unserer Zeit aus ihr herauskommen können. Sich aus dem Tunnelblick der Pandemie zu lösen und unsere Perspektive nicht nur für den Moment auf diese Aufgaben zu weiten, ist allerdings seit Erscheinen des Buchs nicht leichter geworden. Ulrich Matthes, den ich als Künstler bewundere und mit dem ich ein intensives Gespräch darüber geführt habe, hat das Problem im März 2021 auf den Punkt gebracht, als er sagte, die Herausforderungen der Pandemie seien im Alltag gegenwärtig einfach zu übermächtig, um sich der Zukunft zuzuwenden.
Und dennoch bin ich überzeugt, dass wir diese Debatten jetzt führen müssen – weil die Fokussierung auf ein Thema, wie wir täglich erfahren, über die allgemeine Ermüdung zur Radikalisierung an den Rändern führt, und weil die großen Themen, die ich in meinen Essays und mit prominenten Gesprächspartnern diskutiere, ja nicht an Relevanz verloren haben. Im Gegenteil: Jedes Kapitel schrieb sich praktisch weiter.
Wir sind dabei in eine Phase der Kumulation von Krisen eingetreten, die uns seit Jahren begleiten. Die Aggression Russlands sowie zuvor das Debakel des Westens in Afghanistan und die als politische Geiseln missbrauchten Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze, aber auch der Weltklimabericht und die extremen Wetterereignisse mit zerstörerischen Bränden weltweit und einem verheerenden Hochwasser in Deutschland zeigen schonungslos, wie eng die Welt zusammengewachsen und die Entwicklungen miteinander verflochten sind.
Wir tragen Verantwortung in der Welt und für die Demokratie
Das erschwert politische Entscheidungen – in der Demokratie ist Politik ohnehin immer ein schwieriger Abwägungsprozess, gefordert ist das Austarieren widerstreitender Interessen. Dafür werbe ich in diesem Buch, auch mit Blick auf unseren Kampf gegen die Erderwärmung und den Verlust der Artenvielfalt. Denn das mitunter zähe Ringen um gesellschaftliche Mehrheiten müssen wir gerade auch denen nahebringen, die angesichts des Klimawandels von der Trägheit demokratischer Prozesse und internationaler Übereinkommen, wie 2021 beim Klimagipfel in Glasgow sichtbar, enttäuscht sind. Die sofortiges Handeln fordern. Ihre Motive sind nachvollziehbar. Und ihr Verweis auf wissenschaftliche Erkenntnis auch. Damit ist aber noch keines unserer Probleme gelöst. Hier beginnt Politik erst, das demokratische Ringen um den richtigen Weg, der zugleich mehrheitsfähig ist. In der freiheitlichen Gesellschaft gilt immer: Wer Ziele und Mittel absolut setzt, bringt sie gegen das demokratische Prinzip in Stellung.
Die westlichen Demokratien müssen beweisen, dass sie die anstehenden Aufgaben effizient bewältigen können. Denn wer, wenn nicht wir, könnte in der Welt sonst für Freiheit und Rechtstaatlichkeit streiten? Weltweit steht die Demokratie immer stärker unter Druck – und dass wir hierzulande trotzdem viel zu lange und viel zu wenig über die Rolle diskutiert haben, die uns in den internationalen Beziehungen zukommt, ist wohl das größte deutsche Debattendefizit.
Außen- und sicherheitspolitische Fragen waren ARD und ZDF im Fernseh-Triell zur Bundestagswahl 2021 keine einzige Sendeminute wert. Dafür startete die neue Bundesregierung im Zeichen einer brandgefährlichen militärischen Eskalation des Konflikts mit Russland – und erfährt die weitgehende Machtlosigkeit der Europäischen Union. Dabei geht es nicht mehr nur um den Frieden in der Ukraine, sondern um die dauerhafte Sicherheit auf unserem Kontinent und angesichts der atomaren Bedrohungslage um das Überleben der Menschheit.
Während wir es uns als Europäer weiter leisten, auch die bedrohliche Entwicklung auf dem Westbalkan sträflich zu vernachlässigen, obwohl es gerade jetzt europäischer Ideen, Ehrgeiz und Druck bedürfte, um in diesem »Vorhof der EU« die politischen Blockaden aufzulösen und einer neuen gewaltsamen Eskalation in dieser Region rechtzeitig entgegenzuwirken, weckten im Sommer 2021 die dramatischen Bilder vom Hindukusch wenigstens kurzzeitig unsere Aufmerksamkeit. In Afghanistan brach in wenigen Tagen zusammen, was wir im Bündnis über zwei Jahrzehnte mit aufgebaut hatten. Es bleibt eine Tragödie für die Afghanen, vor allem die Frauen und Mädchen, die unter unserem Schutz lernen durften, selbstbestimmt und selbstbewusst zu leben. Für die westliche Welt ist es ein Einschnitt, der unser Selbstverständnis erschüttert hat.
Mit dem Anspruch, Afghanistan nach unseren Vorstellungen und Werten umzugestalten, sind wir brutal gescheitert. Diesen Kampf konnten wir nicht gewinnen. Und es fiel uns sogar schwer, wie die hochriskante Rettungsaktion der Bundeswehr zeigte, der Niederlage gewachsen zu sein. Diese Erfahrungen lehren Demut, und sie fordern von uns, zurückhaltender in unseren Erwartungen und in der Einschätzung unserer Möglichkeiten zu werden. So wie wir angesichts der Katastrophe in der Ukraine, mit der der Krieg zurück in Europa ist, auch nicht von unserem Auftrag abrücken dürfen, den Frieden in der Welt mit zu sichern. Im globalen Wettbewerb der Systeme wird der Autoritätsverlust des Westens brutal ausgenutzt. Deshalb müssen wir im Bündnis schnell überzeugende Antworten finden, wie wir gegenüber der autoritären Anmaßung bestehen und auch in der neuen Weltunordnung unseren universellen Werten Geltung verschaffen wollen. Gerade wir Deutschen müssen nun erst wieder lernen, dass der Friede die Fähigkeit voraussetzt, sich verteidigen zu können. Dazu brauchen wir ein entschlossenes Bündnis Europas mit unseren amerikanischen Partnern. Dieses Buch ist deshalb ein Plädoyer für eine Europäische Union, die nicht nur mit dem Gewicht des weltgrößten Binnenmarktes einen aktiven Beitrag dazu leistet, die gewaltsame Eskalation von Konflikten zu verhindern.
Als Staatengemeinschaft von Demokratien hat die Europäische Union dabei zugleich globale Maßstäbe für ein gerechtes Miteinander zu setzen – für den Klimaschutz und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, für das Primat der Politik gegenüber einer globalisierten Ökonomie, für die Entwicklung der ärmeren Regionen und die politische Stabilisierung an der Peripherie Europas, nicht zuletzt in Afrika. Dass wir uns bei der Frage, wie wir stabile Verhältnisse schaffen, um Entwicklung nachhaltig befördern zu können, auch nicht darum drücken können, über militärische Interventionen zumindest zu diskutieren, mahnte der britische Entwicklungsökonom Paul Collier bereits vor einigen Jahren nachdrücklich an. Und der ist beileibe kein rechter Falke. Diese Frage stellt sich auch und gerade uns Deutschen. Sie ist unbequem, aber unausweichlich.
Inflation – Gefahr für die soziale Stabilität
Zu den besorgniserregenden Entwicklungen gehört schließlich die ausufernde Verschuldung und rasant gestiegene Inflation, die längst nicht nur deutsche Sparer empfindlich trifft. Der Staat muss wegen seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung ständig die Konjunktur mit beeinflussen, nicht nur in Krisenzeiten. Im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz ist das angelegt. Es braucht die richtige Balance, aber sie gelingt uns derzeit offenkundig nicht. Die zur Bekämpfung der Pandemiefolgen aufgelegten Konjunkturprogramme, darunter der gigantische EU-Wiederaufbaufonds, waren richtig, und ich habe sie von Anfang an unterstützt. Viele von denen, die sich dabei gerne auf John Maynard Keynes berufen, übersehen aber, dass der britische Ökonom zugleich eindrücklich vor den Gefahren der Inflation gewarnt hatte – weil sie die größte Gefahr für soziale Gerechtigkeit sei und damit das Potential habe, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden.
Die aktuelle Preisentwicklung ist nicht von den Energiekosten und den pandemiebedingten Problemen in den Lieferketten zu trennen. Längst mehren sich aber Anzeichen für eine Inflationsspirale, und es bestärkt nicht gerade mein Vertrauen in die Ökonomen, wenn diese nun nach und nach von ihren rosigen Wirtschaftsprognosen und Versprechen abrücken, dass sich das Inflationsgeschehen in Europa zügig auf das angestrebte Maß reduzieren werde – zumal Lieferschwierigkeiten als plausible Begründung für die derzeitigen Preissteigerungen die Frage provoziert, wie dann ausgerechnet zusätzliche staatliche Ausgaben diese ausgleichen sollen? Bei verringertem Angebot die Nachfrage künstlich zu erhöhen, bedeutet nach dem Grundsatz, dass Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen, doch das genaue Gegenteil davon.
Dieses Buch ist demgegenüber eine Streitschrift, zur geldpolitischen und fiskalischen Normalität zurück zu finden. Wachstum entsteht durch mehr und bessere Arbeit, wird bestimmt von Demografie und workload, Produktivität und Innovation. Wir brauchen deshalb ordnungspolitische Regeln, denn politische Verantwortungsträger geben im Zweifel der kurzfristigen Staatsverschuldung immer Vorrang, die so viel leichter zu haben ist als langwierige Haushaltskonsolidierung. Die allzu bequeme Verschuldungspolitik in der EU ist auch deshalb falsch, weil der Europäischen Zentralbank dabei eine aktive politische Rolle zugewiesen wird – in einem Teufelskreis: Sie soll die Versäumnisse der Nationalstaaten ausgleichen und ermöglicht den Regierungen damit gleichzeitig, nicht zu tun, was sie ordnungspolitisch tun sollten.
Brüssel könnte stattdessen das Schuldenproblem politisch in den Griff bekommen und so auch die EZB entlasten, wenn es selbst Regeln setzt, die die Mitgliedsländer dazu zwingen, entweder weniger Schulden zu machen oder mehr Wachstum durch steigende Produktivität zu generieren. Die Geschichte lehrt, dass es einer »mixed strategy« aus Fördern und Fordern bedarf, weil Mitglieder in einem Staatenbund zu leicht der Versuchung erliegen, sich auf Kosten der Gemeinschaft zu verschulden.
Politik braucht Wahrhaftigkeit
Angesichts dieser dramatischen Ereignisse und Entwicklungen hat sich der Wahlkampf im vergangenen Jahr zu keinem Moment auch nur annähernd auf Höhe der Herausforderungen bewegt – was nicht allein den Parteien anzulasten ist, sondern auch einer medialen Öffentlichkeit geschuldet war, die kopierten Textpassagen und einem verunglückten Lachen im falschen Augenblick mehr Bedeutung zumaß, als künftigen Verantwortungsträgern Lösungsvorschläge auf die drängenden Fragen der Zeit abzufordern. Richard von Weizsäcker hatte seinerzeit gewarnt, Parteien seien »machtversessen auf den Wahlsieg und machtvergessen bei der Wahrnehmung der politischen Führungsaufgabe«. Was mir zeitgenössisch als zu hartes Urteil schien, erscheint jedenfalls unter den Bedingungen einer zunehmend demoskopisch getriebenen Stimmungsdemokratie beklemmend aktuell. Und es schmerzt mich, dass dieser Vorwurf im Wahljahr gerade auch auf meine Partei zutraf.
Politische Führung verlangt den Blick für die wirklich großen Aufgaben und die Fähigkeit, die öffentliche Wahrnehmung darauf zu lenken. Dazu muss eine Partei bereit sein, den Menschen etwas zuzumuten. Nicht nur Antworten geben, die gern gehört werden, sondern Lösungen entwickeln und zur Diskussion stellen – für die Aufgaben, die sie selbst als drängend erachtet. Um die Bürger davon zu überzeugen. Am Mut und am Willen dazu fehlte es der Union zuletzt erkennbar – und sie ist nach dem Wahldebakel gut beraten, unter neuer Führung diese inhaltliche Leerstelle nach sechzehn Jahren an der Macht zu füllen.
Wir sollten klar sagen, dass die notwendigen Schritte, mit denen wir Deutschland zukunftsfähig halten können, allen etwas abverlangen werden. Den Eindruck zu erwecken, die anstehenden strukturellen Veränderungen, um unseren Wohlstand nachhaltig zu sichern, beträfen den Einzelnen nicht, ist nicht die Wahrheit. Die Menschen können die Wahrheit aber ertragen, Ehrlichkeit schadet nicht. Im Gegenteil: Nur darauf kann Vertrauen wachsen.
Und nur so stärken wir das repräsentative Prinzip, für das ich mehr denn je werbe. Das Parlament ist der Ort, an dem die Vielfalt an Meinungen offen zur Sprache kommen muss, gerade weil in unserer Gesellschaft die Bereitschaft immer weiter sinkt, gegensätzliche Standpunkte auszuhalten oder Widerspruch überhaupt zuzulassen. Weil der Drang nach Konformität in der Gruppe wächst, um von sich fernzuhalten, was dem eigenen Empfinden und Denken widerspricht.
Die Lebenswelten in unserer Gesellschaft sind inzwischen so vielfältig und unterscheiden sich so drastisch voneinander, dass wir kaum mehr in der Lage sind, diese grundverschiedenen Lebenswirklichkeiten noch zusammenzubringen. Verloren geht im Zusammenspiel mit dem Medienwandel durch neue Kommunikationstechnologien das, was die Grundlage jeder Demokratie ist: eine gemeinsame Öffentlichkeit.
Gerade deshalb müssen wir uns bemühen, den Gedanken der Repräsentation zu stärken – und damit das Parlament als Ort der Fokussierung und der Bündelung. Der Bundestag hat nicht etwa repräsentativ die gesellschaftliche Vielfalt prozentual abzubilden, quasi als ein exaktes Spiegelbild der Bevölkerung. Es wäre ohnehin unmöglich, denn wo anfangen und wo aufhören? Trotzdem ist es ein verbreitetes Missverständnis. Gewählte Repräsentanten werden aber nicht als Angehöriger einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe ins Parlament entsandt, sondern weil sie mehrheitlich als am besten geeignet für diese Aufgabe erscheinen. Wir täten überhaupt gut daran, Personalentscheidungen weniger nach Proporzgedanken, sondern nach Leistungsstärke zu treffen.
Das ist Anspruch und Selbstverständnis der repräsentativen Demokratie: Jeder Abgeordnete, ob Frau, Mann oder divers, ob jung oder alt, ob Wissenschaftler oder Arbeiter, ob aus der Stadt oder einem ländlichen Raum, ob hier geboren oder zugewandert, jeder muss sich selbst als Vertreter des ganzen Volkes verstehen und immer, auch wenn er die legitimen Interessen seiner Wähler und Partei vertritt, das Gemeinwohl im Blick behalten. Dazu verpflichtet Artikel 38 Grundgesetz, und es würde in eine völlig falsche Richtung führen, wenn die Verantwortung des Einzelnen für das Ganze verdrängt würde von der Auffassung, dass nur der Angehörige einer Gruppe deren Interessen vertreten könnte. Dann käme man nicht mehr zu gemeinsamen Entscheidungen, sondern würde einer sehr volatilen Diktatur von Minderheiten Vorschub leisten.
Unsere repräsentative Demokratie beruht auf der politischen Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger – ohne Rücksicht auf ihre soziokulturellen Merkmale. Gewählte Repräsentanten vertreten die Repräsentierten eben nicht durch ihre Person, sondern durch ihre Politik. Durch sie sollten alle Menschen politisch Gehör finden und in ihr sollte sich die gesellschaftliche Vielfalt abbilden.
Deshalb haben sich Parteien immer wieder zu hinterfragen, ob sie der Pluralität an Interessen und Meinungen genügend Gehör verschaffen. Es ist in ihrem eigenen Interesse, die Veränderungen in unserem Land mit zu vollziehen und – das geht nicht zuletzt an die Adresse meiner Partei – aktiv mit Inhalten um Frauen zu werben, um Zugewanderte, Jüngere, Enttäuschte. Die Zukunft der parlamentarischen Demokratie hängt von der Erneuerungskraft der Parteien ab. Sie werden ihrer Aufgabe zur politischen Willensbildung nur gerecht, wenn sie sich auf die individualisierte Gesellschaft und den grundlegenden Strukturwandel der digitalisierten Öffentlichkeit einstellen – und dabei ihre Kernklientel mitnehmen.
Dazu braucht es neue, attraktive Formen des Engagements, die Partizipation und Repräsentation in Einklang bringen, die Bürger in die Parteiarbeit einbinden, ohne die Verantwortung durch Mitgliederentscheide und Urwahlen an die Basis abzuschieben. Solange das repräsentative Prinzip bei der Besten-Auswahl funktioniert, ist es auch innerhalb von Parteien in jeder Beziehung dem Mitgliederentscheid vorzuziehen. Gelingt das jedoch nicht, gehen – wie 2021 erlebt – Mehrheiten verloren, und dann kann eine Partei vorübergehend auch einen anderen Wege einschlagen, um sich neu aufzustellen.
Umfragen sollten politische Führung gleichwohl nie ersetzen. Demokratie geht nicht ohne Führung. Wenn Politik nur noch auf Stimmungen abzielt, kann das auch in Populismus abgleiten. Und wohin das führen kann, sehen wir in anderen westlichen Demokratien in verschiedener Ausformung. Deshalb, auch wenn das aktuell unpopulär erscheint, trete ich weiterhin dafür ein, dass wir gerade in einer Zeit, in der die Veränderungen so groß und so schnell sind und Stimmungen so volatil, Strukturen brauchen, die eine gewisse Stabilität geben.
In der Stimmungsdemokratie wird die Herausforderung für den Politiker nur noch größer, eine eigene Haltung mit festen Überzeugungen zu vertreten. Und sie wird wichtiger denn je. Hüten wir uns gleichzeitig vor der Versuchung, als Politiker alles regeln zu wollen – und als Bürger von der Politik alles zu erwarten. Politik weiß auch nicht alles besser. Wenn Politik meint, sie habe keine Grenzen, ist das mindestens genauso gefährlich wie wenn andere glauben, sie seien keinen Begrenzungen unterworfen. Die Voraussetzung unserer freiheitlichen Ordnung ist, dass sie begrenzt ist. Diese Prämisse meines Denkens, die den Überlegungen in diesem Buch zugrunde liegt, scheint mir nur noch wichtiger geworden zu sein.
Offenburg, 24. Februar 2022
Politische Grenzerfahrungen – und warum wir sie nicht fürchten müssen
Leben heißt Veränderung – und ich weiß, was das bedeutet. Etwas Vergleichbares habe ich in fünfzig Jahren Politik dennoch nicht erlebt. Als im Frühjahr 2020 in vielen Ländern ein Lockdown angeordnet wurde, stand für einen Moment die Welt still. Scheinbar. In Wahrheit verändert die Pandemie unser Leben rasant. Wer heute noch einmal eine Zeitung vom Jahresanfang 2020 in die Hand nimmt, wird sich über die damaligen Themen wundern und staunen angesichts einer Berichterstattung über ein Virus, das zwar gefährlich erschien, aber doch sehr weit weg.
Auch heute glauben noch immer Menschen, die Veränderung unserer Gewohnheiten sei eine allenfalls vorübergehende Erscheinung und bald werde alles wieder genauso sein, wie es vor Corona war, als man sich in der Familie und mit Freunden sorglos traf, zwanglos in Restaurants und Bars, entspannt im Konzert, Theater, Kino, feiernd in Klubs oder Stadien. Mit Urlaub in fernen Ländern, ohne Abstandsregel, Maskenpflicht und Quarantäne.
Bei allen Unwägbarkeiten, die mit dem Virus verbunden sind, ist eines sicher: Die globale Pandemie bedeutet eine Zäsur. Aber wird die Welt sich grundlegend wandeln? Die Ansichten darüber gehen auseinander. Für die einen dominiert die Natur des Menschen mit ihren Beharrungskräften. Mir ist die Überlegung des litauischen Schriftstellers Marius Ivaškevičius im Gedächtnis geblieben, der sich beim Satz »Die Welt wird nie mehr so sein, wie sie war« an frühere einschneidende Ereignisse erinnert fühlte. Danach habe es zwar tatsächlich Veränderungen gegeben, die Welt sei aber letztlich geblieben, wie sie gewesen ist. »Der Mensch ist ein zu träges Geschöpf, als dass er einfach gebremst werden könnte«, lautete sein illusionsloses Fazit in der FAZ. »Er ist das lebendigste aller Viren dieses Planeten.«
Also bleibt tatsächlich alles gleich, nur eben anders? Andere Stimmen betonen indes, trotz vielfach herbeigesehnter Rückkehr zur Normalität spräche wenig dafür, dass das Danach dem Davor gleichen würde. Die Normalität vor dem Corona-Virus werde nicht die Zukunft nach der Pandemie sein.
Covid-19 treibt uns durch eine steile Lernkurve und viele Lektionen werden bleiben. Das betrifft die sozialen Beziehungen in der Gesellschaft genauso wie das Verhältnis der Staaten untereinander, den globalen Wettbewerb der Systeme. Und es betrifft ganz grundsätzlich das spannungsreiche Verhältnis zwischen dem Sicherheitsbedürfnis und dem Freiheitsdrang des Menschen, die konfliktbehaftete Abwägung zwischen Lebens- und Gesundheitsschutz einerseits und ökonomischen wie kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten anderseits.
Wir lernen gerade erst, mit dem Virus zu leben, und realisieren, dass wir uns gegen vergleichbare Bedrohungen besser wappnen müssen. Covid-19 werde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass wir unsere Anstrengungen zum Schutz des menschlichen Lebens noch verdoppeln, prognostiziert Yuval Noah Harari mit der Gelassenheit des Historikers, der in seinen Studien regelmäßig die Menschheitsgeschichte durchschreitet. Die vorherrschende kulturelle Reaktion auf Covid-19 sei keine Resignation, sondern eine Mischung aus Empörung und Hoffnung.
Harari, dessen packende Analysen der Vergangenheit mich ebenso faszinieren wie seine nüchtern-technoziden Zukunftsvisionen bisweilen befremden, sieht das Grundvertrauen der Menschen in die Wissenschaft, das Leben zu verlängern, ungebrochen; es unterscheide unsere Welt von der vormodernen Zeit, als der Tod als unausweichliches Schicksal und Ursprung für den Sinn des Lebens gegolten habe. Wenn allerdings die Pandemie, wie auch Harari annimmt, gleichzeitig die Sensibilität des Individuums für seine Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit schärfen würde, wäre das für den modernen Menschen mit seinem Hang zur Hybris und für das Überleben der Spezies sicher nur von Vorteil.
Wir erleben derzeit unsere Verwundbarkeit – die eigene und die der Systeme, in denen wir uns bislang so selbstverständlich bewegt haben. Die Welt, wie wir sie kannten, und unser Grundvertrauen auf eine bessere Zukunft sind gründlich erschüttert. Der bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev, mit dem ich mich für dieses Buch zum Gespräch getroffen habe, prognostiziert, die Welt werde eine andere sein, nicht weil unsere Gesellschaften einen Wandel wollten oder weil ein Konsens über die Richtung des Wandels bestände, sondern weil eine Rückkehr unmöglich sei. Das entbindet uns nicht von unserer Gestaltungsaufgabe.
Im Gegenteil: Wenn wir jetzt handeln und die Weichen richtig stellen, können wir Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit korrigieren, um widerstandsfähiger zu werden. Was für eine Welt dann tatsächlich am Ende der gegenwärtigen Krise stehen wird, können wir noch nicht absehen. Aber ob diese Krise einen disruptiven Charakter annimmt, indem wir neue, innovative Wege beschreiten, und damit diese Welt ein Stück weit besser machen, liegt in einem erheblichen Maße an uns. An unseren Zielvorstellungen und an unserer Fantasie sowie Tatkraft, diese Ziele zu erreichen, kurz: an unserem Gestaltungswillen!
Nach einem Jahrzehnt unterschiedlicher krisenhafter Zuspitzungen sind wir gewohnt, unsere Gegenwart als Krise zu beschreiben. Der Ausnahmezustand scheint zur Regel geworden zu sein. Die Bedrohung durch das Corona-Virus unterscheidet sich allerdings von den vorangegangenen Herausforderungen. Sie ist ein planetares Ereignis und bedroht jeden Menschen. Covid-19 ist nicht die erste Pandemie, mit der es die Menschheit zu tun hat. Aber sie ist die erste, die wir durch die modernen Kommunikationsmittel als wirklich globales Phänomen wahrnehmen. In den Demokratien des Westens hat sie erhebliche Freiheits- und Grundrechtsbeschränkungen ausgelöst und sie macht erhebliche staatliche Eingriffe in das soziale und wirtschaftliche Leben notwendig. Die ganze Welt kennt plötzlich ein gemeinsames Thema, und obwohl wir in der Bewältigung der Krise in vielem auf uns selbst zurückgeworfen sind, ist unser Blick kosmopolitischer geworden. Oder haben wir uns vorher ähnlich leidenschaftlich mit Fragen des Datenschutzes oder des Gesundheitswesens in Südkorea, Brasilien, Schweden befasst?
Die Corona-Pandemie lehrt Demut. Wir Deutschen wähnten uns vor vielen globalen Gefahren in relativer Sicherheit, unser Wohlstand schien garantiert. Plötzlich sehen wir uns nicht nur mit einer rätselhaften, sich ausbreitenden und tödlichen Krankheit konfrontiert, sondern in ihrer Folge auch mit der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Weltweit brach die Wirtschaftsleistung ein, globale Lieferketten wurden unterbrochen, Arbeitsplätze und damit die Existenzgrundlage von Millionen Menschen sind verloren gegangen. Jetzt erinnern wir uns daran, dass Microsoft-Gründer Bill Gates schon vor Jahren mahnte, er fürchte nicht so sehr einen Krieg als eine Pandemie. Damals dachten die meisten von uns: Das wird nie eintreten, das ist doch allenfalls Stoff für Horrorfilme. Heute geißeln Verschwörungstheoretiker den Propheten – und wir alle müssen uns eingestehen, dass wir besser auf ihn gehört hätten.
Die erschreckenden Bilder von Bergamo, die Berichte von Vorrangentscheidungen über Leben und Tod wegen fehlender Intensivbetten im Elsass haben uns an die Grenzen dessen geführt, was wir ethisch vertreten können. Nicht anders die zwischen den Generationen hochemotional geführte Debatte über das Dilemma in der Pandemie, Leben schützen zu wollen und dafür zwangsläufig andere Grundrechte einschränken zu müssen.
Dem gegenüber stehen erstaunliche Erfahrungen neuer gesellschaftlicher Solidarität. In der Isolation gewann menschliche Nähe neuen Wert, innerhalb der Familien, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft. Mit der Krise verbinden sich, etwa bei plötzlich als systemrelevant erkannten Berufen, neu gewonnene Einsichten in soziale Schieflagen – und auch in Übertreibungen der Globalisierung, die wir zuvor mehrheitlich für die Normalität hielten und die zum Ausmaß der Pandemie überhaupt erst beigetragen haben. Selbst wenn die Gesundheitskrise zwischenzeitlich fast alles andere dominierte, schärft die existenzielle Bedrohung unser Bewusstsein für den Schutz der menschlichen Lebensgrundlagen – zumal die Wissenschaft nahelegt, dass es einen Zusammenhang zwischen Klimawandel, dem Raubbau an der Natur mit dem Verlust an Artenvielfalt und dem Risiko von Pandemien gibt.
Die Corona-Krise stellt also mit ihren Folgen für unsere Art, zu leben und zu wirtschaften, viele unserer Gewissheiten infrage und gefühlte Selbstverständlichkeiten auf den Kopf. Sie bedeutet eine Art kollektive Grenzerfahrung, in dem sie Knappheiten aufzeigt und uns dadurch Wertigkeiten neu oder anders bestimmen lässt.
Das ist der Ausgangspunkt für dieses Buch und führt zu einem Leitgedanken, der den hier versammelten Essays und Gesprächen zugrunde liegt: Begrenzung ist für mich eine Bedingung menschlicher Existenz und Knappheit nicht nur ökonomisch Grundlage für Wertbildung und Wertschätzung. Überfluss führt zur Vernachlässigung. Ich bin überzeugt, dass uns im Schlaraffenland die gebratenen Tauben ganz schnell aus dem Hals heraushängen würden. Es muss die richtigen Anreize geben. Das hat mit dem Menschen zu tun, wie er geschaffen ist. Je höher das hängt, was wir begehren, umso mehr strecken wir uns danach. Fehlt der Ansporn, werden wir bequem. Selbstzufriedenheit, neudeutsch: Complacency, tritt ein, wenn uns gesellschaftlich die Balance zwischen Fördern und Fordern verloren geht. Wenn Menschen nichts mehr abgefordert wird, erscheinen auch Probleme immer größer – weil das Selbstvertrauen in die eigene Gestaltungskraft schwindet.
Menschen sind befähigt zu Großem, und sie machen schlimme Fehler. Wir brauchen deshalb Regeln, um frei sein zu können. Das ist mein Verständnis wertgebundener Freiheit, die auf Grenzen angewiesen ist. Nicht um einzuengen, sondern um Halt zu geben. Die Frage nach den Grenzen, die wir benötigen, und denen, die es zu überwinden gilt, stelle ich in diesem Buch immer wieder. Erst aus dem Spannungsverhältnis zwischen dem Drang, Grenzen zu überwinden oder zu verschieben, und der Notwendigkeit, Grenzen zu setzen, ergibt sich menschlicher Fortschritt.
Freiheit und ihre Grenzen: In diesem Spannungsfeld sehe ich die Antworten auf die enormen Herausforderungen, die durch die Corona-Pandemie nur verschärft werden. Denn ich glaube nicht, dass wir weitermachen sollten wie vor der Krise. Im Gegenteil. Die Spätmoderne, in der wir leben, sei eine Moderne radikaler Entgrenzung, sagt der Soziologe Andreas Reckwitz. Und er moniert rückblickend zu Recht, die Politik habe, statt regulierend und stabilisierend zu wirken, also dem Rad der Entwicklung auch einmal in die Speichen zu greifen, die Prozesse von Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung selbst immer noch weiter beschleunigt.
Die Pandemie zeigt nun gnadenlos dort die Grenzen auf, wo wir in den vergangenen Jahrzehnten deregulierend vieles übertrieben haben, wo das unglaubliche Schwungrad des Kapitalismus und der Finanzmärkte überdreht ist – auf Kosten der Resilienz, des Klimas und der Artenvielfalt sowie des sozialen Zusammenhalts. Darin liegt auch Erklärungspotenzial für den ambivalenten Befund, dass Menschen, die sich von der leidvollen Corona-Krise nicht existenziell bedroht sahen, die Entschleunigung zwischenzeitlich durchaus auch als persönlichen Gewinn erleben konnten. Dass sie die Zeit, die sie mehr für sich oder in der Familie hatten, nicht weniger glücklich machte als die alltägliche Hatz in einem Leben des Überflusses. Glück ist eben relativ und social distancing manchmal Anlass, Nähe wieder oder neu zu erfahren. Das Corona-Virus zeigt uns unsere Grenzen auf und erinnert uns daran, dass wir als soziale Wesen auf Beziehungen zu anderen angewiesen sind, auf menschliche Kontakte, auf Gemeinschaft. Damit lenkt es unseren Blick auf die Verantwortung, die wir alle tragen, jeder für sich selbst, aber eben auch für die anderen.
In der Hochphase der Pandemie haben wir erlebt, wie im Ausnahmezustand der Fokus der Öffentlichkeit auf nur einem Thema liegt. Die großen deutschen TV-Sender füllten der Fernsehprogrammforschung von ARD und ZDF zufolge mehr als die Hälfte der Sendezeit ihrer Nachrichten mit Beiträgen zur Covid-19-Pandemie. Das war kaum anders bei der Finanzkrise, bei der Flüchtlingskrise und zuletzt der Klimakrise. Die Liste ließe sich fortführen. Auf der Strecke bleibt die Komplexität der Herausforderungen, vor allem ihre Interdependenz.
Deshalb ist die Corona-Krise in diesem Buch nur der Ausgangspunkt, von dem aus ich mich mit Herausforderungen und Themen noch einmal intensiv befasse, die mich politisch seit Jahren begleiten. Die Pandemie gibt nicht nur Anlass dazu, das Verlorengegangene oder Verdrängte wieder wertschätzen zu lernen. Ihre Bewältigung birgt auch die Chance, durch tiefgreifende Veränderungen eine neue gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Dynamik zu entfachen.
Wie wir in diesem Sinne an der Krise wachsen können – davon handelt dieses Buch. Viele bekannte Probleme zeigen sich in verändertem Licht, es stellen sich Fragen anders und sie fordern neue Antworten. Wir werden zu einer Neujustierung unseres Denkens und Handelns gezwungen: in unserem Verhältnis zueinander, in Bezug auf die Globalisierung und die allumfassende Digitalisierung unserer Lebenswelt genauso wie mit Blick auf nationale Identität, europäische Integration und die Bedeutung westlicher Werte im globalen Wettbewerb der Systeme. Vor allem bei der Suche nach dem besten Weg zu einem technologiefreundlichen, nachhaltig-innovativen Wirtschaften, das dem Menschen gemäß und dem Schutz des Klimas und der Artenvielfalt verpflichtet ist – und dabei Grundregeln des verantwortungsvollen Umgangs mit begrenzten finanziellen Ressourcen wahrt.
Freiheit und Wohlstand sind nicht voraussetzungslos. Mit der Frage, wie wir in der globalisierten Welt beides bewahren, verbinden sich für unsere Gesellschaften unbequeme Debatten – und für politische Verantwortungsträger die Aufgabe, diese mit anzuregen, auszuhalten und am Ende auch womöglich unpopuläre Entscheidungen nicht zu scheuen. Dazu möchte ich mit diesem Buch ermuntern. Stärken wir die Bereitschaft zur Veränderung – ohne gleich alles infrage zu stellen. Wählen wir nicht Radikalität, sondern besinnen wir uns auf die Fähigkeit, bestehende Interessenunterschiede in der offenen Gesellschaft auszubalancieren. Das setzt die Bereitschaft voraus, dem Gegenüber die gleiche Freiheit zuzugestehen, die ich selbst beanspruche, und die Einsicht, dass verschiedene Meinungen und Grundhaltungen nötig sind, um gesellschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen.
Es kann in der Demokratie keinen Exklusivitätsanspruch einer einzigen Denkrichtung geben, von wie vielen auch immer sie vertreten wird. Im politischen Alltag fehlt es allerdings häufig an Offenheit und Toleranz, hier läuft bisweilen der Meinungsstreit aus dem Ruder. Die plurale Gesellschaft wandelt sich, und die Erfahrung zeigt, dass kein Akteur im Voraus weiß, was gut für alle ist. Niemand trifft Entscheidungen für immer. Einschätzungen können sich im Laufe der Zeit überleben oder als falsch erweisen. Aber die Demokratie erlaubt Fehlerkorrekturen, das macht sie und die offene Gesellschaft menschlicher als jede andere Ordnung.
Ich lasse mich in diesem Buch deshalb von einer Grundprämisse westlichen Denkens leiten: von der Bereitschaft zu kritischer Selbstreflexion – und von der Lust an der kontroversen Debatte. Meine in sieben Essays gefassten Überlegungen zu Grundlagen unserer politischen Ordnung und den großen Zukunftsthemen, denen wir heute gegenüberstehen, stelle ich im Gespräch mit Intellektuellen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Diskussion. Es sind alles Experten auf ihrem Gebiet, deren Arbeiten mich fasziniert und inspiriert haben oder zum Widerspruch reizen. Mir geht es dabei nicht um fertige Lösungen. Vielmehr möchte ich Politik als Denkprozess erkennbar, die Bandbreite an legitimen Sichtweisen und Argumenten sichtbar und – im Idealfall – die Freude an der lebhaften Diskussion nachvollziehbar machen. Ich möchte zu Rede und Gegenrede einladen, zu einer leidenschaftlichen und sachbezogenen Debatte, wie sie auch das Parlament führen sollte.
Vor allem möchte ich mit der Erfahrung eines politischen Lebens, das persönliche Tiefschläge ebenso kennt wie überwundene politische Krisen, dazu ermutigen, an die eigene Gestaltungsfähigkeit zu glauben. Denn wir brauchen Zuversicht. Fatalismus ist für einen Politiker keine Option. Läge alle Macht beim Schicksal, wäre Politik zwecklos. Ihr Grund liegt im Gestalten. Die Vorstellung von einem allmächtigen Schicksal oder vermeintlich übermächtigen Lenkern ist so falsch wie gefährlich. Sie ist unvereinbar mit dem Bild vom Menschen, auf dem unsere Gesellschaft gründet, und sie widerspricht den leitenden Prinzipien: Freiheit, Selbstbestimmung und, daran anknüpfend, Verantwortlichkeit.
Machen wir uns nicht kleiner, als wir sind. Wir haben keinen Grund zu verzagen. Wir können die Wirklichkeit nicht beliebig nach unseren Wünschen konstruieren, aber wir können sie verändern – und das sollten wir. Als Individuen und als Gesellschaft. In der Politik ist dies oft mühselig, selten spektakulär und meist nicht im umfassenden Sinne zufriedenstellend. Aber es ist in einer freien, offenen, vielfältigen Gesellschaft der einzige Weg zwischen irrationalem Wunschdenken und düsterem Fatalismus.
Die Zukunft ist offen, auch wenn sich das Heute darin fortschreibt. Manchmal spielt uns das Schicksal in die Hände, und das völlig Unerwartete macht das Erhoffte plötzlich möglich. Der Politik bleibt es dann überlassen, die Möglichkeiten, die sich überraschend bieten, zu erkennen und zu nutzen, das Schicksal beim Schopfe zu packen. Der Fall der Mauer war eine solch glückliche Fügung für die Deutschen, auch wenn er viele Mütter und Väter hat, die über Jahre und Jahrzehnte auf die Überwindung der deutschen Teilung hingewirkt haben – auf der einen Seite der Grenze unter hohem persönlichem Risiko, auf der anderen gegen den Mainstream derer, die sich an die Zweistaatlichkeit längst gewöhnt hatten.
Glück ist indes selten eine Kategorie der Politik, und es wäre zynisch, in der Corona-Pandemie eine glückliche Fügung zu erkennen. Das Virus ist eine Zumutung – doch es hilft nicht, bloß zu lamentieren. In der Bewältigung der Krise liegt auch eine Chance, jedenfalls dann, wenn wir die Aufgabe annehmen und jetzt Entscheidungen treffen, die zuvor nicht realistisch waren.
Wir können dabei nicht wissen, was noch auf uns zukommt. Die Menschen, die 1989 in der DDR auf die Straße gingen, wussten auch nicht, was passieren würde. Es gab damals Hoffnungszeichen, nicht zuletzt durch die Reformversuche Michail Gorbatschows in der Sowjetunion als Folge der im Westen zuvor so heftig umkämpften Nachrüstungspolitik. Dennoch konnte niemand ernsthaft voraussehen, dass am 9. November die Mauer fallen würde, friedlich, ohne einen einzigen Schuss. Und für den Weg zur staatlichen Einheit binnen eines Jahres gab es auch keine Vorlage. Wie hätte es unter den Bedingungen des Kalten Krieges anders sein können? Aber als sich die Chance bot, haben wir Deutschen sie beherzt ergriffen!
Wir können auch heute optimistisch sein, indem wir nicht allein darüber reden, was es abzuwehren gilt und was wir verlieren könnten, sondern mehr auf die Möglichkeiten blicken, die wir haben. Darauf, was wir in dieser Krise erreichen wollen. Konflikte und Krisen wirken produktiv, indem sie das Gefahrenbewusstsein schärfen, zur Verständigung und Selbstverständigung zwingen. Sie können den Weg bahnen zu neuen Instrumenten, zu neuen Allianzen, um die Zukunft zu gestalten. Sie bieten das Potenzial dafür, überkommene Traditionen, gesellschaftliche Verkrustungen und nationale Selbstblockaden aufzubrechen.
Das beginnt mit der Einsicht, dass auch vor dem Corona-Virus nicht alles in Ordnung war – und mit dem Willen, eine neue Weltordnung nach der Pandemie aktiv mitzugestalten. Winston Churchill sagte: Verschwende niemals eine gute Krise. Die Erfahrung gibt ihm recht. Je besser die Lage, umso größer ist die Trägheit. Ohne den Druck von Krisen ist die Bereitschaft zu Veränderungen zu gering. Jetzt erleben wir eine Krise, wie wir sie uns niemals vorstellen konnten und wie wir sie auch nicht noch einmal erleben wollen, in der aber manches möglich wird, was zuvor undenkbar schien. Das können wir nutzen, um voranzukommen.
Deutschland erlebt mitten im erzwungenen Stillstand in vielen Bereichen eine ungeahnte Beweglichkeit. Jahrelang wurde die Online-Sprechstunde skeptisch beäugt, jetzt ist sie Realität und erweist sich als sinnvolle Ergänzung im alltäglichen Praxisbetrieb. Unternehmen realisieren in Windeseile den lange gehegten und immer wieder verschobenen Plan, auf das digitale Büro umzustellen – und machen die Erfahrung, dass sich auf manche zeitraubende Dienstreise verzichten lässt. Selbst die öffentliche Verwaltung zeigt vielfach ungeahnte Flexibilität. Freiberufler und Soloselbstständige staunen, dass »unbürokratische Soforthilfe« tatsächlich bedeuten kann, dass ein online gestellter Antrag genügt und das Geld am nächsten Tag auf dem Konto eingeht. Innerhalb weniger Wochen wurde ein Corona-Krankenhaus errichtet, ohne dass es sich im Gestrüpp des Genehmigungs- und Planungswesens verheddert hätte – und das ausgerechnet in Berlin, dessen Flughafen zum Sinnbild der deutschen Selbstblockade wurde.
Der Umgang mit dem Virus, das Unbekannte und Unabsehbare zwingt uns Deutsche dazu, trotz unseres sprichwörtlichen deutschen Perfektionsdrangs spontan zu reagieren. Und wir erleben: Das geht. Wir lernen, auch mit Unzulänglichkeiten umzugehen, mit dem Nichtperfekten zu leben. So ist der Mensch, so ist die menschliche Gesellschaft. In der Gelassenheit, die uns abverlangt wird, liegt eine Kraft, die uns bei vielen komplexen Herausforderungen voranbringen wird. Davon wird in diesem Buch immer wieder die Rede sein.
Deutschland ist im letzten Jahr in vielem über sich hinausgewachsen. Gerade die jüngere Generation, die sich an der Unbeweglichkeit in Politik, Gesellschaft und Verwaltung gestört hat, macht eine wertvolle Erfahrung: Wir müssen uns nicht an das Bestehende klammern! Wir können Bewährtes sichern und zugleich Neues wagen, auch auf die Gefahr hin, uns später korrigieren zu müssen.
Das kann uns nachhaltig aus der Saturiertheit befreien, in die wir in Jahrzehnten wachsenden Wohlstands und zunehmender Unbeweglichkeit teilweise geraten waren. Viele Menschen in unserem Land spüren, dass es Veränderung braucht. Wir stehen vor großen Aufgaben – das setzt Kräfte und Fantasie frei. Innovationen stärken das Vertrauen in unsere Gestaltungsfähigkeit, die Überzeugung, den Veränderungen gewachsen zu sein. Wir haben die Freiheit, die Welt, in der wir leben, besser zu machen, Großes leisten zu können. Darauf kommt es jetzt an.
1
Grenzenlos glücklich? Der Mensch zwischen Freiheit und Begrenztheit
Der Mensch braucht Grenzen. Wir bewegen uns in einer Ambivalenz: Wir streben nach Freiheit und brauchen zugleich Überschaubarkeit. Das Leben des Menschen in Grenzen beginnt mit der Vertreibung aus dem Paradies. Auch wer sich nicht in der Nachfolge von Adam und Eva sieht, wer nicht an die Auferstehung und das ewige Leben glaubt, kennt die menschliche Urerfahrung: Unser Leben ist endlich. Die Unendlichkeit liegt jenseits unserer Vorstellungskraft, weckt aber unsere Fantasie. Die Unendlichkeit ist ein Sehnsuchtsort: Wenn Goethes Faust seufzt, der schöne Augenblick möge verweilen, sperrt er sich gegen das Verrinnen der Zeit – natürlich vergebens. Wir Menschen sind von jeher fasziniert von der Vision, die Zeit anzuhalten, von Jungbrunnen oder Versuchen, das Sterben hinauszuzögern.
Obwohl wir heute länger leben und später sterben als frühere Generationen, nähren medizinisch-technische Entwicklungen weitere Allmachtsvorstellungen. Wir können inzwischen das Lebensende zwar hinausschieben, abschaffen können wir es nicht. Unsterblichkeit ist uns glücklicherweise nicht gegeben. Unser Leben ist in ständiger Veränderung. Dem können wir uns nicht entziehen, aber daran können wir wachsen.
Wir sind als Menschen zur Freiheit begabt, es ist uns aufgegeben, etwas aus unserem Dasein zu machen. Dabei verschieben sich je nach Alter, Erfahrung, persönlichem Umfeld und aktueller Lebenslage unsere Ansprüche. Die erste gute Note, die erste Goldmedaille zählen mehr als die folgenden. Was die Ökonomie als abnehmenden Grenznutzen kennt, ist eine menschliche Lebenserfahrung. Daraus entwickeln wir ein individuelles Lebenstempo, einen Ausgleich zwischen Beharren und immer neuen Herausforderungen, zwischen dem, was wir sind, dem, was wir wollen, und dem, was wir können.
Die Startbedingungen dafür sind unterschiedlich. Das liegt in der Situation begründet, in die wir hineingeboren werden, und in der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Das eine kann und sollte der Staat absichern, das zweite aber, die Entwicklung unseres Selbst, wird nicht allein von sozio-ökonomischen Bedingungen bestimmt, sondern liegt letztlich auch in unserer Hand.
Der Mensch ist ein soziales Wesen, abhängig von anderen, denn – in den Worten der Enzyklika Fratelli tutti von Papst Franziskus – »ohne ein breiteres Beziehungsgeflecht ist es nicht möglich, sich selbst zu verstehen«. So wie wir ohne unsere Eltern nicht auf der Welt wären, kämen wir ohne andere Menschen nicht weit. Das Bewusstsein, dass unsere eigene Freiheit dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt, prägt unser Leben – ob wir uns dessen bewusst sind oder ob nicht. Für das Zusammenleben gelten notwendigerweise Regeln, an die sich die Mehrheit der Menschen in einer Gemeinschaft halten – freiwillig in freien Gesellschaften, unter Druck in totalitären Systemen, in denen die universellen Menschenrechte verletzt und die bürgerlichen Freiheiten ignoriert oder eingeschränkt sind.
Regeln geben Halt, sie weisen uns den Weg, geben Orientierung, und vielleicht beruhigen sie uns auch. Regeln entspringen nicht allein der Logik oder der Vernunft, sie müssen vielmehr dem Menschen gerecht werden. Sie wandeln sich und funktionieren nur dann, wenn sie den Menschen in ihrer Zeit entsprechen, ihren Ansprüchen, Erfahrungen und Emotionen, wenn sie auf unsere Begrenztheit verweisen. Diesen Bezug zur Humanität brauchen wir gerade in einer komplexer werdenden Welt, in der Digitalisierung und Globalisierung scheinbar grenzenlosen Fortschritt möglich machen.
In der Demokratie funktioniert das Zusammenleben, wenn die Mitglieder einer Gesellschaft die für alle geltenden Regeln akzeptieren, wenn der Staat Verstöße ahndet und die Gesetze den sich wandelnden Bedürfnissen der Gemeinschaft fortlaufend angepasst werden – nicht zuletzt, um die Gefahren, denen die freie Gesellschaft ausgesetzt ist, abzuwehren. Karl Popper ermutigt uns dazu: »In der Demokratie besitzen wir den Schlüssel zur Kontrolle der Dämonen.« Wir müssen wachsam sein für diese Bedrohungen, die »Dämonen« identifizieren und bekämpfen, in welcher Gestalt sie auch immer daherkommen. Eine starre Gesellschaftsordnung, die an überkommenen Konventionen festhält, verliert Legitimität und Akzeptanz.
Freie Gesellschaften haben die Beweglichkeit, Regeln zu hinterfragen und die alte Ordnung an neue Erwartungen anzupassen. Die mühsam erstrittene Gleichberechtigung der Frau oder inzwischen garantierte Minderheitenrechte sind Beispiele dafür, wie sich das Verständnis der Gesellschaft gewandelt hat und neue Normen und novellierte Gesetze diesen Wandel widerspiegeln. Sie zeigen auch, wie quälend langsam gesellschaftlicher Fortschritt sich entwickelt und wie lange es dauert, bis eine Gesellschaft reif ist, Grenzen zu verschieben. Aber das sollte uns nicht entmutigen: Wandel ist möglich – und Veränderung nötig!
Seit mehr als siebzig Jahren schützt der Staat unsere persönliche Integrität. Das Grundgesetz garantiert individuelle Freiheit und Sicherheit. Der Staat und seine Institutionen haben die Aufgabe, die Freiheit aller zu sichern. Aber Freiheit gilt nicht absolut, sie braucht Grenzen. Wir sind zur Freiheit verpflichtet, und zugleich nimmt sie uns in die Pflicht: unser Leben bewusst zu gestalten, für unsere Werte und unsere Entscheidungen Verantwortung zu übernehmen. Für uns selbst – und für die Gemeinschaft.