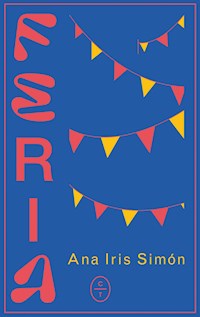10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
»Ein verdammtes Wunder.« — Elvira Navarro Mitten im Sommer ist eine tiefgründige Antwort auf die Frage, was es heißt, heute um die dreißig zu sein, und eine bewegende Liebeserklärung an die Generation der Eltern und an das, was wir Heimat nennen. Es wurde unmittelbar nach Erscheinen zu einem Bestseller in Spanien und zugleich zu einem international viel diskutierten Phänomen. Mit Ana Iris Simón meldet sich eine neue ehrliche, authentische Stimme zu Wort, die die Welt elektrisiert. »Überwältigend, strotzend vor Wahrheit.« — Sergio del Molino »Wie es glänzt, wie es riecht, wie es klingt. Was für ein schönes Buch.« — Miqui Otero
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Ähnliche
Ana Iris Simón
Mitten im Sommer
Aus dem Spanischen von Svenja Becker
Hoffmann und Campe
Für Mari Cruz, María Solo und alles,
was sie hervorgebracht haben
Solang noch ein Baum im Olivenhain bleibt.
Und ein Segel auf dem Meer.
El Último de la Fila, »Mar Antiguo«
Und da ist ein Kind / das alle Dichter verlieren / Und eine Spieluhr /
über dem Wind.
Federico García Lorca, »Poema de la feria«
Das Ende der Einzigartigkeit
Ich beneide meine Eltern um ihr Leben in meinem Alter
Ich beneide meine Eltern um ihr Leben in meinem Alter. Wenn ich das laut ausspreche, sehen mich immer welche befremdet an und sagen etwas, wie dass meine Eltern in meinem Alter nur halb so viel gereist seien wie ich, und sie würden ihre Eltern kein bisschen beneiden, sie müssten noch jede Menge unternehmen, bevor sie »ankommen«. Wir seien heute freier, und unsere Eltern hätten nicht zwei Fächer studieren und einen Master in Englisch machen können und sie hätten auch kein Jahr Doritos futternd und kreuz und quer vögelnd in Brüssel verbringen können dank diesem sogenannten Erasmus-Programm, das doch nur eine Strategie zur Dynastiebildung im einundzwanzigsten Jahrhundert ist, eine Subvention, damit die europäische Mittelschicht sich miteinander paart und sich europäische Geschlechtskrankheiten holt und feiert, dass das hier Europa ist und der europäischen Wesensart entspricht und wir ja nicht von ungefähr die Enkel sind von Homer und Platon.
Tatsache ist, dass meine Eltern in meinem Alter ein siebenjähriges Kind hatten und ein Reihenhaus in Ontígola, Provinz Toledo. Die Ana Mari hatte gerade mit dem Rauchen aufgehört, und von dem gesparten Zigarettengeld kaufte sie sich ihren Thermomix, und darum beneide ich sie, und wenn ich das sage, denken die anderen oft, dass ich sie nicht mehr alle habe, und als Antwort denke ich dann: Du bist zweiunddreißig, du verdienst tausend Euro im Monat, wohnst in einer WG, und das, was du alles noch machen musst, bevor du »ankommst«, ist, ein Jahr sparen, um für zehn Tage nach Thailand zu fliegen, obwohl du dich noch nie dafür interessiert hast, was in Thailand passiert oder wie es dort ist, eine Pille einwerfen und an deinen Leuten auf Festivals rumfummeln, wo du nicht mal die Hälfte der Bands kennst, aber so tun musst, als ob, und glauben, dass die Serien, die du dir anschaust, und die Bücher von Blackie Books, die du liest, Teil deiner ureigenen Identität sind. Das sage ich natürlich nicht, das denke ich nur für mich.
Stattdessen sage ich, dass unsere Eltern auf Fotos älter aussehen, als sie waren, und älter als wir in ihrem Alter. Viele Dreißigjährige würden ja denken, es sei angemessen, in Innenräumen Mütze zu tragen, sage ich schon recht streng, oder es sei überhaupt angemessen, mit dreißig Mütze zu tragen. Ich sage außerdem, dass unsere Eltern wahrscheinlich geheiratet, Kinder bekommen und sich verschuldet haben, weil sie dem unterlagen, was man gemeinhin »soziale Zwänge« nennt, weil »man das eben so gemacht hat«, sich aber einzubilden, über unseren Köpfen würden nicht auch ähnliche Zwänge schweben, sei der beste Beweis dafür, dass sie es täten und dass wir uns das mit der freien Entscheidung und dem Fortschritt und der liberalen Demokratie als einzig möglichem Arkadien vielleicht nur eingebildet hätten. Super Arkadien, danke.
Seit zehn Jahren wird es uns gesagt, aber wir weigern uns, es zu glauben. Wir sind die erste Generation, die schlechter lebt als ihre Eltern, sind die, die die Finanzkrise von 2008 wegstecken mussten, als wir gerade mit der Uni anfingen oder fertig wurden oder mit dem Bachelor oder mit der Oberstufe, und danach das Coronavirus, als wir gerade mit der Vorstellung liebäugelten, wir könnten uns vielleicht in ein paar Jahren eine Wohnung für uns allein leisten.
Unsere Zwänge sind vorhanden, und sie sind materiell, und oft spreche ich mit meiner Freundin Cynthia darüber, dass das mit dem sozialen Aufstieg für mich oder für sie oder für unsere Freundin Tamara leicht war, dass es leicht war, den Lebensstil unserer Briefträger- und Kellner- und Putzfrauen- und Straßenkehrereltern zu übertreffen oder den unserer Industriearbeiter- oder Bauern- oder Schaustellergroßeltern, dass das aber auf unsere übrigen Freunde, auf die aus der Mittelschicht, die Kinder von Lehrern und Ärzten und Anwälten und Unternehmern, nicht zutrifft. Und dass unsere Eltern trotzdem, auch wenn sie null akademische Abschlüsse hatten, in unserem Alter dennoch Kinder und Hauskredite und Wohneigentum hatten. Weil man das so machen musste, keine Frage. Aber auch, weil sie das machen konnten.
Wir dagegen haben weder Kinder noch Haus, noch Auto. Unser Eigentum besteht aus einem iPhone und einem Ikearegal für dreißig Euro, weil wir uns nicht mehr leisten können, und das sind unsere Zwänge, und sie sind materiell. Wobei wir uns aber selbst einreden, es sei Freiheit, auf Kinder und Haus und Auto zu verzichten, denn »wer weiß, wo ich morgen bin«. Man hat uns glauben machen, zu wissen, wo wir morgen sind, sei eine Fessel, von der wir uns zum Glück befreit hätten, Auswanderung und Einwanderung seien Chancen, neue Kulturen kennenzulernen und die Welt in einen Schmelztiegel aus Sprachen und Farben zu verwandeln und nicht in einen Saustall, und sich eine Wohnung zu teilen sei eine Erfahrung fürs Leben und nicht, ab einem gewissen Alter, ein beschämendes Detail, das man lieber für sich behält.
Einmal saßen wir abends daheim in unserer WG im Zentrum von Madrid, und Jaime, mit dem ich seit meinem vierzehnten Lebensjahr befreundet bin und der ein paar Monate bei mir wohnte, bevor er seine Freundin Patricia kennenlernte und zu ihr zog, widersprach mir und sagte, nein, unsere Zwänge seien nicht materiell oder jedenfalls nicht nur. Er sagte, während er die Playstation für ein paar Runden Fortnite anschloss, in seinem Alter hätten seine Eltern schon ihn gehabt und seinen Bruder Guillermo, sie hätten aber auch weniger Geld gehabt als er und das trotzdem riskiert, und mit dem, was er da sagte, hatte er recht. Jaime gehört zu den Freunden, mit denen ich am liebsten rede, weil er aus Erfahrung spricht, er braucht kein Bücherwissen, keine großen Theorien oder Autoren, auf die er sich berufen kann, und hat häufiger recht als diejenigen, die das tun, weil er nur über das redet, was er sieht und erlebt.
Und an dem Abend, als er mir das sagte, dass unsere Zwänge nicht nur materiell sind, dass wir keine Kinder hätten, weil wir keine haben wollten, da hatte er recht. Jaime verdient mehr, als seine Eltern in seinem Alter verdient haben. Ich habe mehr Geld, als meine Eltern in meinem Alter hatten, und mehr, als sie jetzt haben. Und doch saß ich da mit meinen achtundzwanzig Jahren in einer WG im Zentrum von Madrid in einem T-Shirt mit Camelwerbung, das ich bei meinem Vater abgegriffen hatte, und in meiner Schlafanzughose, die eigentlich die Turnhose aus dem Sportunterricht in meinem ersten Oberstufenjahr war, saß da ohne Haus, ohne Kinder und trank Wasser aus einem Schraubglas statt aus einem Wasserglas. Saß da und mäkelte an diesem würdelosen Jugendlichkeitswahn herum, den ich nicht besser und umfassender hätte verkörpern können.
Wenige Tage später fragte ich meinen Vater über WhatsApp, ob er meinte, dass ich schlechter lebte als sie in meinem Alter, und er schrieb zurück, ich solle keinen Unsinn reden. Nachdem ich das gelesen hatte, rief ich ihn an, und wir sprachen über unsichere Arbeit und Fortschrittsglauben und Spätkapitalismus und dass am Ende nur sehr wenig wirklich zählt im Leben, bis er sagte, ihm täte das Ohr weh, es sei schon ganz platt, und wir auflegten.
Jedes Mal, wenn wir dieses Fass aufmachen, ob man früher besser gelebt hat oder heute besser lebt, und das tun wir öfter, wird er ungeduldig und erzählt mir, dass er mit zehn Jahren schon in die Weinlese musste, und mir geht es dann, wie wenn er mich fragt, wie wir der Fahne je eine andere Bedeutung geben wollen, wo er bei Don Leonidio in der Schule vor diesem Fetzen die Faschohymne »Cara al Sol« singen musste und gesagt bekam, sein Großvater hätte sich für die schlechten Spanier entschieden: Mir fällt nichts mehr ein. Aber ihm fällt auch nichts mehr ein, wenn ich sage, in seiner Generation habe man die Aussicht darauf gehabt, dass die eigenen Kinder nicht schon mit zehn würden arbeiten müssen, und meine Generation habe nie im Leben Aussicht auf einen unbefristeten Arbeitsvertrag, und deshalb hätten wir keine Kinder und könnten sie also auch nicht in die Weinlese schicken.
Ich sage ihm allerdings nicht, dass einige trotzdem Kinder haben, einige weiter Kinder bekommen, und dass ich das nicht deshalb weiß, weil ich es in meinem Viertel oder meinem Umfeld sehen würde, sondern auf Facebook. Neulich habe ich gesehen, dass Armando, ein früherer Mitschüler, bald sein erstes Kind haben wird. Zu der Ankündigung hatte er ein Foto von einem sehr kleinen Valentino-Rossi-Helm gepostet, weil er von Motorrädern schon als Kind begeistert war, und ich habe mich sehr gefreut, weil er ein guter Vater sein wird. Seine Lebensgefährtin kenne ich nicht, und über sein Leben weiß ich nur, was ich auf meiner Pinnwand sehe, wenn ich alle zwei, drei Monate draufschaue, aber ich stelle mir vor, dass sie schon viele Jahre ein Paar sind.
Als wir zusammen auf die Vicente Aleixandre gingen, trug Armando eine Brille mit Flaschenbodengläsern und zeichnete im Unterricht ständig Dinosaurier, und er zeichnete sie sehr gut. Er war der beste Schüler in der B, zusammen mit Pablo Sierra, der am Ende Geschichte studierte, weil ihm die Geschichte gefiel. Armando hat dagegen anscheinend einen mittleren Abschluss gemacht und ist immer in Aranjuez geblieben, oder jedenfalls sieht das auf Facebook so aus. Und bestimmt beneidet er seine Eltern nicht um ihr Leben in seinem Alter, weil seins ziemlich ähnlich ist.
Das Problem liegt bei mir, dachte ich an dem Abend mit dem die Playstation anschließenden Jaime und meinem T-Shirt mit Camelwerbung und meiner Schlafanzughose, die eigentlich die Turnhose aus dem Sportunterricht in meinem ersten Oberstufenjahr war. Das Problem liegt bei mir, weil ich mich für den Reisepass mit ein paar Stempeln drin entschieden habe und für das Abo von Netflix und Filmin und HBO. Das Problem liegt bei mir, weil ich mich vor allem anderen auf der Welt für die Uni entschieden habe und für das Zentrum von Madrid und für die Ausstellungen in La Casa Encendida und für die Nächte auf der Dos de Mayo mit allem, was das ausschließt, und alles, was das ausschließt, ist das, was mich eigentlich ausmacht: ein Reihenhaus in Ontígola, wo es noch alte Frauen gibt, die in Höhlen wohnen, und wo ich zur Kommunion gehen konnte, weil ich Don Gumersindo austrickste, dass wir sonntags, wenn keine Erwachsenen in der Nähe waren, auf den Hänger vom Traktor kletterten und meine Großmutter María Solo mir drohte, wenn ich nicht das Heiligenbildchen bei mir trüge, von dem mein Vater nichts wissen durfte, dann würde mir der böse Blick angehext.
Das Nolan-Diagramm, das bei Twitter so angesagt ist und das einem anhand von zwei Vektoren, der Haltung zu ökonomischer und der zu persönlicher Freiheit, sagt, welcher Ideologie man angehört, beinhaltet noch zwei Aspekte, den theoretischen und den anthropologischen, aber davon merken wir anscheinend nichts, und das ist eine der Leistungen des Liberalismus: dass wir von seiner Logik bis auf die Knochen durchdrungen sind, ohne es weiter mitzukriegen. Seine größte Leistung besteht darin, dass er als neutral durchgeht, als ideologiefrei, als normal und aseptisch, und er uns obendrein hat vergessen lassen, dass mit seinem Wirtschaftsmodell ein paar Werte einhergehen. Und dass es miteinander vereinbar scheint, wenn man das eine ablehnt, das andere aber bejubelt und danach lebt, und dass wir das tatsächlich massenhaft tun.
An dem Tag, als ich den Post von Armando auf Facebook sah, und an dem Abend, als Jaime sagte, wir hätten keine Kinder, weil wir keine haben wollten, dachte ich, wenn ich am liebsten über die Familie und über das Leben früher schreiben würde, dann vielleicht nicht, weil mir das Schreiben, sondern weil mir die Familie und das Leben früher gefallen. Außerdem, dass bei mir seit vielen Jahren etwas im Argen liegt, und dass ich dafür nicht den anderen die Schuld geben kann oder jedenfalls nicht ausschließlich. Ich kann schlecht behaupten, man hätte mir die Katze im Sack verkauft, denn damit einem jemand die Katze im Sack verkauft, muss man sie erst mal kaufen wollen.
Als Jugendliche und junge Erwachsene hatte ich viel über Madrid geschrieben, wie wir, wenn wir jung sind und in der Peripherie wohnen, über Madrid schreiben, als wäre Madrid eine Art Macondo aus Hundert Jahre Einsamkeit, wo es keine Frösche regnet, es einem aber so super geht an der Plaza de las Comendadoras am Abend. Ich hatte mir ausgemalt, wie ich mit Anfang dreißig, schon mit ersten grauen Haaren und mit zwei Babys, in einer Wohnung im Zentrum leben würde, inklusive einer Terrasse und Monsteras und Yuccapalmen und vielen Büchern vom Taschen Verlag im Wohnzimmer. Ich hatte auf die herabgesehen, die in Aranjuez wohnen blieben, wie provinziell, in so einem kleinen Ort, der so wenig zu bieten hat. Aber wer provinziell war und wenig zu bieten hatte, war ich, und klein waren mein Herz und meine Sichtweise.
Ich war es doch, die sich entschieden hatte, in einem Themenpark zu wohnen, die geglaubt hatte, wenn ich mit Anfang zwanzig in dem arbeitete, was meine Leidenschaft ist, dann wäre schon das ein Erfolg, und sei es für tausend Euro und kaum abgesichert, ich hatte doch gedacht, nur arme Leute würden jung Kinder bekommen, so wie meine Eltern, und es mit unter dreißig nicht mal in Erwägung zu ziehen wäre ein Zeichen dafür, dass etwas vorangeht, wo es genau umgekehrt ist. Ich war es doch, die zwar nicht viel, aber eben das eine oder andere hatte machen müssen, bevor ich »ankomme«, und wenn das heute einer zu mir sagt, dann antworte ich, dass bei mir nichts davon übrig ist, oder, mehr noch, dass es nichts davon je gegeben hat. Das sei alles Schall und Rauch und Nichts und Gott nicht tot, sondern ermordet, und die Freizeit das Opium des Volks, und mit mir sei los, dass ich meine Eltern beneide um ihr Leben in meinem Alter, und ich beneide sie, weil die Ana Mari in meinem Alter eine Festanstellung hatte, die sie bis heute, über zwanzig Jahre später, immer noch hat, und dabei nimmt sie die Arbeit nicht mal halb so wichtig wie ich oder jedenfalls anders wichtig.
In meinem Alter hatte die Ana Mari eine siebenjährige Tochter (mich), einen Thermomix, den sie sich vom gesparten Zigarettengeld gekauft hatte, und einen Hauskredit. Und bestimmt hatte sie auch eine sehr klare Vorstellung von dem und ein nahezu blindes Vertrauen auf das, was sie heute selbst trügerisch nennt, und vielleicht ist das der springende Punkt. Vielleicht beneide ich meine Eltern deshalb um ihr Leben in meinem Alter, weil ich manchmal, so ohne Haus und ohne Kinder aus welchen Gründen auch immer, aber jedenfalls als Folge davon, dass sich perspektivisch kaum etwas anderes als Unsicherheit auftut, weil ich also manchmal mein winziges Reich, mein Ikearegal und mein Handy darum geben würde, dass mir jemand eine schlüssige, konkrete und realistische Definition von dem lieferte, was gemeint war und gemeint ist mit Fortschritt.
Aramís, krieg ich einen Kuss von dir?
Es war heiß, und es gab schon viele Fliegen, als meine Tante Ana Rosa meinen Cousin Pablo, meine Cousine María und mich in die Bäckerei Orejón schickte. Ich hatte ein T-Shirt an, auf dem stand: »Meine Großeltern, die mich sehr lieb haben, haben mir dieses T-Shirt aus Vigo mitgebracht«, das meine Großmutter Mari Cruz und mein Großvater Vicente auf einer staatlich geförderten Seniorenreise für mich gekauft hatten, und María trug ein Baumwollkleid mit Fransen und einem aufgedruckten Hund, dem vom vielen Waschen Körperteile fehlten. Wir sollten die Baguettes für die Tortillabrote kaufen, und ich befehligte den Marschtrupp als stolzer Feldwebel, weil Pablo sechs war, María fünf, ich aber schon acht. Die Tür war noch zu, denn es war früh, also klingelten wir. Der Orejónbäcker öffnete, und im ersten Moment, bevor ich den Kopf hob und ihm ins Gesicht sah und ihm erklärte, dass wir Brot kaufen wollten, sah ich nur einen haarigen Bauch, und der Nabel war ausgestülpt.
Er führte uns in den Verkaufsraum, wo es nach Mehl und nach Ofen roch und noch schummrig war, und gab uns die Brote. Als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, tuschelten wir über seinen ausgestülpten Nabel, weil wir alle drei auf seiner Höhe gewesen waren und ihn bemerkt hatten, und dann rannten wir los zum Haus von meinen Großeltern, was auch das Haus von Pablo und María war und von meiner Tante Ana Rosa. Hüpfend liefen wir die Calle el Cristo hinunter und riefen dabei, dass der Nabel vom Orejónbäcker ausgestülpt war, und wie ausgestülpt der Nabel vom Orejónbäcker war. Pablo konnte seinen auch rausholen, und wenn er das tat, nannten wir ihn Marsmännchenmaul, und wenn die Ana Rosa ihn dabei erwischte, dass er das tat, dann schimpfte sie mit ihm, und wenn sie meine Cousine Marta oder mich, die älter waren als Pablo, dabei erwischte, dass wir ihn aufforderten, das zu tun, dann schimpfte sie mit uns, wir würden ihn aufhetzen. Bei unserer Ankunft erzählten wir drei ihr im Chor aufgeregt das vom Orejónbäcker, während wir ihr die Brote gaben, und sie sagte, wir sollten sie nicht um das Wechselgeld betuppen und schnell machen und unsere Rucksäcke packen, die Juli und Pepe seien gleich da.
Pepe war auch ein Onkel von mir, einer der Brüder meines Vaters, und die Juli war seine Frau, und wir würden zusammen mit ihren Kindern, die auch meine Cousinen und Cousins waren, ins Aquopolis nach Villanueva de la Cañada fahren. Meine Eltern waren wieder heim nach Ontígola gefahren und hatten mit meinem Onkel und meiner Tante ausgemacht, dass die mich nach dem Tag im Wasserpark nach Hause bringen würden. In den Peugeot 309 von meinem Onkel Pablo und der Ana Rosa stiegen, ohne Kindersitze und Gurte, mein Cousin Pablo und meine Cousine María, also ihre Kinder, und ich mit meinem Cousin Alberto, dem Mittleren von Pepe und der Juli. In den schwarzen Ford Orion von Pepe und der Juli stiegen deren Tochter Isabel, meine Cousine, die wie María fünf Jahre alt war und der ihre Brüder beigebracht hatten, alle Vokale zu rülpsen, außerdem ihr Bruder Mario, von meinen Cousins einer der Ältesten, und zwei Freunde von ihm: Edu und Repi, der lange Haare hatte und einen Mittelscheitel und der für mich aussah wie Quimi aus der Serie Compañeros, aber das sagte ich ihm nicht.
In beiden Autos saß einer zu viel, und als wir die Autobahn erreichten und sahen, dass die Guardia Civil dort stand, wurde mein Onkel Pablo nervös und fürchtete, wir würden einen Strafzettel bekommen, deshalb mussten wir umdrehen und die Nationalstraße nehmen. Es war nicht meine erste Fahrt als eine zu viel im Auto. Mit fünf war ich auf dem Schoß meiner Tante Arantxa von Criptana nach Ontígola gefahren und hatte mich geduckt, als meine Großmutter María Solo sagte, ich solle mich ducken, da vorn würde die Guardia stehen. Mit meinen Eltern war das nie vorgekommen, obwohl wir fast jeden Freitag von Ontígola nach Criptana fuhren und sonntags wieder zurück, erst im Lada und später im Clio.
Die Ana Mari nahm immer viel zum Anziehen mit, und mein Vater lachte darüber, dass sie so viel zum Anziehen mitnahm, wo wir bloß zwei Tage ins Dorf fuhren. Die Kleidungsstücke, die leicht verknitterten, hängte sie auf Bügeln an die Handgriffe im Fond des Lada, und einen Gutteil der Fahrt brachte sie damit zu, mit mir zu schimpfen, weil ich sie anfasste, und wenn ich antwortete, ich würde sie gar nicht anfassen, was nicht stimmte, weil ich zu gern mit der Hand über die Sachen von der Ana Mari strich, dann sagte sie, ich solle nicht schnippisch sein und nicht solche Antworten geben. Dann fing ich an, aus dem Fenster zu schauen, und spielte, ich würde Dinge in den Wolken sehen, weil das die Kinder in Filmen taten, wenn sie im Auto unterwegs waren, still aus dem Fenster schauen und Dinge in den Wolken sehen. Aber das wurde mir schnell langweilig, und ich sagte zu meinem Vater, dass er die Kassette von El Último de la Fila rausnehmen und für mich die von den Toreros Muertos einlegen sollte, die mit dem Lied übers Pinkeln.
Wir fuhren wegen der Familie so oft nach Criptana, aber auch, damit die Ana Mari und mein Vater, die beide Anfang zwanzig waren, ihre Freunde treffen konnten, Onkel Domingo und Onkel Juan, wie ich sie nannte, und wenn sie mit ihnen feiern gingen, dann sagten sie zu mir, sie würden auf die Beerdigung von Manolo Cacharro gehen. Die ersten Male glaubte ich das, wie sollte ich auch eine Beerdigung bestreiten, ich war ja ein Kind und kannte mich nicht aus mit dem Tod, aber eines Abends baute ich mich vor ihnen auf und fragte, wie oft dieser Manolo Cacharro denn noch vorhätte zu sterben. Meine Großmutter María Solo, bei der sie mich ließen, wenn sie feiern gingen, lachte und sagte, die beiden würden was trinken gehen, aber wir beide würden den Russischen Salat zu Abend essen, den sie uns gemacht hatte, und dann Tute spielen, und morgen sei ja Wochenmarkt in Las Mesas und da müsse ich meinem Großvater Gregorio und ihr beim Aufbauen helfen.
Aber an dem Aquopolis-Tag hatte ich nicht bei meiner Großmutter María Solo übernachtet, sondern bei Pablo und María, die Bettdecken mit den 101 Dalmatinern hatten und außerdem Rex, den Dinosaurier aus Toy Story. Über die Nationalstraße kamen wir ohne Strafzettel an, und eine Weile stritten wir, ob wir erst zu den Hangrutschen oder zum Splash gehen sollten, und ich erzählte meinen Cousins und Cousinen, dass es in Aranjuez auch ein Aquopolis gab, bloß dass alle »das Schwimmbad vom Toten« dazu sagten, weil dort einer gestorben war, der die Rutsche runtergerutscht war, und sie glaubten mir nicht, aber es stimmte.
Wir einigten uns darauf, am besten erst zu den Hangrutschen zu gehen, weil Isabel und María, die noch klein waren, dort rutschen durften, und als wir ankamen, sahen wir einen Reporter der Realityshow Aquí hay tomate mit einem Mikrofon in der Hand, und bei ihm war Aramís Fuster. Sie steckte in einem Badeanzug mit Leopardenmuster und trug das Haar in einem üppigen hohen Zopf. Während sie die Stufen ins Wasser hinabstieg, schaute sie von einer Seite zur anderen und strich sich mit sinnlicher Geste übers Haar, und wir rannten zu den Handtüchern, um der Juli und der Ana Rosa davon zu berichten, und machten sie mit wiegenden Hüften nach. Die Ana Rosa meinte lachend, ich solle zu ihr hingehen und Hallo sagen, und wir rannten zurück zum Becken, und als der Kameramann sie aufforderte, aus dem Wasser zu kommen, trat ich hinter der Hecke hervor, wo wir gestanden hatten, schaute hoch und fragte sie: »Aramís, krieg ich einen Kuss von dir?«, und sie gab mir einen, und der Reporter von Tomate verabschiedete sich mit einem Blick in die Kamera und rief: »Seht ihr? Sogar die Kinder sind verrückt nach ihr!«
Meine Cousins und Cousinen erzählten es meiner Tante Ana Rosa und meinem Onkel Pablo und meinem Onkel Pepe und der Juli, und die lachten noch Jahre später über das »Aramís, krieg ich einen Kuss von dir?«, und immer wenn sie darauf zu sprechen kamen, war mir das sehr peinlich, denn Aramís war durchgeknallt, und geküsst hatte sie mich, weil ich sie darum gebeten hatte, aber ich hatte ja auch noch nie einen Promi aus der Nähe gesehen. José Bono, eigentlich Pepe, seit die Ana Mari ein Selfie mit ihm gemacht hatte, als er zur Rathauseinweihung nach Ontígola kam, also Pepe, den Präsidenten der Region, hatte ich schon aus der Nähe gesehen, aber einen richtigen Promi nie.
Als sie mich sonnenverbrannt und mit geröteten Augen nach Ontígola zurückbrachten und meinen Eltern davon erzählten, lachten die auch und malten sich aus, wie sie Telecinco verklagen und einen Batzen Geld einstreichen würden, sollte ich im Fernsehen ohne die Pixel auftauchen, die über das Gesicht von Andreíta gelegt wurden, der Tochter vom Torero Jesulín und dem Fernsehpromi Belén Esteban.
Die Ana Mari und mein Vater waren gerade aus dem Leclerc zurückgekommen, und ich war sauer auf sie, weil sie ohne mich dort gewesen waren, wo ich doch so gern in den Leclerc ging. Er hatte erst vor kurzem in Aranjuez eröffnet und war der erste große Supermarkt, den ich in meinem Leben gesehen hatte, und es war dort ganz anders als bei der Rocío, in der Bäckerei von der Benita oder beim Orejónbäcker, dessen haariger Bauch und ausgestülpter Nabel mit das Erste gewesen waren, was ich gleich nach dem Aufstehen gesehen hatte.
Einkaufen war fast immer Sache meines Vaters, und manchmal nahm er mich mit in die Markthalle von Ocaña, um Hähnchen zu kaufen, und ich hatte das Gefühl, dass der Geruch nach totem Tier und nach Chlorreiniger und nach den Kohlblättern auf dem Boden an mir kleben blieb. Andere Male fuhren wir zum Leclerc, und wenn ich Glück hatte, kaufte er mir ein Buch oder das Witch-Heft in der Zeitschriftenabteilung, und dort roch es trotz allem nach nichts, und mir kam das vor wie die Zukunft, die Modernität und die einzige Verheißung, die zählte.
Im Leclerc war alles fein säuberlich sortiert und in Plastik verpackt, nicht wie in der Markthalle von Ocaña, wo sie einem die Filets in graues Wachspapier einschlugen, auf dem stand »Danke für Ihren Besuch, kommen Sie bald wieder«, und wo ich immer dachte, hoffentlich nicht, hoffentlich kommen wir so schnell nicht wieder oder hört die Markthalle von Ocaña wenigstens auf, nach totem Tier zu riechen und nach Chlorreiniger und nach Kohlblättern auf dem Boden, und vielleicht installieren sie endlich LED-Anzeigen wie im Leclerc, statt dass man an jedem Stand fragen muss, wer der Letzte ist in der Schlan- ge.
Bald würden wir den Euro haben. In der Schule übten wir schon mit Münzen und Scheinen aus Pappe, und ich konnte es kaum erwarten, im Süßwarenladen El Duende mit Euros zu bezahlen statt mit den schäbigen Fünf-Peseten-Münzen, die bloß als Stopper für die Kreiselschnur oder als Gabe an den heiligen Pankratius taugten. Die Markthalle von Ocaña und die Euros konnte es nicht gleichzeitig geben, denn wenn wir die Münzen bekommen würden, dann würden sie glänzen und modern sein, und wir wären das ebenfalls und wir würden zu Europa gehören, dachte ich und schrieb das in mein Tagebuch. Die Euros waren der Leclerc, die Peseten der Hähnchenstand, der die Oberkeulen noch in graues Wachspapier einschlug.
Zusammen mit dem Leclerc hatte in Aranjuez auch ein riesiger Chinesenladen aufgemacht, der, seiner Zeit voraus, statt mit »Alles für 100 Peseten« auf seiner Leuchtreklame mit »Alles für 60 Cent und 1 Euro« warb. Das hatte Rubén in der Mathestunde erzählt, während wir zur Übung mit unseren Pappeuros taten, als würden wir Wechselgeld geben. Ich hatte den Laden noch nicht gesehen, denn wenn wir Haargummis brauchten oder ein Sieb oder einen Mörser, dann gingen wir weiterhin zum Haushaltwarenladen Abanico oder zum Don Pimpón Chollo, und ich verstand nicht, wieso wir weiter zum Abanico oder zum Don Pimpón Chollo gingen, wie ich auch nicht verstand, wieso wir manchmal auf den Markt von Ocaña gingen statt in den Leclerc.
Ich erinnerte mich, dass ich gehört hatte, wie sich meine Großmutter María Solo vor ihrem Tod über die Chinesen beklagte. Also nicht über sie, aber über ihre Läden, die allerorten wie Pilze aus dem Boden schossen, aber ich erinnerte mich auch, dass sie sich über die Einkaufszentren und den Indiana Bill beklagt hatte, das neue Bällebad in Aranjuez, und über Pizza Hut, »weil Spielzeug kaufen oder Karussell fahren oder einen Hamburger essen konntest du früher bloß auf dem Jahrmarkt, und was jetzt«. »Und was jetzt« bedeutete, dass Jahrmärkte sinnlos geworden waren, weil das Leben, die Welt, unser Dasein als solches zu einem Jahrmarkt geworden waren.
Auf diese Klagen entgegnete ich nie etwas, denn niemals hätte ich meiner Großmutter María Solo widersprechen können, aber in mein Tagebuch schrieb ich, dass ich die Chinesenläden gut fand und die Einkaufszentren und den Indiana Bill und den Leclerc und den Pizza Hut, und den Burger King, der gegenüber vom Palast von Aranjuez gebaut wurde, den fand ich auch gut, obwohl mein Vater sagte, dort würde er nicht mit mir hingehen, das sei Amikram.
Ebenfalls Amikram war in seinen Augen Actimel, das gerade auf den Markt gekommen war und das alle meine Freunde als Pausenfrühstück dabeihatten, während ich beschämt mein belegtes Brot oder meine Doppelkekse mit Schokolade auspackte, auch wenn die mir gut schmeckten, und abends bekniete ich meinen Vater, dass er mir Actimels kaufte, alle Kinder würden die mitbringen, aber damit hatte ich nie Glück.
Er sagte: »Schau her, was mein Finger sagt«, hob seinen Zeigefinger und bewegte ihn hin und her und antwortete, wenn ich ein Actimel wolle, dann solle ich mir einen Joghurt schütteln, und ich war eingeschnappt und ging hoch in mein Zimmer und dachte, dass er von nichts eine Ahnung hatte, weil er weder die Euros noch die Lieder auf Englisch, noch den Burger King oder die Actimels mochte und weiter für Hähnchen zum Markt nach Ocaña fuhr und es ihm egal war, dass es dort nach totem Tier roch und Fliegenlampen von der Decke hingen. Jahre später musste ich ihm recht geben, aber meinem Vater muss ich sowieso immer recht geben, und sei es Jahre später. Ich wohnte dem Ende von Spanien bei, dem Ende der Einzigartigkeit. Und ich kriegte es nicht mit.
Draußen: die Welt
Rebecas Hochzeit
Am 13. Juli 1997, ich war gerade sechs geworden, war die Hochzeit von Rebeca, einer Cousine meiner Mutter, Tochter von meiner Großtante Toñi. Sie heiratete die Maus, einen sehr schmächtigen Mann mit stark geschlitzten Augen, der sehr viele Schwielen an den Händen hatte, oder jedenfalls kam mir das so vor. Er arbeitete auf dem Land, und irgendwo hatte ich aufgeschnappt, dass er am letzten Tag der Lese immer im Anzug in den Weinberg ging, und ich dachte damals, dass der ihm zu groß sein müsste und vom Knie abwärts Falten schlug, weil die Maus doch ein so kleiner Mann war und so kleine Anzüge nicht hergestellt wurden, sodass ich mir ausmalte, wie er sich ständig die Ärmel hochschob, ehe er die Trauben mit dem Rebmesser abschnitt.