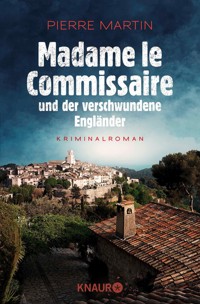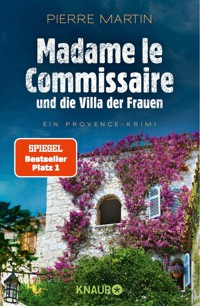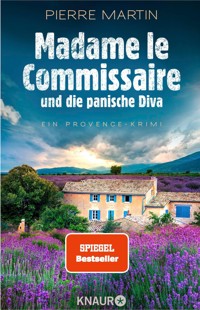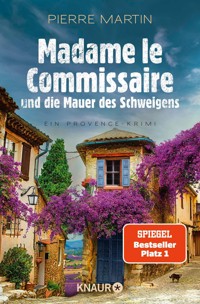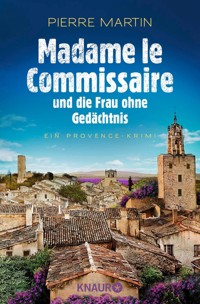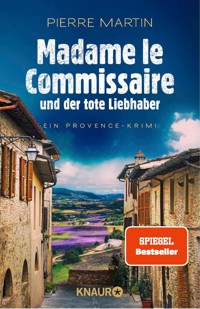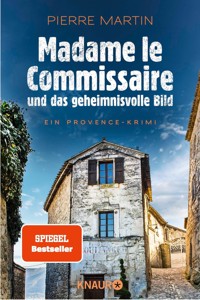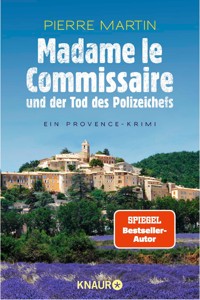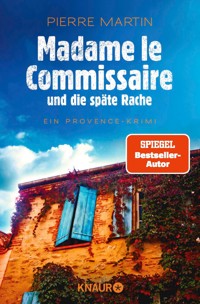9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Monsieur-le-Comte-Serie
- Sprache: Deutsch
Ein Auftragsmörder und sein Vorsatz, nicht zu töten: Im zweiten Band der humorvollen Krimi-Reihe entführt uns der Bestseller-Autor Pierre Martin an die französische Riviera Lucien Comte de Chacarasse hat seinem Vater am Sterbebett ein Versprechen gegeben: Er wird die Tradition des Adelsgeschlechts seiner Familie fortsetzen und geheime Aufträge für bezahlte Morde entgegennehmen – und sie zur Zufriedenheit seines Onkels zum Abschluss bringen. Das aber ist nur mit Tricks und unter Vortäuschung falscher Tatsachen möglich. Denn Lucien hat einen Vorsatz gefasst: Er bringt keine Menschen um. Dabei hat er von klein auf die Kunst des Tötens gelernt – nun ist eine andere Kunst gefragt: jene der listigen Täuschung. Monsieur le Comtes nächster Auftrag führt ihn nach Marseille, wo er in ein Priestergewand gekleidet ein seelsorgerisches Gespräch mit der Zielperson führt: Wird es ihm mithilfe dieser raffinierten Täuschung gelingen, sein neues Opfer gleichzeitig zu töten und am Leben zu lassen? Wir kehren in "Monsieur le Comte und die Kunst der Täuschung" auch in die sympathischen Gemeinden Villefranche-sur-Mer und Cap-Ferrat an der französischen Riviera zurück und treffen auf bekannte Charaktere des ersten Bandes der Cosy-Krimi-Reihe: die liebenswerte Haushälterin Rosalie und die attraktive, rätselhafte und unnahbare Francine, ehemalige Geliebte von Luciens Vater. Ein Cosy Crime Kriminalroman zum Eintauchen und Entspannen Reisen Sie an die französische Riviera, genießen Sie ein Glas Rosé in Luciens Bistrot in Villefranche-sur-Mer und tauchen Sie ein in die spannenden Abenteuer dieses lustigen Kriminalromans. Entdecken Sie weitere spannende Fälle in der der Madame le Commissaire-Bestseller-Krimi-Reihe: - Madame le Commissaire und der verschwundene Engländer (Band 1) - Madame le Commissaire und die späte Rache (Band 2) - Madame le Commissaire und der Tod des Polizeichefs (Band 3) - ... - Madame le Commissaire und die Mauer des Schweigens (Band 10)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Pierre Martin
Monsieur le Comte und die Kunst der Täuschung
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Lucien Comte de Chacarasse hat sich auf seine ganz eigene Weise mit dem Versprechen arrangiert, das er seinem Vater am Sterbebett geben musste. Gemäß der Tradition seiner adligen Familie wird er geheime Aufträge für bezahlte Morde entgegennehmen und sie zur Zufriedenheit seines Onkels Edmond zum Abschluss bringen – aber ohne dabei einen Menschen zu töten! Selbst wenn er sich dafür in ein Priestergewand kleiden und zum Beichtvater werden muss: Bei seinem neuesten Auftrag in Marseilles führt Lucien als Priester ein äußerst ungewöhnliches Beichtgespräch mit der Zielperson. Ob es ihm auf diesem trickreichen Weg mithilfe der Kunst der listigen Täuschung am Ende gelingt, dass sein Opfer tot ist – und gleichzeitig am Leben bleibt?
Inhaltsübersicht
Motto
Prologue
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
Épilogue
Disclaimer
La vérité est rarement pureet jamais simple
Die Wahrheit ist selten reinund niemals einfach
Oscar Wilde
Prologue
Die herrschaftliche Villa Béatitude auf Cap Ferrat war von hohen Mauern und dichten Hecken umgeben. Die Grafen Chacarasses waren seit jeher auf ihre Privatsphäre bedacht und schützten sich vor neugierigen Blicken. Der verblichene Comte Alexandre hatte gar mal überlegt, einen elektrischen Zaun um das parkähnliche Grundstück zu ziehen. Doch seine Gattin Laetitia hatte ihn davon abgehalten. Eine Villa, die die Glückseligkeit im Namen trug, sei doch kein Hochsicherheitstrakt. Gleichwohl war es dem Comte wie schon seinen Vorfahren ein Anliegen gewesen, ungebetene Gäste fernzuhalten. Ganz im Gegensatz zur nahe gelegenen Villa Ephrussi de Rothschild, die sich mit ihrer prachtvollen Gartenanlage großer Berühmtheit erfreute und täglich Scharen von Besuchern empfing.
Natürlich konnte die Villa Béatitude in keinster Weise mit dem Glanz der Rothschilds konkurrieren, sie hatte auch kein schlossähnliches Hauptgebäude und keine wertvolle Porzellansammlung, aber sie war – darauf war die Familie stolz – um einiges älter als die Villa Ephrussi de Rothschild. Comte Alexandres Vater hatte sogar behauptet, dass die Baronesse de Rothschild, die bei ihnen mal zum Diner geladen war, erst durch ihren Besuch auf die Idee einer eigenen Villa auf Cap Ferrat gekommen sei. Vor allem habe sie der kleine Park der Chacarasses inspiriert. Dass es dann gleich ein Palast im Stil der italienischen Renaissance werden musste und die Gartenanlage exorbitante Ausmaße annahm, habe ihn nicht überrascht. In den Augen des versnobten alten Comte waren die Rothschilds … an dieser Stelle pflegte er sich verlegen zu räuspern … waren die Rothschilds »Neureiche«, die ihren unermesslichen Wohlstand eben gerne zur Schau stellten. Dagegen blieben die Grafen von Chacarasses, die ihren Adelstitel schon etwas länger besaßen, gerne unauffällig.
Letzteres aber war schlicht ein Gebot der Vernunft. Die Grafen von Chacarasses scheuten schon deshalb das Licht der Öffentlichkeit, weil sie seit Jahrhunderten einem geheimen Gewerbe nachgingen. Sie verstanden sich als Assassinen. Was in der wörtlichen Übersetzung »Mörder« bedeutete. Von den Niederungen krimineller Milieus aber trennten sie Welten. Sie hatten das Töten zur Kunstform erhoben und bekamen ihre Aufträge aus höchsten Kreisen. Der Legende nach waren sie schon für die Bourbonen tätig geworden, für die Medici, für Napoleon, sogar für den Vatikan.
Die Familientradition wurde bis heute fortgesetzt. Nach dem frühzeitigen und gewaltsam herbeigeführten Tod von Comte Alexandre hatte in der nächsten Generation als einziger Nachkomme der junge Lucien Comte de Chacarasse das Erbe angetreten. Auf dem Sterbebett war er von seinem Vater in die Pflicht genommen worden. Obwohl dieser wusste, dass sein Sohn einen »genetischen Defekt« hatte: Zwar hatte Lucien alle notwendigen Techniken erlernt, aber er hasste es, jemanden umzubringen! In der langen Linie seiner Vorfahren hatte es das noch nie gegeben.
1
Lucien stand im Park der Villa Béatitude. Hier hatte er schon als Kind gespielt, jetzt war er Anfang dreißig. Er liebte die alten Bäume und den Teich mit dem Springbrunnen. Auch das Rosenbeet, das ihn an seine verstorbene Mutter erinnerte, weil sie sich mit Hingabe um die Pflege gekümmert hatte. Heute hatte er dafür einen Gärtner.
Zum Missfallen seines Vaters hatte Lucien noch nie viel Wert auf angemessene Kleidung gelegt. Gerade eben machte er eine Ausnahme. Seinen Vater würde es freuen, aber er lebte nicht mehr. Lucien war zwar barfuß, aber er trug einen blütenweißen Kimono. Zum Kyudo, dem japanischen Bogenschießen, passten einfach keine ausgefransten Bermudas.
In etwa fünfzig Metern Entfernung hatte Lucien an einer alten Eiche eine Zielscheibe befestigt, das sogenannte Mato. In der Hand hielt er einen traditionellen Bogen aus Bambus. Er war asymmetrisch geformt und oben länger als unten. Das war typisch für die Kyudo-Bögen. Lucien hatte schon länger nicht mehr mit einem geschossen und war neugierig, ob er es noch konnte.
Kyudo bedeutete »Weg des Bogens«. Es gab rituelle, langsam auszuführende Bewegungsabläufe, die mindestens so wichtig waren, wie ins Ziel zu treffen. Lucien interpretierte Kyudo als Meditation. Es gab ein Buch mit dem Titel Zen in der Kunst des Bogenschießens. Er hatte es gelesen.
Er wusste, dass es darauf ankam, den Geist zu kontrollieren. Alle Gedanken mussten auf den Bogen, den Pfeil und das Ziel fokussiert werden. Nichts durfte einen ablenken.
Lucien hob den Bogen hoch über den Kopf und ließ ihn mit ausgestrecktem linkem Arm in Zeitlupentempo sinken, bis die Schussposition erreicht war. Er sah nur die Zielscheibe vor sich. Es existierte kein Park mehr. Kein Rosenbeet. Es plätscherte kein Springbrunnen. Er kontrollierte seinen Atem … und zog die Sehne mit dem Pfeil zurück.
Er verharrte eine Weile in dieser Position … dann ließ er den Pfeil los. Erst als er sich Sekundenbruchteile später in die Zielscheibe bohrte, setzten seine Sinne wieder ein. Plötzlich hörte er alles. Den Springbrunnen. Vögel zwitscherten. Er sah den Baum und den Park rundherum.
Lächelnd stellte er fest, dass der Pfeil ziemlich in die Mitte getroffen hatte. Nicht schlecht für den Anfang. Sein Vater wäre zufrieden.
Aus dem Augenwinkel sah er Rosalie näher kommen, die alte Haushälterin, die er schon so lange kannte, wie er auf der Welt war.
»Dein Vater hat zum Bogenschießen immer japanischen Tee getrunken«, sagte sie.
Rosalie reichte ihm eine Tasse.
Sollte er ihr sagen, dass er zum Bogenschießen lieber ein Glas Wein trinken würde?
»Danke, lieb von dir. Aber jetzt bring dich in Sicherheit. Nicht dass ich dich aus Versehen noch treffe.«
Sie hielt sich eine Hand ans Ohr.
»Mit wem willst du dich treffen?«
Lucien lachte. Ihre Schwerhörigkeit wurde immer schlimmer.
»Ich will niemanden treffen. Nicht einmal dich.«
Rosalie drohte ihm mit dem Finger.
»Das habe ich verstanden.«
Er wartete, bis sie zurück im Haus war. Der Tee schmeckte gar nicht so schlecht. Der Duft erinnerte an frisch gemähtes Gras.
Lucien wiederholte seine rituellen Übungen – und jagte weitere Pfeile ins Zentrum der Scheibe. Er wurde immer besser.
Ihm fiel ein großer Zen-Meister ein, der seinen Geist so auf sein Ziel ausrichten konnte, dass er es sogar mit verbundenen Augen traf.
Einen Versuch war es wert. Lucien schloss die Augen. Er drehte sich nach links, dann wieder nach rechts. Dabei dachte er fortwährend an die Zielscheibe. Er glaubte, sie vor sich zu sehen. Er brachte den Bogen in Position und den Pfeil in Anschlag. Einatmen, ausatmen … Dann ließ er den Pfeil von der Sehne …
Er hörte ein hässliches Geräusch. Die Zielscheibe war das nicht. Er öffnete die Augen … und sah, dass er einer bemoosten Marmorskulptur, die an den David von Michelangelo erinnerte, ein Ohr abgeschossen hatte. Wie konnte das passieren? Die Zielscheibe stand in einer völlig anderen Richtung.
Gott sei Dank, dachte Lucien, war Rosalie im Haus. Er stützte sich auf den Bogen und schüttelte lächelnd den Kopf. Er war wohl kein schlechter Bogenschütze, stellte er fest, aber offenbar kein Zen-Meister. Er nahm sich vor, beim Schießen in Zukunft immer die Augen geöffnet zu halten. Egal, mit welcher Waffe.
Wobei noch die vage Möglichkeit bestand, überlegte er, dass der Tee daran schuld war. Mit einem Glas Wein ging es vielleicht besser.
Eine knappe Stunde später saß Lucien auf seiner Vespa. Die Strecke von Cap Ferrat nach Villefranche-sur-Mer war nur kurz, kam ihm aber vor wie eine Reise von einer Welt in eine andere. Die Villa Béatitude war der gediegene Familiensitz der Chacarasses. Sie konfrontierte ihn mit der Geschichte seiner Vorfahren, ließ ihn an seine Eltern denken und an seinen mit dem Motorrad tödlich verunglückten Bruder – vor allem aber erinnerte sie ihn jede Minute an die Verpflichtung, die er eingegangen war. In Villefranche dagegen konnte er wie befreit aufatmen. Obwohl nur auf der anderen Seite der großen Bucht gelegen, erschien ihm der Ort Lichtjahre entfernt. Villefranche stand für ein anderes, unbeschwertes Leben, für das er sich vor Jahren entschieden hatte. Hier kannten ihn die meisten Menschen nur mit seinem Vornamen. Hier war er der Lucien, dem mit dem P’tit Bouchon ein beliebtes Lokal gehörte, in dem er fast jeden Abend sein eigener Stammgast war. Hier grüßten ihn auf der Straße fröhliche junge Frauen, von denen ihm einige mehr vertraut waren als andere. Manche kannten sogar sein kleines Appartement. Sie wussten, wo der Kühlschrank mit dem Champagner stand.
Wenn er in seiner Wohnung alleine war, saß er gerne mit einem Glas Wein auf seinem Balkon … und blickte über die große Bucht mit den dort ankernden Jachten auf die gegenüberliegende Halbinsel. Er wusste genau, wo sich die Villa Béatitude befand. Doch selbst mit dem Fernglas würde er sie nicht sehen. Und das war gut so.
Lucien hatte eine Erziehung genossen, die ihm wenig Respekt vor Gesetzen beigebracht hatte. Das merkte man auch seinem Fahrstil auf der Vespa an. Vom Cap Ferrat kommend, ignorierte er eine rote Ampel, schließlich war deutlich zu erkennen, dass kein anderes Fahrzeug kreuzte. Ein kurzes Stück fuhr er über den Bürgersteig, um einen Stau zu umgehen, was er als Beitrag zur Verkehrsentlastung interpretierte. Als er schließlich entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße abbog, grüßte ihn ein Streifenbeamter der Police municipale. Sie kannten sich vom Beachvolleyball.
Lucien parkte die Vespa in einem Hinterhof. Natürlich hatte er keinen Kimono mehr an, sondern Jeans – und ein Leinenhemd, das nach seinem Geschmack viel zu akkurat gebügelt war. Das passierte mit all seinen Kleidungsstücken, die Rosalie in die Hände bekam. Mit Mühe hatte er die alte Haushälterin davon abbringen können, die Löcher in seinen Jeans auszubessern. Sie glaubte ihm nicht, dass die Hosen genau so verkauft wurden. Rosalie, Rosalie … Er liebte sie.
Er lief über den Quai de l’Amiral Courbet und kam am legendären Hotel Welcome vorbei. Als sein Appartement mal einige Tage wegen eines Wasserrohrbruchs unbewohnbar gewesen war, hatte er sich im Welcome ein Zimmer genommen. Er hatte es genossen, dort zu wohnen, wo Jean Cocteau vor ziemlich genau hundert Jahren sein Opium geraucht hatte, wo unter anderem schon Charles Baudelaire, Oscar Wilde und Thomas Mann genächtigt hatten. Um das Hotel Welcome rankten sich abenteuerliche Geschichten. An der Hotelbar war das berühmte Pariser Nacktmodell Kiki de Montparnasse mal in eine Rauferei mit Nutten geraten. In seinem Appartement hatte Lucien ein großes Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1924 des amerikanischen Künstlers Man Ray hängen: Le violon d’Ingres. Der nackte Frauenrücken war jener von Kiki de Montparnasse. Er war von makelloser Schönheit. Lucien wusste noch weitere Geschichten aus dem Welcome-Hotel. Auch waren die Rolling Stones zu Besuch gewesen, die es 1971 als britische Steuerflüchtlinge nach Südfrankreich verschlagen hatte. Keith Richard hatte in Villefranche die noble Villa Nellcôte angemietet, wo die Stones vermutlich mehr Drogen konsumierten, als es Jean Cocteau je möglich war …
Luciens bevorzugte Droge wurde aus Trauben wie Sauvignon blanc gekeltert und vor der Abfüllung einige Jahre im Holzfass gelagert. Aber er war flexibel – natürlich mochte er auch die provenzalischen Rosé-Weine, zum Beispiel von den Trauben Grenache, Cinsault oder Syrah. Eine Auswahl der besten hatte er im P’tit Bouchon immer vorrätig. Er sollte sich beeilen, in einer Stunde bekam er eine neue Lieferung. Vorher musste er noch was abholen.
2
Im Karton unter seinem Arm hatte er die neuen Speisekarten. Die alten waren so abgegriffen, dass manche Gäste sie nur noch mit spitzen Fingern anfassten. Außerdem mussten die Preise korrigiert werden. Sie einfach zu überkleben sah nicht gut aus. Wobei die meisten Stammgäste sowieso keinen Blick in die gedruckte Speisekarte warfen. Auch lud sich kaum jemand mit dem QR-Code am Tisch die digitale Version aufs Handy. Sie richteten ihr Augenmerk auf die Schiefertafel mit den plats du jour. Dort standen die täglich wechselnden Empfehlungen des Küchenchefs. Lucien hatte ein Auge drauf, denn Roland wurde gelegentlich Opfer seiner eigenen Kreativität. Gerichte, die kein Mensch verstand, nicht einmal das Servicepersonal erklären konnte, waren nicht gut fürs Geschäft – und mussten hinterher von den Angestellten gegessen werden.
Die Tische im P’tit Bouchon waren schon eingedeckt. Alle Plätze waren reserviert. Ein Abend nach Luciens Geschmack.
Später übernahm er es persönlich, die Gäste zu empfangen und sie an ihren Tisch zu bringen. Mittlerweile machte er das nicht immer selbst, schließlich konnte was dazwischenkommen – zum Beispiel ein Auftrag, jemanden umzubringen. Aber daran wollte er heute nicht denken.
Viele Gäste kannte er, weil sie immer wieder kamen. Ein größeres Kompliment gab es nicht. Aber natürlich lernte er auch neue Gesichter kennen. Vor allem während der Saison, in der Touristen das P’tit Bouchon stürmten – und sauer waren, wenn sie keinen Tisch bekamen. Lucien schaffte es, immer freundlich zu bleiben.
Bei einer jungen Frau, die heute zu den ersten Gästen zählte, fiel ihm das besonders leicht. Erstens hatte sie eine Reservierung, das war schon mal gut, zweitens sah sie super aus. Schwarze Haare, wenig geschminkt, tolle Figur, kein Ehering … Er bemühte sich, sie nicht allzu intensiv zu mustern. Das gehörte sich nicht. Im Reservierungsbuch überprüfte er ihren Namen. Anne Dalmasso.
»Madame Dalmasso, Sie haben einen Tisch für zwei Personen reserviert«, sagte er. »Noch haben Sie die Wahl, eher am Fenster oder näher an der Bar?«
Das P’tit Bouchon hatte zwar auch eine schmale Terrasse an der Straße, die wenigen Tische dort waren aber nur bei ausländischen Touristen begehrt, Franzosen saßen lieber drin. Einheimische sowieso.
»Ist mir egal«, antwortete sie. »Übrigens können Sie ein Gedeck entfernen, mein Begleiter kommt nicht.«
Fröhlich sah sie dabei nicht aus.
»Das tut mir leid …«
»Mir nicht, ich habe mich vor einer Stunde von ihm getrennt. Aber das ist ja kein Grund, nicht zu Abend zu essen. Dann halt allein.«
Kurz hegte er den Gedanken, diese Anne Dalmasso an seinen privaten Ecktisch einzuladen und den Empfang der weiteren Gäste Paul zu übertragen. Aber das erschien ihm doch zu plump. Außerdem wirkte sie so, als ob sie durchaus alleine zu Abend essen könnte, darauf vielleicht sogar gerade Wert legte.
»Sie haben völlig recht«, sagte er, »männliche Begleitung wird oft überschätzt. Ich hoffe, der Abend wird Ihnen dennoch gefallen.«
Anne Dalmasso sah ihn stirnrunzelnd an.
»Das sagen Sie ausgerechnet als Mann?«
»Nein, nicht als Mann, aber als jemand, der in der Gastronomie schon viel erlebt hat. Darf ich vorausgehen?«
Er zeigte ihr den Zweiertisch, der seiner Meinung nach der schönste war.
Inès, die zuständige Bedienung, kam vorbei.
»Ein Gedeck kann abserviert werden«, sagte er zu ihr.
»Abserviert klingt gut«, sagte Anne Dalmasso mit leisem Lächeln. »Genau das habe ich gerade mit diesem Idioten gemacht.«
»Es steht mir nicht zu, Sie zu diesem Schritt zu beglückwünschen, aber darf ich Sie zu einem Glas Champagner einladen?« Er wartete ihre Antwort nicht ab. »Bitte ein Glas Champagner aufs Haus«, sagte er zu Inès.
Anne Dalmasso nickte.
»Merci, das ist keine schlechte Idee. Champagner passt zu allen Lebenslagen.«
Sie wurde ihm immer sympathischer. Dennoch hielt er es für klug, sie jetzt alleine zu lassen.
Er deutete zum Eingang.
»Bitte entschuldigen Sie mich, die nächsten Gäste warten schon.«
»Sind Sie hier der Platzanweiser?«
»Ja, so kann man das sagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bon appetit.«
Später beobachtete er, wie sich Anne – in seinen Gedanken nannte er sie wie alle Frauen, die ihm gefielen, beim Vornamen – geradezu enthemmt aufs Essen stürzte. Sie begann mit Austern fines de claire. Die Platte mit zwölf Austernwurde normalerweise für zwei Personen serviert. Sie schlürfte die huîtres mit Hingabe aus. Dazu ließ sie sich mehrfach aus einer Flasche Muscadet Sèvre et Maine nachschenken, keine schlechte Wahl. Als Nächstes hatte sie sich für einen demi homard entschieden. Oder handelte es sich sogar um einen ganzen Hummer?
Lucien gewann den Eindruck, dass Anne die Trennung von dem »Idioten« doch nicht auf die leichte Schulter nahm. Gab es so etwas wie Frustessen?
Er hieß gerade Stammgäste aus Saint-Jean-Cap-Ferrat willkommen, da hörte er plötzlich einen Schlag und Stimmengewirr. Lucien drehte sich um und sah, dass die Aufregung von Annes Tisch kam. Sie selbst war nicht zu sehen. Lucien eilte durch das Lokal. Paul, der chef de service, traf fast gleichzeitig ein. Annes Stuhl war umgekippt, die Tischdecke heruntergerissen … Sie selbst lag zusammengekrümmt am Boden. Paul beugte sich zu ihr, versuchte, mit ihr zu sprechen, aber Anne war dazu nicht in der Lage. Sie rang nach Luft, ihre Augen waren geweitet, und ihr Gesicht war rot angelaufen.
»Das sieht nicht gut aus«, stellte Paul lakonisch fest.
Da hatte er zweifellos recht. Lucien nahm sein Handy und verständigte den Notarzt.
»Verdacht auf anaphylaktischen Schock«, gab er durch. »C’est urgent, es eilt.«
Die Symptome schienen ihm eindeutig. Als Ursache vermutete er eine allergische Reaktion auf die Austern und den Hummer. Das passierte gelegentlich bei einem Gast, weshalb er sofort daraufkam. Allerdings hatte er noch nie erlebt, dass die Reaktion so schnell und so heftig erfolgte.
Anne krümmte sich. Lucien fühlte ihren Puls. Er raste. Er sprach ihr gut zu. Eine wirkliche Hilfe war das nicht.
Die Bedienung Inès kam aus der Küche mit einem Notfallkoffer herbeigeeilt.
Lucien erinnerte sich an einen Fall vor einigen Monaten. Da hatte der Notarzt dem Gast als Erstes eine Spritze gegeben. Er wusste auch noch, welche.
»Paul, findest du im Koffer eine Adrenalinspritze?«
»Adrénaline, un moment … Et voilà …«
Lucien riss die Einwegspritze aus der sterilen Verpackung und entfernte die Schutzkappe.
Anne röchelte. Sie schien zu ersticken.
Lucien bat Inès, Annes Kleid nach oben zu schieben. Er wollte das nicht selber tun.
Sobald ihr Oberschenkel frei war, stieß er kurz entschlossen die Nadel in den Muskel und injizierte das Adrenalin. Dabei hoffte er inständig, dass er gerade das Richtige tat. Er hatte gelernt, Menschen umzubringen. Wie man sie am Leben erhielt, hatte man ihm nicht beigebracht.
Inès hielt Anne die Hand und redete beruhigend auf sie ein.
»Sie haben eine Spritze bekommen, gleich wird es besser. Der Notarzt muss auch gleich hier sein. Tout va bien, alles wird gut …«
»Sollen wir sie auf den Rücken legen und ihre Beine hoch lagern?«, fragte Paul.
Lucien zuckte ratlos mit den Schultern.
»Klingt gut, kann aber auch verkehrt sein.«
»Ich mach’s.«
Zwanzig Minuten später war alles vorbei. Gottlob in dem Sinne, dass Annes dramatische Symptome im Abklingen begriffen waren und sie sogar wieder ansprechbar war. Der Notarzt hatte gesagt, dass ihr die Adrenalinspritze womöglich das Leben gerettet hatte. Eine solche Akutreaktion bei einem anaphylaktischen Schock könne zu einem Organversagen führen, zu Erstickung und Kreislaufstillstand.
Lucien sah dem Notfallwagen der SAMU hinterher, der mit Anne unterwegs ins Krankenhaus war. Bei dem Service d’Aide Médicale Urgente war sie in den besten Händen.
Plötzlich stand Achille Giraud neben ihm. Der Capitaine der Gendarmerie nationale klopfte ihm auf die Schulter.
»Salut, mon ami. Hast du gerade versucht, einen Gast umzubringen?«, scherzte er.
Lucien mochte seinen Humor nicht. Die Anspielungen nervten ihn. Sie waren befreundet, aber er wurde nicht schlau aus ihm. Was glaubte Achille von ihm zu wissen? Gegen seinen Vater hatte er was in der Hand gehabt, weshalb er sich von ihm hatte schmieren lassen. Achille hatte Lucien davon überzeugt, dass es besser war, diese Tradition fortzusetzen. Gegen ihn selbst hatte er gewiss nichts in der Hand. Warum dann diese blöden Witze?
»Du kannst meinen Koch verhaften«, antwortete Lucien. »Wenn, dann war es Roland, der einen Gast vergiftet hat.«
»Wirklich?«
»Quatsch, natürlich nicht. Die junge Frau hatte eine heftige allergische Reaktion auf zu viele Austern und Hummer. Aber sie hat überlebt. Ich hoffe, dass sie uns bald wieder als Gast beehrt. Wir haben ja nicht nur Muscheln und Schalentiere auf unserer Karte.«
»Ich liebe eure Lammkoteletts«, stellte Achille fest. »Apropos, hast du an deinem Tisch noch ein Plätzchen frei. Erstens habe ich Hunger, und zweitens gibt es was zu besprechen.«
Lucien konnte sich im Moment eine angenehmere Abwechslung vorstellen, als mit dem Capitaine zu speisen. Vor Kurzem hatte er noch mit dem Gedanken gespielt, sich im Verlauf des Abends zu Anne an den Tisch zu setzen. Sie wäre zweifellos eine charmantere Gesprächspartnerin gewesen. Aber sie war ihm abhandengekommen und auf dem Weg ins Krankenhaus. Nun denn, dann halt Achille. Wobei er schon jetzt wusste, dass der Capitaine keine Anstalten machen würde, seine Lammkoteletts und den konsumierten Wein zu bezahlen. Wie selbstverständlich würde er davon ausgehen, eingeladen zu sein.
Achille gönnte sich zum Auftakt eine soupe de poisson, nach der Fischsuppe die erwähnten côtelettes d’agneau und zum Dessert eine crème brûlée. Obwohl er sicherlich mit dem Auto da war, achtete der Capitaine beim Wein nicht auf die Promillegrenze. Keine Polizeistreife würde es wagen, ihn zu kontrollieren.
»Lucien, mon ami, was ich noch besprechen wollte …« Er zögerte und nahm einen Schluck vom Wein. »Nun, du kannst es dir wohl denken. Du hast dich netterweise bereit erklärt, mir wie schon dein Vater regelmäßig eine kleine Spende zukommen zu lassen. Ich will ja nicht aufdringlich erscheinen, aber es wäre wieder mal so weit.«
Lucien sah ihn stirnrunzelnd an. Ihm gefiel diese Vereinbarung immer weniger. Sie kam ihm vor wie ein Schuldeingeständnis – dabei lebte er mit dem Vorsatz, keinem Menschen ein Leid zuzufügen. Aber wie es der Teufel wollte, konnte es vielleicht doch mal passieren – dann wäre es nicht falsch, Achille zum Freund zu haben. Auch konnte er kein Interesse daran haben, dass der Capitaine seinen verstorbenen Vater belastete und die weiße Weste der Grafen von Chacarasses beschmutzte.
Lucien rang sich ein Lächeln ab.
»Ach ja, ich erinnere mich. Wie die Zeit vergeht … Ich vermute, du bevorzugst wieder Barzahlung?«
»Das wäre sehr angenehm.«
»Dann lass uns demnächst einen Termin vereinbaren.«
»Très bien. Lucien, du bist ein wahrer Freund. Du kannst immer auf mich zählen. Sogar, wenn dein Koch einen Gast vergiftet.«
3
Als Lucien am nächsten Morgen mit einer Tasse Kaffee auf seinem Balkon stand und hinaus auf die Bucht mit den dort ankernden Jachten blickte, dachte er, dass ihm ein schöner Tag bevorstand. Er konnte nicht ahnen, dass ihm später sein Onkel Edmond die gute Laune gehörig verderben würde. Doch zunächst war alles in Ordnung. Lucien dachte an Anne, die ihm ausnehmend gut gefallen hatte.
Er wusste, in welche Notaufnahme sie gestern Abend gebracht wurde. Ob man sie wohl über Nacht dabehalten hatte?
Lucien rief in der Klinik an. Zunächst wollte man ihm keine Auskunft geben. Als er aber erklärte, dass besagte Anne Dalmasso gestern Abend in seinem Lokal kollabiert sei und er nur schnell ihre vergessene Handtasche vorbeibringen wolle, bekam er die gewünschte Information. Die Patientin werde heute Nachmittag entlassen, erfuhr er. Er könne die Handtasche an der Rezeption hinterlegen.
Lucien bedankte sich. Natürlich würde er die Handtasche nicht an der Rezeption hinterlegen. Denn erstens hatte sie keine dabeigehabt. Und zweitens wollte er sich persönlich davon überzeugen, dass es ihr wieder gut ging. Als Patron des P’tit Bouchon gehörte sich das so. Er musste grinsen. Er wusste, dass das eine faule Ausrede war.
Nach einem kurzen Frühstück, das aus einem Croissant, einer zweiten Tasse Kaffee und frischem Orangensaft bestand, lief er zu einem Blumengeschäft und kaufte einen kleinen Strauß.
Dann startete er seine Vespa. Zum Hôpital Pasteur in Nizza war es nicht weit. In der Notaufnahme war er schon mal gewesen, aber das war eine andere Geschichte. Er fand heraus, in welchem Zimmer Anne lag. Minuten später klopfte er und trat ein. Es war nur ein Bett belegt. Sie hing noch am Tropf einer Infusionsflasche, sah aber schon wieder quicklebendig aus. Verwundert blickte sie ihn an.
»Madame Dalmasso. Entschuldigen Sie die Störung. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich Sie gestern an Ihren Tisch gebracht habe. In Vertretung der gesamten équipe des P’tit Bouchon darf ich Ihnen mit diesen Blumen die besten Genesungswünsche überbringen.«
Ihr Lächeln gefiel ihm. Auch ihre Augen.
»Das ist lieb, aber mir geht es schon wieder gut. Weiß auch nicht, warum mir das gestern passiert ist. Hoffentlich habe ich nicht zu viele Unannehmlichkeiten bereitet.«
»Nicht der Rede wert. Aber wir haben uns wirklich Sorgen gemacht.«
»Ein anaphylaktischer Schock, haben mir die Ärzte gesagt. Eine allergische Reaktion vielleicht auf die Austern, keine Ahnung. Ich hab wohl Glück gehabt, weil mir im Lokal jemand eine Adrenalinspritze gegeben hat.«
»Ich erinnere mich.«
»Wissen Sie, wer das war?«
»Doch, ja, aber das spielt keine Rolle. Hauptsache, es geht Ihnen wieder gut.«
»Bitte richten Sie meinem Retter meinen besten Dank aus.«
»Mach ich gerne.«
»Da fällt mir ein, ich muss noch die Rechnung bezahlen.«
»Kommt nicht infrage. Im Gegenteil würde sich das P’tit Bouchon freuen, wenn Sie wieder mal als Gast vorbeikämen. Sie sind selbstverständlich eingeladen.« Lucien grinste. »Aber wir würden Ihnen weder Austern noch Schalentiere servieren.«
Anne verzog das Gesicht.
»Keine Sorge. Ich darf gar nicht daran denken.«
»Wenn Sie mir noch eine Frage erlauben … Sie haben mir gestern verraten, dass Sie sich kurz vor Ihrem Besuch von Ihrem Freund getrennt haben. Das geht mich natürlich nichts an …«
»Stimmt«, stellte sie fest. Aber sie schien ihm nicht böse zu sein.
»Wenn Sie also jemanden brauchen, der Sie nach Hause bringt, stehe ich gerne zur Verfügung.«
Sie legte lächelnd den Kopf zur Seite.
»Ist das Ihre Idee?«
»Die Idee unseres Patrons. Wie auch der Blumenstrauß.«
»Und Sie tun, was er sagt?«
»Auf jeden Fall. Er lässt mir keine Wahl.«
»Na dann. Meine Infusion ist in zehn Minuten durch, anschließend darf ich gehen. Sie können mich gerne heimbringen. Oder besser: Sie bringen mich nach Villefranche, wo ich gestern geparkt habe.«
Lucien räusperte sich verlegen.
»Es gibt ein kleines Problem, ich bin mit meiner Vespa hier …«
Anne lachte.
»Kein Problem, ich liebe Motorroller. Hauptsache, Sie haben einen Helm für mich.«
Mit Rücksicht auf seine Sozia fuhr Lucien weniger rasant als üblich. Sie saß hinter ihm auf der Vespa. Mit der einen Hand hielt sie sich an ihm fest, mit der anderen versuchte sie, den Blumenstrauß vor dem Fahrtwind zu schützen. Gepäck hatte sie ja keines dabei. Er bedauerte, dass die Strecke nach Villefranche-sur-Mer so kurz war. Es war ein angenehmes Gefühl, sie im Rücken zu spüren, auch wenn er sie so nicht sehen konnte.
In Villefranche lotste sie ihn in eine Seitenstraße nicht weit vom P’tit Bouchon. Dort angekommen, verstand er, warum sie bei Vespa gelacht hatte. Sie fuhr ebenfalls einen Motorroller. Allerdings ein Modell der Marke Peugeot. Sie war also patriotischer als er, hatte aber wahrscheinlich auch keine italienische Mutter gehabt.
»Sind Sie fit genug, selber zu fahren?«, fragte er.
»Ich bin fit wie ein Turnschuh. Weiß auch nicht, was in den Infusionen alles drin war. Jedenfalls müssen Sie sich keine Sorgen machen. Mit dem Motorroller kann ich sogar im betrunkenen Zustand fahren.«
»Das hätten Sie gestern Abend wohl auch gemacht, wenn Sie nicht vom Stuhl gekippt wären.«
»Aber natürlich. Wie wäre ich sonst heimgekommen?«
»Haben Sie es weit?«
Sie sah ihn lächelnd an.
»Das ist eine Fangfrage. Sie wollen wissen, wo ich wohne, stimmt’s?«
»Nur, wenn Sie es mir freiwillig verraten. Immerhin kenne ich schon Ihren Namen, Anne Dalmasso. Das ist ja ein Anfang …«
»Ein Anfang von was?«
Er zuckte grinsend mit den Schultern.
»Ich hab keine Ahnung.«
»Ja, Lucien, so ist das. Wir haben beide keine Ahnung.«
»Sie kennen meinen Vornamen?«
»Stimmt, obwohl Sie sich unhöflicherweise nicht vorgestellt haben. Ich weiß sogar, dass Sie im P’tit Bouchon nicht der Platzanweiser sind, sondern dass Ihnen das Restaurant gehört.«
Er sah sie erstaunt an.
»Ich habe die nette Bedienung gefragt«, erklärte sie, »die hat es mir verraten. Erstaunlicherweise habe ich es trotz meines Kollapses in Erinnerung behalten. Folglich ist mir auch klar, warum Sie, wie Sie gesagt haben, alles tun, was Ihnen der Patron anschafft … weil Sie es selber sind. Das wäre ja sonst schizophren. Umso mehr habe ich mich über Ihren Krankenbesuch gefreut. Auch über die Blumen.« Sie gab ihm einen überraschenden Kuss auf die Wange. »Lucien, mille mercis. Wir sehen uns bestimmt wieder, spätestens, wenn ich Ihre Einladung ins Restaurant annehme. Ich freue mich, aber jetzt muss ich wirklich weiter.«
»Ciao, Anne. Und passen Sie auf sich auf.«
4
Wenig später fuhr er über die gekieste Auffahrt der Villa Béatitude. In Gedanken war er noch bei Anne. Es amüsierte Lucien, wie sie ihn hatte auflaufen lassen. Auch dass sie ihm nicht verraten hatte, wo sie wohnte, gefiel ihm. Er mochte Frauen, die nicht gleich alles von sich ausplauderten. Ihm fiel ein, dass er immerhin Annes Telefonnummer kannte. Die stand wie bei allen Gästen im Reservierungsbuch des P’tit Bouchon. Trotzdem würde er sie vorläufig nicht anrufen. Das wäre uncool. Vorläufig nicht, überlegte er, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht doch …
Er stellte seine Vespa neben einer Stelle ab, wo um diese Tageszeit sonst häufig ein roter Alfa stand. Das Cabriolet gehörte Francine. Sie war die Privatsekretärin seines Vaters gewesen – und noch viel mehr. Jetzt arbeitete sie für ihn, war aber offenbar nicht da.
Rosalie kam aus dem Haus.
»Du bist spät dran, mein Lieber. Ich hatte dich zum Frühstück erwartet.«
Sie hatte recht, das hatte er mit ihr ausgemacht.
»Tut mir leid, aber wir hatten im Restaurant einen Notfall …«
Rosalie drohte ihm lächelnd mit dem Finger.
»Schwindel mich nicht an, am Vormittag habt ihr doch gar nicht geöffnet. Gib zu, du hast die alte Rosalie vergessen.«
»Ich will es dir erklären, der Notfall war gestern Abend …«
»Eine großartige Ausrede, jetzt ist Vormittag.«
»Ein Gast hatte gestern Abend einen allergischen Schock und wurde vom Notarzt abgeholt. Heute Morgen habe ich sie im Krankenhaus besucht.«
Sie zog die Augenbrauen nach oben.
»Aha, jetzt hast du dich verraten. Es handelt sich um eine Frau. Wahrscheinlich ist sie jung und hübsch, deshalb deine Fürsorge.«
Lucien schüttelte belustigt den Kopf. Weil Rosalie schlecht hörte, bekam sie oft die Hälfte nicht mit. Gerade aber hatte sie jedes Wort verstanden.
»Ja, eine Frau«, gab er zu. »Aber vor allem ein Gast, deshalb war mir der Krankenbesuch so wichtig …«
»Taratata, papperlapapp, du musst nicht weiterreden. Die Frau ist jung und sieht gut aus, so viel steht fest. Ich hoffe, sie hat sich über deinen Besuch gefreut. So, und jetzt komm rein. Ich hab frische pains au chocolat, und der Kaffee sollte noch warm sein.«
Schokobrötchen hatte er vielleicht als Kind gemocht, heute aber nicht mehr. Doch wollte er sie nicht schon wieder enttäuschen.
»Sehr gerne. Wo ist eigentlich Francine?«
»Sie hat eine bessere Ausrede als du. Sie ist beim Arzt und kommt deshalb später.«
»Ist sie krank?«
»Natürlich nicht, sonst würde sie ja wohl kaum später kommen.«
Er stellte fest, dass Rosalie heute nicht nur jedes Wort verstand, sondern auch logisch argumentierte. Entweder sprach er lauter als gewöhnlich … oder sie hatte sich insgeheim doch Hörgeräte angeschafft. Er schielte zu ihren Ohren. Aber die weißen Haare ließen nichts erkennen.
Sie saßen noch am Küchentisch, als Lucien einen Anruf bekam. Auf dem Display erkannte er, von wem: Edmond Comte de Chacarasse war der Bruder seines verstorbenen Vaters und lebte nur wenige Kilometer entfernt in Beaulieu-sur-Mer. Sie hatten ein ausgesprochen distanziertes Verhältnis. Die Gründe waren vielfältig. Doch war er Edmond auf fatale Weise ausgeliefert. Seinem Vater hatte Lucien versprochen, das Erbe der Chacarasses fortzusetzen. Zunächst hatte er gehofft, dass dieser vergiftete Kelch an ihm vorübergehen würde – indem er einfach keine Aufträge bekam. Dann aber hatte sich herausgestellt, dass sein Onkel Edmond schon in der Vergangenheit derjenige gewesen war, über den die Aufträge auf verschlungenen und undurchsichtigen Pfaden hereinkamen. Sein Vater hatte sie dann ausgeführt. Eine »Arbeitsteilung«, die über seinen Tod hinaus Bestand hatte. Jetzt war er es, der in die Pflicht genommen wurde. Folglich hatte Edmonds Anruf nichts Gutes zu bedeuten. Lucien ahnte, was gleich auf ihn zukam.
»Salut, Edmond«, begrüßte er ihn kurz und knapp. »Was verschafft mir die Ehre deines Anrufs?«
Das war ironisch gemeint. Ob Edmond den Unterton verstand?
»Kannst dir ja denken. Ich möchte, dass du bei mir vorbeischaust. Am besten gleich.«
»Warum so eilig?«
»Weil es mir gerade gut passt, deshalb!«
Was war denn das für eine Begründung? Sollte er ihm Kontra geben? Lucien fand diese Machtspielchen albern. Keiner hatte was davon.
»Du hast Glück. Ich kann es einrichten«, antwortete er.
»Dann bis gleich. À tout à l’heure.«
Lucien legte das Handy zur Seite.
Rosalie schaute ihn fragend an.
»Er hat wieder einen Auftrag für dich, stimmt’s?«
»Sieht ganz so aus. Ich mag ihn nicht.«
»Ich auch nicht, das weißt du, aber aus einem anderen Grund.«
»Den du mir immer noch nicht verraten hast.«
»Nein, habe ich nicht … vielleicht werde ich es mal tun …« Sie verzog das Gesicht. »Aber es bringt nichts. Was geschehen ist, ist geschehen.«
Lucien war im Prinzip ihrer Meinung. Doch interessierte ihn wirklich, weshalb Rosalie seinen Onkel verabscheute. Es musste was Persönliches sein. Er würde es herausfinden. Nicht heute, aber irgendwann. Rosalie trank gerne Marc de Provence. Er würde sie beschwipst machen, vielleicht löste das ihre Zunge.
Lucien gab sich einen Ruck und stand auf.
»Am besten bringe ich es hinter mich. Ich fahr jetzt zu Edmond, komme aber im Anschluss wieder her. Bis dahin ist ja vielleicht auch Francine zurück vom Arzt.«
Rosalie langte sich ans Ohr.
»Du musst zum Arzt? Warum denn das?«
Lucien sah sie lächelnd an. Spätestens jetzt wusste er, dass sie doch keine Hörgeräte in den Ohren hatte.
»Du hast recht, mir fehlt nichts. Ich sag den Arzt ab.«
»Très bien. Weißt du, warum ich so alt geworden bin? Weil ich nie zum Arzt gehe, das ist die beste Vorsorge.«
Beaulieu-sur-Mer, wo Edmond eine repräsentative Art-déco-Villa bewohnte, war von der Villa Béatitude fast noch schneller erreichbar als Villefranche-sur-Mer. Nach Luciens Empfinden waren diese Orte auf beiden Seiten des Cap Ferrat aber himmelweit voneinander entfernt. Villefranche stand für ein unbeschwertes, lockeres Leben. Beaulieu dagegen kam ihm steifer, gediegener vor. Ihm war klar, dass dieser Eindruck wenig objektiv war … und direkt mit seinem Onkel zu tun hatte. Edmond Comte de Chacarasse schwamm nicht im Meer und tanzte auf keiner Party – schon deshalb, weil er von der Hüfte abwärts gelähmt im Rollstuhl saß. Lucien kannte ihn nur als Invalide. Er wusste, dass Edmond als junger Mann beim Fallschirmspringen verunglückt war. Seltsamerweise hatte er kein Mitleid mit ihm. Vielleicht deshalb, weil Edmond chronisch schlecht gelaunt war und ihn gerne herablassend behandelte. Auch wusste er, dass sein Vater und Edmond zwar Brüder waren, aber ihre Differenzen hatten. Schon als Kind hatte er heftige Auseinandersetzungen miterlebt, ohne je zu verstehen, worum es ging. Doch war es nie zum Bruch zwischen den Brüdern gekommen. Die Familienbande hielten sie zusammen – und die Verpflichtung, die sie beide eingegangen waren. Die Verpflichtung nämlich, Aufträge zu erledigen, die zum Ziel hatten, ein Menschenleben zu eliminieren. Diskret und effektiv. Ohne nach den Gründen zu fragen. So wie es die Grafen von Chacarasses seit Generationen erfolgreich taten. Weil Edmond an den Rollstuhl gefesselt war und für den aktiven Einsatz ausschied, hatten sie eine Arbeitsteilung vereinbart. Edmond nahm die Aufträge entgegen – wie dies erfolgte, wusste Lucien bis heute nicht –, und sein Vater führte sie aus. Edmond, der Beschaffer, und Alexandre, der Vollstrecker. Zwei Brüder, die die Familientradition der Chacarasses zusammenschweißte, die sich ansonsten aber aus dem Weg gingen.
Lucien stellte die Vespa auf der Straße ab und ging die letzten Meter zu Fuß. Er musste nicht läuten. Die Überwachungskamera hatte ihn längst erfasst. Ein Butler öffnete die Tür und begrüßte ihn mit englischem Akzent. Diese Attitüde nervte ihn jedes Mal, weil er wusste, dass der gute Mann ein waschechter Franzose war. Wie so vieles im Leben war auch er ein Schwindel.
Lucien wurde von ihm in den Pavillon geführt, wo Edmond im Rollstuhl auf ihn wartete. Das Ritual war immer das gleiche. Nur fehlte heute der obligatorische Tee. Sein Onkel wartete, bis der Butler die Tür hinter sich geschlossen hatte. In der Zeit musterte Edmond ihn vom Scheitel bis zur Sohle.
»Irgendwas nicht in Ordnung?«, fragte Lucien.
»Du hast zugenommen. Wird Zeit, dass du wieder in Bewegung kommst.«
Lucien stellte sich zwar nie auf die Waage, aber er war sich sicher, dass sein Gewicht das gleiche war wie immer.
»Nett, dass du dich um meine Fitness sorgst. Wäre aber nicht nötig.«
»Ich habe einen Auftrag für dich. Er sollte dich vor keine allzu großen Probleme stellen. Die Zielperson heißt Jacques Collard. Vierundfünfzig Jahre alt, wohnhaft in Marseille. Derzeit ohne Arbeit. Liquidation innerhalb der nächsten zehn Tage. Hinsichtlich der Tötungsart hat unser Auftraggeber keine Präferenzen.«
Der geschäftsmäßige Ton war Lucien zuwider. Aber wahrscheinlich ging es nicht anders.
»Hier habe ich ein Foto von ihm. Kannst es behalten. Hinten habe ich die Adresse draufgeschrieben.«
»Lebt er alleine?«
»Weiß ich nicht. Falls er eine Frau hat, kannst du sie am Leben lassen.«
Wie großherzig, dachte Lucien. Geradezu menschenfreundlich.
»Irgendeinen Anhaltspunkt, warum dieser Collard sterben muss?«
Edmond lachte krächzend. Er war chronisch heiser.
»Du versuchst es immer wieder. Du erfährst von mir weder den Auftraggeber noch die Hintergründe. Das sind die Spielregeln …«
»Ist kein Spiel.«
»Dann halt unsere Geschäftsvereinbarung. Du kennst den Delinquenten, mehr musst du nicht wissen. Ist auch zu deinem Schutz.«
Unsinn, dachte Lucien. Etwas nicht zu wissen war noch nie ein guter Schutz.
»Das Honorar ist bereits auf unserem Treuhandkonto«, fuhr Edmond fort. »In üblicher Höhe. Sobald der Auftrag erledigt ist, wird das Geld freigegeben. Business as usual.«
Schon wieder eine Formulierung, die ihm missfiel. Doch war es besser, darauf nicht zu reagieren. Edmond sollte glauben, dass er den Job mittlerweile genauso nüchtern sah. Er durfte an ihm nicht zweifeln – umso leichter fiel es, ihn hinters Licht zu führen.
Lucien steckte das Foto ein.
»Dann fahre ich also nach Marseille«, sagte er betont unaufgeregt, fast gelangweilt. »Ich mag die Stadt. Dort gibt es immer noch die beste Bouillabaisse … und die drittbeste.«
»Was ist mit der zweitbesten?«
»Die gibt’s bei mir im P’tit Bouchon.«
»Angeber.«
»Kannst ja mal vorbeikommen und dich davon überzeugen.«
»Das wird nie passieren.«
5
In der Eingangshalle der Villa Béatitude blieb Lucien vor der Marmorbüste seines Urgroßvaters stehen. Von ihm war überliefert, auf welche Weise er viele seiner Aufträge ausgeführt hatte. Er war ein exzellenter Pistolenschütze und Degenfechter gewesen. Deshalb musste er seine Mordopfer nur so lange provozieren, vor Freunden beleidigen oder ihren Frauen schöne Augen machen, bis sie ihn, um ihre Ehre zu verteidigen, zum Duell aufforderten. Damit war ihr Schicksal besiegelt – und der Auftrag mit Stil und Würde erledigt.
Zwar hatte es auf französischem Boden noch 1967 ein legendäres Duell gegeben, allerdings ohne Beteiligung eines Chacarasse, dann aber sei es mit dieser schönen Tradition endgültig vorbei gewesen, hatte Luciens Vater beklagt.
Das Degenduell von 1967 ging auf einen Streit in der französischen Nationalversammlung zurück. Der sozialistische Fraktionschef und langjährige Bürgermeister von Marseille Gaston Defferre hatte sich mit dem Abgeordneten René Ribière angelegt. Der war so dumm, ihn zum Duell mit dem Degen zu fordern – dabei konnte er überhaupt nicht fechten. Der viel ältere »Haudegen« Defferre aber schon. Zu den Sekundanten zählte pikanterweise der Rechtspopulist Jean-Marie Le Pen. Nach den ersten Treffern von Defferre wurde der ungleiche Kampf abgebrochen. Ribière war nur leicht verletzt – und konnte am nächsten Tag seine Verlobte heiraten.
So glimpflich waren die Duelle der Grafen von Chacarasses nie ausgegangen. Natürlich nicht, sonst hätten sie ja ihren Zweck verfehlt. Im Gegensatz zu seinem Vater fand Lucien, dass diese Zweikämpfe zu Recht verboten waren. Duelle hatten Berühmtheiten wie Ferdinand Lassalle oder Alexander Puschkin das Leben gekostet. Was alles hätten sie im Leben noch leisten können?
»Was stehst du hier dumm herum?«
Lucien hatte Rosalie nicht kommen hören. Hatte er es jetzt auch an den Ohren? Das wäre bei seinem Job ziemlich unvorteilhaft.
»Ich habe nachgedacht. Über meinen Urgroßvater und über meine Familie.«
»Das bringt nichts, Lucien, glaub mir. Lass die Vergangenheit ruhen. Sag mir lieber, was Edmond von dir wollte?«
»Leider das, was wir vermutet haben.«
Sie schüttelte den Kopf.
»Warum gibt er keine Ruhe? Soll das immer so weitergehen?«
Lucien deutete auf die Büste seines Urgroßvaters. »Er hätte es so gewollt. Und nicht nur er, auch mein Vater.«
»Da hast du wohl recht«, sagte sie resignierend. »Und … wirst du es tun?«
»Natürlich.« Er lächelte. »Aber auf meine Art.«
Sie tätschelte seinen Arm.
»Du bist ein guter Junge.«
Er überlegte, nach seinem Appartement zu sehen, das er sich gerade in einem Seitenflügel der Villa errichten ließ. Aber der Bau ging nur schleppend voran. Außerdem war er sowieso viel lieber in seiner Wohnung auf der anderen Seite der großen Bucht. Also war es egal, wann es fertig wurde.
Lucien lief die große, geschwungene Steintreppe hinauf in den ersten Stock. Als Kind war er über die Stufen mit dem Schlitten in die Halle gesaust. Um die Wette mit seinem Bruder Raymond. Einige Kratzspuren sah man bis heute. Nicht nur vom Schlitten, sondern, wenn man wusste, wo, auch von den Hufeisen der Pferde, mit denen seine Vorfahren im trunkenen Zustand direkt vor ihre Schlafgemächer geritten waren. Die herrschaftliche Villa Béatitude barg nicht nur dunkle Geheimnisse, sondern auch schöne und lustige Erinnerungen.
Vor der Tür zum Büro zögerte er kurz. Drinnen wartete Francine. Er erinnerte sich an ihre erste Begegnung. Das war am Tag nach dem Tod seines Vaters gewesen. Bei ihrem Anblick hatte es ihm die Rede verschlagen. Nicht nur, weil sie fantastisch aussah und etwa in seinem Alter war, was er nicht erwartet hatte, sondern weil sie einen auffälligen Smaragdring am Finger hatte, den er von seiner verstorbenen Mutter kannte. Die Schlussfolgerung lag nahe: Francine war nicht nur die Sekretärin seines Vaters gewesen, sondern … sondern auch seine Geliebte. Eine Geliebte, die ihre Tränen kaum hatte zurückhalten und nur mit größter Anstrengung ihre Haltung hatte bewahren können.
Seit dem Tod des Comte Alexandre hatte er zu Francine ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Das musste auch sein, denn wie sich herausstellte, kannte sie das Familiengeheimnis. Sie wusste, welcher Tätigkeit sein Vater nachgegangen war. Sie hatte ihn davon abbringen wollen. Ob es ihr gelungen wäre? Sie würden es nie erfahren.
Jetzt versuchte sie, Lucien daran zu hindern, die Tradition der Chacarasses fortzusetzen. Im Prinzip sollte ihr das leichtfallen, denn Lucien hatte sich geschworen, nie jemanden umzubringen. Dennoch hatte er seinem Vater versprochen, das Erbe der Chacarasses fortzusetzen. Francine wusste, dass er in einem Dilemma steckte.
Lucien klopfte und trat ein. Sie stand am offenen Fenster und hielt ein Glas Wasser in der Hand. Blaues Kleid, hohe Schuhe, makellos frisiert – top gepflegt wie immer. Zweifellos hatte sie trotz des Altersunterschieds gut zu seinem Vater gepasst. Alexandre hatte immer großen Wert auf ein korrektes Äußeres gelegt. Selbst bei der Ausübung seines »Berufes« hatte er häufig Krawatte und Clubblazer getragen.
»Bonjour, Francine«, begrüßte er sie. »Du warst beim Arzt?«
Sie lächelte.
»Und du bei Edmond. War sicher weniger erfreulich.«
Er hob fragend die Augenbrauen nach oben.
»Zum Arzt geht man ja auch nicht freiwillig.«
»Ich schon. Mir geht es wunderbar.«
Er brauchte einen Moment, bis er begriff.
»Du warst beim Frauenarzt?«
»Ärztin«, korrigierte sie ihn.
»Man sieht es dir immer noch nicht an.«
»Wird nicht mehr lange dauern, bis es auffällt. Rosalie hat mich schon so komisch angeschaut. Ich glaube, sie ahnt es.«
»Wir werden es ihr sagen müssen.«
»Ja, werden wir.«
»Auch muss sie wissen, wer der Vater des Kindes ist.« Er lächelte. »Bevor sie auf falsche Gedanken kommt.«
»Denkst du, sie kann es für sich behalten?«
»Rosalie hat noch nie etwas verraten. Außerdem … wem soll sie es erzählen? Sie hat ja niemanden. Bis auf Paul, ihren Neffen, der in meinem Restaurant arbeitet. Sie haben wenig Kontakt.«
»Wie wird sie es finden, dass ich ein Kind … ein Kind deines Vaters unter meinem Herzen trage?«
Lucien sah sie nachdenklich an.
»Sie wird sich freuen. Genauso wie ich.«
Francine setzte sich an ihren Schreibtisch.
»Freust du dich wirklich?«
»Natürlich. Mein Vater hat uns einen Chacarasse hinterlassen …«
»Könnte auch eine Chacarassine werden.«
»Sehr unwahrscheinlich. Meine Familie hat seit Generationen nur Jungs in die Welt gesetzt.«
»Liegt ja immer auch an der Mutter. Lassen wir uns überraschen.«
»Es wird ein Junge, glaub mir.«
Dieser Junge, dachte Lucien, könnte vom Alter her sein Sohn sein. Tatsächlich würde er aber einen Bruder bekommen – einen Halbbruder zwar, aber zweifellos einen Chacarasse. Sein Vater hatte sich von Lucien auf dem Sterbebett gewünscht, dass er für einen männlichen Nachkommen sorgen sollte. Eigentlich sollte er erleichtert sein. Für einen jungen Chacarasse der nächsten Generation hatte sein Vater noch selber gesorgt. Zumindest diese Pflicht war ihm von den Schultern genommen. Jetzt gab es mehrere Möglichkeiten: Sie könnten Francines Kind als sein eigenes ausgeben. Damit wäre die Erbfolge gesichert. Alternativ könnte er das Kind adoptieren. Das wäre genauso gut. Allerdings gab es noch eine dritte Möglichkeit. Francine hatte sie schon mal angedeutet. In der Geburtsurkunde des Kindes würde sie keinen Namen des Vaters angeben. Lucien hielt es für möglich, dass sie sich für diesen Schritt entschied. Auf diese Weise blieb dem Kind erspart, die Familientradition fortzusetzen. Sein Vater würde sich im Grab umdrehen …
Francine sah ihn schmunzelnd an. »Ich glaube, es wird ein Mädchen, schon aus Trotz. Aber erzähl, was wollte Edmond von dir?«
»Was wohl? Er hat einen neuen Auftrag.« Lucien gab ihr das Foto mit den Angaben auf der Rückseite. »Jacques Collard. Vierundfünfzig Jahre alt, wohnhaft in Marseille. Derzeit ohne Arbeit. Ich hab zehn Tage Zeit.«
Francine sah sich das Foto an.
»Da kann man gar nichts sagen«, stellte sie fest. »Der Mann kann sympathisch sein oder das Gegenteil davon. Spielt aber eigentlich keine Rolle. Du wirst ihn in jedem Fall am Leben lassen!«
Das klang wie ein Befehl. Unwillkürlich dachte er daran, dass Francine auch keine Heilige war. Immerhin hatte sie den Mörder seines Vaters getötet. Doch das war – diese Entschuldigung billigte er ihr zu – eine Ausnahmesituation gewesen. Sie hatte im Affekt gehandelt.
»Edmond hat mir nicht den geringsten Hinweis auf den Auftraggeber gegeben …«
»Wie immer.«
Er deutete auf ihren Computer.
»Kannst du mal versuchen, etwas über diesen Collard rauszubekommen?«
Francine war gut darin, im Internet zu recherchieren. Bislang hatte sie noch immer eine Spur gefunden.
»Ich probiere es.«
»Kannst du gleich damit anfangen?«
»Bien sûr. Schließlich … schließlich ist es wichtig.«
Lucien ließ sie alleine. Er suchte Rosalie – und fand sie wie so häufig in der Küche. Hier hielt sie sich am liebsten auf. Früher arbeiteten hier nicht nur die Köche und Köchinnen, die Küche war der Treffpunkt für alle Hausangestellten. Entsprechend groß war sie dimensioniert. In der Mitte stand ein riesiger Eichentisch. An den passten gut und gerne zwanzig Leute. Köche gab es keine mehr, seit dem Tod seines Vaters auch keine Hausangestellten. Rosalie hielt alleine die Stellung. Lucien kam der Gedanke, dass sie sich oft ziemlich einsam fühlen musste. Umso wichtiger war es, ihr möglichst häufig Gesellschaft zu leisten. Auch Francine hatte sich angewöhnt, immer wieder mal in der Küche vorbeizuschauen und mit Rosalie ein Schwätzchen zu halten.
»War ja ein kurzer Besuch bei Francine«, stellte sie fest, als er bei ihr auftauchte. »Gibt’s Probleme?«
»Nein, in keinster Weise. Sie macht für mich eine Recherche im Internet, da will ich nicht stören.«
»Zum neuen Auftrag von Edmond?«
Er nickte.
»Ich hoffe, sie findet was heraus. Ganz was anderes, Rosalie, ich wollte dich schon länger mal fragen: Paul ist dein Neffe …«
»Zweiten Grades, also der Sohn einer Cousine meines Vaters …« Sie rieb sich das Kinn. »Oder seiner Schwester? Da bin ich mir gerade nicht sicher.«
»Musst nicht darüber nachdenken. Der Verwandtschaftsgrad interessiert mich nicht. Ich bin froh, dass Paul bei mir im P’tit Bouchon arbeitet. Er schmeißt den ganzen Service …«
»Er schmeißt das Service? Das tut mir leid.«
Lucien lachte.
»So habe ich es nicht gemeint. Paul sorgt dafür, dass im Service alles klappt. Er macht das vorzüglich.«
»Lucien, du solltest dich klarer ausdrücken. Wie soll man dich sonst verstehen? Was war gleich deine Frage?«
»Die habe ich noch gar nicht gestellt. Mich interessiert, was Paul über die Chacarasses denkt?«
»Was soll er schon denken? Er ist stolz darauf, dass seine Tante im Dienst einer so ehrenhaften und respektablen Familie steht.«
Er sah sie skeptisch an.
»Ehrenhaft und respektabel?«
»Natürlich. Das sollte dir immer bewusst sein, du bist doch selber ein Chacarasse.«
»Ebendeshalb. Wir wissen beide …«
»Taratata«, fuhr sie Lucien über den Mund. »Was wir beide wissen, geht niemanden etwas an.«
»Um auf Paul zurückzukommen, er hat also keine Ahnung?«
»Wovon?«
»Womit, glaubt er, haben wir unser Geld verdient?«
Rosalie runzelte die Stirn.
»Paul kommt aus einfachen Verhältnissen. In seiner Vorstellung sind Grafen von Geburt an reich. Sie müssen kein Geld verdienen. So einfach ist das.«
»So einfach und so falsch.«
»Paul war Catcher, er hat schwere Jungs verprügelt. Warum sollte er darüber nachdenken, wie die Chacarasses zu ihrem Wohlstand gekommen sind?«
»Hast recht. Jedenfalls bin ich froh, dass er bei mir im P’tit Bouchon arbeitet.« Er sah sie schmunzelnd an. »Was für ein Zufall, dass er sich ausgerechnet bei uns beworben hat.«
Sie rieb sich die Nase.
»War kein Zufall. Paul musste nach einer Verletzung mit dem Catchen aufhören und brauchte einen Job. Da habe ich ihm den Tipp gegeben. Ich wusste ja, dass du jemanden suchst.«
Lucien lächelte. So ähnlich hatte er sich das gedacht. Denn er glaubte aus Prinzip nicht an Zufälle.