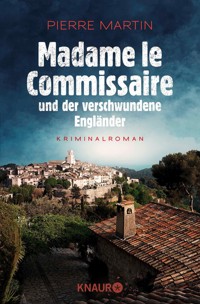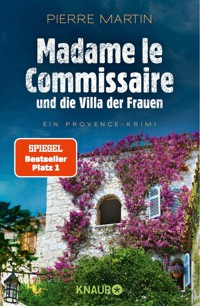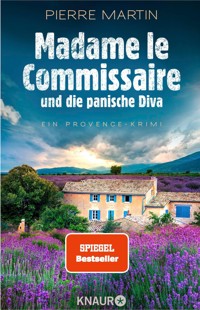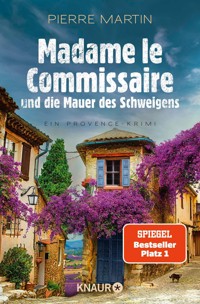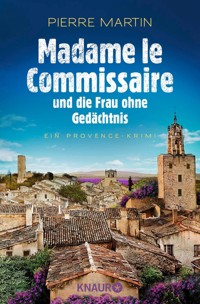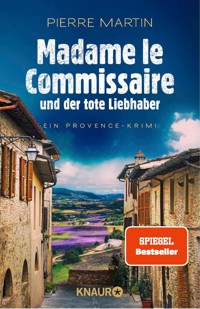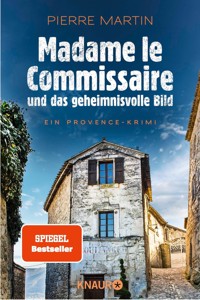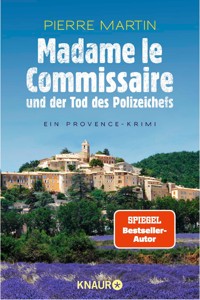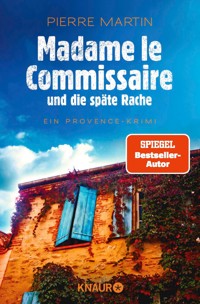9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Monsieur-le-Comte-Serie
- Sprache: Deutsch
Ein Auftragsmörder, der sich weigert, zu töten: »Monsieur le Comte und die Kunst des Tötens«, der #1-SPIEGEL-Bestseller erscheint jetzt endlich im Taschenbuch! Mit diesem 1. Band der humorvollen Krimi-Reihe entführt der Bestseller-Autor Pierre Martin alle Liebhaber von cosy Krimis an die französische Riviera. Lucien, der junge Comte de Chacarasse, entstammt einem alten französischen Adelsgeschlecht, das seit Generationen eine besondere Fertigkeit ausübt: die Kunst des Tötens! Seine Vorfahren sollen als äußerst diskrete Auftragsmörder für Napoleon, den Vatikan, die Medici und die Bourbonen tätig gewesen sein. Zwar wurde auch Lucien von klein auf in der Familientradition ausgebildet, doch er betreibt lieber ein Bistro in Villefranche-sur-Mer. Denn Lucien liebt die Frauen, den Wein – und die kulinarischen Genüsse der provenzalischen Küche. Das unbeschwerte Leben des jungen Comte endet abrupt, als er ans Sterbebett seines schwer verletzten Vaters gerufen wird: Lucien muss schwören, dem Erbe der Familie treu zu bleiben. Nur, wie begeht man einen Auftragsmord, wenn man es ablehnt zu töten? Lustiger Cosy-Crime-Genuss mit sympathischen Charakter Pierre Martin – Bestseller-Autor der Provence-Krimis um »Madame le Commissaire« – hat mit dem Auftragsmörder wider Willen »Monsieur le Comte« einen liebenswerten Protagonisten erschaffen: Zu gerne würde man sich mit Lucien in seinem Bistro an der französischen Riviera auf ein Glas Rosé und eine Bouillabaisse zusammensetzen. Und wie es mit Monsieur le Comte, Francine und Rosalie weitergeht erfahren Sie in Band 2 »Monsieur le Comte und die Kunst der Täuschung«. Entdecken Sie weitere spannende Fälle der Madame le Commissaire-Bestseller-Krimi-Reihe: - Madame le Commissaire und der verschwundene Engländer (Band 1) - Madame le Commissaire und die späte Rache (Band 2) - Madame le Commissaire und der Tod des Polizeichefs (Band 3) - ... - Madame le Commissaire und die Mauer des Schweigens (Band 10)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Pierre Martin
Monsieur le Comte und die Kunst des Tötens
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Lucien Comte de Chacarasse entstammt einem alten französischen Adelsgeschlecht, das seit Generationen eine hohe Kunst an die Nachkommen weitergibt: die Kunst des Tötens! Der Legende nach waren seine Vorfahren als äußerst diskrete Auftragsmörder für die Bourbonen ebenso tätig wie für Napoleon, den Vatikan oder die Medici.
Zwar wurde Lucien von klein auf für diese Aufgabe trainiert, aber als junger Mann steigt er aus und betreibt stattdessen ein Bistro in Villefranche-sur-Mer. Er liebt die Frauen, den Wein – und die kulinarischen Genüsse der provenzalischen Küche.
Luciens unbeschwertes Leben endet, als er ans Sterbebett seines schwer verletzten Vaters gerufen wird, der ihn schwören lässt, die Tradition der Familie fortzusetzen. Nur, wie begeht man einen Auftragsmord, wenn man sich weigert zu töten?
Inhaltsübersicht
PROLOGUE
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
ÉPILOGUE
PROLOGUE
Der Cimetière de Saint-Pancrace lag oberhalb von Roquebrune. Von hier hatte man über die roten Dächer der verwinkelten Altstadt hinweg einen fantastischen Blick aufs darunterliegende Meer. Oft war es so blau, dass es dem Namen der Küste alle Ehre machte: Côte d’Azur. Weil es hier so schön war, hatten viele Berühmtheiten den Friedhof als letzte Ruhestätte gewählt. So der irische Dichter William Butler Yeats. Auch die russische Großherzogin Alexandrowna Romanowa. Der legendäre Architekt Le Corbusier hatte seinen Grabstein selbst entworfen. Zudem hatte er sich einen bevorzugten Platz mit freier Sicht aufs Meer gesichert – in dem er makabrerweise später ertrank.
Wie fast jeden Tag suchten auch heute Verehrer Corbusiers nach dem Betonwürfel, der an ihn und seine Frau Yvonne erinnerte. Nicht so der junge Mann, der einige Reihen weiter oben vor einer marmornen Grabplatte stand und seinen Gedanken nachhing. Den Rücken hatte er dem Meer zugewandt. Es interessierte ihn nicht. Den Blick kannte er schon sein Leben lang. Von klein auf war er hierher mitgenommen worden. An das Familiengrab der Grafen Chacarasse. Seit Generationen lagen hier die Vorfahren begraben. Seine Vorfahren.
Lucien betrachtete die Grabplatte, deren eingemeißelte Namen und Geburts- sowie Sterbedaten er auswendig wusste. Bis hin zu seiner verstorbenen Mutter. Und seinem älteren Bruder. Ein Name fehlte noch. Der seines Vaters. Die Beisetzung hatte erst gestern stattgefunden. Blumen lagen auf dem Grab. An das mächtige Kreuz am Kopfende war ein Bild seines Vaters gelehnt. Ernst sah er aus und sehr ehrwürdig. Dazu ein Trauerband: »Alexandre Comte de Chacarasse. Il nous a quitté.«
Lucien schluckte. Ja, sein Vater hatte sie verlassen. Plötzlich und unerwartet. Unter dramatischen Umständen, die niemanden etwas angingen. Die ein Geheimnis bleiben würden. Wie so vieles, was sich unter dieser Grabplatte verbarg. Die Welt würde nie davon erfahren.
Er faltete die Hände. Auf dem Marmor stand das Familienmotto: »Obligé aux vivants et aux morts«. Verpflichtet den Lebenden und den Toten. Darunter zwei gekreuzte Säbel. Wie das zu interpretieren sei, blieb jedem überlassen. Die wahre Bedeutung kannte nur der engste Kreis der Familie. Und von dem war kaum noch jemand am Leben. Er selbst würde alles dafür geben, den tieferen Sinn des Leitspruchs vergessen zu können. Aber er hatte seinem Vater auf dem Sterbebett ein Versprechen gegeben. Er war eine Verpflichtung eingegangen. Nämlich die Verpflichtung, die jahrhundertealte Tradition der Familie fortzusetzen. Ihm war bewusst, dass er über die nötigen Fähigkeiten verfügte. Dass er alle Voraussetzungen mitbrachte – bis auf eine. Daran würde er scheitern.
1
Vor ziemlich genau zwei Wochen wurde Luciens Leben aus der Bahn geworfen. Von einer Stunde auf die andere. Ohne Vorwarnung.
Als er am späten Vormittag durch Villefranche-sur-Mer lief, war er noch bester Laune. Eine Bekannte, die ihm begegnete, blond und très sexy, begrüßte ihn mit Küsschen und meinte, man müsse sich mal wieder verabreden. Super Idee. Dumm nur, dass ihm gerade ihr Name nicht einfiel. Aber er war auch erst vor einer halben Stunde aufgestanden. Da konnte so was passieren.
Vor der Chapelle Saint-Pierre warteten Touristen auf Einlass. Nicht, weil sie besonders fromm waren, sondern weil sie Jean Cocteau bewunderten, der sie ausgemalt hatte. Lucien hätte sie auch in das Haus seines Vaters auf Cap Ferrat einladen können. Dort hatte Cocteau, der ein Freund der Familie gewesen war, das Esszimmer gestaltet. Aber natürlich würden Gäste keinen Einlass bekommen. Fremden gegenüber war sein Vater ausgesprochen abweisend. Lucien lächelte. Erst recht, wenn sie so schlecht angezogen waren wie die Touristen vor der Chapelle Saint-Pierre.
Er selbst trug ein verwaschenes Polo über ausgefransten Bermudas. An den Füßen Flipflops. Damit würde auch er dem konservativen Geschmack seines Vaters nicht entsprechen. Aber bei ihm machte er eine Ausnahme. Er billigte ihm zu, mit Anfang dreißig weniger Wert auf sein Äußeres zu legen. Bei Familienfeierlichkeiten, von denen es nicht viele gab, holte Lucien seinen einzigen Anzug aus dem Schrank. Mit dem Wappen der Grafen von Chacarasse auf der Brusttasche.
Hinauf in die Altstadt nahm er zwei Stufen auf einmal. Dann stand er vor dem Restaurant P’tit Bouchon. An der Tür ein Schild: Fermé! Jour de repos! Dass das Lokal geschlossen hatte, überraschte ihn nicht. Den wöchentlichen Ruhetag hatte er selbst festgelegt. Schließlich gehörte ihm das Restaurant. Weshalb er auch einen Schlüssel besaß.
Kaum war er drin, machte er die Tür gleich wieder zu. Es sollte nur keiner auf die Idee kommen, es könnte doch geöffnet haben. Er wollte sich nur schnell ein Omelett zubereiten. Das machte er häufig am Ruhetag. Mit Zwiebeln, Tomaten, Käse und Speck – und reichlich Chili. Lucien hatte es gerne scharf. Das weckte die Lebensgeister.
Als er sein Handy aus der Gesäßtasche zog, um es neben einem Hackbrett abzulegen, stellte er fest, dass es sich von selbst abgestellt hatte. Weil er vergessen hatte, über Nacht den Akku aufzuladen. Lucien grinste. Hatte auch einen Vorteil. So musste er es nicht auf stumm stellen. Er hatte keine Lust, am jour de repos Tischreservierungen entgegenzunehmen. Es wurde höchste Zeit, sich ein zweites Handy zuzulegen. Zwar war das Lokal seine Leidenschaft, aber es gab Grenzen – auch für Leidenschaften.
Das P’tit Bouchon hatte er vor zwei Jahren eröffnet. Dabei hatte er nie vorgehabt, ein eigenes Lokal zu besitzen. Der Gedanke war spontan an einem langen Abend gereift. Er war mit Roland zusammengesessen, einem befreundeten Koch, der gerade eine neue Anstellung suchte. Nach der ersten Flasche Wein fiel Lucien ein, dass in Villefranche-sur-Mer, nicht weit von seiner Wohnung, ein Restaurant wegen eines Todesfalls geschlossen hatte und zum Verkauf stand. Was schade war, weil er dort häufig gegessen hatte und die Atmosphäre mochte. Während der zweiten Flasche Wein dachte Lucien, dass es vergnüglich sein müsste, in seinem eigenen Lokal Stammgast zu sein. Man bekäme zuverlässig einen Tisch. Der Koch müsste kochen, worauf er Lust hatte. Das Servicepersonal wäre immer freundlich und zuvorkommend. Die Weinkarte wäre gut sortiert – weil er sich höchstpersönlich darum kümmern würde. Und Roland hätte einen neuen Job … Bei der dritten Flasche Wein war er zwar nicht mehr zurechnungsfähig, aber er besiegelte mit Roland den Deal per Handschlag. Einen Namen für das Lokal hatten sie auch schon. Inspiriert von den gerade entkorkten Flaschen drängte er sich förmlich auf: P’tit Bouchon, der kleine Korken.
Nicht vorausgesehen hatte Lucien, dass Roland zwar gut am Herd war, aber kein Restaurant managen konnte. Weshalb er notgedrungen selbst die Führung übernommen hatte. Was sogar Spaß machte, aber keine Dauerlösung sein konnte. Darauf bestand schon sein Vater, der ihm unmissverständlich klargemacht hatte, dass selbst ein »schwarzes Schaf« irgendwann zur Besinnung kommen müsse. Ein Comte de Chacarasse dürfe sich zwar einige Extravaganzen gönnen, sei aber nicht dazu bestimmt, als »Kneipenwirt« zu enden. Den Ausdruck fand Lucien zwar despektierlich, aber es war wohl richtig, dass er dafür nicht an einer école supérieure hätte studieren müssen. Auch könnte er, so ein Argument seines Vaters, im P’tit Bouchon keine seiner »Spezialkenntnisse« anwenden, die er sich seit früher Kindheit auf seinen Druck hin angeeignet hatte. Darauf allerdings konnte er gerne verzichten …
Lucien hackte gerade Zwiebeln, als er aus den Augenwinkeln eine Ratte sah, die über den Küchenboden huschte. Ein Problem, das sie in der Altstadt von Villefranche nicht gelöst bekamen – und zudem den Hygienevorschriften in einem Restaurant widersprach. Bei Lucien setzte ein Reflex ein. Ohne eine Sekunde zu zögern, warf er mit dem Küchenmesser nach der Ratte … und obwohl sie fast drei Meter entfernt war, traf er sie präzise. Die scharfe Klinge durchbohrte sie …
Lucien erstarrte. Erschrocken blickte er auf die tote Ratte. Erschrocken über sich selbst und seine Reaktion. Das war jene Seite an ihm, die er nicht mochte. Die er verabscheute. Seine Treffsicherheit dagegen überraschte ihn weniger. So etwas verlernte man nicht. Wie so vieles andere.
Ihm war der Appetit auf sein Omelett vergangen. Er entsorgte die Ratte, machte in der Küche sauber, steckte sein ausgeschaltetes Handy in die Tasche – und lief durch den verdunkelten Gastraum, um das P’tit Bouchon zu verlassen. Außen vor der Tür stand ein Mann und klopfte dagegen. Musste das sein? Kapierte der Typ nicht, dass das Lokal geschlossen war?
Lucien wollte ihn zurechtweisen, da erkannte er Paul, der bei ihm den Service leitete, aber keinen Schlüssel besaß. Er hatte einen roten Kopf und war so aufgeregt, dass er kaum Luft bekam. So hatte ihn Lucien noch nie gesehen. Paul war ein Hüne von Mann und nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen.
»Lucien, du bist am Handy nicht erreichbar …«, japste er.
»Ich weiß, der Akku ist leer. Was gibt’s so Dringendes?«
»Mich hat die Haushälterin deines Vaters angerufen …«
»Rosalie? Sie hat deine Nummer?«
»Ich bin ihr Neffe …«
»Wusste ich gar nicht.«
»Erzähl ich dir ein anderes Mal. Du sollst dringend nach Hause kommen, deinem Vater geht es nicht gut. Rosalie meint, es sei wirklich ernst. Er will dich noch mal sehen …«
Noch mal sehen? Hörte sich so an, als ob es mit seinem Vater zu Ende ginge. Aber das konnte nicht sein. Er war erst Anfang sechzig und bei bester Gesundheit. Vor zwei Tagen noch hatte er mit ihm eine Runde Tennis gespielt.
»Gib mir bitte dein Handy«, forderte er Paul auf.
Der wählte schon Rosalies Nummer und reichte ihm den Apparat.
Rosalie war für Lucien eine Herzensperson. Sie war trotz ihres hohen Alters noch ziemlich rüstig. Und sie war schon so lange im Haushalt, wie er sich erinnern konnte. Sie hatte auf ihn aufgepasst, als er klein war. Sie war wie ein Familienmitglied.
»Rosalie, ich bin’s. Was ist passiert?«
»Lucien,mein Lieber, du musst jetzt stark sein, dein Vater liegt im Sterben. Unser Hausarzt ist bei ihm. Er sagt, man könne nichts mehr machen …«
Ihm lief es kalt den Rücken runter.
»Hatte er einen Schlaganfall?«
»Nein, viel schlimmer. Der Comte will dich unbedingt noch sprechen. Unter vier Augen. Du musst dich beeilen.«
2
Lucien rannte zu seiner Vespa, die in einem nahe gelegenen Hof geparkt war. Er startete den Motorroller und fuhr mit Vollgas entgegen einer Einbahnstraße auf kürzestem Weg zur Petite Corniche. Er musste einigen Autos ausweichen, die auf ihn zukamen. Ihr Gehupe ignorierte er. Auch einen Stinkefinger, der ihm entgegengestreckt wurde. Auf den engen und chronisch verstopften Straßen der Côte gab es kein schnelleres Fortbewegungsmittel als ein motorisiertes Zweirad – vorausgesetzt, man hielt sich an keine Verkehrsregeln. Was Lucien auch sonst nicht tat. Heute waren sie ihm erst recht egal. Von Villefranche-sur-Mer war es nur ein Katzensprung hinüber zum Cap Ferrat auf der anderen Seite der Bucht. Die grüne Halbinsel trennte Nizza vom nahe gelegenen Monaco. Hinter hohen Hecken versteckten sich altehrwürdige Anwesen. Auch jenes der Grafen von Chacarasse.
Lucien schlängelte sich durch einen Verkehrsstau, bewältigte die kurze Strecke in Rekordzeit, um dann in einer scharfen Kurve nach Süden auf das Kap abzubiegen. Trotz der Kürze und obwohl die rasende Fahrt eigentlich seine volle Aufmerksamkeit erforderte, schossen ihm viele Gedanken durch den Kopf. Dass sein Vater im Sterben lag, wollte und konnte er nicht glauben. Er hatte ein durchaus gespanntes Verhältnis zu ihm. Aus vielerlei Gründen. Dennoch liebte er ihn. Dass er jetzt von ihm gehen könnte, sprengte seine Vorstellungskraft. Schließlich hatte er nur noch ihn. Seine Mutter Laetitia, eine gebürtige Italienerin, war vor einigen Jahren an Krebs gestorben. Ihren Verlust hatte er noch immer nicht verarbeitet. Sein älterer Bruder Raymond, der seinem Vater hörig gewesen war und alles getan hatte, was Lucien beharrlich verweigerte, war vor zwei Jahren mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Auf der Route de la Turbie, nicht weit von der Stelle, wo Gracia Patricia von Monaco ums Leben gekommen war. Wer blieb noch? Onkel Edmond? Er mochte ihn nicht …
Das schmiedeeiserne Tor zum Anwesen stand offen. Das kam sonst nie vor. Die Villa Béatitude konnte man von hier nicht sehen. Erst ging es durch einen kleinen Park, dann über eine gekieste Auffahrt. Vor dem Eingang parkte der Peugeot des Hausarztes. An der schweren Haustür gab Lucien den Nummerncode ein. Dann legte er den Daumen auf den Fingerabdruckscanner. Sein Vater war ein Sicherheitsfanatiker.
Er eilte durch die Eingangshalle, vorbei an der Büste seines Urgroßvaters, die steinerne Treppe hinauf in den ersten Stock. Rosalie kam ihm entgegen. Ihr Gesicht war verheult.
Er nahm sie in den Arm. »Komme ich zu spät?«, fragte er.
»Nein, aber Docteur Moreau rechnet jede Minute mit dem Ableben des Grafen. Dein Vater kämpft dagegen an, weil er dich unbedingt noch sehen möchte.«
»Was ist passiert? Warum kommt er nicht ins Krankenhaus, wo man ihn vielleicht retten könnte?«
»Weil es zu spät ist. Dein Vater erwartet dich in seinem Schlafzimmer. Moreau ist bei ihm.«
Lucien wusste nicht, ob er anklopfen sollte. Oder die Tür einfach aufstoßen und hineinstürzen? In das Zimmer eines Sterbenden?
Leise drückte er die Klinke herunter und spähte in den abgedunkelten Raum. Die schweren Damastvorhänge waren zugezogen. Einige Kerzen brannten. Im Hintergrund gedämpfte Klänge eines Klaviers. Lucien erkannte eine Nocturne von Chopin.
Sein Vater achtete auch angesichts des Todes auf Stil. Oder Rosalie, die seine Vorlieben kannte.
Moreau, der am Bett stand, drehte sich um und begrüßte Lucien. Er nahm ihn zur Seite.
»Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Ihr Vater ist in den Rücken geschossen worden. Die Kugel hat zwar die Wirbelsäule verfehlt, aber im Bauchraum schlimme Verletzungen angerichtet. Selbst wenn er sofort in die Notaufnahme gekommen wäre, hätte er kaum überlebt. Er hat massive innere Blutungen, und auch lebenswichtige Organe wurden verletzt. Ich kann nur versuchen, seine Schmerzen zu lindern.«
»Wie lange noch?«
»Eigentlich müsste er schon tot sein. Aber er hat einen starken Willen.« Moreau klopfte Lucien aufmunternd auf die Schulter. »Gehen Sie zu ihm. Ich lasse Sie jetzt allein.«
Lucien atmete tief durch. Die nächsten Schritte waren die schwersten seines Lebens.
Über dem Bett spannte sich ein Baldachin. Ein Ständer mit zwei Infusionsflaschen. Er hörte den schnarrenden Atem seines Vaters.
Lucien beugte sich über ihn und gab ihm einen Kuss auf die Stirn.
»Papa, je suis là«, sagte er leise.
Alexandre schlug die Augen auf. Mit einer Hand tastete er nach Lucien.
»Ja, du bist hier. C’est bien!«, flüsterte er.
»Hast du große Schmerzen?«
Er verzog das Gesicht. »Ging mir schon mal besser.«
»Warum spritzt dir Moreau kein Morphium?«
»Tut er doch. Aber nicht zu viel, ich will bei klarem Verstand bleiben. Das ist wichtig …«
Weil er nicht weitersprach, stellte Lucien eine Frage.
»Wer hat auf dich geschossen?«
Er rang nach Luft. »Es gibt Wichtigeres.«
Lucien spürte, wie sich die Hand seines Vaters verkrampfte.
»Mein Sohn, dein Bruder ist tot, jetzt musst du das Erbe antreten. Mit allen Konsequenzen …«
Lucien schluckte. Ihm war klar, dass sein Vater nicht das materielle Erbe meinte, sondern das Vermächtnis seiner Vorfahren. Das »Erbe« der Grafen von Chacarasse war eine schwere Last, die zu tragen er nicht bereit gewesen war. Sein Bruder hatte dies übernommen. Aber Raymond lebte nicht mehr. Jetzt blieb nur noch er.
Alexandre sprach stockend weiter. »Du weißt, wir haben dem Vatikan gedient … ist schon lange her. Die Medici haben unsere Dienste in Anspruch genommen. Die Bourbonen. Napoleon hat uns in den Adelsstand erhoben. Mit den Grimaldis von Monaco sind wir weitläufig verwandt. Garibaldi …« Er rang nach Luft.
Er sollte seine Kraft nicht mit der Familiengeschichte vergeuden, dachte Lucien. Natürlich kannte er diese. Vor allem die dunklen Kapitel. Die Grafen von Chacarasse gingen seit Jahrhunderten einem geheimen Gewerbe nach, das auf alten Traditionen fußte. Die Chacarasse verstanden sich als Assassinen. Was in der wörtlichen Übersetzung »Mörder« bedeutete. Aber sie hatten nichts gemein mit den gleichnamigen Glaubenskriegern des Mittelalters. Sie waren weder fanatisch, noch hatten sie eine Mission. Auch verfolgten sie grundsätzlich keine persönlichen Ziele. Die Chacarasse waren »Dienstleister«, die das Töten zur Kunstform erhoben hatten. Wenn sie einen Auftrag bekamen, wickelten sie ihn ab – verschwiegen und effektiv. Mit kühler, professioneller Distanz. Von den Niederungen krimineller Milieus trennten sie Welten. Auf dieses Niveau ließen sie sich nicht herab. Ihre »Kunden« kamen aus höchsten Kreisen.
»Lucien, von Kind auf bist du ausgebildet worden, unsere Familientradition fortzusetzen«, fuhr Alexandre fort. »Du warst talentierter darin als dein Bruder. Aber du hattest Skrupel. Wahrscheinlich ein Erbe deiner Mutter Laetitia, die ich sehr geliebt habe … die aber eine weiche Seele hatte …«
Es war offensichtlich, wie sehr Alexandre das Sprechen anstrengte. Aber er zwang sich dazu, zusammenhängende Sätze zu formulieren. Disziplin und Konzentration – auch das war eine Maxime seines Vaters.
»Raymond ist von uns gegangen. Ich folge ihm nun. Damit ich meinen Frieden finden kann, musst du mir etwas versprechen … Das kann ich dir nicht ersparen …«
Alexandre griff sich an den Hals. Lucien wusste, was folgen würde, welches Versprechen er seinem Vater geben sollte. Fast hoffte er, dass sein Vater sofort sterben würde. Noch in dieser Sekunde. Bevor er seine Bitte aussprechen konnte. Ein grausamer Gedanke. Aber das Versprechen war noch viel grausamer.
»Du bist ein Chacarasse. Lucien, versprich mir, dass du die Tradition der Familie fortsetzen wirst. Erweise unserem Namen alle Ehre. Setze einen Sohn in die Welt, der in der nächsten Generation weitermacht. Gemäß unserem Leitspruch: Obligé aux vivants et aux morts. Wir stellen keine Fragen … Wir ersparen den Delinquenten unnötiges Leid …«
Alexandre röchelte. Er war mit seiner Kraft am Ende.
»Lucien … schwöre es … bei allem, was dir heilig ist!«
Lucien überlegte, was ihm heilig war. Nicht viel. Aber er liebte seinen Vater, der gerade unter Qualen aus dem Leben schied. Konnte er seinen letzten Wunsch abschlagen?
»Bitte, Lucien, bitte …«
Die Hand seines Vaters verkrampfte sich.
»Bitte …«
Luciens Widerstand war gebrochen. Er konnte nicht anders.
»Naturellement, mon papa, je te le promets!«
Lucien atmete tief durch. Mit diesem Versprechen hatte er seinem Vater den Abschied erleichtert. Und sich selbst ins Unglück gestürzt.
»Merci, mon fils. Que Dieu te bénisse!«, flüsterte Alexandre.
Ob ihn Gott für ein Versprechen segnen würde, das gegen das fünfte Gebot verstieß? Wohl kaum.
Die Hand seines Vaters erschlaffte. Der rasselnde Atem verstummte. Ein kurzes Stöhnen – dann war es vorbei.
3
Eine Stunde später verabschiedete sich der Arzt. Nicht ohne Lucien ein weiteres Mal sein tief empfundenes Mitgefühl auszudrücken. Eine Kleinigkeit wäre noch zu besprechen, sagte er sichtlich verlegen. Wie der junge Herr Graf sicherlich wisse, seien Schussverletzungen meldepflichtig. Erst recht, wenn sie zum Tode führten. Mit dem Comte habe er kurz vor Luciens Eintreffen vereinbart, dass er auf dem Totenschein ein Ableben aufgrund eines Herzinfarktes bescheinigen werde. Auch habe er ein Bestattungsunternehmen an der Hand, das den Leichnam ohne weitere Fragen abholen und gleich morgen früh im Krematorium einäschern werde.
Lucien nickte. Er verstand. Der Asche in einer Urne würde man nicht ansehen, wie der Verblichene zu Tode gekommen war. Natürlich durfte es keine polizeiliche Ermittlung geben. Sein Vater hatte es zeitlebens verstanden, nie mit Gewalttaten in Verbindung gebracht zu werden. Das musste auch über seinen Tod hinaus gelten. Selbst dann, wenn er jetzt selbst Opfer einer solchen geworden war.
»Da sind wir uns einig«, sagte Lucien. »Ich danke Ihnen für Ihre Diskretion.«
»Ist doch selbstverständlich. Wie Sie wissen, hatte schon mein Vater die Ehre, Ihrer Familie als Hausarzt zu dienen. So etwas verpflichtet.«
Schön, dass er das so sah. Was aber gab es dann noch zu besprechen?
Moreau hüstelte.
»Meine ärztliche Leistung wird quasi außertariflich vergütet«, half er ihm auf die Sprünge.
Jetzt fiel bei Lucien der Groschen.
»Aber natürlich. Nennen Sie mir Ihr Honorar, und ich werde sofort die Zahlung anweisen.«
Moreau knetete seine Finger.
»Wir haben eine etwas andere Vereinbarung getroffen. Der Comte hat mir einen Blankoscheck zugesichert. So haben wir das schon in anderen Fällen gehandhabt, wenn Sie verstehen. Ich trage dann eine Summe ein, die mir angemessen erscheint. Wobei ich Ihnen versichern darf, dass ich keine übermäßige Forderung stelle.«
Eine ungewöhnliche Vorgehensweise. Aber Lucien sah keinen Grund, an der Aussage des Doktors zu zweifeln.
»So machen wir das. Den Scheck bringe ich Ihnen in den nächsten Tagen vorbei.«
Moreau reichte ihm die Hand.
»Ich freue mich, dass ich in dieser schweren Stunde einen neuen Freund gefunden habe. Monsieur le Comte, auf eine gute Zusammenarbeit.«
Lucien verstand nicht genau, wie er das meinte. Hatte Moreau häufiger falsche Totenscheine ausstellen müssen? Oder gab es andere Formen der Zusammenarbeit, von denen er nichts wusste? Die Zeit würde es zeigen. Wie wahrscheinlich vieles, vor dem er sich fürchtete.
Lucien begleitete den Arzt zum Ausgang. Rosalie war nirgends zu sehen.
Auf der Schwelle blieb Moreau stehen.
»Was ich Ihnen noch sagen wollte: Die Kugel, die den Grafen getötet hat, ist vorne wieder ausgetreten. Sonst hätte ich sie rausoperiert und Ihnen gegeben. Vielleicht hätte sie Ihnen bei der Suche nach seinem Mörder weitergeholfen.«
»Ja, womöglich. Vielen Dank jedenfalls.«
Nachdenklich schloss er hinter ihm die Tür. Der Arzt ging davon aus, dass er den Mörder seines Vaters suchen würde. Seltsamerweise war ihm der Gedanke noch gar nicht gekommen. Vermutlich handelte es sich um einen »Arbeitsunfall«. Ein Zielobjekt hatte sich zur Wehr gesetzt … Sein Vater hatte keine Gelegenheit mehr gehabt, ihm den Namen seines Mörders zu nennen. Ihm war wichtiger gewesen, Lucien in die Pflicht zu nehmen, die Familientradition fortzusetzen. Er hatte von ihm nicht verlangt, ihn zu rächen. Weil es ihm nicht wichtig war? Für diesen kurzen Satz hätte seine Lebensenergie wohl noch gereicht.
Langsamen Schrittes lief Lucien durch das Foyer. Er sah auf seine Füße in den Flipflops. Die ausgefransten Bermudas … Als ob er an den Strand zum Baden gehen würde. Stattdessen hatte er gerade von seinem Vater Abschied genommen. Nicht nur von ihm. Wohl auch von dem unbeschwerten Leben, das er bis heute geführt hatte. Außer … ja, außer er würde das Versprechen brechen, das er seinem Vater auf dem Sterbebett gegeben hatte. Doch das würde er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren können. Das Gegenteil aber auch nicht. Er war kein Mann, der andere Menschen umbrachte. Dazu war er nicht fähig – auch wenn er alle nötigen Techniken beherrschte. Was hatte sein Vater gesagt? Er wäre talentierter gewesen als sein Bruder? In sportlicher Hinsicht vielleicht, sonst gewiss nicht. Weshalb Raymond die Nachfolge angetreten hatte. Er war frei von Skrupel gewesen. Es hatte ihm nichts ausgemacht. Leider lebte er nicht mehr.
Und nun? Lucien sah sich in einer ausweglosen Situation. Weder konnte er sein Versprechen brechen, noch konnte er tun, was von ihm verlangt wurde.
Eine Hoffnung gab es. Sein Vater hatte nie verraten, wie die Aufträge an ihn herangetragen wurden. Was also, wenn es einfach nicht geschah? Dann wäre er frei … Ohne zu wissen, ob es plötzlich nicht doch passierte. Das sprichwörtliche Damoklesschwert über seinem Kopf. Er musste überlegen, wie er sich im Falle des Falles verhalten würde. Er brauchte eine Strategie. Doch er hatte keine Ahnung, wie diese aussehen könnte. Heute war der falsche Tag, darüber nachzudenken. Heute war ein Tag des Abschieds.
Lucien sah sich um. Wo war Rosalie?
Er machte sich auf die Suche und fand sie weinend am Küchentisch. Vor ihr eine Flasche Marc de Provence. Sie war halb leer. Lucien ging nicht davon aus, dass sie gerade alles selbst getrunken hatte. Obwohl es ihr zuzutrauen war. Sie vertrug einiges. Trotz ihres hohen Alters. Oder vielleicht gerade deshalb.
»Schenk mir auch ein Glas ein«, sagte er.
»Es geht nicht anders, wir müssen uns betrinken«, meinte sie.
»Das macht meinen Vater auch nicht mehr lebendig.«
»Aber es wäre in seinem … seinem Sinne. Er würde mittrinken, das kannst du mir glauben. Er würde …«
Sie hatte schon mal flüssiger gesprochen. Nüchtern war sie nicht mehr.
»Er würde mit uns anstoßen und auf das … auf das Leben nach dem Tod trinken.«
»Das würde er«, bestätigte Lucien.
»Hoffentlich ist er nicht im Himmel, sondern in der Hölle …«
Er runzelte die Stirn. Wie kam sie dazu, seinem Vater die Hölle zu wünschen? Wobei sie recht haben könnte. In den Himmel kam er gewiss nicht.
»In der Hölle ist mehr los«, lieferte sie die Erklärung. »Dort geht es heiß her. Da sind die interessanteren Menschen. Ich möchte auch mal in die Hölle. Doch, doch … nur nicht in den Himmel.«
Lucien kippte das Glas mit dem Tresterbrand hinunter. Er brannte in der Kehle. Der Bauch wurde warm. Und der Kopf heiß. Ihm fiel ein, dass er immer noch nichts gegessen hatte.
»Du bist ein guter Mensch, ich fürchte, du kommst in den Himmel«, sagte er.
Rosalie stützte ihren Kopf schluchzend in die Hände.
»Was wird nun aus mir? Was soll ich in diesem riesigen Haus ohne den Comte? Am besten stürze ich mich von einer Klippe ins Meer …«
Lucien nahm sie in die Arme.
»Das tu mir nicht an. Mach dir keine Sorgen, wir finden eine Lösung. Ich verspreche es.«
Was für eine Lösung? Wie sollte diese aussehen? Das wusste er selbst nicht. Auch für sich selbst musste er eine finden. Das war die größere Herausforderung.
Er goss sich einen zweiten Tresterbrand ein.
»Hast du ein Ladekabel für mein Handy?«, fragte er. »Der Akku ist leer, deshalb konntest du mich nicht erreichen.«
»Du wirst nie erwachsen. Schon als Kind hast du alles vergessen.«
Aus einer Küchenschublade zauberte sie ein Ladekabel hervor.
»Anstecken musst du es selbst, meine Hände zittern.«
Er sah sie von der Seite an.
»Aber einen Kochlöffel kannst du halten, oder?«
»Was soll diese … diese bescheuerte Frage?«
»Ich habe heute noch nichts gegessen. Könntest du mir bitte ein Omelett machen, mit drei Eiern?«
Rosalie hielt sich eine Hand ans Ohr.
»Ein Kotelett mit drei Eiern? Wie stellst du dir das vor?«
»Rosalie, du hörst immer schlechter. Kein Kotelett, sondern ein Omelett.«
»Ach so, aber für ein Omelett braucht man keinen Kochlöffel, das solltest du wissen.« Sie schüttelte verständnislos den Kopf. »Hat ein Restaurant, aber keine Ahnung vom Kochen. Das kann nicht gut gehen.«
Heute war ihm nicht danach, sonst hätte er lachen müssen. Er liebte es, sich mit Rosalie zu necken. Aber gerade wollte er nur eines – ein Omelett.
Sie schob den Stuhl zurück.
»Weil du’s bist. Mit Tomaten, Speck, Käse und Zwiebeln. Ach ja, und Chili.«
»Du kennst mich …«
»Besser, als dir lieb ist.«
Er sah ihr zu, wie sie die Eier holte und den Herd anstellte. Sie schwankte leicht. Aber nicht besorgniserregend.
»Eines möchte ich … richtigstellen«, sagte sie mit belegter Zunge. »Ich höre ausgezeichnet, du dagegen solltest nicht so nuscheln. Deinen Vater habe ich immer verstanden.«
Lucien wunderte das nicht. Sein Vater hatte Rosalie regelrecht angeschrien. Das sollte er sich wohl auch angewöhnen.
»Rosalie«, wechselte er das Thema, »wir müssen überlegen, was als Nächstes zu tun ist.«
»Fürs Überlegen bist du zuständig. Ich überlege höchstens, wo die Zwiebeln sind.«
»Im Ernst, wer organisiert die Trauerfeier? Wer verschickt die Anzeigen? Was soll da überhaupt drinstehen? Es gibt so viel zu erledigen.«
Tatsächlich hatte Lucien keine Ahnung. Er fühlte sich maßlos überfordert.
»Dein Vater hat immer gesagt, für alles gibt es Leute. Man muss nur die richtigen finden. Morgen um acht kommt seine Privatsekretärin …«
»Alice?«
»Nein, er hat schon seit einem halben Jahr eine neue. Ihr Name ist Francine.« Rosalie warf ihm über die Schulter einen Blick zu. »Sie wird dir gefallen.«
Als ob das eine Rolle spielen würde.
»Sagtest du acht Uhr? So früh?«
»Tja, mein Lieber, jetzt beginnt für dich der Ernst des Lebens.«
Das musste sie ihm nicht sagen, das wusste er selbst. Acht Uhr war trotzdem sehr früh.
»Zwölf Uhr reicht völlig. Sie kann ja schon mal alles vorbereiten.«
»Werde ich ihr sagen. Aber ich bezweifle, dass sie dazu in der Lage sein wird.«
»Warum? Weil sie unfähig ist?«
»Nein, du Ignorant. Weil auch sie erst mal mit der Todesnachricht klarkommen muss.«
Stimmt, das hatte er nicht bedacht.
»Ich sollte Edmond anrufen«, fiel ihm ein. »Und ihm mitteilen, dass sein Bruder …«
Sie sah ihn kopfschüttelnd an. »Du willst deinen Bruder anrufen? Ich glaub, du stehst unter Schock. Dein Bruder ist vor zwei Jahren gestorben.«
»Nein, nicht Raymond, sondern Edmond, den Bruder meines Vaters.«
»Ach so. Du musst dich in Zukunft klarer ausdrücken. Aber du hast recht: Das solltest du.« Sie deutete auf ein Telefon an der Wand. »Kannst du von hier machen, brauchst dafür dein Handy nicht.«
»Erst muss ich was im Magen haben. Sonst bin ich dem Gespräch nicht gewachsen.«
»Vor deinem Onkel hast du schon als Kind Schiss gehabt«, stellte sie fest.
»Als Kind schon, heute nicht mehr. Aber er ist der Erste, dem ich die Nachricht vom Tod meines Vaters überbringen muss. So was habe ich noch nie gemacht …«
Lucien griff zum Glas mit dem Marc de Provence. Etwas war noch drin. Er hob es feierlich.
»À la tienne, mon papa. Repose en paix!«
4
Den Abend verbrachte Lucien auf dem kleinen Balkon seiner Wohnung in Villefranche-sur-Mer. Er wollte allein sein. Mit sich und seinen Gedanken. Nur eine angebrochene Flasche Wein leistete ihm Gesellschaft. Der Lärm auf der Straße störte ihn nicht. Er hatte Kopfhörer auf und hörte Musik. Seinem Vater hätte sie nicht gefallen. Doch Techno war ihm gerade lieber als Chopin. Von seinem Balkon konnte Lucien aufs Meer blicken. Das war der größte Vorzug seiner Wohnung. Genau genommen der einzige. Abgesehen von der Nähe zu seinem Arbeitsplatz, zum Restaurant P’tit Bouchon.
Er beobachtete eine Motorjacht, die in der Bucht nach einem günstigen Ankerplatz suchte. Zu dieser Jahreszeit gaben sich hier die Schönen und Reichen mit ihren schwimmenden Luxusherbergen ein Stelldichein. Schön und reich? Er kannte einige von ihnen. Schön waren sie nicht alle. Vor allem die Männer wiesen oft erhebliche Defizite auf. Viele Frauen bei näherer Betrachtung auch. Und wirklich reich waren manche Jachteigner ebenfalls nicht. Obwohl sie sich so in Szene setzten. Ihm war egal, wie sie das machten, solange sie das Essen bezahlten, das er an Bord lieferte. Mit diesem »Lieferservice« machte er an manchen Tagen mehr Umsatz als mit den Gästen im Lokal. Vor allem, wenn zur Bestellung auch Champagner und Wein gehörten.
Lucien hatte ein Fernglas am Geländer hängen. Aber heute interessierten ihn die Jachten nicht. Er kam sich vor wie gelähmt. Immer wieder sah er seinen sterbenden Vater vor sich. Seinen flehenden Blick würde er nie vergessen. In seinen Ohren hallten seine letzten Worte: »Lucien … schwöre es … bei allem, was dir heilig ist!« Und dann sein Versprechen, das er gegeben hatte – aber nie hätte geben dürfen. Warum hatte er nachgegeben? Weil er ein sentimentaler Idiot war? Eine andere Erklärung gab es nicht.
Er trank einen Schluck Wein. Der Technobeat aus den Kopfhörern schaffte es nicht, gegen die bösen Geister in seinem Kopf anzukommen. Schließlich war er nicht nur eine unselige Verpflichtung eingegangen, vor allem hatte er … seinen Vater verloren. Darauf war er nicht vorbereitet gewesen. Damit hatte er nicht gerechnet. Seine Mutter war tot, auch sein älterer Bruder. Seinen Vater hatte er für unsterblich gehalten, für unverwundbar. Bei allen Differenzen, die es zwischen ihnen gegeben hatte, hatten sie sich dennoch nahegestanden. Und jetzt? War sein Vater nicht mehr am Leben. Lucien stellte fest, dass er in der direkten Linie plötzlich allein war.
Ihm fiel sein Onkel Edmond ein. Natürlich, ihn gab es noch. Er war der Bruder seines Vaters. Wahrscheinlich hatte auch er mal einen Treueschwur geleistet, gegenüber seinem Großvater. Aber dann war er als junger Mann beim Fallschirmspringen schwer verunglückt. Sein Schirm hatte sich nicht richtig geöffnet. Ein Wunder, dass er überlebt hatte. Seitdem war Edmond auf den Rollstuhl angewiesen. Lucien kannte ihn als verbitterten Mann. Er wohnte in Beaulieu-sur-Mer in einer Art-déco-Villa, die er nur selten verließ. Lucien konnte sich vorstellen, dass ihn sein Onkel um sein unbeschwertes Leben beneidete. Vielleicht war er deshalb so mürrisch zu ihm.
Am Telefon heute Nachmittag hatte ihn Lucien von einer anderen Seite kennengelernt. Zwar hatte das Telefonat nicht lange gedauert, aber Edmond hatte überraschende Emotionen gezeigt. Tief betroffen hatte er sich sogar dazu hinreißen lassen, Lucien sein Mitgefühl auszusprechen. Dabei hatte er ja gerade selbst seinen Bruder verloren. Lucien könne auf ihn zählen, hatte er hinzugefügt. Er sei immer für ihn da.
Auf Edmonds Frage nach der Todesursache hatte Lucien zunächst gezögert. Offenbar lange genug, um Edmonds Misstrauen zu erregen. Denn als er von einem Herzinfarkt sprach, wiederholte sein Onkel bedächtig: »Soso, ein Herzinfarkt …« Lucien fühlte sich verpflichtet, ihm die Wahrheit zu sagen. Doch über die ersten Worte kam er nicht hinaus. Edmond würgte ihn ab. Er solle nicht weiterreden, hatte er ihn zurechtgewiesen. Nicht am Telefon. Es gebe Dinge, die dürfe man sich nur im persönlichen Gespräch anvertrauen. Das müsse er sich für die Zukunft merken. Er erwarte morgen Nachmittag seinen Besuch. Dann könne er ihm bei einer Tasse Tee alles erzählen. Auch könnten sie gemeinsam die Trauerfeierlichkeiten durchgehen. Er habe da sehr konkrete Vorstellungen. Auch was die Gästeliste betreffe.
Lucien dachte an die Privatsekretärin seines Vaters, mit der er morgen um zwölf verabredet war. Mit ihr blieb genug anderes zu besprechen. Sie hieß Francine. Warum hatte Rosalie gesagt, dass sie ihm gefallen würde? Besser als ihre adipöse Vorgängerin Alice ganz bestimmt. Das war nicht schwer.
Seine Erinnerungen schweiften zurück in seine Kindheit und Jugend. Die waren so ganz anders gewesen als jene seiner Altersgenossen. Denn von klein auf durchlief er ein von seinem Vater minutiös geplantes Trainingsprogramm. Zusammen mit seinem Bruder Raymond. Er lernte, mit Wurfmessern umzugehen. Mit Pfeil und Bogen und mit der Armbrust. Er war Mitglied in einem Fechtverein. Von einem Shaolin-Meister bekam er Unterricht im Nahkampf. Mit dem Fokus darauf, wie man einen Gegner … nein, nicht kampfunfähig machte … sondern schnell und effektiv töten konnte. Das war auch die Vorgabe auf dem Schießstand im Keller. Es zählten nur die Treffer mitten ins Herz oder in den Kopf. Anfangs machte es ihm nichts aus. Waren ja nur Pappkameraden. Ihn reizte die sportliche Herausforderung. Mit zunehmendem Alter aber begriff er, was das Ganze sollte. Dass das kein Spiel war, sondern bitterer Ernst. Er begann, sich zu verweigern. Ganz im Unterschied zu Raymond, der immer fanatischer wurde. Vielleicht auch deshalb, weil er in allen Disziplinen seinem jüngeren Bruder unterlegen war. Das stachelte ihn an. Irgendwann ließ ihn Lucien gewinnen …
Er verdrängte seine Gedanken an früher und beschloss, noch eine Runde im Meer zu schwimmen. Um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Das war besser, als eine zweite Flasche Wein zu öffnen und gegen die Erinnerungen und die Trauer anzutrinken. Sein Vater würde ihm davon abraten. Und Onkel Edmond sowieso. Der hatte ihn morgen zu einer Tasse Tee eingeladen. Er war ein Asket. Ein Asket im Rollstuhl.
Über der Bucht von Villefranche-sur-Mer glänzte in der Abendsonne das gegenüberliegende Cap Ferrat. Er wusste genau, wo die Villa Béatitude lag, auch wenn sie unter den Bäumen und hinter der dichten Hecke selbst mit dem Fernglas nicht zu sehen war. Béatitude? Das stand für Glückseligkeit. Die Villa verdiente den Namen nicht. Von ihr führten in den Fels gehauene Stufen hinunter ans Wasser. Häufig fuhr er bei seinen Besuchen mit dem Schlauchboot rüber und legte dort an. Was fast noch schneller ging als mit der Vespa. Das war das Leben, wie er es liebte. Den Wind in den Haaren, die Sonne auf der Haut und Salz auf den Lippen. Am besten in charmanter weiblicher Begleitung. Ob dieses unbeschwerte Dasein mit dem heutigen Tag vorbei war? Lucien überlegte, dass dem nicht zwingend so sein musste. Und doch ahnte er, dass mit dem Tod seines Vaters nichts mehr sein würde wie vorher.
5
Gegen elf Uhr am nächsten Morgen stand Lucien im P’tit Bouchon vor der versammelten Mannschaft. Alle waren schon da, um den Mittagstisch vorzubereiten: Roland, der Maître de Cuisine, mit dem er das Lokal gegründet hatte. Alain, der Souschef. Paul, der Chef de Rang,der das Serviceteam leitete und ihm gestern die schlimme Nachricht überbracht hatte. Auch die weiteren Kräfte aus der Küche und dem Service. Lucien informierte seine Leute in knappen Worten, dass sein Vater gestorben sei. Die nächsten Tage kämen einige Verpflichtungen auf ihn zu. Um das P’tit Bouchon könne er sich leider nicht kümmern. Aber er sei sich sicher, dass seine wunderbare équipe das Lokal allein schmeißen werde. Zu seiner Zufriedenheit und zu der ihrer Gäste. Bis Ende der Woche seien sie ausgebucht, alle Tische belegt. Außerdem gebe es Vorbestellungen für einige Jachten, die in der Bucht vor Anker lägen. Ihnen werde also nicht langweilig werden. Lucien klatschte in die Hände. Bonne chance et plein de succès!
Auf der Fahrt nach Cap Ferrat, die er heute ruhiger angehen ließ, ging ihm durch den Kopf, dass er aktuell keine Freundin hatte, bei der er sich »abmelden« musste. Seltsamerweise mochte er diese Phasen des puren Singledaseins, die nie lange dauerten, in denen er aber zu sich selbst finden konnte. Gerade passte es besonders gut. Er wollte mit niemandem über den Tod seines Vaters sprechen. Natürlich nicht, denn er müsste die Wahrheit verschweigen. Und Trost würde ihm auch keine Frau spenden können. Bis auf die alte Rosalie, die von allem wusste – aber selbst gerade am meisten litt.
Lucien stellte seine Vespa neben einem roten Alfa-Cabrio ab. Offenbar das Auto dieser Francine. Klarer Punkt für sie. Ihre Vorgängerin hatte nicht mal einen Führerschein.
Rosalie kam ihm im Hausflur entgegen. Man sah ihr an, dass sie die letzte Nacht kaum geschlafen hatte. Außerdem hielt sie sich ihr Kinn. Nichts Schlimmes, meinte sie. Sie habe sich gestern ihren Kiefer ausgerenkt. Das sei ihr schon mal passiert, beim Gähnen. Diesmal beim Schreien. Sie habe ihren Kummer rausbrüllen müssen. Gott sei Dank sei der Kiefer von allein wieder zurückgesprungen.
Die alte Haushälterin, dachte Lucien, war immer für Überraschungen gut. Ihr waren schon die unglaublichsten Dinge widerfahren, ohne je ernsthaft Schaden zu nehmen.
Wo er Francine finden könne, fragte er. Ob sie die Nachricht vom Tod des Grafen gut verkraftet habe?
Rosalie deutete ein vorsichtiges Kopfschütteln an. Konnte man sich auch dabei den Kiefer ausrenken? Francine sei natürlich im bureau, flüsterte sie. Und nein, sie habe die Nachricht nicht gut verkraftet. Sie habe einen hysterischen Anfall erlitten. Danach geheult wie ein Schlosshund. Mittlerweile gehe es ihr besser. Auch bei ihr habe der Marc de Provence geholfen.
Einen hysterischen Anfall, weil der Arbeitgeber gestorben war? Lucien machte sich auf eine überspannte Zicke gefasst. Er bat Rosalie, ihm eine Tasse starken Kaffee ins Arbeitszimmer zu bringen. Très fort, sie wisse schon.
Dann ging er in den ersten Stock. Er kam am Schlafzimmer seines Vaters vorbei. Rosalie hatte eine schwarze Schleife an die Klinke gehängt. Lucien blieb kurz stehen und atmete durch.
Am Arbeitszimmer klopfte er. Beim Eintreten war er auf alles vorbereitet, aber nicht darauf: Vor dem Fenster stand mit dem Rücken zu ihm eine Frau mit langen schwarzen Haaren und einer aufregenden Figur. In einem hautengen roten Kleid und hochhackigen Schuhen. Schon von hinten sah sie sensationell aus. Als sie sich langsam umdrehte, fand er seinen Eindruck – übertroffen. Lucien fragte sich, was in seinen Vater gefahren war, eine solche Privatsekretärin einzustellen. Sie war in Luciens Alter. Francine würde ihm gefallen, hatte Rosalie prophezeit. Nun, sie hatte nicht falschgelegen.
Er deutete eine Verbeugung an und stellte sich vor. So förmlich war er selten. Aber die Situation machte ihn verlegen. Denn plötzlich schien ihm klar, warum Francine so emotional auf den Tod seines Vaters reagiert hatte. Auch musste er nicht mehr länger über die Motive seines Vaters nachdenken, diese Frau einzustellen. Lucien hatte die Fähigkeit, in Sekundenbruchteilen scheinbare Kleinigkeiten wahrzunehmen. So hatte er sofort registriert, dass Francine einen Smaragdring trug, den er gut kannte – von seiner verstorbenen Mutter. Immerhin war es nicht ihr Lieblingsring gewesen, so viel Pietät hatte sein Vater bewiesen. Aber einer Sekretärin würde er diesen Ring nicht schenken. Folglich … folglich stand mit Francine … die Geliebte seines Vaters vor ihm. Warum hatte ihm Rosalie nichts gesagt?
»Bonjour, Monsieur le Comte«, begrüßte ihn Francine mit belegter Stimme, aber gefasst.
Monsieur le Comte? Die Anrede versetzte ihm einen Stich. Für ihn war das immer sein Vater gewesen. Aber natürlich stimmte es.
»Mes condoléances!«, fügte sie hinzu. »Mein Beileid!«
Sollte er ihr das Gleiche wünschen?
»Merci, Madame«, sagte er stattdessen. »Ist sicherlich auch für Sie nicht leicht.«
»Nein, ist es nicht.«
Respekt, sie bewahrte Haltung.
»Darf ich davon ausgehen, dass Sie auch mit mir …« Er räusperte sich. Er wollte sich nicht missverständlich ausdrücken. »… dass Sie auch mir für die nächste Zeit als Sekretärin zur Verfügung stehen. Ich brauche Ihre Hilfe.«
Sie sah ihn aus verheulten Augen an.
»Dem Sohn des Grafen? Natürlich, Alexandre hätte es so gewollt.«
Sie verwendete seinen Vornamen. Sie machte ihm nichts vor.
»Vielen Dank, ich weiß es zu schätzen.«
Er fragte sich, wie gut sie in ihrem Job war. Gut möglich, dass sein Vater dem kaum Beachtung geschenkt hatte. Bald würde er es wissen.
Francine deutete auf den Schreibtisch.
»Ich habe bereits eine Liste vorbereitet, mit allem, was aktuell zu erledigen ist. Ich schlage vor, wir gehen sie gemeinsam durch.«
Hörte sich gut an, dachte Lucien.
An der Tür klopfte es. Rosalie brachte den Kaffee. Zwei Tassen, eine für Francine.
»Excellent. Am besten, wir fangen gleich an.«
Während sie sich setzten, fragte sich Lucien, was Francine alles von seinem Vater wusste. Er kannte seine fast schon pathologische Verschwiegenheit. Auch das war ein Erbe der Chacarasse. Weshalb Lucien vermutete, dass Francine keine Ahnung hatte. Aber er musste Gewissheit haben. Er würde es herausbekommen. Und wenn sich ergeben sollte, dass sie doch Bescheid wusste oder zumindest einen Verdacht hatte … Was dann? Der Logik der Familiengeschichte folgend, würde er sie umbringen müssen.
Am Nachmittag fuhr Lucien nach Beaulieu-sur-Mer zu seinem Onkel Edmond. Mit gemischten Gefühlen. Denn er glaubte zu wissen, dass ihn der Bruder seines Vaters ablehnte. Weil er ein Leben führte, das ihm versagt blieb? Weil er sich der Verantwortung entzogen hatte und stattdessen ein Lokal führte? Weil er bei Frauen gut ankam – während Edmond im Rollstuhl saß? Fast konnte ihn Lucien verstehen.
Obwohl Beaulieu von Villefranche nur wenige Kilometer entfernt lag, quasi spiegelbildlich auf der anderen Seite des Cap Ferrat, hatte der Ort einen völlig anderen Charakter. Man merkte dem traditionsreichen Badeort an, dass er seine Glanzzeit in der Belle Époque hatte. Einige Grandhotels, ein Spielcasino, die Villa Kérylos, eine repräsentative Uferpromenade … Dagegen strahlte Villefranche mit seinem Hafen und der verwinkelten Altstadt noch immer den Charme eines früheren Fischerortes aus. Dies trotz einer wechselvollen Historie als Kriegshafen. Und ungeachtet des heutigen Tourismus. Lucien mochte die Geschichten aus den Zwanzigerjahren, als Jean Cocteau Villefranche zu einem Treffpunkt für Künstler und Homosexuelle gemacht hatte. Er fand, dass man hier die Nähe des pulsierenden Nizza spürte, während Beaulieu auf ihn den gediegenen Eindruck eines Kurortes machte.
So gesehen hatte alles seine Richtigkeit: Er selbst passte besser nach Villefranche, sein konservativer Onkel Edmond dagegen nach Beaulieu. Und das Haus seines Vaters lag genau dazwischen auf Cap Ferrat – hinter hohen Hecken, versteckt vor den Augen der Öffentlichkeit.
Lucien stellte seine Vespa vor einer prächtigen Art-déco-Villa ab. Davor blühten Orangenbäume. Rote Bougainvillea rankte sich an der Fassade empor. Man konnte dem Haus nicht ansehen, dass es von einem alten Griesgram bewohnt wurde.
Ein Bediensteter machte ihm auf. Natürlich kannte er ihn. Er hatte die servile Attitüde eines Butlers, sprach sogar mit englischem Akzent – dabei stammte er aus Marseille. Wie so vieles im Leben war auch er ein Schwindel.
Lucien wurde von ihm in den Pavillon geführt, wo Edmond auf ihn wartete. Er winkte ihn zu sich und umarmte ihn.
»Ich habe meinen Bruder verloren, du deinen Vater«, sagte er unerwartet mitfühlend. »Die Trauer wird uns zusammenführen, ob wir wollen oder nicht.«
Lucien wusste nicht, was er darauf sagen sollte.
»Du bist mein Onkel«, antwortete er ausweichend. »Das warst du immer. Ich wüsste nicht, wie uns der Tod meines Vaters stärker zusammenführen könnte.«
»Weil du keine Ahnung hast, mon cher …«
Edmond brach ab und wartete, bis der Butler den Tee serviert und die Tür zum Pavillon hinter sich geschlossen hatte.
»Aber alles nacheinander«, fuhr er fort. »Woran ist Alexandre gestorben?«
»Ein Schuss in den Rücken. Laut Docteur Moreau hatte er keine Überlebenschance«, antwortete Lucien so knapp wie möglich.
»Also kein Herzinfarkt, das habe ich mir schon gedacht.«
»Hast du eine Ahnung, wer …?«
»Nein, habe ich nicht. Und wenn, dann würde ich es dir nicht sagen.«
»Warum nicht?«
»Um dich zu schützen. Andere Frage: Hat dein Vater vor seinem Tod noch mit dir gesprochen?«
Lucien zögerte. Was ging das seinen Onkel an? Wahrscheinlich mehr, als ihm lieb sein konnte.
»Das hat er, auf seinem Sterbebett. Mit letzter Kraft.«
»Unter vier Augen?«
Lucien nickte nur.
»Dann gehe ich davon aus, dass du deinem Vater ein Versprechen gegeben hast. Korrekt?«
Ob es Sinn machte, überlegte Lucien, das Versprechen zu leugnen? Er und sein Vater waren allein gewesen, keine Zeugen. Er könnte es abstreiten – und wäre frei. Für alle Zeiten …
Lucien sah seinen Onkel an. Sollte er also lügen? Er hatte nur diese eine Chance. Gab er es jetzt zu, gab es kein Zurück …
Wieder antwortete Lucien mit einem stummen Nicken. Er konnte nicht anders.
»Das ist gut so, sehr gut«, flüsterte Edmond. »Ob du willst oder nicht, du bist ein Chacarasse, du wirst deiner Verantwortung gerecht werden und unserer Familie Ehre machen.«
Ging es noch pathetischer? Die Ehre der Familie war ihm egal, dachte Lucien und dass er sich außerstande sah, eine Tradition fortzusetzen, die es zu keiner Zeit hätte geben dürfen. Wenn es eine Ehre gab, dann war es seine eigene – und die sah so aus, dass er sich an ein Versprechen gebunden fühlte, das er seinem Vater in den letzten Minuten seines Lebens gegeben hatte. Er spürte, wie ihm dieser Schwur den Atem nahm.
»Was, wenn ich Nein gesagt hätte?«
Edmond lächelte. »Dann, mon cher, wärst du ein toter Mann. Ich bin zwar an meinen Rollstuhl gefesselt, aber vergiss nicht, ich habe alles gelernt, was auch dein Vater gelernt hat. Dich umzubringen, um die Ehre der Familie zu retten, wäre ein Kinderspiel.«
Hatte ihm Edmond gerade gedroht? Was war das für eine Welt? Er müsste die Geliebte seines Vaters umbringen, wenn sie das Geheimnis seiner Familie kannte. Sein Onkel würde ihn eliminieren, wenn er nicht tat, was von ihm erwartet wurde … Beides würde nicht geschehen, dafür würde er sorgen.
»Gerade habe ich begonnen, dich zu mögen«, sagte Lucien. »Du machst es mir nicht leicht.«
»Ob wir uns mögen, ist kein Kriterium. Uns verbindet das Band der Familie.« Edmond sah ihn ernst an. »Und mach dir nichts vor: Natürlich mögen wir uns. Halt auf eine besondere Weise. Ich jedenfalls will nur dein Bestes. Das musst du mir glauben.«
Lucien beschloss, das Thema zu wechseln. Es machte wenig Sinn, sich über emotionale Befindlichkeiten auszutauschen. Es gab drängendere Fragen.
»Wir müssen über die Trauerfeierlichkeiten reden. Du hast konkrete Vorstellungen, sagtest du. Auch bezüglich der Gäste …«
»So ist es.«
»Aber vorher beantworte mir noch zwei Fragen. Erstens, was weiß Docteur Moreau? Kann ich ihm vertrauen?«
»Schon sein Vater war unser Hausarzt. Er hat mich nach meinem Fallschirmunfall behandelt. Moreau weiß, dass wir eine besondere Familie sind und unsere Geheimnisse haben. Natürlich weiß er nichts von unserem Gewerbe. Ich glaube, er hält uns für Spione. Ja, ich denke, du kannst ihm vertrauen.«
Spione? Über Generationen? Für wen und warum? Lucien hielt den Arzt für nicht ganz so einfältig, wie sein Onkel dachte.
»Zweite Frage: Die Aufträge, die wir bekommen, wie werden sie an uns herangetragen?«
»Gute Frage. Trink einen Schluck Tee, bevor er kalt wird. Ein Grand Cru mit Aromen von Jasmin, Kardamom und Zitronengras.«
Lucien kannte sich besser mit den Aromen von Weinen aus. Pflichtschuldigst probierte er den Tee. So schlecht war er gar nicht mal.
»Wie die Aufträge an uns herangetragen werden, willst du wissen? Lass es mich so sagen: auf sehr verschlungenen und verschwiegenen Pfaden. Dabei haben wir eine seit Generationen bewährte Arbeitsteilung. Eine Linie der Familie führt die Aufträge aus, eine andere nimmt sie entgegen.«
»… macht also die Akquise?«
»Akquise? Wie das klingt! Wir haben uns noch nie um einen Auftrag bemüht. Man tritt an uns heran.« Edmond klopfte auf seinen Rollstuhl. »Weil ich weniger für den aktiven Einsatz tauge, bin ich der aktuelle ministre des Affaires étrangères. Über mich erfolgt der Kundenkontakt. Von mir bekommst du gesagt, was du zu tun hast. Mehr muss dich nicht interessieren. Auf diese Weise sind wir nicht erpressbar. Ich will nicht wissen, wie du es anstellst. Und du musst nicht wissen, wer der Auftraggeber ist. So halten wir es seit jeher.«
Lucien stellte fest, dass sein Onkel wie selbstverständlich davon ausging, dass er die »Arbeit« seines Vaters fortsetzen würde. Das gegebene Versprechen hatte den Übergang geregelt.
»Wie häufig werde ich von dir hören?«
Edmond sah ihn amüsiert an. »Du hoffst, möglichst nie, habe ich recht? Da muss ich dich enttäuschen, aber es kann schon mal sein, dass es ein halbes Jahr gar nichts zu tun gibt. Oder sogar länger. In der Zeit kannst du deine Fertigkeiten trainieren.«
Genau das würde er nicht tun, schwor sich Lucien. Lieber schaute er seinem Koch Roland auf die Finger, der beim Ratatouille schon mal die Zucchini oder die Paprikaschoten vergaß oder beim carré d’agneau den Thymian.
»Bevor wir zu den Trauerfeierlichkeiten kommen«, sagte Edmond, »beantworte ich dir noch eine letzte Frage. Du würdest sie nie stellen, das weiß ich, aber sie wird sich in deinem Kopf einnisten. Was ist, wenn ich nicht mehr leben sollte? Bist du dann von deiner Pflicht befreit, weil du von mir keine Aufträge mehr bekommst? Irrtum, mon cher. Auch meine Nachfolge ist geregelt. Die Tradition der Chacarasse wird fortbestehen. Auch über meinen Tod hinaus.«
Lucien sah keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Einen kleinen Denkfehler gab es aber doch. Würde er selbst aus dem Leben scheiden, gab es niemanden mehr, der seinen Job erledigte. Dann wäre Schluss mit der gepriesenen Familientradition. Einen Suizid schloss er freilich aus. Dafür hing er zu sehr am Leben. Aber er könnte einen Selbstmord vortäuschen und einfach von der Bühne verschwinden. Um zum Beispiel auf den französischen Antillen ein neues Leben zu beginnen. Edmond wäre er los – aber sein Vater würde ihn begleiten und ihn fortwährend an sein Versprechen erinnern. Am Tag, in der Nacht, in seinen Träumen. Das war also auch keine Lösung.
6
In den nächsten Tagen gab es so viel zu tun, dass er nur wenig Zeit zum Nachdenken hatte. Was ein Vorteil war, denn so blieb es ihm erspart, über seine ungewisse Zukunft nachzugrübeln. Mit Francines Unterstützung regelte er alle Formalitäten, die sich aus dem Ableben seines Vaters ergaben. Und das waren mehr, als er sich vorgestellt hatte. Francine erwies sich als große Hilfe. Weshalb Lucien bei seinem Vater heimlich Abbitte tat. Offenbar hatte er seine Sekretärin nicht nur unter erotischen Gesichtspunkten ausgewählt. Als Nächstes widmeten sie sich der Wunschliste von Onkel Edmond. Nach seiner Anweisung gaben sie die Trauerkarten in Auftrag. Die Umschläge wurden vorbereitet und mit den Adressen versehen, die er von ihm bekommen hatte. Einige riefen bei ihm Stirnrunzeln hervor. War sein Onkel größenwahnsinnig geworden? Außerdem legte Edmond Wert darauf, dass in einigen Zeitungen Todesanzeigen geschaltet wurden. Auch dies zu Luciens Überraschung, schließlich traten die Chacarasse sonst nie öffentlich in Erscheinung. Doch er würde seine Gründe haben. Sie legten den Termin für die Trauerfeier auf dem Friedhof in Roquebrune fest. Da sein Vater bereits eingeäschert war, blieb für die Urnenbeisetzung etwas Zeit. Am Grab würde eine berühmte Violinistin aus Aix-en-Provence ein Adagio spielen.
Lucien unterhielt sich mit dem greisen Familienpfarrer und übergab ihm die Stichwörter, die Edmond für die Trauerrede aufgeschrieben hatte. Der Pfarrer spendete ihm Trost und versicherte ein ums andere Mal, was für ein gutherziger Mann sein Vater gewesen war, auch, dass er ein gottesfürchtiges und wohlgefälliges Leben geführt hatte. Lucien widersprach ihm nicht, natürlich nicht. In seinen Augen bestätigte sich einmal mehr, dass die Kirche nicht im Besitz der Wahrheit war. Und dass regelmäßige Spenden an die Gemeinde noch immer so funktionierten wie der Ablasshandel im Mittelalter. Nur dass einem die Sünden nicht wirklich vergeben wurden.
Lucien ließ jeden Tag im P’tit Bouchon ausklingen, wo er zu Abend aß und nach dem Rechten sah. Anschließend ging er in seine nahe gelegene Wohnung und trank auf dem Balkon ein letztes Glas Wein. Am Morgen fuhr er regelmäßig nach Cap Ferrat, um mit Rosalie zu frühstücken. Er tat dies ihr zu Gefallen. Denn eigentlich brauchte er kein petit-déjeuner, ihm reichte ein café noir. Doch wollte er Rosalie das Gefühl geben, dass mit dem Tod seines Vaters nicht alles vorbei war, dass es irgendwie weiterging. Später kam dann Francine hinzu. Nicht mehr in einem roten Kleid, aber auch nicht in Schwarz. Sie spielte keine trauernde Witwe, was unpassend gewesen wäre. Aber mit den gedeckten Farben erwies sie dem verstorbenen Grafen Chacarasse den gebotenen Respekt. Lucien konstatierte, dass sie in allen Kleidern aufregend aussah. Gleichzeitig versuchte er, den Gedanken nicht an sich heranzulassen. Denn die Geliebte seines Vaters war für ihn natürlich tabu.
Den Blankoscheck an Docteur Moreau hatte er ihm längst vorbeigebracht. Mittlerweile war auch die Abbuchung erfolgt. Jetzt wusste er, was der Arzt unter einer »angemessenen« Honorierung verstand. Sie war ganz sicher außertariflich – aber das galt auch für die erbrachte Leistung. Mit einem respektablen Aufschlag für seine Diskretion.
Dass Lucien keine Geldsorgen plagten und definitiv nie plagen würden, hatte er schon am ersten Tag herausgefunden. Da hatte er im Salon einen schweren Holzrahmen mit einem Gemälde von Auguste Renoir zur Seite geschwenkt. Natürlich war er dabei allein gewesen. Denn hinter Renoirs Femme dans un jardin