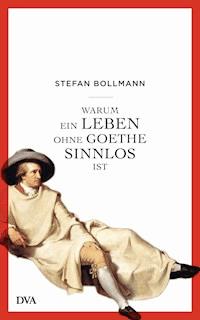5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Aussteigern, Veganern und Lebenskünstlern
Das 20. Jahrhundert ist noch kein Jahr alt, da macht sich eine Gruppe junger Aussteiger nach Ascona an den Lago Maggiore auf und gründet eine Kommune auf dem Monte Verità – dem Berg der Wahrheit. Sie träumen den Traum vom wahren Leben, ernähren sich vegan, tanzen, propagieren die freie Liebe und verehren das Licht des Südens. Schon bald verbreitet sich ihr Ruf in der ganzen Welt und immer mehr Literaten, Künstler, arme und reiche Bohemiens folgen ihnen ins Tessin: Erich Mühsam, Hermann Hesse, Käthe Kruse, Marianne von Werefkin und viele andere.
Das mitreißende Panorama der ersten modernen Gegenkultur – faszinierend und unterhaltsam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Das 20. Jahrhundert ist noch kein Jahr alt, da macht sich eine Gruppe junger Aussteiger nach Ascona an den Lago Maggiore auf. Sie gründen den Monte Verità, den Berg der Wahrheit. Ihre Agenda: in der Natur leben, sich vegan ernähren, freier lieben, sich selbst verwirklichen. Schnell verbreitet sich ihr Ruf nach Berlin, München, Genf und St. Petersburg. Erich Mühsam kommt, völlig blank, mit dem schönen Dichter Johannes Nohl im Schlepptau, doch er verträgt das vegetarische Essen nicht. Käthe Kruse tanzt mit ihrem unehelichen Kind an Weihnachten ums Feuer. Hermann Hesse flüchtet sich vor dem Alkohol nach Ascona und gräbt sich in die Erde ein. Marianne Werefkin malt über sechshundert Bilder. Mary Wigman folgt ihrem Lehrer Rudolf von Laban auf den Berg und bringt diesen mit ihrem Tanz an die Sonne zum Beben.
Stefan Bollmann erzählt von den Lebensreformern und der faszinierenden Aktualität ihrer Ideen bis heute.
Der Autor
STEFANBOLLMANN, 1958 in Düsseldorf geboren, promovierte über Thomas Mann und arbeitete als Hochschullehrer. Seit 2005 ist er Lektor beim Verlag C. H. Beck in München. Von ihm erschienen im Elisabeth Sandmann Verlag Frauen, die lesen, sind gefährlich (2005) sowie bei der DVAFrauen und Bücher. Eine Leidenschaft mit Folgen (2013) und Warum ein Leben ohne Goethe sinnlos ist (2016).
Stefan Bollmann
Monte Verità
1900.Der Traum vom alternativen Leben beginnt
Deutsche Verlags-Anstalt
»… und da waren sie, und lebten diese Geschichte, ließen sie Wirklichkeit werden in der Moderne, die nie so modern war, dass man nicht einen Schritt zurück tun konnte.«
T. C. Boyle, Drop City
© Fondo Harald Szeemann. Archivio Fondazione Monte Verità in Archivio di Stato del Cantone Ticino
Inhalt
Der Aufbruch
Ins Freie, ins Licht!
Mach dich auf!
Suche die Wahrheit!
Zieh dich aus!
Die Agenda
Ernähre dich vegan!
Lebe anarchisch!
Werde, der du bist!
Die Verwandlung
Tanze!
Folge deinen Träumen!
Anhang
Dank
Zeittafel
Literaturhinweise
Bildnachweis
Teil 1
Der Aufbruch
Der Monte Verità, Anfang des 20. Jahrhunderts.
© Fondo Harald Szeemann. Archivio Fondazione Monte Verità in Archivio di Stato del Cantone Ticino
1. Kapitel
Ins Freie, ins Licht!
Monte Verità, Berg der Wahrheit, so wird eine Anhöhe oberhalb Asconas am Lago Maggiore im Tessin genannt. Als Berg beeindruckt er nicht. Das sich ans Seeufer schmiegende Ascona ist die tiefstgelegene Ortschaft der Schweiz, und mit dreihundertfünfzig Metern über normal null ist der Monte Verità wahrscheinlich der niedrigste Berg des gesamten alpenländischen Raums.
Im Herbst 1900, als eine kleine Gruppe von Aussteigern in Ascona ankam und den Hügel zu besiedeln begann, war der ohnehin schon mickrige Berg geradezu auf dem Tiefpunkt seiner Existenz angelangt. Erst wenige Jahrzehnte zuvor war die Reblaus aus Amerika nach Europa eingeschleppt worden und hatte bereits ganze Weinbaugebiete kahl gefressen. Nur die verstreuten Ruinen primitiver Steinhäuschen erinnerten daran, dass hier vor Kurzem noch reger Weinbau jenem Teil der Asconeser Bevölkerung, der nicht vom Fischen lebte, ein Auskommen verschafft hatte. Viele Einheimische gingen mittlerweile den umgekehrten Weg der Reblaus, in der Hoffnung, jenseits des Atlantiks ein besseres Leben zu finden. Währenddessen trieben Schaf- und Ziegenhirten ihre Herden über den kargen Boden des Hügels, sodass dort kaum noch Pflanzen und Bäume wuchsen und seine Kuppe einen kahlen, wenig einladenden Anblick bot.
Näherte man sich dem Hügel allerdings nicht von der seezugewandten Seite, sondern hinterrücks, von den beiden ihn überragenden Bergen her, die so verwunschene Namen tragen wie Balladrum und Gratena, sah die Sache gleich freundlicher aus. Dann führte ein alter Pilgerpfad durch wildwüchsige Kastanienwälder, wie sie bis heute im Tessin vorkommen, vorbei an einer wuchtigen Wallfahrtskirche, wo einst in einer Zeit schrecklicher Trockenheit über Nacht eine Quelle hervorgebrochen sein soll. Nach einer leichten Steigung mündete der Pfad auf eine Lichtung zwischen den drei Bergen. Von hier aus konnte man dem alten Römerpfad Richtung Süden folgen, der in idealer Höhe über den Wassern des Lago Maggiore verläuft. Hielt man sich hingegen scharf links, führte ein steiler Anstieg im Nu auf den Gipfel.
Traumhaft dann der Blick über den See, dessen Wasser je nach Wetter und Tageszeit grün oder bläulich schimmert. Im weiten Umkreis hohe dunkelgrüne Bergzüge; zum Norden hin sind die schneebedeckten Zacken der Alpenkette zu sehen, gen Süden scheint sich der See in der Ewigkeit zu verlieren. In Wirklichkeit erstreckt er sich weit hinein nach Italien bis an den Rand der Poebene. Gut möglich, dass man sich auf dem kleinen Berg mit seinem großen Rundblick fühlt wie auf einem Balkon, auf dem der Norden und der Süden des Kontinents einander berühren.
Trotzdem deutete im Spätsommer des Jahres 1900 wenig darauf hin, dass der Hügel über Ascona einmal zum Symbol für die Suche nach einem alternativen, zu unseren wahren Bedürfnissen passenden Leben werden und Menschen aus der ganzen Welt, darunter viele Künstler, anziehen sollte. Zu dieser Zeit hieß er noch nicht einmal so. Monte Monescia nannten ihn die Einheimischen oder auch Pai Mött, was so viel heißt wie Wiesenhügel oder Grüner Hügel. In den »Mött«, den Hügeln über dem Dorf, sammelten die Einheimischen Pilze, Kastanien und Feuerholz. Wer weiß, ob der kleine Berg ohne die Umbenennung in »Monte Verità« jemals die Anziehungskraft entfaltet hätte, die er sich durch eine wechselvolle Geschichte hindurch bis heute bewahrt hat. Indem zwei der hier ankommenden Aussteiger der von ihnen gegründeten Heilanstalt diesen genialen Namen gaben, haben sie allem, was auf dem und rund um den Hügel bei Ascona passierte, einen Markennamen verschafft. Als Monte Verità ist der Berg noch heute auf den Landkarten und in Reiseführern verzeichnet. Der Traum von einem alternativen Leben hat seitdem einen Schauplatz, und dieser Schauplatz steht für sein zentrales Motiv: Du musst, du kannst dein Leben ändern.
Gerade einmal sechs Menschen sind es, die sich von München aus aufmachen, um nach einer mehrwöchigen Odyssee den kleinen, kahlen Berg für ihre ganz persönliche Lebensreform zu entdecken. Es sind dies die Schwestern Ida und Jenny Hofmann, beide Musikerinnen. Sodann die Brüder Karl und Gustav Gräser, der erste und ältere ein an den Grenzen des Habsburgerreiches stationierter, soeben demissionierter Soldat, der zweite und jüngere ein Maler und Lebenskünstler mit Sendungsbewusstsein und einem ausgeprägten Hang zur Nichtsesshaftigkeit. Dazu kommen noch der vermögende belgische Industriellensohn Henri Oedenkoven sowie Lotte Hattemer, ein aus der elterlichen Gewalt entflohenes Mädchen mit einer Vorliebe für Esoterisches. Zwei Geschwisterpaare also und bald schon zwei Liebespaare. Zwei Musikerinnen, ein Künstler, ein entlaufener Soldat, ein reicher Erbe und ein Hippiemädchen. Eine bunte, nicht gerade alltägliche, europäische Mischung.
Kennengelernt haben sich drei von den sechs – Ida, Henri und Karl, die prägenden Figuren der Aussteigergruppe – bereits im Jahr zuvor im oberkrainischen Veldes, dem heutigen slowenischen Bled. Da hatte das neue Jahrhundert noch nicht begonnen, das alte aber lag gefühlt schon längst auf dem Siechbett. Ergebnis war ein diffuses Schwanken zwischen Endzeit- und Aufbruchsstimmung, zwischen Zukunftsangst und Zukunftseuphorie, das die Ästheten unter den Bürgern Fin de Siècle nannten, während die Aktivisten unter ihnen es mit einer Reform des Lebens an Haupt und Gliedern zu kurieren gedachten. Auch in Veldes prägte ein hügelumstandener See mit hohen Bergen im Hintergrund das Landschaftsbild. Und unübersehbar auf einem der Hügel hatte der Schweizer Naturheiler Arnold Rikli eine Anstalt errichtet, wie sie damals an vielen Orten in Europa entstanden – Sanatorien, die die vor allem im Bürgertum grassierende Jahrhundertwende-Depression mithilfe der Natur, mit Sonne, Licht und Luft zu heilen versprachen. Hier beginnt die Geschichte des Monte Verità.
Beim Sonnendoktor
Arnold Rikli, Hydro- und Heliopath sowie Erfinder der Lichtlufthütte, von seinen Anhängern »Sonnendoktor« genannt, von seinen Gegnern als »Narrenkönig« verspottet, steht auf einer Anhöhe. Das über der Brust offene Hemd bedeckt nur locker den Oberkörper, auch die knielangen Sporthosen sind weit geschnitten, die Füße unbeschuht. Mit dem rechten Zeigefinger weist er zur Sonne hin, als wolle er sagen: Ich bin hier, um allen das Licht zu zeigen. In der linken Hand hält er einen fast mannshohen Wanderstab, an dessen oberem Ende ein goldener Knauf und eine Sichel blitzen. Das schlohweiße Haar ist zurückgekämmt, ein Schnäuzer beherrscht das von Wind und Wetter gegerbte Gesicht mit dem männlich entschlossenen, stolzen Blick. So ließ sich der gebürtige Schweizer aus Wangen an der Aare, Gründer und Leiter der Heilanstalt Mallnerbrunn in Veldes, gerne fotografieren. Das Bild zierte die Werbeprospekte seines Sanatoriums und die Titelblätter seiner Broschüren zu einem besseren, gesünderen, naturnahen Leben.
Gut zwei Drittel der Originalfotografie nahm dabei eine der von ihm propagierten Lichtlufthütten ein – ein primitiv anmutendes Modell der ersten Stunde. Seit seiner Ankunft in Veldes im Jahr 1854 hatte Rikli in dem einfachen Holzverschlag von Mitte Mai bis Mitte Oktober jede Nacht verbracht. Stürmte es, so kam es vor, dass das dünne Dach durchlässig wurde und er im Bett den Regenschirm aufspannen musste. Am nächsten Abend fand er dann eine gut durchfeuchtete Schlafstatt vor. Trotzdem – Rikli behauptete, gerade deswegen – war er seither kaum ernsthaft krank gewesen, im Gegensatz zu früher, als er noch, wie es in bürgerlichen Kreisen Usus war, die Nacht unter schweren Federbetten in wenig bis gar nicht durchlüfteten Räumen verbracht hatte. Nichts sei so rasch »der Verderbnis unterworfen, als stillstehende, eingesperrte Luft«, verkündete Rikli. Der Wassertherapeut Gustav Wolbold, wie Rikli ein Autodidakt, hatte es ausgerechnet und das Ergebnis bereits 1877 im Naturarzt, der wichtigsten Zeitschrift der Naturheilbewegung, publiziert: Die Luft eines Zimmers, in dem drei Personen eine Nacht geschlafen hatten, enthielt, sage und schreibe, »2 Pfd. ausgedünstete Haut-Auswurfstoffe und 20 Kubikfuß Lungenexcremente-Kohlensäure«. Bedurfte es da noch eines weiteren Beweises, dass der größte Verunreiniger der Luft der Mensch selbst mit seinen Körperausscheidungen ist? Wir alle, das war schon damals klar, sind auf dem besten Wege, uns selbst zu vergiften. Autointoxikation lautete die Diagnose der Epoche. Dagegen hilft vor allem eins: frische Luft, die Rückkehr zur Hütte.
Rikli hatte dafür gesorgt, dass Mallnerbrunn inzwischen mit über fünfzig komfortablen, weniger archaisch anmutenden Lichtlufthütten bestückt war. Während die gewöhnlichen Bauwerke der Zeit mit ihren üppigen Formen und ihrem plüschigen Dekor die Bewohner gegenüber Licht und Luft abschirmten, waren die zum Veldeser See hin offenen und nur mit den nötigsten Einrichtungsgegenständen versehenen Kurbehausungen Arnold Riklis schlichte Umhüllungen, die den permanenten Austausch mit der umgebenden Natur ermöglichten. Sie glichen, wie ein Zeitgenosse, selbst Leiter einer Naturheilanstalt, treffend bemerkte, hygienischen Apparaten, um einen gesunden Körper zu erzeugen. Unter den Gästen von Riklis Sanatorium, die während ihres Aufenthalts sich solchen Apparaten anvertrauten, waren im Spätsommer des Jahres 1899 auch Ida Hofmann, Henri Oedenkoven und Karl Gräser. Wie vom Anstaltsleiter vorgelebt, schliefen sie an frischer Luft und wurden vom ersten Licht des anbrechenden Tages geweckt, der dann ein ausgedehntes Fitness- und Wellnessprogramm in freier Natur für sie bereithielt, das mit so wenig Kleidung am Körper wie möglich, vorzugsweise nackt, auszuüben war.
Die für Frauen und Männer getrennten Lichtbadestationen, die Namen trugen wie »Riklikulm« oder »Arnoldshöhe«, lagen zwanzig bis dreißig Fußminuten vom eigentlichen Sanatoriumsgelände entfernt. Um seine Patienten auf diesem Spaziergang vor dem Zorn oder den Übergriffen der einheimischen Bevölkerung zu schützen, hatte Rikli spezielle Monturen entworfen, die ein wenig dem ähnelten, was er selbst anhatte. Die Frauen trugen leichte, beinahe durchsichtige Baumwollüberwürfe – statt wie damals üblich, eingeschnürt in Korsetts, zugeknöpft vom Kragen bis zur Stiefelette, selbst in der Sommerfrische mit Hut und Sonnenschirm bewaffnet, herumzulaufen, ohne je einen Sonnenstrahl oder ein Lüftchen auf der nackten Haut zu spüren. Die Männer hingegen rüstete Rikli mit eigens von ihm entwickelten »Luftbadegurten« aus, die vor dem Aufbruch umzuschnallen waren. Daran wurden die abgelegten Kleidungsstücke befestigt, sodass sie sofort griffbereit waren, wenn etwa eine Begegnung mit Einheimischen oder Personen des anderen Geschlechts bevorstand.
Die Stinkfabrik
Ida Hofmann war nach Mallnerbrunn gekommen, um ihren schwer kranken Vater zu besuchen, der seine Tage in unmittelbarer Nähe des Sanatoriums verbrachte. Anders als die meisten Anwesenden war Ida keine Patientin, sondern Beobachterin. Und was sie sah, gefiel ihr: Menschen, die mit einfachen, natürlichen Mitteln ihre Gesundheit wiederherzustellen oder zu erhalten suchten; die abseits vom Weltgetriebe, dem Lärm und der Nervosität der Großstadt nach einem Leben trachteten, das ihren natürlichen Bedürfnissen entsprach; die mit großer Ernsthaftigkeit Sonnenbad und Sinnsuche miteinander verbanden. So, sagte sie sich, müsste es immer sein, heute, morgen, übermorgen und ein ganzes Leben lang, und nicht nur für die wenigen Wochen eines Sanatoriumsaufenthalts oder Urlaubs. Aus diesem Gefühl heraus wurde die Idee des Monte Verità geboren: um die Ausnahmesituation zur Regel, die Lebensreform zur Lebensgrundlage zu machen.
Ida war Pianistin, sogar diplomierte Klavierlehrerin, und eine große musikalische Begabung, wie Professor Epstein, ihr Wiener Lehrer, öfters betont hatte. Doch wie ihre Schwester Eugenia, eine in Frankfurt und Berlin ausgebildete Opernsängerin, von allen nur Jenny genannt, war sie zu schüchtern, um öffentlich aufzutreten. So hatte sie sofort zugegriffen, als man ihr mit Anfang dreißig im montenegrinischen Cetinje eine Stelle als Musiklehrerin angeboten hatte – an einer von der russischen Zarin gegründeten Erziehungsanstalt für höhere Töchter. Ihre Familie hielt das für den Start in eine glänzende Karriere. Je genauer sie jedoch mit der besseren Gesellschaft Bekanntschaft machte, desto mehr stachen ihr deren Egoismus und Anspruchshaltung ins Auge, und sie lernte Lebensverhältnisse zu verachten, die ihrem Eindruck nach auf Schein und Lüge gebaut waren.
Wie anders dagegen ging es in Mallnerbrunn zu. Was Ida hier wahrnahm, waren nicht die Anstrengungen Einzelner, ihre Beschwerden loszuwerden und ein gesünderes Leben zu führen. Für sie war der Kurbetrieb nicht nur eine medizinische Angelegenheit, vielmehr kam er ihr wie ein Sinnbild dafür vor, nach neuen Wegen zu suchen, um dem Leben eine natürlichere Wendung zu geben. Verhielt es sich in Wahrheit nicht so, dass die Gesellschaft die Menschen krank machte, weil sie zu Lebensbedingungen gezwungen waren, die nicht der Natur entsprachen? Also musste man diese Lebensbedingungen ändern, um wirklich gesund zu werden. Und dabei ging es keineswegs nur um Gesundheit, jedenfalls nicht im gewöhnlichen, allopathischen Sinne, sondern um – Wahrheit.
Diese Überlegungen hatten mit Henri Oedenkoven zu tun, den sie gleich nach ihrer Ankunft kennengelernt hatte, weil er mit ihr am selben Tisch platziert worden war. Henri stammte aus Belgien, genauer gesagt aus Antwerpen, und sprach lediglich sehr gebrochen deutsch, sie hingegen ausgezeichnet französisch. So waren sie ins Gespräch gekommen, und das war kein oberflächlicher Small Talk, sondern die Sorte Gespräch, die die Welt bereicherte – rückhaltlos und auf Augenhöhe, ohne Angst vor den heiklen Lebensfragen.
Henris Großvater Hendrik Oedenkoven war Bürgermeister von Borgerhout, einer Industriestadt in unmittelbarer Nachbarschaft von Antwerpen, gewesen. Zusammen mit seinem Schwager Adolphe de Roubaix hatte er vor fast einem halben Jahrhundert mitten in Borgerhout die Kerzenfabrik de Roubaix-Oedenkoven gegründet. Im Volksmund hieß die rasch expandierende Fabrik, die Hoflieferant war und auch nach Übersee exportierte, nur »Den Bougie«. Gründung und Aufstieg des Unternehmens fielen in die Zeit der kolonialen Ambitionen des winzigen Landes, das nicht mehr als ein Fleck auf dem Globus zu sein schien. Doch an den Rohstoffbörsen und Kapitalmärkten Brüssels wurden gigantische Summen erwirtschaftet. Seit der Wiedereröffnung der Schelde war Antwerpen ein Tor zur Welt, und unter den Bürgern breitete sich ein grenzenloser Zukunftsoptimismus aus.
In Den Bougie schufteten bald schon tausendfünfhundert Arbeiter und beugten sich einem Reglement von drakonischer Strenge. Die Fabrik bediente sich der neuesten Erfindungen der Chemie und Mechanik, um aus dem Rohstoff – übel riechendem Ochsen- und Hammelfett – durch Schmelzen und Wiederschmelzen das weiße marmorartige Stearin zu gewinnen, das dann zu Kerzen geformt wurde. Ätzende Dämpfe stiegen dabei auf, insbesondere das hochgiftige Acrolein, eine farblose, flüchtige Substanz, die die Augen der Arbeiter angriff, heftiges Brennen und Tränenfluss hervorrief. Selbst wenn sie sich alle zwölf Stunden ablösten und hin und wieder in den Urlaub gingen, kam es zu bleibenden Schäden an Augen und Atemwegen. Auch in der Umgebung der Fabrik waren Luft und Gewässer stark verschmutzt. Stets stieg ein merkwürdiger Brandgeruch in die Nase, der sich je nach Windrichtung und -stärke ausbreitete. Auf die Frage von Fremden, ob es denn irgendwo brenne, pflegten die Bürger Borgerhouts zu antworten: Ach, das ist nichts, das ist Den Bougie – »dat stinkfabriek«, die Stinkfabrik.
Georges Eekhoud, ein Ziehsohn seines Großvaters, mit dem er gut bekannt sei, habe das alles – so Henri – in seinem Roman Das neue Karthago festgehalten. Es sei eine literarische Abrechnung mit dem Fortschritt, den die Bourgeoisie immer im Munde führe und der doch nur ihre eigene Raubsucht und Widernatürlichkeit bemäntele. Als Henri achtzehn Jahre alt war, war es, wie er erzählte, in Den Bougie zu einem blutig niedergeschlagenen Streik gekommen, mit fünf Toten und zahlreichen Verletzten. Dieses Ereignis habe ihn vollends in der Auffassung von der Verderbtheit eines Systems bestärkt, das dem Wohlleben und Luxus von einigen wenigen diene, aber schlimmes Leid bei der Mehrzahl der Menschen verursache.
Henri war gerade erst Mitte zwanzig, gut zehn Jahre jünger als Ida. Doch schien er ihr wesentlich reifer als ein gewöhnlicher junger Mann dieses Alters. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit seiner Herkunft hatte das zweifellos auch mit seiner langwierigen Krankengeschichte zu tun. Mallnerbrunn war keineswegs sein erster Sanatoriumsaufenthalt; auf der Suche nach Heilung von seinem »unaussprechlichen Leiden«, wie Ida es später nennt, war er schon durch die Hände vieler Ärzte gewandert, doch keiner hatte ihm helfen können. Vielmehr hatten sie ihn mit zweifelhaften Chemotherapien zu behandeln versucht, dabei sein Leiden aber höchstens zurückgedrängt, in Wahrheit noch verschlimmert. Erst im Sanatorium von Louis Kuhne in Leipzig, dem einzigen Laienheiler der Zeit, der sich in einer Großstadt niedergelassen hatte, war ihm wirkliches Verständnis und, wie er hoffte, Heilung zuteilgeworden. »Hinweg mit der Prüderie, hinweg mit der falschen Scham«, hatte Kuhne gerufen, als er bei ihm vorstellig geworden war. Geschlechtskrankheiten seien nichts anderes als Heilkrisen des Körpers, durch welche derselbe die in ihm befindlichen Fremdstoffe herauszufördern bestrebt ist. Geschlechtskrank werde nur derjenige, dessen Körper schon zuvor mit Krankheitsstoffen belastet war – was bei ihm, der neben einer Stinkfabrik groß geworden war, wahrlich kein Wunder sei.
Sprach’s und verordnete ihm seine berühmt-berüchtigten Reibesitzbäder. Dazu legte man eine Bretteinlage in eine Badewanne und füllte diese daraufhin nur so weit mit kaltem Wasser, dass es mit der Sitzfläche auf gleicher Höhe stand. Sodann wusch man unter Zuhilfenahme eines Leinenlappens die äußerste Spitze der vorgezogenen Vorhaut mit sanften, gleichmäßigen Bewegungen. Letzteres erzählte Henri Ida nicht, deutete es höchstens an. Aber, was sollte er sagen, die Wirkung sei so frappierend wie durchschlagend gewesen: Binnen Kurzem gingen seine Beschwerden – eitrige Ausflüsse und mit starkem Juckreiz einhergehende Hautveränderungen – zurück und waren nun fast gänzlich abgeheilt, jedenfalls so weit, dass er sich ohne Weiteres in der von Rikli empfohlenen Lichtluftkleidung zeigen konnte.
Ohne Zwang
Während sich zwischen dem rebellischen, aber leidenden Fabrikantensohn und der an einer unglücklichen Liebe tragenden Klavierlehrerin die zarten Bande einer Freundschaft entspannen, welche schon bald in zahlreichen Briefen ihre Vertiefung finden sollte, machten beide Bekanntschaft mit einer dritten Person, die aus ganz anderem Holz geschnitzt schien als sie selbst, dennoch nicht weniger Außenseiter war: Karl Gräser. Auch er war auf der Suche nach einem alternativen Lebensweg abseits der ausgetretenen und verachteten Karrierepfade, die wie die jungen Leute meinten, in die Enge und Krankheit führten.
Die Familie Gräser kam aus Kronstadt (heute Braşov, zwischendurch auch Oraşul Stalin) in Siebenbürgen, das damals ein Teil der ungarischen Reichshälfte der Doppelmonarchie war – ein Hügelland jenseits der waldreichen Karpaten, weshalb es seit dem Mittelalter auch unter dem Namen Transsylvanien bekannt war. Noch Jahrzehnte später, als Siebenbürgen längst Teil Rumäniens ist, wird sich Reisenden der Eindruck vermitteln, dass das technische Zeitalter an diesen Gegenden spurlos vorübergegangen ist. Und man lebte nicht nur gestrig, man sprach auch so: ein altertümliches Deutsch, das einer längst vergangenen Epoche anzugehören schien. Aus dieser für die Errungenschaften der Moderne verlorenen Provinz – bezeichnenderweise auch die Heimat des Grafen Dracula – stammten die erzfrommen Gräsers.
Karl, etwas älter als Henri, hatte zwei jüngere Brüder, Gustav und Ernst, die beide Künstler werden wollten. Gusto, wie Gustav nur genannt wurde, war ein Schüler des Malers und Aussteigers Karl Wilhelm Diefenbach, dessen Landkommune Himmelhof im Wiener Stadtteil Ober-Sankt-Veit er zeitweise angehörte. Karl berichtete von hymnischen Briefen, die er der Mutter und ihm geschrieben habe; sie würden nach dem Paradies auf Erden streben, die unmenschlichen Rohheiten, die Entartung der heutigen Gesellschaft seien von ihnen erkannt und verbannt worden. Gerüchte über Kindesmissbrauch seitens des Patriarchen Diefenbach, vor allem aber dessen autoritäres Gehabe führten dazu, dass Gusto schon bald das Weite suchte und nach Siebenbürgen zurückkehrte. Dort sei, so Karl, in kurzer Zeit ein Riesengemälde entstanden, fast zwei Meter breit und über einen Meter hoch, es trage den Titel Der Liebe Macht. Man musste es anders als gewöhnlich, nämlich gegen den Uhrzeigersinn und entgegen der Richtung des Fortschritts, von rechts nach links betrachten. Dann gab es seine Botschaft preis: Die Welt der Zivilisation mit ihren Fabrikschloten und Großstädten stand bereits in Flammen; doch der Weg zurück in ein irdisches Paradies war noch möglich, wie das nackte Paar zeigte, das, von einem kindlichen Engel geführt, sich aufmachte, ein neues Leben im Anschluss an die Mutter Natur zu entdecken. Und wie Gustos Frauenbild es wollte, trug die Mutter auf dem Bild lange lockige, blonde Haare.
Diefenbach, so berichtete Karl Gräser hinter vorgehaltener Hand weiter, sei ebenfalls schon in Mallnerbrunn gewesen, um sich von einer Syphilis und den Folgen ihrer falschen Behandlung zu kurieren. Dabei ließ er offen, was ihn selbst hierhergeführt hatte. Kaum denkbar war, dass er unter Neurasthenie, dem Burn-out der Jahrhundertwende, litt; er hatte, wie Ida rasch bemerkte, so gar nichts Feinsinniges oder Mimosenhaftes, eher etwas Knorriges und Unwirsches. Und sein Starrsinn war so grenzenlos wie sein Stolz. Gut denkbar, dass auch er an einer Geschlechtskrankheit laborierte, jedenfalls wäre das bei einem jungen Mann, der seit seinem achtzehnten Lebensjahr Soldat war, nichts Ungewöhnliches gewesen. Vielleicht wusste er auch selbst nicht genau, was hinter seinen Symptomen steckte, oder wollte es nicht wissen.
Was den Soldatenstand betraf, so war zum Zeitpunkt von Karls Aufenthalt in Mallnerbrunn allerdings beinahe schon die Vergangenheitsform angebracht. Zuletzt als Offizier in der Festungsstadt Prömsel (polnisch Przemyśl) stationiert, im hintersten Winkel des ärmlichen, vernachlässigten Galizien, unmittelbar an der Grenze zum Russischen Reich, hatte Karl fest vor, so bald wie möglich zu demissionieren. Sein schlechter Gesundheitszustand würde ihm dabei gewiss Schützenhilfe leisten. Eine beträchtliche Rolle bei dieser Entscheidung hatte ein Erzherzog gespielt, allerdings einer von der Sorte, die aus der Art geschlagen war: Leopold Ferdinand von Österreich-Toskana, ein Ururenkel von Kaiser Leopold II., der wenige Jahre später auf alle Titel verzichtete und unter dem bürgerlichen Namen Leopold Wölfling seine Geliebte, eine ehemalige Prostituierte, heiratete.
Leopold Ferdinand und Karl Gräser verband eine tief sitzende Verachtung für den Drill, der neben der Langeweile den Berufsalltag der Soldaten bestimmte. Drill, das war die geistlose Zurichtung des Körpers wie des Verstandes zu militärischen Zwecken; er hatte zur Voraussetzung, wie Leopold Ferdinand meinte, »dass alle Menschen, an denen er geübt wird, gleicher Brei seien«. Aus Widerstand dagegen hatten er und Karl Gräser in Prömsel eine Vereinigung gegründet, die sie »Ohne Zwang« nannten; Leopold Ferdinand fungierte als deren Präsident, Karl Gräser als eine Art Vorstand.
»Ohne Zwang«, das war Gräsers Mantra. »Nach meinem Gusto« hätte er auch sagen können, aber das war nicht seine Art von Humor, sondern mehr die des jüngeren Bruders. Der spielte gerne mit Namen, nannte sich selbst etwa »Gras« statt »Gräser«, mit der Begründung, einem Einzelwesen komme kein Name zu, der eine Mehrzahl bedeutet, und erläuterte seinen Spitznamen dahingehend, dass er Gefallen habe an den Dingen dieser Welt.
Karl hatte die Formel für sein Weltgefühl bei dem Frühsozialisten Charles Fourier gefunden, der alle seine Wohnungen in Gewächshäuser verwandelt hatte. Fourier führte die Missstände der Gesellschaft darauf zurück, dass sich die naturgemäßen Bedürfnisse des Menschen in ständigem Konflikt mit seiner sozialen Umgebung befänden. Jeden Einzelnen sah er aus einer Fülle von Leidenschaften zusammengesetzt, die danach verlangten, ausgelebt zu werden. Nur dann konnte so etwas wie Harmonie unter den Menschen entstehen. Es kam also darauf an, Formen des Zusammenlebens zu organisieren, die das ermöglichten. »Phalansterium« hatte Fourier die neue Sozialeinheit getauft, die diesem Ideal nahekommen sollte. Dem Soldaten Karl gefiel der Neologismus, insbesondere sein erster Bestandteil.
Fourier hatte nicht nur an eine Wirtschafts-, sondern zugleich an eine Liebesgemeinschaft gedacht. Sie ähnelte ein wenig jenen Gruppen von jungen Leuten, die ihre Tage am liebsten zusammen verbringen, die ganze Zeit quatschen, zwischendurch kochen und knutschen und am Abend nur ungern nach Hause gehen. Oder, noch naheliegender, einem jener Sanatorien, wie sie es gerade bewohnten: Da gab es einen festen Tagesplan, aber der war auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten und bot genügend Spielraum, den eigenen Neigungen zu frönen. In Fouriers neuer Gemeinschaft herrschte freundliche Abwechslung: Niemand war länger als zwei Stunden mit derselben Aufgabe beschäftigt. Die Beseitigung des anfallenden Mülls – so konkret dachte und plante Fourier – sollte Sache der kleinen Kinder sein, denn schließlich spielen diese bekanntermaßen gern mit Schmutz. Vor allem aber gab es weder innerhalb der Phalanstères noch in den Beziehungen zwischen ihnen Herrschaftsinstanzen.
»Alles, was sich auf Zwang gründet«, schrieb Fourier, »ist hinfällig und verrät Mangel an Geist.«
Dabei hatten die Häufigkeit und die Hartnäckigkeit, mit der Karl sein Mantra im Munde führte, beinahe ihrerseits etwas Zwanghaftes. So wie andere immerzu ein zustimmungsheischendes »Nicht wahr?«, ein »Perfekt!« oder »Achtung!« in ihre Aussagen einweben, hielt Karl es mit seinem »Ohne Zwang«: »Ich unternehme heute Nachmittag einen längeren Spaziergang – ohne Zwang«, sagte er etwa oder: »Ein gutes Wort zur rechten Zeit wirkt Wunder – ganz ohne Zwang.«
Das änderte nichts daran, dass Ida, Henri und Karl ein gemeinsames existenzielles Anliegen verband. Was sie suchten, war nicht weniger als ein neues Leben, in dem die Herkunft wie ausradiert war und die Zukunft Gestalt annahm. Die Gesellschaft macht krank, war ihre Überzeugung, wir müssen aussteigen. Unser Phalansterium bauen.
Henri kam aus reichen Verhältnissen und wollte mit seinem Geld etwas anfangen, das ihn persönlich weiterbrachte und zugleich die Welt veränderte. Darunter machte er es nicht. Nach Veldes war er, wie sich nun herausstellte, bereits mit dem Plan gereist, Gesinnungsgenossen für sein Vorhaben zu gewinnen, das ihm als Fabrikantensohn zur Verfügung stehende Kapital für ein Zukunftsunternehmen einzusetzen, welches das Zeug hatte, den Kapitalismus mit allen seinen Übeln zu beseitigen – jedenfalls modellhaft. Er dachte an die Gründung einer Naturheilanstalt, deren Gewinne dann in den Aufbau einer möglichst autarken Siedlungsgemeinschaft fließen sollten, mit Mühlen, Webereien, Fabriken und Schulen – nicht mehr und nicht weniger als eine Lebensgemeinschaft mit der Fähigkeit zur Selbstversorgung in den wesentlichen materiellen und geistigen Belangen – und ohne Ausbeutung der Natur und von Menschen.
Karl fand das alles gut und schön, aber wichtiger als jeder Einfluss auf seine Zeit war ihm die Selbstvervollkommnung – darin stimmte er mit seinem Bruder überein. Für Geld hatten die Brüder Gräser nur Verachtung übrig; sie erblickten in ihm nicht einmal ein notwendiges Übel, sondern ausschließlich den Mammon, der den Menschen von sich selbst entfremdet. Ida hingegen wollte, dass der Frau dieselbe Freiheit und dieselben Rechte zustehen, wie sie sich der Mann mit Billigung seiner Umwelt herausnimmt. Und sie betrachtete den Vegetarismus als einen bislang übersehenen, in Wahrheit aber als den einzig zielführenden Weg zur Gleichberechtigung.
Wie die meisten jungen Leute hatten alle drei das dringende Bedürfnis, an eine Vision zu glauben, Teil von etwas zu sein, das größer war als sie selbst. Noch wussten sie nicht genau, wie sie das erreichen sollten, nur dass sie mit dem Bestehenden brechen und das Erwartbare hinterfragen wollten. Sie träumten von einer Heilstätte für Körper, Seele und Geist, einem Experimentierfeld, um ein besseres Leben zu erproben. Im Süden sollte es liegen, so viel war klar, wo man mit den Kleidern auch jene Gesinnungen und Verhaltensweisen ablegen konnte, die für die Selbstbefreiung hinderlich waren. Dennoch sollte der Ort nicht aus der Welt, sondern mit der Eisenbahn gut erreichbar sein, damit sie selbst die kulturelle Anbindung nicht verloren und Menschen, die auf der Suche waren wie sie, gut zu ihnen gelangen konnten.
Sie verabredeten, sich in einem Jahr wiederzutreffen und in der Zwischenzeit ihre Pläne zu konkretisieren. Henri würde zum Heiligen Jahr nach Rom reisen und anschließend die Weltausstellung in Paris besuchen. Karl würde sein Demissionsgesuch einreichen und mit Gusto Vorträge halten, die für ein anderes, freies Leben warben. Ida würde erst einmal nach Montenegro zurückkehren und sich um den todkranken Vater kümmern.
So gingen sie auseinander.
Vegetarier-Treffen, Monte Verità, 1902.
© Fondo Harald Szeemann. Archivio Fondazione Monte Verità in Archivio di Stato del Cantone Ticino
2. Kapitel
Mach dich auf!
Ein Jahr später. Ida Hofmann, Henri Oedenkoven und Karl Gräser sind in München-Schwabing verabredet, um ihre Ausstiegspläne zu besprechen. Nach dem Tod ihres Mannes ist Idas Mutter mit den drei Töchtern dort hingezogen. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es für junge alleinstehende Frauen zu diesem Zeitpunkt mehr Möglichkeiten als in Münchens hippem Stadtteil, in dem gerade der Radius des Individuums neu vermessen wird. Zu Hochzeiten leben hier annähernd tausenddreihundert Künstler, das ist Rekord im gesamten Deutschen Reich. Höchstens noch Paris kann in dieser Hinsicht mit München konkurrieren. Das Erstaunlichste aber ist die hohe Schwabinger Frauenquote dank des Münchner Künstlerinnen-Vereins und seiner Damen-Akademie. »Ab nach München«, notiert die später sehr bekannte Malerin und Kandinsky-Freundin Gabriele Münter denn auch um diese Zeit in ihrem Tagebuch.
Dass Frauen ihren Neigungen nachgehen und daraus einen Beruf machen, ist in Schwabing eher die Regel als die Ausnahme. Ob sie sich auch gegen die übermächtige Männerwelt durchzusetzen vermögen, steht auf einem anderen Blatt. Trotzdem sind das eigentlich gute Voraussetzungen für die Hofmann-Töchter mit ihren künstlerischen Ambitionen, möchte man meinen. Doch sie können mit der Schwabinger Boheme-Welt nicht viel anfangen. Insbesondere Ida sieht ihre Zukunft nicht zwischen Englischem Garten, Café Luitpold und Hohenzollernstraße, in zugigen Mansarden, durchzechten Nächten und fremden Betten. Die Boheme, zu der sich die meisten jungen Schwabinger Künstler und Literaten zählen, und die Lebensreformer, das sind zwei unterschiedliche Welten, wenn auch ihr Aufeinandertreffen, wie sich noch zeigen wird, die Funken des Neuen in dem gerade angefangenen 20. Jahrhundert besonders intensiv sprühen lässt.
Henri kommt aus Paris nach Schwabing und steht – Technikfreak, der er ist – noch ganz unter dem Eindruck der Weltausstellung und der dort präsentierten Sensationen: Städtepanoramen der Brüder Lumière mit 360-Grad-Rundumsicht, das Trottoir roulant der Rue de l’Avenir, der Straße der Zukunft – ein sich selbst bewegender Fahrsteig, auf dem die Besucher das Ausstellungsgelände umrunden können –, der erste, kurioserweise mit Erdnussöl betriebene Dieselmotor und ein Riesenrad mit einem Durchmesser von hundert Metern. Kürzlich ist in Paris auch die erste Metrolinie zwischen Porte Maillot und Porte de Vincennes eröffnet worden, und Henri berichtet von dem Verlust der Orientierung, den die unterirdische, rasante Fahrt mit sich bringe, auch von den Schauergefühlen, die ihm das Hinabsteigen in diese Katakomben bereitet habe. Seien sie nicht »das Ende aller sanftrauschenden Wälder, aller Morgen- und Abenddämmerungen«, ja, das »Ende der menschlichen Seele«? Mehr als zuvor sieht er sich in dem Vorhaben bestätigt, die Großstadt, in der man doch nichts sei als eine Ameise, die mit fünfzigtausend anderen Ameisen in einem Bau herumkrabbelt, zu verlassen und eine neue Lebensgemeinschaft in der freien Natur zu gründen.
Ida hat ihre Schwester Jenny, die Sängerin, bereits vor dem Treffen ins Vertrauen gezogen. Intellektuelle Überlegungen, wie der Fabrikantensohn sie anstellt, mit dem ihre Schwester poussiert, sind ihre Sache nicht. Aber raus aus der Stadt zu kommen, nicht mehr die verhassten Gesangsstunden geben zu müssen, mit den eigenen Händen etwas aufzubauen, wovon man womöglich leben kann – das sind verlockende Aussichten.
Karl Gräser, frisch demissioniert, bringt, unangekündigt, seinen Bruder mit. Gusto Gräser ist, wie Ida zugeben muss, ein attraktiver junger Mann mit seinem schulterlangen dunkelbraunen Haar, das von einem Stirnband zusammengehalten wird. Darauf angesprochen, stellt er sich als Erfinder dieses praktischen Haarschmucks vor. »Das ist keine Krone«, erläutert er mit seiner tiefen, weichen Stimme, »sondern ein Riemen zum Zusammenhalten meiner langen Haare. Ich gab dem Ding nur eine zierliche Form, und was die Hosen betrifft« – die ihm nur bis zum Knie reichen, wie die von Arnold Rikli propagierte Lichtluftkleidung –, »so gesteh’ ich offen, dass mir die Elefanten-Façon bei unserer Männerkleidung wenig gefällt.« Gusto strahlt Gesundheit aus, physisch wie psychisch. Er ist eine Mischung aus Naturbursche und Geistesaristokrat, bei dem alles eine Bewandtnis zum Höheren hat. Nichts ist unabsichtlich. Schon bald geht Ida seine prätentiöse Art auf die Nerven. Sie hält ihn für einen Besserwisser.
Noch zwei weitere Personen nehmen an dem Treffen teil. Da ist zum einen Charlotte Pauline Hattemer, genannt Lotte, Anfang zwanzig, die Tochter eines preußischen Eisenbahningenieurs und schon vor einigen Jahren dem autoritären Stettiner Elternhaus entflohen – ohne eine müde Mark in der Tasche. Durchgeschlagen hat sie sich mit Gelegenheitsjobs, unter anderem als Kellnerin in anrüchigen Kneipen. Trotz der zahlreichen Avancen, die das mit sich brachte, soll sie sich nicht mit Männern eingelassen haben. Das Haar trägt sie offen; in dichten, straffen Strähnen verhüllt es ihr Gesicht fast bis zur Nase und macht sie zu einer exzentrischen Erscheinung. Stets ist sie leicht überdreht, äußerst impulsiv. Wie die anderen anwesenden Frauen trägt sie leichte, luftige Kleidung, ohne Mieder, und natürlich keinen Hut. Die Sandalen an den Füßen streift sie drinnen sofort ab. Barfuß schwebt sie durch die Wohnung, als wollte sie das Tanzen neu erfinden.
In ihrer Begleitung ist Ferdinand Brune aus Graz, angeblich Sohn eines Gutsbesitzers. Seine in einem dogmatischen Tonfall vorgetragenen Äußerungen lassen in ihm rasch einen in der Wolle gefärbten Theosophen erkennen. Der – da sind sich die anderen mit Ausnahme von Lotte rasch einig – ist nun gar nicht geeignet.
Von den Gesprächen, die dem Aufbruch gen Süden vorausgehen, ist nichts überliefert. Doch die Vermutung, dass es hoch hergegangen sein muss, wird durch die Differenzen gestützt, die schon bald zwischen ihnen ausbrechen. Hier will eine Handvoll junger Leute etwas Gemeinsames organisieren: den Ausstieg aus ihnen sinnlos und inhuman erscheinenden Lebensverhältnissen. Sie wollen sich im Süden niederlassen und dort eine neue Existenz gründen. Doch wie genau und vor allem mit welcher Zielvorstellung das zu geschehen hat – da fangen die Meinungsverschiedenheiten schon an.
Karl und Gusto schwärmen von »vegetarischen Niederlassungen«, die sie auf ihren Wanderungen durch Deutschland kennengelernt haben. »Sie bringen Mut in unsere feige Zeit und Leben in die Bude.« Beinahe pathetisch fordert Gusto die Anwesenden dazu auf, es diesen Aufrührern und Empörern gleichzutun, »die ein wenig Fluss in die träge Masse bringen«.
Ida zieht ein Büchlein hervor. Es trägt den Titel Vorschlag an die Freunde einer vernünftigen Lebensführung. Geschrieben hat es der russisch-deutsche Philosoph Afrikan Spir. Es ist bereits vor dreißig Jahren erschienen und hat, wie die Anwesenden wissen, großen Einfluss auf Nietzsche gehabt. Der Philosoph Theodor Lessing, genervter Großstadtbewohner und Gründer des Deutschen Anti-Lärm-Vereins, hat seine Doktorarbeit über Spir geschrieben. Ohne Zweifel, Afrikan Spir ist eine Autorität in diesem Kreis. Seine Definition von Freiheit als »das Wollen und Handeln in Übereinstimmung mit sich selbst, das Wollen und Handeln seiner eigenen Natur gemäß« ist für Ida und Henri, Karl und Gusto ein wegweisender Gedanke, beinahe so etwas wie eine Formel für ein sinnvolles Leben.
Doch was folgt daraus? Laut Afrikan Spir folgt, dass wir uns »von der Lebensroutine losmachen« müssen. Denn diese verhindert, dass wir in Übereinstimmung mit uns selbst und unserer Natur leben. Das tun wir nämlich nur dann, wenn wir anderen nützlich sind und uns dabei vervollkommnen. Der Alltag des Durchschnittsmenschen, geprägt vom Streben nach Fortkommen, Status und womöglich Luxus, geprägt zudem von vielfachen Rücksichten auf Familie und soziale Hierarchien, geprägt in zunehmendem Maße aber auch von immer mehr Wahl- und Konsummöglichkeiten, steht einem solchen Leben mehr entgegen, als dass er dazu beiträgt. Seiner wahren Natur nach sei der Mensch, schreibt Spir, »wie die belebende Sonne, welche ihre Wärme und ihr Licht über Alles zu ergießen sucht«. Ida liest diesen Satz laut vor. Und wo könnte man ein solches warmes, helles, uneigennütziges Leben wohl besser führen als dort, wo die sonnenhafte Natur des Lebens den Alltag bestimmt, also im Süden?
Karl und vor allem Gusto ist das aus der Seele gesprochen. Sie sind Minimalisten, lange bevor von Überflussgesellschaft und Konsumterror die Rede sein kann. Möglichst wenige Dinge um sich herum zu haben, damit einem mehr Zeit und Energie bleibt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – das ist ihre Maxime.
Spir schlägt eine Siedlungsgemeinschaft von Freunden vor, um die Idee eines Lebens in Übereinstimmung mit sich selbst und der eigenen Natur Realität werden zu lassen. Er meint, es dürfen nicht weniger als fünf und nicht mehr als fünfzehn, höchstens zwanzig sein, die sich zu diesem Projekt zusammenfinden. Nicht weniger, um die nötigen Hilfsmittel zusammenzubringen, die geistigen wie die pekuniären, nicht mehr, um den Zusammenhalt nicht zu gefährden. Und noch eine Zahl: Nur wer das fünfundzwanzigste Jahr zurückgelegt hat, soll Mitglied einer solchen Gemeinde werden können, damit man sicher ist, dass er »einen ernsten und bleibenden Entschluss« fasst. (Gusto ist unter fünfundzwanzig, wie Ida feststellt; Lotte auch.) Eine besondere Anschauungsweise fordert Spir nicht, »wohl aber aufrichtige Liebe zur Wahrheit und Gerechtigkeit«. Auch diese Passage liest Ida laut vor, nachdem sie beinahe atemlos von Spirs Vorschlag berichtet hat. Die anderen nicken beifällig. Von Frauen als möglichen Mitgliedern ist bei Spir übrigens nicht die Rede, wie Ida empört feststellen muss. Er wendet sich ausschließlich an Männer. Typisch Philosoph.
Gusto erinnert die Anwesenden an Johannes Guttzeit. Er ist wie sein älterer Bruder ein ehemaliger Militär, der den Dienst quittiert und sich der alternativen Lebensweise verschrieben hat. Er gründete einen Bruder-Bund, der auch eine Zeitschrift herausgab, schloss sich zeitweise Karl Diefenbach an, von dem er sich aber, wie Gusto auch, wieder trennte, und befindet sich seitdem auf Wanderschaft – eine eindrucksvolle Gestalt mit wallender Kutte und rötlichem Prophetenbart, ein unerschrockener Apostel der Wahrheit. Lotte ist ihm einst begegnet; er hatte gegen die »Schlachthaus-Zivilisation« gepredigt, wie er das nannte, gegen Gewalt in jeder Form, politisch, militärisch, ökonomisch, gegenüber Andersdenken, Frauen und Tieren. Die Titelblätter seiner Schriften führten das Symbol des durch einen Apfel zerstörten Schwertes. Er könnte ein Vorbild sein.
Wie viele Propheten und Messiasfiguren seien in den vergangenen Jahren erschienen, entgegnet Ida. Jeder von ihnen habe genug Anhänger gefunden. Es komme aber darauf an, die Menschen nicht durch bloßen Glauben und unbewiesene Versprechen zum Ausstieg aus dem falschen Leben zu bewegen. Der durchgreifende Entschluss, den das erfordere, solle vernünftiger Überlegung erwachsen, nicht Schwärmerei. So stehe es schon bei Spir.
Henri befürwortet den Siedlungsgedanken. Alle Kultur, meint er, beruhe von jeher auf dem Besitz, und dagegen, ob nun Gemeindebesitz oder Privatbesitz, sei im Prinzip nichts einzuwenden. Nur dass immer weniger Menschen der Löwenanteil des Bodens, den meisten hingegen nicht einmal ein winziges Stück gehöre. Es sei noch gar nicht so lange her, dass die arbeitende Bevölkerung mit Gewalt und List vom Lande vertrieben worden sei, um dem Landhunger der Landjunker und dem Menschenhunger der Fabrikherren zu dienen. Das Stück Natur, das uns allen gehört, gelte es, wiederzuerlangen und der freien Nutzung zuzuführen.
Er wird konkret. «Kapitalien sind augenblicklich das größte Machtmittel«, sagt er. »Aber wir können sie dazu verwenden, dem Kapitalismus entgegenzutreten.« Er schlägt vor, die gemeinsame Ansiedlung an einem der oberitalienischen Seen mit der Gründung eines Sanatoriums zu verbinden. Er traut sich zu, die reiche Erfahrung, die er in den diversen Naturheilanstalten von Kuhne bis Rikli gesammelt habe, an Heilungsbedürftige weiterzugeben.
Karl Gräser erzählt, dass er sein ohnehin überschaubares Vermögen zu großen Teilen bereits verschenkt habe. Jeglicher Besitz von Geld bringe Abhängigkeit und Zwang mit sich. Man müsse ohne Geld auszukommen versuchen, es letztlich abschaffen. »Wir werden dann einfacher, freier dastehen, unbeirrt, und in der richtigen Wechselwirkung der Kräfte.« So etwas bilde sich nur in allmählicher Entwicklung, »die natürlich und ohne Zwang, von selbst vor sich gehen und zum Durchbruch kommen muss«.
Ida und Henri widersprechen energisch. Sie halten das für ein Zeichen von Verantwortungslosigkeit, für Drückebergerei, die letztlich, man werde es ja sehen, zu Schmarotzertum und zum Zelebrieren der eigenen Ohnmacht führe. Von den bestehenden Erwerbsmöglichkeiten stelle ein Sanatorium, meint Henri, »noch eine der rechtlichsten, idealsten« dar und brächte zugleich mehr Gesundheit, Schaffensfreude und mehr Liebe unter die Menschen.
Den Theosophen und angeblichen Gutsbesitzer schreckt das ab. Er ist davon ausgegangen, hier auf eine neue Bewegung zu stoßen, eine Bewegung im Wortsinne: Menschen, die umherwandern, Repräsentanten einer ungebundenen Lebensweise. Sein Vorbild ist die große Madame Blavatsky, die Begründerin der Theosophie. Rastlos zog sie zwischen Russland, dem Mittleren und Nahen Osten, Europa und Amerika umher, um den Menschen der Zivilisation die in sich ruhende Weisheit ihrer westöstlichen Geheimlehre zu bringen. Das hier riecht Brune zu sehr nach Gründung und festem Wohnsitz, kaum einen Monat Fußmarsch über die Alpen vom Ausgangspunkt entfernt. Er wird später Europa verlassen und nach Indien gehen. Gut möglich, dass die anderen auch darüber nachdenken, vielleicht sogar darüber sprechen, richtiggehend auszuwandern, nach Südamerika etwa oder in die Karibik. Doch noch können sie sich das nicht vorstellen.
Henri wird noch konkreter: »Ich schlage vor: Jeder steuert bei, was er an beweglichem Vermögen besitzt. Kommt es zu Gewinn, wird der Hauptteil davon zugunsten des Unternehmens verwendet, der Rest geht zu gleichen Teilen an die Mitarbeiter. Jedem steht es frei, jederzeit auszutreten, egal aus welchem Grund, zum Beispiel weil ihm die Sache nicht mehr gefällt oder ihm eine andere Lebensweise mehr zusagt. In diesem Fall erhält er das eingezahlte Kapital zurück, sobald es flüssig ist.«
»Und was meinst du?« Ida wendet sich an Lotte, die bisher geschwiegen hat. »Wenn du dich in den Süden aufmachst«, sagt sie, während sie hin und her tänzelt, »vergiss nicht, Blumen in deinem Haar zu tragen.«
Theatromanie
Anfang Oktober macht sich die kleine Schar von München aus auf, um jenseits der Alpen an einem der oberitalienischen Seen einen geeigneten Ort für ihre Gründungsabsichten zu finden. So berichtet es Ida Hofmann. Sie gehen zu Fuß, in »einfacher und luftiger Kleidung«, auf den Rücken vermutlich recht schwere Rucksäcke, jedoch ohne das verpönte Schuhwerk, das die direkte Erdberührung verhindert – den ersehnten Kontakt mit der Natur. Gestattet sind höchstens Sandalen, die dem Träger das Gefühl des Barfußlaufens in Schuhen verleihen.
Ihre erste Station ist Oberammergau, gut achtzig Kilometer, drei bis vier Tagesmärsche von München entfernt. 1900 fanden dort Passionsspiele statt (was bis heute lediglich alle zehn Jahre der Fall ist). Schon damals zogen sie ein internationales Publikum an. Selbst ohne eine Aufführung besucht zu haben, dürfte sich den Wanderern die besondere Atmosphäre des Passionsspielorts erschlossen haben, zumal in einem Festspieljahr: eine Nähe von Leben und Theater, wie sie kaum woanders so inbrünstig und einprägsam zu beobachten war. »Wir leben und sterben für die Passion«, heißt es in den Lebenserinnerungen Anton Langs, der im Jahr 1900 Christus dargestellt hat. Wir, das sind die Oberammergauer.
Auch das Lebensexperiment des Monte Verità wird durch diese Nähe von Leben und Theater geprägt sein. Mit ihrer Ansiedlung auf der Anhöhe über Ascona schaffen die Gründer eine Bühne, auf der eine wachsende Schar von Siedlern, Gästen und Besuchern das Schauspiel von Aufstieg und Fall des alternativen Lebens zur Aufführung bringen kann. Zugleich sind die Gründer selbst von der Theatromanie, wie Nietzsche das nannte, gepackt: begnadete Darsteller ihres Nonkonformismus. Sie leben ihr Außenseitertum nicht nur, sie stellen es auch zur Schau. Es ist nicht zuletzt diese Verschränkung von Leben und Inszenierung, die das Experiment des Monte Verità gegenüber anderen Aussteigerprojekten um 1900 von Anfang an so einzigartig macht.
Die Lust der Selbstdarstellung ist insbesondere an dem jungen Gustav Gräser zu beobachten, der sich nach Idas Aussage ihnen unaufgefordert angeschlossen hat. Noch stärker als die anderen setzt Gusto sein Anderssein in Szene und greift dabei, inspiriert durch Gestalten wie Johannes Guttzeit und Anton Lang, auf Attribute zurück, wie man sie eigentlich von Jesus und seinen Jüngern her kennt: Die hohe Gestalt des jüngeren Gräser umhüllt ein formloses eierschalenfarbenes Gewand, in der Hand trägt er einen Hirtenstab. So schreitet er in seinen Latschen erhobenen Hauptes dahin. Das lockige Haar und der ebenfalls lang getragene Bart tun ein Übriges. Jedenfalls berichtet Ida, dass Kinder vor ihm niederknien, weil sie meinen, der Heiland zeige sich ihnen. Vor allem auf Gustos Erscheinung ist es zurückzuführen, dass man die drei Männer der kleinen Gruppe in Oberammergau anfangs für Aposteldarsteller hält.
Gusto redet nicht einfach wie andere Leute, er predigt – in seinem altertümlichen Deutsch, mit volltönender Stimme und »in einem gewissen lehrhaften Ton«, den zumindest Ida unausstehlich findet. Neben einer kleinen Schatulle mit einem gekreuzigten Christus – womöglich ein Geschenk seiner Mutter, einer frommen Frau – trägt er stets ein Täschchen bei sich, das »dichterische Ergüsse« enthält, wie Ida spottet. Gebeten wie ungebeten liest er daraus vor und geht mit seinen Weisheiten hausieren. »Hirnfrost frisst Uns! / Herzgeist nur kann uns retten«, ist da etwa zu lesen, unter einem fetten, mit einem Ausrufezeichen versehenen »Du!«. Auf einer anderen Karte heißt es im gesuchten Reim: »Mütterlichkeit, du Seele allen Lebens / Ohne dich sucht Ruh und Glück alle Welt vergebens«. Gusto Gräser ist ein Vorläufer der wandernden Sucher und Gurus. Ein Muttersöhnchen, wie Ida findet, die selbst eine Vater-Tochter ist.
Wo ist der Ort?
Jenny ist in München bei der kränkelnden Mutter geblieben. Auch Ida kehrt von Oberammergau aus noch einmal dorthin zurück, bevor sie sich dann Ende Oktober – und dieses Mal wohl nicht zu Fuß – nach Cadenabbia am Comer See aufmacht. Dort hat die Viererbande aus Henri, Lotte, Karl und Gusto inzwischen Quartier bezogen. Man erkundet die Gegend nach geeigneten Grundstücken und hat die auf dem Gebiet von Lenno liegende Halbinsel Lavedo ins Auge gefasst.
Obwohl sie dort bereits fündig werden, wollen sie sich weiter umsehen, »um uns ja kein geeignetes Stück Land entgehen zu lassen«, wie Ida schreibt. Die Aussteiger erweisen sich als durchaus anspruchsvoll und haben Recht damit: Die Wahl des Ortes ist für ihr Vorhaben alles andere als trivial. Kaum ein Zufall, dass ihre erste Wahl auf eine zum Teil steil aufsteigende Halbinsel fällt, die wie ein Finger in den Comer See hineinragt. Auf ihrer Erhebung lag in römischer Zeit eine Festung, von der nur noch ein Turm übrig geblieben ist. Die Halbinsel Lavedo ist ein exzeptioneller Ort wie auch der später gewählte Hügel oberhalb von Ascona: ein Schnittpunkt von spektakulärer Natur, Abgeschiedenheit und geschichtlicher Bedeutung. Der passende Ort für das widersprüchliche Bedürfnis von Flucht und Ankommen, das die Gründer umtreibt.
Um so gründlich wie zeitsparend vorzugehen, aber damit ihnen auch ja keiner das favorisierte Grundstück wegschnappt, trennen sie sich erneut. Henri bleibt »behufs eventuellen Kaufabschlusses« in Cadenabbia zurück, die Brüder Gräser sollen den südlichen Teil des Lago di Como und den Mailänder Speckgürtel absuchen, und die beiden Frauen brechen in Richtung Luganer See und Lago Maggiore auf. Mittlerweile – Anfang November – ist der Sommer vorbei, und der Regen klatscht herunter. Als Ida und Lotte bei stockdunkler Nacht am Luganer See anlangen, wo sie unweit des Anlegers von Porlezza in einem kleinen Gasthaus unterkommen, sind sie bis auf die Haut durchnässt. Wie nicht anders zu erwarten erregen zwei pitschnasse, für damalige Verhältnisse leicht bekleidete Frauen, die noch dazu alleine unterwegs sind, bei den Einheimischen beträchtliches Aufsehen. Doch sie werden gutherzig aufgenommen, und die Wirtin begleitet sie sogar noch aufs Zimmer, um die beiden Wanderinnen eigenhändig in warme Decken zu hüllen. Dass Lotte vor dem Zubettgehen allerdings am offenen Fenster gymnastische Übungen macht, ruft bei der Wirtin dann doch heftiges Staunen hervor. »Müllern« wird man diese Art der Zimmergymnastik bei frischer Luft nach ihrem Erfinder und Propagandisten, dem dänischen Sportler J. P. Müller, schon bald nennen.
Am nächsten Tag geht es mit dem Dampfschiff nach Lugano. Dort treffen sie unvermutet auf die Brüder Gräser, die mit ihnen Hase und Igel zu spielen scheinen: Wo es die beiden Frauen auch hinführt, Karl und Gusto sind längst da. Als Ida und Lotte jedoch das Logierzimmer der Männer betreten wollen, stellt sich ihnen der Wirt mit der Bemerkung in den Weg, Frauen sei der Zutritt in ein von Männern bewohntes Zimmer nicht gestattet. Die beiden Gräsers können sie gerade noch von ihrer Absicht in Kenntnis setzen, einen Mann aufzusuchen, der sich in dieser Gegend auskennt – da stehen Ida und Lotte schon auf der Straße und wandern in Kälte und strömendem Regen weiter, nun Richtung Lago Maggiore. Auf der Suche nach einem Nachtquartier werden sie erst überall abgewiesen, dann bietet ihnen ein Italiener an, »a tre« in seinem Haus zu schlafen. »Wie ungewohnt ist die Selbstständigkeit der Frau, wie wenig ist solche geachtet!«, kommentiert Ida das Erlebnis. Mut und Ausdauer tragen ihnen in Ponte Tresa aber doch noch »zwei prächtige Zimmerchen« ein.
Tags darauf werden sie auf dem Bahnhof von Monte Ceresio beinahe verhaftet und eingesperrt. Es beginnt damit, dass ein Bahnhofswärter, der die beiden Frauen mit verächtlichen Blicken misst, sich neben sie stellt und sie nach ihrer Herkunft fragt. Als sie keine Antwort geben und stattdessen weiter ihre Brote verzehren, kommen ein zweiter Neugieriger, dann der Stationschef, schließlich ein feiner Herr aus der Stadt und immer weitere Leute zu ihnen. Alle bestürmen sie: »sono inglesi«, »sono artisti«, »non capiscono« – man kann sich das vorstellen. Als sie trotzdem schweigsam zu essen fortfahren, greift der feine Herr plötzlich nach der Landkarte, die sie bei sich tragen, um ihre Nationalität herauszubekommen. Ida verbittet sich das – in gebrochenem Italienisch –, und er holt daraufhin die Carabinieri, »zwei uniformierte lange Häschergestalten«, wie Ida schreibt, die energisch die Ausweise verlangen. Sie haben keine. Alles Reden hilft nichts, die Lage beginnt ungemütlich zu werden. »Personen, die ohne Dokumente, bloßfüßig in Sandalen und barhäuptig in ein fremdes Land kommen, gelten unbedingt als sehr verdächtig.« Schließlich taucht als Retterin in höchster Not die des Französischen kundige Posthalterin auf, die mit milder Stimme vermittelt, sodass sich die Empörung auf beiden Seiten legt. »Heute würde es mir Spaß machen, auch einmal Untersuchungshaft gekostet zu haben«, schreibt Ida, als sie sich einige Jahre später an dieses Vorkommnis erinnert. Seinerzeit war ihre Empfindung jedoch eher ein sklavisches Ohnmachtsgefühl vor dem »Staate« und seinen Gesetzen.
Schließlich gelangen sie nach Luino, an das Ostufer des Lago Maggiore. Auch hier treffen sie die Brüder Gräser – in der Post, wo sie gerade eine Depesche an Henri aufgeben. Der unablässig prasselnde Regen, Kälte und für diese Umstände – wie Ida zugeben muss – ungenügende Kleidung sowie Unentschiedenheit bezüglich der Terrainwahl lassen die Stimmung sinken. Eines Nachmittags schließlich kommt Henri sehnsüchtig erwartet an. Er ist ebenfalls blau gefroren – aber seine gute Laune ist unverwüstlich und vor allem: Er bringt etwas Warmes und frische Wäsche mit. Zusammen mit den beiden Frauen setzt er sich ans Kaminfeuer, und dort treffen sie den Entschluss, am folgenden Tag mit dem Schiff ans Nordende des Lago Maggiore, nach Locarno, zu fahren. Seit der Freigabe des Gotthard-Tunnels für den Eisenbahnverkehr im Jahr 1882 hat sich das Gebiet zu einem touristischen Zentrum entwickelt. Erneut sind ihnen die Gräsers vorausgeeilt. Sie schicken ein Telegramm: »Hier findet man Menschen, auch langhaarige, vegetarische Pensionen usw., kommet zu uns.« Nach vielem Suchen und Fragen werden sie in der Pension des Ehepaares Engelmann auf dem Monte Trinità oberhalb Locarnos freundlichst empfangen. Die Gräsers scheinen sich hier schon wie zu Hause zu fühlen.
Auszug auf den heiligen Berg
Zusammen mit den Touristen, die vor allem das milde Klima schätzten, war vor der Jahrhundertwende bereits eine Handvoll Aussteiger nach Locarno gelangt – Langhaarige und Vegetarier wie die nun aus München kommende Schar. »Vielerorts, in Brissago, Ronco, Ascona, Losone, Minusio, Orselina, Monte Trinità – bis hinein in die Täler und hinauf zu den Höhen von Bosco – gab es eine Stimmung, die einer neuen Gedankenwelt günstig war. Überall gab es Abseitslebende, Künstler, Philosophen, Theosophen, Vegetarier, politische Flüchtlinge«, schreibt Robert Landmann in seiner erstmals Anfang der 1930er Jahre erschienenen Geschichte Asconas und des Monte Verità. In und um Locarno hatte sich ein neuer Geist entfalten können, abseits des fortschrittlichen Mainstreams, aber doch keineswegs konservativ oder gar reaktionär gesinnt. Einige hier ansässige Intellektuelle hatten in der von Helena Petrovna Blavatsky begründeten Theosophie ein Instrument entdeckt, um ihren Vorbehalten gegen den industriellen Fortschritt und die damit einhergehende Naturzerstörung, ihrer Ablehnung von Autorität und Dogma auch in religiösen Belangen und ihrer Vorstellung von neuen Lebensgemeinschaften jenseits von Privateigentum, familiären und sozialen Zwängen Ausdruck zu verleihen.
Die antitraditionelle und antichristliche Tendenz der Theosophie konnte sich durchaus mit libertären und anarchistischen Forderungen vertragen, wie etwa das Leben von Annie Besant, der Nachfolgerin Blavatskys, zeigt. Sie hatte ihren Ehemann, einen sittenstrengen anglikanischen Priester, nebst den gemeinsamen Kindern verlassen und lebte mit einem Freidenker zusammen. An die Spitze der Theosophischen Gesellschaft gelangte sie, nachdem sie in Londoner Sozialistenkreisen gearbeitet und an antireligiösen Kampagnen teilgenommen hatte. Annie Besant war eine der ersten Frauen, die gegen das Abtreibungsverbot zu Felde zogen. Ihre rhetorische Begabung war legendär. Ida und Henri werden in den Jahren 1902