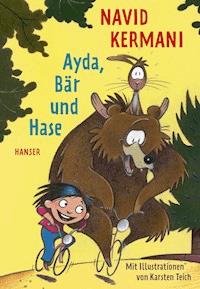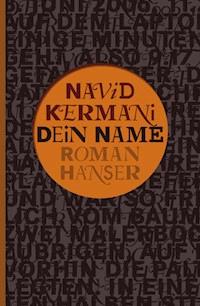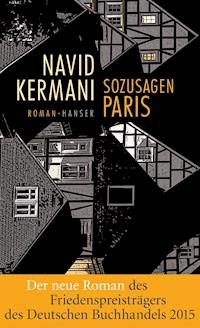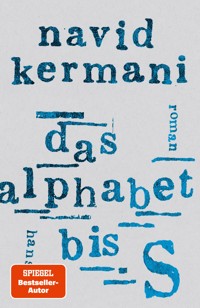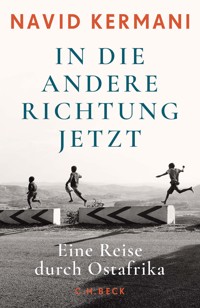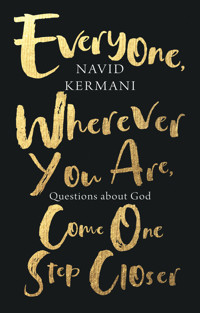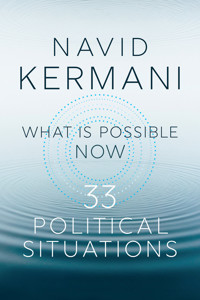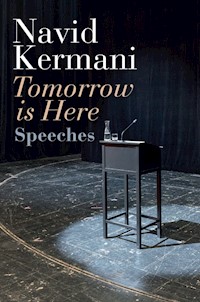19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"In die rhetorische Linie, die von den großen antiken Rednern bis in die Zukunft eines wirklich geeinten Europa reicht, gehört Navid Kermani an prominenter Stelle."
Gerd Ueding, Laudatio zur Verleihung des Cicero-Rednerpreises 2012
Navid Kermani hat die öffentliche Rede zu einer Kunst gemacht, über die das Land staunt - nicht nur mit seiner berühmten Rede im Bundestag zum Grundgesetz oder der Dankesrede zum Friedenspreis in der Paulskirche. Immer wieder überraschte er seine Zuhörer, klärte sie auf, stieß Debatten an, verstörte oder rührte zu Tränen. Das Buch versammelt Kermanis bedeutendste Reden aus den vergangenen zwanzig Jahren und bringt damit eine der ältesten Gattungen der Literatur zu neuer Geltung.
Wie bedankt man sich angemessen für einen Preis, der einem zunächst aberkannt worden ist? Wie erklärt man Amerika kurz nach der Wahl Donald Trumps seine Liebe? Was sagt ein Deutscher mit iranischen Wurzeln über Auschwitz? Welche Worte bleiben am Grab des eigenen Vaters? Und kann ein Kölner objektiv bleiben, wenn er über den 1. FC Köln spricht? Navid Kermani scheut in seinen großen Reden keine Herausforderung und fordert damit auch seine Zuhörer heraus, sich von bekannten Denkmustern zu lösen. In seinem ureigenen Spannungsfeld von klassischer deutscher Literatur, islamischer Mystik, amerikanischer Gegenkultur und europäischem Geist findet Kermani immer neue Gedankenbögen, die auch den Leser bis zur letzten Zeile fesseln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Navid Kermani
Morgen ist da
Reden
C.H.BECK
Zum Buch
Navid Kermani hat die öffentliche Rede zu einer Kunst gemacht, über die das Land staunt – nicht nur mit seiner berühmten Rede im Bundestag zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes oder der Dankrede für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche. Immer wieder überraschte er seine Zuhörer, klärte sie auf, stieß Debatten an, verstörte oder rührte zu Tränen. Das Buch versammelt Kermanis bedeutendste Reden aus den vergangenen zwanzig Jahren und bringt damit eine der ältesten Gattungen der Literatur zu neuer Geltung.
Wie bedankt man sich angemessen für einen Preis, der einem zunächst aberkannt worden ist? Wie erklärt man Amerika kurz nach der Wahl Donald Trumps seine Liebe? Was sagt ein Deutscher mit iranischen Wurzeln über Auschwitz? Welche Worte bleiben am Grab des eigenen Vaters? Und kann ein Kölner objektiv bleiben, wenn er über den 1. FC Köln spricht? Navid Kermani scheut in seinen großen Reden keine Herausforderung und fordert damit auch seine Zuhörer heraus, sich von bekannten Denkmustern zu lösen. In seinem ureigenen Spannungsfeld von klassischer deutscher Literatur, islamischer Mystik, amerikanischer Gegenkultur und europäischem Geist findet Kermani immer neue Gedankenbögen, die auch den Leser bis zur letzten Zeile fesseln. So beseelt spricht gegenwärtig kein zweiter Deutscher zu uns, taktvoll und provokant zugleich, mit Pathos, wo es angemessen ist, und in einem Rhythmus, der fast schon Musik ist.
«Am Ende bewegt und manchmal sogar überwältigt, weil er das, was er sagt, mit solcher Emphase und Echtheit vorträgt, dass es ungehört und unangepasst, aber nie kitschig, spöttisch oder verletzend klingt.» Tobias Haberl, SZ-Magazin
«In die rhetorische Linie, die von den großen antiken Rednern bis in die Zukunft eines wirklich geeinten Europa reicht, gehört Navid Kermani an prominenter Stelle.» Gerd Ueding, Laudatio zur Verleihung des Cicero-Rednerpreises 2012
Über den Autor
Navid Kermani, geboren 1967, ist habilitierter Orientalist und lebt als freier Schriftsteller in Köln. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, etwa den Joseph-Breitbach-Preis, den Kleist-Preis und den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Bei C.H.Beck erschienen von ihm zuletzt «Entlang den Gräben» (4. Auflage 2018), «Einbruch der Wirklichkeit» (4. Auflage 2016) sowie «Ungläubiges Staunen» (13. Auflage 2016, Edition C.H.Beck Paperback 2017).
Inhalt
Vorwort
Laudatio auf den iranischen Schriftstellerverband bei der Verleihung des Sonderpreises zum Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis – Osnabrück, Rathaus, 3. Juli 1999
Zum Tod der ungeborenen Sofía – Berlin, Kirche St. Thomas von Aquin, 27. April 2003
Zum Dank für den Jahrespreis der Helga und Edzard Reuter-Stiftung – Berlin, Liebermannhaus, 23. Januar 2004
Auf der Konferenz «Dialog mit der islamischen Welt» – Berlin, Auswärtiges Amt, 15. März 2005
Zum 50. Jahrestag der Wiedereröffnung des Burgtheaters – Wien, Burgtheater, 14. Oktober 2005
Zum Dank für den Hessischen Kulturpreis – Wiesbaden, Kurhaus, 23. November 2009
Allianz-Lecture über Europa – Berlin, Deutsches Theater, 23. Oktober 2011
Zur Eröffnung der Lessingtage – Hamburg, Thalia Theater, 22. Januar 2012
Zum Dank für den Heinrich-von-Kleist-Preis – Berlin, Berliner Ensemble, 18. November 2012
Zur Eröffnung der 83. Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft – Weimar, Deutsches Theater, 22. Mai 2013
Laudatio auf Angelika Neuwirth bei der Verleihung des Sigmund-Freud-Preises – Darmstadt, Staatstheater, 26. Oktober 2013
Zum 65. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes – Berlin, Bundestag, 23. Mai 2014
Zum Dank für den Joseph-Breitbach-Preis – Koblenz, Stadttheater, 19. September 2014
Auf der Trauerkundgebung für die Opfer der Pariser Anschläge – Köln, Appellhofplatz, 14. Januar 2015
Zum Dank für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels – Frankfurt, Paulskirche, 18. Oktober 2015
Zum Tod von Rupert Neudeck – Köln, St. Aposteln, 14. Juni 2016
Zum Dank für den Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung – Hamburg, Schauspielhaus, 4. Dezember 2016
Zum Tod von Jaki Liebezeit – Köln, Friedhof Melaten, 6. Februar 2017
Zum zwanzigsten Jahrestag des Bestehens des Lehrstuhls für Jüdische Geschichte und Kultur – München, Große Aula der Ludwig-Maximilians-Universität, 6. Juli 2017
Zum Dank für den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen – Köln, Gürzenich, 27. November 2017
Zum Tod von Djavad Kermani – Köln, Friedhof Melaten, 8. Dezember 2017
Zum Tod von Karl Schlamminger – München, Nordfriedhof, 21. Dezember 2017
Laudatio auf Norbert Lammert bei der Verleihung des Leo-Baeck-Preises – Berlin, Jüdisches Museum, 1. Februar 2018
Zum Dank für den deutsch-polnischen Samuel-Bogumił-Linde-Literaturpreis – Göttingen, Deutsches Theater, 3. Juni 2018
Zum siebzigsten Geburtstag des 1. FC Köln – Köln, MTC-Hallen, 17. November 2018
Zum Gedenken an Egon Ammann – Berlin, Literarisches Colloquium, 5. Juli 2019
Zur Eröffnung des XXI. Weltkongresses der Internationalen Gesellschaft für Analytische Psychologie (IAAP) sowie zum fünfundzwanzigjährigen Bestehen der C. G. Jung-Gesellschaft Köln – Wien, Audimax der Universität, 26. August 2019, und Köln, Wallraff-Richartz-Museum, 4. Oktober 2019
Dinner-Speak auf der Investment-Konferenz der Flossbach von Storch AG – Königswinter, Grandhotel Petersberg, 11. September 2019
Epilog über meinen Buchhändler Ömer Özerturgut
Editorische Notiz
Fußnoten
Vorwort
Unter allen Formen der öffentlichen Kommunikation scheint mir das Verlesen einer Rede die seltsamste zu sein. Wer ohne Manuskript spricht, sei es von einem Pult aus oder als Teilnehmer eines Podiums, der verfertigt seine Gedanken bei aller Vorbereitung oder Routine doch während des Redens. Er kann auf das Unverständnis, den Zuspruch, die Überraschung, die Langeweile, den Unmut reagieren, die er an den Gesichtern der Zuhörer abliest oder als Zwischenrufe, Applaus, Husten vernimmt. Er kann selbst jenen etwas nachrufen, die vorzeitig den Saal verlassen, und das macht die Rede in vielen Fällen erst recht lebendig, zumal wenn aus dem Protest ein, und sei es hitziger, Dialog wird.
Bei einer gewöhnlichen Lesung wiederum gehört es zur Verabredung, daß das Vorgetragene sich nicht unmittelbar an die Zuhörer richtet. Deshalb ist sie den meisten Schriftstellern das angenehmere, ihrer Arbeitsweise eher entsprechende Format. Dem Duktus nach ist die Lesung geschriebenes Wort, und noch in der Modulation spricht der Vorlesende keinen bestimmten Adressaten an. Daher sieht er auch selten auf, um seine Zuhörer anzublicken, also mit ihnen in Verbindung zu treten. Ich selbst jedenfalls neige bei Lesungen instinktiv dazu, mich auf das Buch zu konzentrieren, das vor mir auf dem Tisch liegt, und alles auszublenden, was von außen auf mich einströmt. Schon das Klicken einer Kamera, das mich bei den einleitenden Worten oder dem anschließenden Gespräch mit dem Moderator nicht stören würde, kann so sehr irritieren, daß ich die Lesung unterbreche, um darum zu bitten, daß nicht photographiert wird. Das wirkt dann affektiert, das weiß ich selbst, ist jedoch für die Zuhörer immer noch besser, als wenn ich mich über jedes Klicken ärgere und also abgelenkt bin.
Eine geschriebene Rede ist schon im Wortsinn ein Paradox, in der Sache erst recht: Der Redner wendet sich an eine konkrete Zuhörerschaft, die er in der Anrede und im Gestus direkt anspricht. Aber was er scheinbar spontan sagt, hat er sich Wort für Wort vorher überlegt. In gewisser Weise imitiert er den Akt der Rede. Gewiß, der Redner kann vom Manuskript abweichen, wenn ihm ein neuer Gedanke kommt; er kann auf Zuhörer reagieren, die dazwischenrufen oder applaudieren. Aber dann fährt er in der Regel doch fort wie geplant und verliest seinen längst fertigen Text, selbst wenn er merkt, daß andere Worte passender wären. Wird die Diskrepanz zwischen den niedergeschriebenen und den tatsächlichen Gedanken zu groß, kann der Redner das Manuskript auch ganz beiseite legen. Allerdings wird er die Improvisation, da sie neue Unwägbarkeiten mit sich bringt, kaum beabsichtigt haben, als er die Rede verfaßte. Nein, die Absicht beim Verfassen einer Rede ist es, sich so gut in eine Situation hineinzuversetzen, die erst noch bevorsteht, daß man in jedem Augenblick genau das vorträgt, was man auch wird sagen wollen – nur präziser, schöner und tiefgründiger, als es spontan je möglich sein würde. Denn ein Manuskript abzulesen ist mitnichten nur ein Mangel, wie es Rednern gelegentlich vorgehalten wird; die vorherige Verschriftlichung und damit Literarisierung kann auch eine Qualität und bei vielen Anlässen oder für manche rhetorische Talente sogar geboten sein. Die sogenannte freie Rede ist nicht zwingend freier. Soll sie kunstvoll, überzeugend und einprägsam sein, folgt sie schon aus Gründen der Memorierbarkeit rhetorischen, homiletischen Regeln und Topoi, also wörtlich «Gemeinplätzen». Die aufgeschriebene Rede, weil sie komplexere Satzstrukturen und Motivketten erlaubt, erweitert damit im besten Falle auch den Geist. Es ist wunderbar, wenn, sagen wir, im Parlament ohne Manuskript gesprochen wird, und gern nehmen die Zuhörer dafür manche Ungenauigkeit, sprachliche Ungeschicklichkeit oder Polemik in Kauf, die sich im Eifer ergeben. Aber genauso ist es notwendig, daß, sagen wir, in einer Rede über Auschwitz kein Wort unbedacht fällt. Genau genommen handelt es sich um zwei verschiedene Gattungen und versammelt der vorliegende Band keine Reden, sondern Texte, die öffentlich vorgetragen worden sind.
Auch wer einen Roman oder Essay schreibt, stellt die Reaktionen seiner Leser in Rechnung. Er hofft die Erwartungen zu kennen, die er bricht, erfüllt oder mißachtet. Das ist beim Verfassen einer Rede nicht anders: Der Redner nimmt bereits am Schreibtisch den Beifall, die Irritation, die enttäuschte Erwartung und selbst den Protest, die er für einzelne Stellen mutmaßt, in den Gedankengang auf. Der Unterschied zum Buch oder Aufsatz freilich ist: Wer eine Rede verfaßt, hat den Vor- oder Nachteil, daß er die Reaktionen live miterleben wird. Er schaut diejenigen an, an die er sich wendet, und merkt in der Regel sofort, wenn sie den Faden verlieren, erzürnen, begeistert sind oder die Augen verdrehen. Wenn es ganz schlimm kommt, wird er den Wunsch verspüren, sich in Luft aufzulösen – was einem Redner leider noch nie vergönnt war. Die Spannung und auch Anspannung, die ich zu Beginn jeder Rede spüre, rühren eben aus der Unsicherheit, ob die Zuhörer den Gedanken, die bereits feststehen, tatsächlich folgen werden – und daß ich auch dann fortfahren muß, wenn sie sich im übertragenen oder wörtlichen Sinne abwenden.
Als ich etwa 2015 ans Pult der Paulskirche trat, um mich für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zu bedanken, kannten nur einige wenige Freunde, mit denen ich das Manuskript vorab besprochen hatte, das Ende der Rede – also daß ich die Zuhörer auffordern würde aufzustehen, um für Pater Jacques Mourad, Pater Paolo dall’Oglio und die übrigen Geiseln im Irak und in Syrien zu beten oder mit den Wünschen bei ihnen zu sein. So malte ich mir, während ich zu sprechen anfing, in allen Farben die Peinlichkeit aus, daß die Zuhörer trotz meiner Bitte einfach sitzen bleiben würden. Zusätzlich nervös war ich, weil mein Manuskript etwa doppelt so lang war als für die Feststunde und die Sendezeit vorgesehen, und schon mein Laudator unerbittlich überzogen hatte. Ich stellte mir tatsächlich vor, daß zum Schluß meiner Rede kaum noch jemand da sein würde, der aufstehen könnte, und auch das Fernsehen längst abgeschaltet hätte. Erst als ich die Aufmerksamkeit in den Gesichtern der Zuhörer las und als Stille zwischen den Sätzen vernahm, verloren sich die Ängste und gelang es mir, mich auf Pater Jacques Mourad, auf Pater Paolo und die übrigen Geiseln zu besinnen, mit denen ich den eigentlichen, meinen inneren Dialog führte, während ich sprach. Die Kraft, die Liebe und der Mut der Verzweiflung, die die Rede ausgestrahlt haben mag, kamen nicht von mir, sie kamen – so empfand ich es, und das trug mich bis zum Ende und brachte mich dazu, die Erwartungen der Veranstalter, die mögliche Ermüdung der Zuhörer und das Fernsehprogramm zu ignorieren – Kraft, Liebe und Mut kamen von den Gefangenen in Syrien und dem Irak.
Das ist nun ein weiteres Paradox, wenn man eine Rede vorträgt, die längst aufgeschrieben ist: So unmittelbar der Redner die Reaktionen erfährt, wird er doch um so überzeugender, je gleichgültiger ihm die Zuhörer werden und je weniger er sich um ihre Erwartungen schert. Daß ein Mensch andere Menschen um so eher erreicht, je näher er bei sich selbst ist, je mehr also die Aussage einem inneren Anliegen entspricht – «hier stehe ich und kann nicht anders» –, habe ich als Zuhörer wie auch als Redner oft erlebt. Das Gegenteil erlebt man gerade an Festtagen oder bei repräsentativen Anlässen häufig – wenn der Redner nicht für sich selbst spricht, sondern als Vertreter einer Nation, einer Religion, eines Konzerns, einer Stadt oder einer Trauergemeinde. Literatur entsteht niemals in Stellvertretung, sie ist maximal individualistisch, ansonsten ist sie nicht. Sie kann gemeinschaftlichen Nöten, Sehnsüchten und Forderungen nur dadurch Ausdruck verleihen, daß sie die denkbar eigensten, von der einzelnen Lebenserfahrung, Persönlichkeit und Situationen geprägten, dadurch unverwechselbaren Worte findet. Je weniger literarisch aber eine Rede wird, je mehr äußere Erfordernisse hineinwirken, Berater, Interessenvertreter, politische Zwänge, kommerzielle Erwartungen, pietätsvolle oder diplomatische Rücksichten, zwischen denen es einen Ausgleich zu finden gilt, desto größer ist die Gefahr von Sprechblasen, Denkschablonen, Allerweltswahrheiten, denen niemand widerspricht und die sofort vergessen sind. Die höchste Kunst der öffentlichen Rede wäre es, im Namen von vielen zu sprechen, aber so, wie es nur ein einzelner Mensch sagen kann, literarisch zu sein und zugleich repräsentativ. Selbstverständlich war mir diese paradoxe Anforderung nicht, und das merkt man vor allem meinen älteren Reden an, von denen deshalb nur wenige in diese Sammlung aufgenommen sind. Das Selbstbewußtsein, auch im Vortrag bei meiner eigenen Sprache zu bleiben mit ihren rhythmischen Eigenheiten und verwinkelten Sätzen, mußte ich mir ebenso aneignen wie die Chuzpe, in einer Festversammlung etwas Unpassendes zu äußern, etwas Ungehöriges, allzu Pathetisches, Weitschweifiges, Privates und sei es eine Banalität, wenn sie mir in dem Augenblick nun einmal wichtig ist.
Daß ich manche Aussagen, so überzeugt ich von ihnen seinerzeit war, im nachhinein anders treffen würde und mich immer wieder mal auch schlicht geirrt habe, liegt in der Natur der Sache. Mehr als ein Buch und selbst ein Zeitungsartikel ist eine Rede für einen genau bestimmten Zeitpunkt, einen konkreten Ort und eine klar umrissene Zuhörerschaft verfaßt. Später, anderswo und für eine unbestimmte Leserschaft stellt sich die Welt notwendig anders dar. In einem Essay, einem Roman oder einer wissenschaftlichen Studie ist es außerdem zulässig, nachträglich Revisionen vorzunehmen. Am Pult jedoch gilt das gesprochene Wort. Lediglich bei den Reden, die nicht öffentlich aufgezeichnet worden sind, habe ich mir die Freiheit genommen, kleinere sprachliche Retuschen vorzunehmen; ansonsten muß ich die eigenen Irrtümer und Unzulänglichkeiten aushalten, die mir verständlicherweise selbst am unangenehmsten sind. Die Hoffnung auf den Reformprozeß, die 1999 die iranischen Schriftsteller beflügelte, hat sich längst zerschlagen. Die Frage, ob Lehrerinnen in der Schule ein Kopftuch tragen dürfen, würde ich heute vermutlich nicht mehr in einem einzigen Satz abhandeln können wie 2003. Die jüdische und muslimische Tradition gemeinsam zu erforschen, wie ich es 2005 einforderte, ist inzwischen zu einer gängigen Praxis geworden, wenn auch vorläufig nur an akademischen Institutionen, während der kulturelle Austausch heute eher noch strikter Israel von seiner arabischen und islamischen Nachbarschaft trennt. Die Koranaktion, über die ich 2013 in meiner Laudatio auf Angelika Neuwirth noch spöttelte, erwies sich später als Brutstätte für Dschihadisten. In der Bundestagsrede 2014 hätte ich auf den Unterschied zwischen Flüchtlingen im Sinne der Genfer Konvention und den vergleichsweise wenigen politisch Verfolgten hinweisen sollen, auf die speziell der Paragraph 16 des Grundgesetzes gemünzt ist. Auch wäre mir mancher Widerspruch erspart geblieben, hätte ich mit einem Beispiel klarer gemacht, was genau gemeint war, als ich kritisierte, daß mit der Reform des Paragraphen das Asyl «als ein Grundrecht praktisch abgeschafft» worden sei (wohlgemerkt nicht das Asyl selbst, wie mir in den Mund gelegt wurde). Denn in der Sache hatte ich leider recht: Einem Menschenrechtsaktivisten, dem in seinem Land Verhaftung, Folter oder Hinrichtung drohen, sind mit der Drittstaatenregelung strenggenommen alle legalen Möglichkeiten verwehrt worden, in Deutschland Asyl zu beantragen – es sei denn, er spränge mit dem Fallschirm über Deutschland ab. Als im darauffolgenden Jahr Hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland Schutz suchten, handelte es sich nur zu einem geringen Teil um politisch Verfolgte im Sinne des Paragraphen 16, und selbst wenn, hätten sie kein Grundrecht in Anspruch genommen. So oder so lag ihre Aufnahme im Ermessen der Bundesregierung, und es ist bis heute umstritten, ob eine so weitreichende Entscheidung ohne Zustimmung des Bundestags getroffen werden durfte.
Und so weiter: In der Friedenspreisrede hätte ich, wie in vielen vorherigen und späteren Veröffentlichungen, noch expliziter die iranische Politik in Syrien und den schiitischen Extremismus anprangern müssen, damit meine Kritik am Wahhabismus nicht als schiitisch diskreditiert werden konnte. Der konservative französische Präsidentschaftskandidat François Fillon, den ich am 4. Dezember 2016 für die ehrliche Beseeltheit lobte, mit der er seine – aus meiner Sicht weitgehend falschen – Überzeugungen vertrat, wurde nur Tage später der illegalen Beschäftigung von Familienmitgliedern auf Staatskosten überführt, die er auch noch dreist leugnete. In der Grabrede für meinen Vater, eilig und noch im ersten Schock geschrieben, weil das Begräbnis nur wenige Tage nach dem Tod stattfand, habe ich mich selbst wahrscheinlich ein paar Mal zu häufig erwähnt. In der Rede über Karl Schlamminger, der in der Nacht nach dem Begräbnis meines Vaters starb, hätte ich so viel mehr sagen müssen, um seiner Arbeit, seinem Wesen, seiner Familie und Liebe gerecht zu werden. Ja, diesen unbefriedigenden Eindruck hatte ich nach allen Trauerreden, vielleicht ist er dem Genre inhärent und weist, ins Positive gewendet, auf das Unendliche eines jeden Menschen hin: Viel mehr wäre zu sagen gewesen. So setzt sich die Liste der Fehler und möglichen Verbesserungen fort, und die Frage, die sich mir bei der Vorbereitung dieses Buches gestellt hat, war nicht, welche Irrtümer ich korrigiere, sondern ob eine Rede als Ganze, mitsamt ihren Ungenauigkeiten, Mängeln oder Verständnisschwierigkeiten für eine allgemeine Leserschaft (der beispielsweise die Historie des 1. FC Köln nicht so geläufig ist wie den Gästen einer vereinsinternen Jubiläumsgala), bedeutend genug erscheint, noch einmal abgedruckt zu werden (wobei der Fan, der ich bin, den 1. FC Köln an sich schon für bedeutend genug hält). Wahrlich nicht für alle Reden gilt das, die ich gehalten habe oder abbrechen mußte, um zu improvisieren. Aber zu den Manuskripten, die im vorliegenden Buch versammelt sind, würde ich dann doch stehen.
Laudatio auf den iranischen Schriftstellerverband bei der Verleihung des Sonderpreises zum Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis
Osnabrück, Rathaus, 3. Juli 1999
Herr Bundestagspräsident, Herr Oberbürgermeister, liebe Frau Sari, lieber Herr Golschiri, meine Damen und Herren,
vor über dreißig Jahren trafen sich in Teheran die bedeutendsten Schriftsteller und Schriftstellerinnen des Landes, um den iranischen Schriftstellerverband zu gründen. Sie beschlossen, einen Antrag auf Zulassung zu stellen und ihr Anliegen dem zuständigen Beamten im Kulturministerium vorzutragen. Der Beamte sagte zu, das Anliegen zu prüfen. Aber er meldete sich nicht mehr. Nach ihm kamen noch viele andere Beamte. Irgendwann trugen sie keine Krawatten mehr, sondern Bärte. Aber niemals sagten sie, zu welchem Ergebnis sie gelangt sind.
Seit dem ersten Versuch der iranischen Schriftsteller, einen unabhängigen Verband zu gründen, hat Iran eine Revolution erlebt, einen acht Jahre währenden Krieg, Zehntausende von Hinrichtungen, die Rückkehr von Hunderttausenden von Iranern aus dem Exil, die Auswanderung von Millionen Iranern, gleichzeitig die Aufnahme von mindestens drei Millionen Flüchtlingen aus anderen Nationen, eine beispiellose Wirtschaftskrise, interne Machtkämpfe, politische Morde, den Terrorismus des Staates und der bewaffneten Opposition, die nicht enden wollende Verfolgung jener, die anders denken als die Herrschenden, und immer wieder Hoffnungen, die sich als trügerisch erwiesen. Es war eine Zeit, die nicht hätte bewegter sein können, in der kein Stein auf dem anderen geblieben ist, aber noch immer, über dreißig Jahre später, ist der Schriftstellerverband dabei, sich zu gründen. Das ist eine Kontinuität, über die sich vielleicht schmunzeln ließe, wenn sie nicht die ganze Enttäuschung einer Zeitenwende in sich trüge.
Gewiß, es gab Phasen, vor allem unmittelbar vor und unmittelbar nach der Revolution von 1979, als die Schriftsteller relativ unbehelligt zusammenkommen und Erklärungen verfassen konnten, aber sie sind kurz im Vergleich zu der langen Zeit im Untergrund, als sie sich nur in Privatwohnungen trafen, den Jahren, in denen sie niemals sicher sein konnten, ob bei der nächsten Versammlung noch alle Freunde in Freiheit, am Leben oder im Land sein würden. So ließe sich die Geschichte des iranischen Schriftstellerverbandes als eine Geschichte der Unterdrückung erzählen, als eine Geschichte der Bedrohungen, eine Geschichte der Getöteten, Verhafteten, Gefolterten, Zensierten, Geflohenen. Man kann aber auch eine Geschichte des Widerstands erzählen, eine Geschichte der Geduld, des Trotzes, der Selbstbehauptung und der Kraft der Literatur. Wenn nach dreißig Jahren immer noch – oder wieder – ein Gründungskomitee des Schriftstellerverbandes existiert, ist das schließlich nicht nur ein Hinweis auf die Widrigkeiten, denen Schriftsteller in Iran ausgesetzt sind. Es ist auch ein Hinweis auf ihre Beharrlichkeit.
Daß Diktaturen es Schriftstellern verwehren, sich zu einem unabhängigen Verband zusammenzuschließen, versteht sich beinah von selbst. Daß die Schriftsteller jedoch über einen so langen Zeitraum hinweg an ihrem Vorhaben festhalten, daß sie unter den denkbar schwierigsten Bedingungen auf der einen und zentralen Forderung aller Schriftsteller dieser Welt bestanden haben – der Forderung, daß das Wort frei sei –, ist keineswegs selbstverständlich. Davon ist zu künden, weil es zeigt, wozu Literatur fähig ist. Ich sage nicht: wozu Menschen, ich sage nicht: wozu Widerstandskämpfer, Freiheitsliebende, Intellektuelle fähig sind. Ich sage: wozu Literatur fähig ist, denn sie ist es, die am Anfang steht und am Ende stehen soll. «Wir sind Schriftsteller», lautet der erste Satz jener Protesterklärung vom Herbst 1994, in der 134 iranische Autoren die Abschaffung der Zensur und die Zulassung des Schriftstellerverbandes verlangen. «Wir sind Schriftsteller.» Das klingt wie eine banale Feststellung, aber tatsächlich war es ein Manifest und eine brisante Forderung. In einem durch die Revolution ideologisierten Land, wo noch jede Quizsendung im Fernsehen die rechte Gesinnung probt und jedes Buch einer Gesinnungsprüfung unterworfen wird, ist es ein mühsamer und sehr politischer Kampf, dem Privaten, der Kunst, dem Unpolitischen Räume zurückzuerobern und darauf zu bestehen: «Wir sind nichts anderes als Schriftsteller.»
Und da ist noch etwas anderes, weshalb ich von der Macht der Literatur gesprochen habe: Schriftsteller mögen noch so kluge und mutige Stellungnahmen zur politischen Situation in ihrem Land abgeben, aber würden sie keine großartigen Romane, Gedichte, Erzählungen, Theaterstücke schreiben – wer würde sie hören? Es ist die Dichtung, die ihren Kampf um die Meinungsfreiheit zu einem Existenzkampf macht, weil es ein Kampf um ihre Existenz als Dichter ist. Und es ist ihr literarisches Werk, das ihren Widerworten jene Autorität verleiht, die selbst von den Mächtigsten nicht ignoriert werden kann. Nur so ist der Aufwand erklärbar, den zwei Sicherheitsapparate – der Sicherheitsapparat der Monarchie und der Sicherheitsapparat der Islamischen Republik – betrieben haben, um diesen doch recht kleinen Kern von hundert oder zweihundert Literaten zum Schweigen zu bringen. Nur so sind die Sonderabteilungen der verschiedenen Geheimdienste, die konzertierten Verhaftungen, die wütenden Gerichtsurteile, die generalstabsmäßigen Kampagnen in den staatlichen Medien zu verstehen, denen der Schriftstellerverband seit seinen Anfängen ausgesetzt war.
Wie gesagt, die Anfänge reichen über dreißig Jahre zurück, bis in das Jahr 1967. Auch ohne eine offizielle Genehmigung zu haben, mieteten die Schriftsteller damals ein Büro an, um sich regelmäßig zu literarischen Zirkeln, Lesungen und Diskussionen zu treffen. Aber schon bald begannen die ersten Verhaftungen. Gholamhossein Saedi, Abbas Milani, der diesjährige Friedenspreisträger Huschang Golschiri und der ebenfalls anwesende Ali Aschraf Darwischian gehören zu denjenigen, die Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre für ihre Forderung nach Meinungsfreiheit verhaftet und zum Teil gefoltert wurden. Manchen von Ihnen werden die Namen, die ich erwähne, wenig sagen, aber wer die zeitgenössische persische Literatur kennt, der weiß, daß praktisch alle bedeutenden Schriftsteller der Gegenwart sich in diesem Verband engagiert, für diesen Verband gekämpft haben, ob Ahmad Schamlu oder Simin Daneschwar, Mahmoud Doulatabadi oder Simin Behbahani und ebenso der diesjährige Träger des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises, Huschang Golschiri.
1977 lockerte das Regime die Zügel, um den Aufstand zu verhindern, der sich anbahnte. Die Schriftsteller nahmen ihre öffentlichen Aktivitäten von neuem auf. Im gleichen Jahr kam es zu den wohl denkwürdigsten Tagen in der Geschichte des Schriftstellerverbandes und vielleicht auch in der Geschichte des deutschen Goethe-Instituts. Zehn Herbstnächte lang kamen etwa sechzig der bedeutendsten iranischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen im Garten des Teheraner Goethe-Instituts zusammen, um ihre Texte zu lesen, Reden zu halten und über Literatur und Politik zu diskutieren. Nacht für Nacht strömten Tausende Iraner zu den Dichterlesungen. Es hat etwas Magisches mit diesen zehn Nächten. Es war kalt, und oft regnete es in Strömen. Aber die Menschen harrten unter Regenschirmen und Planen über Stunden hinweg aus, um neue Poesie und avantgardistische Prosa zu hören. Spricht man mit Iranern, die an diesen zehn Nächten teilgenommen haben, gleich ob als Vortragende oder als Besucher, wird man augenblicklich ein Leuchten in den Augen wahrnehmen, und man wird Adjektive hören, die man gewöhnlich aus Liebeserzählungen kennt. Es muß tatsächlich ein großer Moment gewesen sein, ja ein Moment der erfüllten Liebe, als die Schriftsteller ungehindert ihre Leser treffen konnten. Es gab nicht viele solche Momente in der Geschichte der modernen iranischen Literatur.
Die Revolution von 1979 brachte den Dichtern zunächst die erhoffte Freiheit. Einige – unter ihnen Simin Daneschwar, Ahmad Schamlu und Huschang Golschiri – beschlossen, Revolutionsführer Ajatollah Chomeini aufzusuchen, um die Ideen und Forderungen des Schriftstellerverbandes vorzutragen. Es muß eine sehr enttäuschende Begegnung gewesen sein. Chomeini war mißmutig und verstand nicht, was die Dichter von ihm wollten; vielleicht wollte er es auch nicht verstehen. Spätestens, als die Schriftsteller sich bereits nach einigen Minuten vor der Tür wiederfanden, wußten sie, daß dieser Führer eine andere Revolution im Sinne hatte als sie. 1980, nur ein Jahr nach dem Sturz des Schahs, setzten die altbekannten Angriffe auf die Literatur wieder ein, diesmal nicht mehr im Namen der Nation und des Monarchen, sondern im Namen der Religion und des Revolutionsführers, der rief: «Brecht ihre Federn!» Der Dichter Said Soltanpur wurde verhaftet und hingerichtet. Viele andere mußten ihre Lehrstühle aufgeben oder wurden mit einem Publikationsverbot belegt.
Es sollte über zehn Jahre dauern, bis der Schriftstellerverband wieder seine regelmäßigen Sitzungen aufnahm. Eine halbe Generation von Dichtern war ausgewandert oder gestorben, eine weitere Generation neu auf die literarische Bühne getreten, unter ihnen die anwesenden Abbas Maroufi, Amir Hossein Tscheheltan sowie Fereschteh Sari, die heute den Preis im Namen des Schriftstellerverbandes entgegennehmen wird. Im Frühjahr 1994 veröffentlichten die Schriftsteller erstmals wieder eine Erklärung, um gegen die Verhaftung ihres Kollegen Said Sirdschani zu protestieren, der einige Monate später in seiner Zelle sterben sollte, angeblich an Herzversagen. Im Oktober desselben Jahres gingen die Schriftsteller noch einen Schritt weiter und verfaßten den «Text der 134», der die Abschaffung der Zensur, die Einhaltung der Menschenrechte und die Zulassung des Schriftstellerverbandes verlangte. Die Erklärung sorgte weltweit für Aufsehen. Ich war zu der Zeit in Iran und erinnere mich, wie mich der Kulturredakteur einer deutschen Tageszeitung anrief. Am meisten habe ihn erstaunt, sagte der Redakteur, daß es in Iran überhaupt 134 oppositionelle Schriftsteller gibt.
So war die Wahrnehmung zu jener Zeit in Deutschland: Iran galt als Gottesstaat mit gleichgeschalteten, fanatischen Massen. Diese Wahrnehmung hat sich mittlerweile grundlegend verändert. Die westliche Öffentlichkeit hat von einer kreativen Kunstszene, von bedeutenden Filmemachern, von mutigen Intellektuellen erfahren. Sie hat zur Kenntnis genommen, daß sich die iranische Bevölkerung in ihrer Mehrheit Demokratie, Freiheit und die außenpolitische Öffnung wünscht; man mag sich in der Beurteilung der Erfolgsaussichten nicht einig sein, aber man staunt über die gesellschaftliche Bewegung, die das herrschende System erschüttert. An dieser veränderten Wahrnehmung des Auslands waren die Schriftsteller mit ihrem «Text der 134», aber auch mit ihren Interviews, ihren Erklärungen, ihren Artikeln in der internationalen Presse, die seitdem erschienen sind, maßgeblich beteiligt.
Wenn heute von der iranischen Reformbewegung gesprochen wird, wirkt es oft so, als habe sie vor zwei Jahren mit der überraschenden Wahl Mohammad Chatamis zum Präsidenten begonnen. Dabei hat sich diese Bewegung schon lange vorher in der Gesellschaft, in den Schulen und Universitäten, in den Theologischen Hochschulen, unter den Frauen und Intellektuellen formiert; der haushohe Sieg Chatamis gegen den erklärten Willen des Revolutionsführers und trotz der Propagandamaschinerie des Staates ist die Folge dieser breiten gesellschaftlichen Bewegung gewesen, nicht ihr Anfang. Die Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung war schon zuvor mit Händen zu greifen, es war zu ersten Aufständen gekommen, und unabhängige Zeitschriften wie Kiyan, Gardun oder Adineh hatten die Forderungen umrissen, um die heute in Iran offen gestritten wird.
Die Schriftsteller waren und sind nur ein Teil dieser breiten Bewegung und keineswegs die einzigen, die Opfer gebracht haben; kritische Theologen, Studentenvertreter, Angehörige religiöser Minderheiten wurden in den letzten Jahren kaum weniger brutal verfolgt, mag man deren Schicksale im Westen auch oft nur am Rande wahrgenommen haben. So ist es heute eher den Geistlichen und religiösen Intellektuellen überlassen, sich mit der Ideologie der Islamischen Republik auseinanderzusetzen und jene Diskussionen über Säkularismus, Menschenrechte und Demokratie in Gang zu setzen, vor denen sich die Hüter der islamistischen Ordnung am meisten fürchten. Es kann nicht die Aufgabe der Schriftsteller sein, Theorien zu entwickeln oder zu verwerfen. Aber die Schriftsteller sind es, die dem Verlangen nach Freiheit eine Stimme verleihen, die in der Welt gehört wird, weil sie jene Sprache sprechen, die in allen Kulturen verstanden wird, die Sprache der Bilder, Rhythmen und Geschichten, des Staunens, der Zwischentöne und Vieldeutigkeiten, die Sprache der Poesie. Es ist ihre Aufgabe, die Furcht der Menschen so genau zu beschreiben, daß sie erfahrbar wird, und ihrer Hoffnung einen so verheißungsvollen Ausdruck zu geben, daß alle Menschen an ihr teilhaben.
Eben weil sie spürte, daß der Boden unter ihren Füßen zittert, holte die herrschende Elite noch einmal zum Schlag aus. Schon bald nach dem «Text der 134» begann eine neue Welle der Repression. Der Übersetzer Ahmad Miralai wurde ermordet, ebenso der Publizist Ghaffar Hosseini. Beide hatten die Erklärung unterschrieben. Andere wurden vom Geheimdienst gezwungen, ihre Unterschriften zurückzunehmen, oder flohen ins Ausland. Umgebracht wurden auch der Verleger Ebrahim Zalzadeh und der Universitätsprofessor Ahmad Tafazzoli. Der Mordanschlag auf über zwanzig Schriftsteller, die sich auf der Reise nach Armenien befanden, die Schließung kritischer Zeitschriften, die Verurteilung Abbas Maroufis zu Peitschenhieben und Gefängnis, die Verschleppung Faradsch Sarkuhis – der Terror, zu dem die Herrschenden Zuflucht nahmen, entsprang ihrer Angst, nicht ihrer Stärke. Das Beispiel Sowjetunion, das Beispiel Ceauşescu und die Wahrheitskommission in Südafrika vor Augen, versuchten sie das Streben nach Freiheit zu unterbinden, bevor es übermächtig würde, und insbesondere die Schriftsteller durch nackten Terror einzuschüchtern.
Im vergangenen Herbst kam es zu einer neuerlichen Mordserie. Neben den Oppositionspolitikern Dariusch und Parwaneh Foruhar waren es wieder zwei Mitglieder des Schriftstellerverbandes, Mohammad Mochtari und Mohammad Puyandeh, die ihr zum Opfer fielen. Das Schicksal von zwei weiteren Intellektuellen, Piruz Dawani und Madschid Scharif – der eine seit Sommer letzten Jahres vermißt, der andere tot aufgefunden –, ist bis heute nicht geklärt. Aber dann trat ein, was die Mörder und ihre Auftraggeber am wenigstens erwartet hätten: Anstatt sich verängstigt und resigniert zurückzuziehen, wehrten sich die Menschen. Zehntausende kamen zu den Begräbnissen der ermordeten Intellektuellen. Die Studenten demonstrierten, Zeitungen verlangten in dicken Lettern die Aufklärung der Morde, die Schriftsteller wandten sich an die nationale und internationale Öffentlichkeit, Politiker erklärten sich solidarisch mit den Bedrohten. Der öffentliche Druck zwang den Geheimdienst zu einer Erklärung, die beispiellos in der iranischen Geschichte ist: Der Geheimdienst gab zu, die Morde begangen zu haben. Das Geständnis löste ein politisches Erdbeben aus, in dessen Folge die ersten Kommunalwahlen der iranischen Geschichte stattfanden und eine iranische Regierung erstmals die Gründung des Schriftstellerverbandes ausdrücklich befürwortete.
Man sollte diese Regierung daran messen, ob sie ihr Wort hält, denn noch ist der Verband, der heute mit dem Sonderpreis zum Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis ausgezeichnet wird, nicht gegründet. Er ist noch immer, wie seit über dreißig Jahren, in der Gründung begriffen. Legt man die aktuellen Nachrichten zugrunde, kann es noch lange Zeit dauern, bis in Iran unabhängige Parteien, Verbände, Institutionen und eben auch ein Schriftstellerverband existieren werden und die Gewalt endgültig kein Mittel der politischen Auseinandersetzung mehr ist. Aber am Ende – mag es noch weitere dreißig Jahre dauern –, am Ende werden die Schwerter, die heute noch gezückt sind und morgen wieder morden können, am Ende werden sie schmelzen in der glühenden Geduld auch jener Menschen, die an die Literatur glauben, an die Bilder, Rhythmen und Geschichten, an das Staunen, die Zwischentöne und die Vieldeutigkeiten des Lebens.
Ich danke Ihnen, ich danke allen Mitgliedern des iranischen Schriftstellerverbandes, auch und besonders den ermordeten Ahmad Miralai, Ghaffar Hosseini, Mohammad Mochtari und Mohammad Puyandeh.
Zum Tod der ungeborenen Sofía
Berlin, Kirche St. Thomas von Aquin, 27. April 2003
Liebe Maria, lieber Gereon, lieber Felix, liebe Freunde,
Sofía Charlotte Hamm war ein ruhiges Kind, ruhiger als ihr Bruder Felix. Offenbar fühlte sie sich wohl in der liebenden Fürsorge, die sie durch die Stimmen und Hände ihrer Eltern umgab. In Aufregung geriet sie nur, wenn ihr Bruder Felix zu ihr sprach. Dann reckte und streckte sie sich und schlug freudig mit den Beinen. Etwas Besonderes verband die beiden. Sie sah ihm auch sehr ähnlich. Sie hatte dieselbe Nase, den schmalen Mund, dieselben dunklen, vollen Locken, mit denen Felix die Eltern bei seiner Geburt überrascht hatte, und sie hatte die gleichen feinen, langgestreckten Lippen wie Felix. Wäre sie eine Frau geworden, hätten diese Lippen gewiß die Männer um den Verstand gebracht. Aber Sofía ist keine Frau geworden, sondern ein Engel geblieben. Am 11. März ist sie gestorben. Das war drei Wochen vor dem Termin, den die Ärzte für ihre Geburt vorausgesagt hatten. Es gibt keinen Grund: Sofía war gesund, 49 Zentimeter groß und damit um einen Zentimeter kleiner als der neugeborene Felix. Schlank war sie, ein halbes Kilo leichter als ihr Bruder, dabei scheint mir ihr Gesicht etwas breiter gewesen zu sein als das ihres Bruders, richtige Pausbäckchen hatte sie, die zu einem spitzen Kinn zusammenliefen. Wie ihre Mutter war Sofía ein sehr schönes Mädchen.
Wir wissen nicht, warum Sofía gestorben ist, bevor sie geboren wurde. Die Medizin kann die Frage nur mit Statistiken beantworten, aber ihre Zahlen verdecken nur unsere Ratlosigkeit. Nur eines ahnen wir: warum wir es nicht erklären können. Sofía lebte, sie hatte Augen, Ohren, eine kleine Nase, sie konnte mit ihren Fingern tasten, mir ihrer Zunge schmecken und durch ihre Bewegungen kundtun, wenn ihr etwas behagte oder mißfiel. Ihr Herz klopfte. Sie nahm unsere Welt wahr, sie reagierte auf die Zeichen, durch die ihre Eltern oder ihr Bruder mit ihr sprachen. Zugleich aber gehörte sie noch einer anderen Welt an, in der die Logik unseres Verstehens nicht gilt, einer jenseitigen Welt.
Wodurch ist das Diesseits gekennzeichnet? Dadurch, daß alles darin prinzipiell erklärbar ist. Wir können verstehen, warum ein Kind heranwächst und ein Greis stirbt, wir kennen die organischen Gesetzmäßigkeiten, nach denen eine Pflanze wächst und eine Blume verwelkt. Alles, was wird, hat einen Grund. Nicht erklären kann unser Verstand, warum etwas ist. Denn um etwas zu sein, muß es zunächst nichts sein. Über das Nichtsein aber wissen wir nichts, wir wissen nicht einmal, ob wir es uns als ein Nichts oder ein Anderssein vorzustellen haben. Und was wäre das – ein Nichts? Wir wissen, wie ein Mensch geboren wird, aber wir wissen nicht, wie es ist, nicht geboren zu sein. Wir wissen, warum jemand stirbt, aber wir wissen nicht, was der Tod ist. Wenn das Diesseits dadurch gekennzeichnet ist, daß alles darin prinzipiell erklärbar wäre, dann definiert sich das Jenseits durch seine prinzipielle Unerklärlichkeit. Und Sofía gehörte noch zum Jenseits unserer Welt. Sie hatte unsere Welt zwar betreten, aber die Tür noch nicht hinter sich abgeschlossen. Weil sie zwischen beiden Welten lebte, war sie ein Engel. Und weil sie ein Engel war, gilt für sie keiner der Gründe, nach denen wir Menschen handeln. Wir können sie spüren, manchmal sogar sehen. Ich weiß ganz sicher, daß sie hier ist, unter uns – aber wir können uns ihre Anwesenheit sowenig wie ihr Verschwinden erklären.
Wohl alle Kulturen kennen Engel: Sie sind jene Wesen, die das Jenseits verlassen können, ohne es zu verlieren, und sich im Diesseits bewegen können, ohne ihm anzugehören. Engel verkörpern die Möglichkeit eines Dazwischen. Mit dem einen Flügel berühren sie den Himmel, mit dem anderen Flügel streifen sie unsere Seelen. Und Engel sind rein, alle Kulturen sagen das, sie tun niemandem Übel, sie sind im emphatischen Sinne gut. Deshalb sagen die meisten Religionen, daß Kinder direkt ins Paradies ziehen. Auch wer anders als ich an Engel nicht glaubt, mag sie als Metapher für eine moralische und ästhetische Reinheit akzeptieren. Um nichts anderes geht es schließlich, wenn wir von Engeln sprechen oder von Gott: in Gleichnissen auszudrücken, was die Sprache nicht sagen kann, einen Ausdruck zu finden für das, was allein diesseitig nicht zu erklären wäre, die ersten und die letzten Dinge, die manche von uns fühlen, aber keiner von uns weiß.
Während ihrer ersten Schwangerschaft malte Maria eine Serie von roten Bildern, die etwas wie einen explodierenden, energiegeladenen Ball zu zeigen schienen. Das war, wie sich herausstellte, eine ziemlich prägnante Vorstellung von Felix. Während ihrer zweiten Schwangerschaft, ihrer Schwangerschaft mit Sofía, malte Maria ebenfalls eine Serie von roten Bildern. Diesmal jedoch zeigten sie etwas wie einen Frauenkörper, der anmutig auf schmalen Füßen stand. Das Merkwürdige an dieser geometrischen Figur waren die Bögen, die sich im oberen Drittel ausbreiteten, mal weiter, mal schmaler. Vielleicht war es doch keine Frau, sondern ein Vogel. Jetzt wissen wir, daß es sich bei den Bögen tatsächlich um Flügel handelt, die geschwungen werden. Und zugleich ist es eine Frau, ein Mädchen, ein kleines Kind. Ohne es zu wissen, hatte Maria die Umrisse eines Engels gemalt. Es war das Bild von Sofía im Himmel.
Wie auf den Einladungen zu dieser Andacht zu erkennen ist, handelt es sich bei der Zeichnung Sofías nicht gerade um ein Porträt. Es ist eine geometrische Figur, es sind Konturen, es ist wie die Schraffur eines Schattens. Wahrscheinlich muß das so sein, wahrscheinlich kann man von Engeln nur die Schatten zeichnen. Das ist nicht wenig. Es ist mehr, als von Gott zu malen wäre, dem absolut Anderen. Engel sind anders als Menschen, aber sie sind auch Menschen, sie haben menschliche Züge, sie können empfinden und sich freuen, sie kümmern sich und leiden mit, wie kein Gott es könnte. Anders als von Gott können wir von den Engeln immerhin die Schatten aufzeichnen, denn sie fallen auf unsere Welt; wir haben eine Ahnung, wie sie aussehen, wir können es uns vorstellen – abbilden können wir es nicht. «Einen Engel erkennt man erst, wenn er vorübergegangen ist», heißt es im Judentum.
Alle Engelsbilder der Kunstgeschichte und der Kulturindustrie lehren, daß unweigerlich lügt, wer Engeln ein zu genaues Aussehen gibt. Der Schatten zeigt nicht, wie Engel aussehen. Aber er zeigt, daß es sie gibt. Und so ist es auch mit Sofía. Wir konnten einiges über sie erfahren, aber es ist nichts Genaues. Wir wissen nicht, wie sie geworden wäre, hätte sie fortgefahren zu leben. Aber wir spüren, wie groß der Verlust ist, daß wir sie nicht näher kennenlernen durften. Wir haben eine Ahnung von ihr bekommen. Das ist nicht wenig, es ist viel mehr, als wir von anderen Engeln je erfahren werden. Und zugleich ist es wenig; gerade weil wir etwas von ihrem Wesen, ihrer Schönheit ahnen konnten, ist es schrecklich wenig.
Ich stehe nicht hier, um zu trösten. Das kann ich nicht. Der Tod eines Kindes ist der nackte Schrecken – wenn auch wahrscheinlich nur für uns, nicht für Sofía, die geblieben ist, wohin sie ohnehin zurückgekehrt wäre, im Paradies oder im Nichtsein oder im Paradies, das das Nichts vielleicht ist. Aber für die Überlebenden ist der Tod der Schrecken, für die Eltern, den Bruder. Und für viele andere ist Sofías Tod ein Verlust, den sie niemals ermessen können, für die Freunde, denen sie nicht begegnen, und für die Männer, die sie nicht begehren wird, für die Kollegen, mit denen sie nicht arbeiten, und für die Nachbarn, neben denen sie nicht wohnen wird, für die Menschen, die sie nicht lieben, und für die Kinder, deren Mutter sie nicht sein wird. Es gibt keine frommen Worte oder philosophischen Gedanken, die Sofías vorzeitigem Tod Sinn verleihen; ich kenne sie jedenfalls nicht. Alles, was ich tun kann, was wir tun können, ist es, den Schmerz mit Maria, Gereon und Felix zu teilen im Wissen, daß der Schmerz nicht weniger werden wird deswegen.
Ich kann nicht trösten, aber ich weiß, daß es Trost geben kann. Trost ist die Liebe, die wir geben und empfangen. Der Verlust eines geliebten Menschen schärft den Blick für das Geschenk, das uns bereits zuteil geworden ist. Auch das lindert nicht den Schmerz, aber es hilft, ihn zu ertragen. Und Trost liegt auch in zwei Dingen, die sich zu widersprechen scheinen und dennoch gleichzeitig sein können: im Vergessen und im Erinnern. Indem wir uns erinnern, lebt Sofía weiter. Indem die Zeit uns hilft, unsere Not zu vergessen, können wir weiterleben. Deshalb sind wir heute hier: um mit Maria, Gereon und Felix an das Mädchen zu erinnern, das wir nicht kennenlernen durften, und um das Leben zu beginnen, das weitergeht. Erlaubt mir, den deutschen Dichter zu zitieren, Rainer Maria Rilke, der am meisten von Engeln verstand.
Preise dem Engel die Welt, nicht die unsägliche, ihm
kannst du nicht großtun mit herrlich Erfühltem; im Weltall,
wo er fühlender fühlt, bist du ein Neuling. Drum zeig
ihm das Einfache, das, von Geschlecht zu Geschlechtern gestaltet,
als ein Unsriges lebt, neben der Hand und im Blick.
Sag ihm die Dinge. Er wird staunender stehn; wie du standest
bei dem Seiler in Rom, oder beim Töpfer am Nil.
Zeig ihm, wie glücklich ein Ding sein kann, wie schuldlos und unser,
wie selbst das klagende Leid rein zur Gestalt sich entschließt,
dient als ein Ding, oder stirbt in ein Ding –, und jenseits
selig der Geige entgeht. – Und diese, von Hingang
lebenden Dinge verstehn, daß du sie rühmst; vergänglich,
traun sie ein Rettendes uns, den Vergänglichsten, zu.
Wollen, wir sollen sie ganz im unsichtbarn Herzen verwandeln
in – o unendlich – in uns! Wer wir am Ende auch seien.
Auch im Namen von Maria, Gereon und Felix möchte ich Ihnen und Euch allen danken, daß Ihr gekommen seid und den Schmerz, die Liebe und die Erinnerung mit ihnen teilt. So viele Menschen haben den dreien in den letzten Wochen beigestanden und sie mit Güte reich beschenkt, daß ich um Verständnis bitten muß, nicht jeden einzelnen von Ihnen und von Euch persönlich anzusprechen. In unser aller Namen danken möchte ich an dieser Stelle nur Felix, der Maria wahrscheinlich das Leben gerettet hat, als sie zu verbluten drohte. Allein hat Felix die Wohnung verlassen und bei den Nachbarn geklingelt, obwohl die Klingel so hoch war, daß er mit aller Kraft springen mußte, um sie zu erreichen. Zu danken haben wir auch Marias und Gereons Nachbarn Rob Groth, der dafür sorgte, daß Maria nur Minuten später und gerade noch rechtzeitig medizinisch versorgt wurde. Danken soll ich im Namen von Maria, Gereon und Felix auch den Kindern Naomi und David, die sich entschlossen um Felix gekümmert haben, als seine Mutter sich nicht um ihn kümmern konnte, weil sie ohne Bewußtsein war. Gedankt sei außerdem Selina, die sich beinah so sehr wie Felix auf Sofía gefreut und Maria während der Schwangerschaft immer auf den Bauch geküßt hatte, sowie ihrer Mutter Melanie Müller von Hindenburg. In den Tagen nach dem Tod seiner Schwester, als Felix bei ihr wohnte, war Selina ihm selbst eine Schwester.
Nicht im Namen von, sondern bei Maria, Gereon und Felix bedanken möchte ich mich für die Liebe und Kraft, mit der sie Sofía auf ihrem kurzen Besuch auf Erden begleitet und behütet haben. Ihre Liebe und Kraft wird uns ein Beispiel sein in eigenen schweren Stunden.
Ich sagte, wir können von Engeln nur die Schatten sehen. Ich hätte sagen sollen: wir gewöhnlichen Menschen können nur die Schatten sehen. Maria, Gereon, Felix haben einen Tag und eine Nacht mit Sofía verbracht. Als Felix seine Schwester erblickte, fragte er, wo denn die Flügel seien. Die bringen ihr die anderen Engel mit, wenn sie Sofía abholen, erklärte ihm Gereon. Felix wollte das ganz genau wissen: Werden die Flügel angeklebt oder angeschraubt? Sie wachsen einfach, wenn man mit den Engeln mitgeht, wußte Gereon. Nun ist sie mitgegangen, und bestimmt sind ihr längst jene Flügel gewachsen, die Maria unbewußt gezeichnet hatte. Zurückgeblieben in der Urne, die Isabel Hamm geschaffen hat, ist die Asche – nicht Sofías Asche, wie ich von Felix gelernt habe, sondern die Asche der Kerzen, welche die Engel bei sich hatten, als sie Sofía mit in den Himmel nahmen.
Ich sagte, wir gewöhnlichen Menschen können von Engeln nur die Schatten sehen. Aber es gibt eine Photographie von Sofía, auf der zu sehen ist, wie sie eingehüllt in eine Decke zu schlafen scheint, die Hände ruhig auf der Brust. Seit Maria es mir geschickt hat, hole ich das Bild immer wieder hervor, um es zu betrachten. Der Frieden, der in ihren Gesichtszügen liegt, ist nicht von irdischer Natur. Für mich ist es ein Photo aus dem Himmel, und wenn es nicht lügt, dann hat sie es gut dort.
Die Andacht hat mit einem Lied begonnen, das die Engel anrief. Sie geht mit einem Lied zu Ende, das Sofía immer gehört hat, als sie in Marias Bauch lag. Es heißt «4 Sophia» und stammt von der Band The Durutti Column. Nun ist es nicht mehr nur das Lied «für», sondern für immer auch das Lied von Sofía, das Lied, in dem uns das Mädchen begegnet, das wir nicht getroffen haben.
Zum Dank für den Jahrespreis der Helga und Edzard Reuter-Stiftung
Berlin, Liebermannhaus, 23. Januar 2004
Verehrte Stifter, lieber Wolf Lepenies, meine Damen und Herren,
über zwei Thesen möchte ich im Folgenden sprechen:
– Warum der Westen seine Leitkultur missionarisch ausbreiten sollte.
– Warum Deutschland seinen Lehrerinnen erlauben sollte, das Kopftuch zu tragen.
Für sich betrachtet zeugt weder die erste noch die zweite These von Originalität. Ungewöhnlich aber könnte sein, sowohl die eine als auch die andere These zu vertreten. Denn wer auf dem ultimativen Anspruch der westlichen Werte beharrt, sieht in der Regel eben jenen Anspruch herausgefordert durch das Tuch auf dem Kopf einer muslimischen Lehrerin. Und umgekehrt treten die Befürworter des Kopftuchs nicht eben als Missionare europäischer Wertvorstellungen auf. Angesichts der klaren Verteilung der Debattenlager könnte mein Vorhaben geradezu als ein Beitrag zur Völkerverständigung zwischen Leitkulturalisten und Multikulturalisten durchgehen. Doch damit des intellektuellen Spagats, mit dem ich mich der Auszeichnung für Integration würdig zu erweisen hoffe, nicht genug: Ich möchte die beiden scheinbar gegenläufigen Thesen vertreten, indem ich mein Metier vorübergehend verlasse, um mit zwei Dingen zu beginnen, die mindestens einem der beiden Stifter vertraut sein dürften: Geld und Limousinen. Letztere kommen allerdings nicht aus Stuttgart-Zuffenhausen, um es gleich zu sagen, sondern aus Sochaux in Frankreich. Aber der Reihe nach und damit zum Erstgenannten: zum Geld, genau gesagt zum Preisgeld, das ich erhalte.
Ohne Sie mit Zahlen zu belästigen, so viel darf ich verraten: Für meine Verhältnisse handelt es sich um viel Geld. In Stuttgart-Zuffenhausen mag das anders sein. Aber bei uns in Köln-Eigelstein würde man sagen: «Dat izzene lecker Sümmsche.» Noch in der Minute, in der ich die Nachricht erhalten habe, auf so ehrenvolle Weise ausgezeichnet worden zu sein, habe ich mich deshalb gefragt: Was mache ich mit dem Geld? Mir fehlt doch gar nichts. Eine Wohnung in der schönsten Stadt Deutschlands habe ich, eine ausgezeichnete Stereoanlage ebenso. Ich kann mir Karten fürs Müngersdorfer Stadion leisten, um den 1. FC Köln tapfer verlieren zu sehen, und für den Abend in der Stammkneipe reicht es auch. Größere Anschaffungen stehen nicht an – und damit komme ich zum zweiten Gegenstand, von dem mindestens einer der beiden Stifter viel versteht. Ich fahre bereits das schönste Auto der Welt: einen Peugeot 605, Baujahr 1990. Das Jahr der Einheit. Das Jahr, in dem der Westen sich weit nach Osten ausgebreitet hat. Ich fand das immer gut, von vornherein. Ich saß vor dem Fernseher meiner Studentenwohnung und dachte: Wunderbar. Weg mit den Greisen! Nieder mit den Statuen! Runter mit den Uniformen! Stoppt die Paraden! Malt den Diktatoren Schnurrbärte aufs Plakat! Her mit den Bildern von ihren vergoldeten Toiletten!
Das ist ein Impuls, den ich mir bis heute bewahrt habe: die Freude darüber, daß die Vergangenheit beendet ist, wie schlecht die Zukunft auch sein mag. Auch als zuletzt jener Diktator, dem man keinen Schnurrbart anmalen mußte, weil er wie alle Mitglieder seiner Partei bereits einen trug, plötzlich mit einem Vollbart auftrat, empfand ich weder Mitleid noch Nostalgie. Natürlich gibt es immer Dinge zu bemäkeln. Natürlich hatte Oskar Lafontaine recht und verlief der Einigungsprozeß desaströs. Natürlich haben die Vereinigten Staaten bei ihrem Einmarsch im Irak falsch gemacht, was falsch zu machen war: Jeder, der als unabhängiger Beobachter im Irak war, schüttelt den Kopf über das offenkundige Mißmanagement der Besatzung. Natürlich gibt es bessere Autos als einen Peugeot 605, Jahrgang 1990, bei dem ich vor jeder längeren Fahrt das Kühlwasser nachfüllen muß. Jeder, der im Sommer die Klimaanlage in meinem Wagen anstellt, schüttelt den Kopf über die französische Technik. Es gibt immer etwas Besseres. Saddam Hussein wäre besser von seinem eigenen Volk gestürzt worden. Ein Peugeot 607 ist noch schöner als ein 605er, zumal er serienmäßig über ein Navigationssystem verfügen dürfte, wie es nicht einmal den Amerikanern im Irak zur Verfügung zu stehen scheint – aber einen 607 zu kaufen, dafür reicht nicht einmal das Preisgeld der Helga und Edzard Reuter-Stiftung.
Ich überlegte also: Was tue ich mit dem Geld? Und entschied: Ich kaufe ein altes Haus in Isfahan. Meine Familie stammt aus Isfahan, und wenn es Sie bis jetzt gestört hat, daß ich immerfort vom Geld rede, kann ich mich gut kulturalistisch verteidigen: Die Isfahanis gelten als die Schwaben Irans. Nun gut, nicht alle Schwaben sind so, verehrte Stifter. Aber alle Isfahanis. Ausnahmslos alle. Das sagen jedenfalls alle anderen Iraner über uns. Wir sind nach allgemeinem Dafürhalten extrem geizig, denken immer nur ans Geld und hauen jeden anderen Iraner übers Ohr, mit Vorliebe die türkischen Iraner, die Aserbaidschaner also. Meine Frau ist eine solche Türkin mit iranischem Paß. Ich kann vor solchen Doppelidentitäten nur warnen. Da besuche ich die Familie meiner Frau in Teheran, und meinen Sie, ich würde ein Wort verstehen? Die sprechen dort alle türkisch. Mitten in Teheran. Abgründe der Reformunfähigkeit tun sich auf. Eine erschreckende Parallelgesellschaft, vollständig integrationsresistent. Kompromißlose Dialogverweigerung. Schickt mir Claudia Roth, und ich zeige ihr die Grenzen der Integrierbarkeit auf. Mit den Türken ist schon keine Familie zu machen, wie ich erfahren mußte – wie dann erst eine politische Union?
Die Isfahanis würden die Türken aber ohnehin nicht in die EU aufnehmen – zu teuer. Mit Isfahan hätte es allerdings auch keine deutsche Einheit gegeben – ebenfalls zu teuer. Dann müßten Sie immer noch Egon Krenz ertragen. Seien Sie also froh, daß Deutschland von keinem Isfahani regiert wird – obwohl, andererseits, in Anbetracht der Verschuldung mag ein isfahanischer Bundeskanzler durchaus eine Verlockung sein. Aber ich mach’s nicht, ich sag es gleich, denn sonst müßte ich wieder von Köln nach Berlin ziehen. Das habe ich schon mal getan, aber nach drei Jahren hatte ich von der Grunewalder Idylle genug. Bei uns im Eigelstein lacht mich wenigstens niemand aus, wenn ich mein täglich Kühlwasser in den Peugeot schütte. Das machen dort alle so, schließlich lebe ich im Türkenviertel, und wenn ich meine Nachbarn sehe, muß ich konstatieren: definitiv inkompatibel mit der EU. Die sind der Tod für jeden TÜV. Sogar meinen Peugeot hat der türkische Mechaniker von gegenüber an den deutschen Prüfern vorbeigeschmuggelt – da kann man sich denken, was die Türken mit den Brüsseler Verordnungen zur Streichholzschachtelfülle oder Butterdosengröße anstellen. Dann schon eher die isfahanischen Sparfüchse.
Aber zum EU-Beitritt der Türkei wollte ich mich gar nicht äußern. Das überlasse ich den Türkei-Experten, die unter deutschen Historikern und CDU-Abgeordneten zur Zeit wie Wasser aus meinem Kühler schießen. Ich möchte auch kein Plädoyer abgeben zur Aufnahme Isfahans in die Europäische Union. Nein, zur Völkerverständigung wollte ich mich äußern, schließlich bin ich dafür ausgezeichnet worden. Und zwar ist das so: Da ich zur Verständigung zwischen Kölnern und Berlinern nichts beitragen konnte, beschloß ich, in Isfahan ein Haus zu kaufen, auf daß mir die Verständigung zwischen Deutschen und Iranern besser gelänge.
Es gibt in Isfahan tausendsechshundert denkmalgeschützte Wohnhäuser aus der Zeit der Safawiden und Kadscharen. Jedes von ihnen ist ein Palast, ein Museum, ein Triumph des Individualismus. Jedes ist anders, und jedes scheint vollkommen in seiner architektonischen Harmonie. Die Miniaturen, Stuckarbeiten, Iwane, Kuppeln und Deckengewölbe, die Glas- und Spiegelarbeiten, die Einlegearbeiten und Wandgemälde, die in diesen jahrhundertealten, Touristen fast nicht zugänglichen Häusern zu finden sind, rauben einem den Atem – vor Schönheit, vor Staunen, wieviel Mühe sich Menschen einst gemacht haben, um die Sinne täglich zu liebkosen, und vor Scham, weil man unweigerlich an die Einfallslosigkeit heutiger iranischer Gebrauchsarchitektur denkt. Und jedes dieser Häuser hat einen großen Innenhof, mit Blumenbeeten, mit Rosensträuchern, mit Grantapfelbäumen. Es sind Häuser, in denen sich die Sehnsucht der Menschen nach dem Paradies ausdrückt – es sind 1600 kleine Gärten Eden.
Leider ist die Wohnwelt, von der ich spreche, zum größten Teil Vergangenheit. Im zwanzigsten Jahrhundert haben die meisten Isfahanis das Bewußtsein vom Wert ihrer ästhetischen und architektonischen Tradition verloren. Gewiß, die großen Denkmäler und Moscheen der Stadt wurden gepflegt, schon um Touristen anzulocken. Aber im Alltag verliert Isfahan sein Gesicht: mit jeder Schneise, die zum Bau einer Hauptstraße durch die gewachsenen Wohnviertel geschlagen wird; mit jeder Holztür, die man gegen ein Eisentor austauscht; mit jedem alten Haus, das einem Appartementblock weicht. Ökonomisch sind die alten Häuser fast wertlos; viel zu wenig Wohnraum auf zuviel Platz. Wertvoll sind die Grundstücke. Die meisten Eigentümer empfinden es daher als Fluch, wenn der Staat ihr Haus zum Denkmal erklärt, denn dann dürfen sie es nicht einfach durch einen Neubau ersetzen. Aber selbst wo der Staat beschließt, das Haus zu schützen, lassen sich Wege finden, es niederzureißen: Man läßt es leerstehen, man läßt im Winter den Gartenschlauch tagelang ins Haus laufen, man läßt dem Beamten ein paar tausend Euro vom Gewinn – und schon hat Isfahan ein weiteres Stück seiner Vergangenheit vernichtet.
Aber es sind nicht nur ökonomische Gründe. Wer es sich leisten kann, will heute modern wohnen – und modern, das heißt in der Regel in einem Appartement, mit Wohnküche und Aufzug, mit Parkettboden und Gardinen, Klimaanlage und Etagenheizung. Es sind alte Leute, Greise, die nicht mehr anders als unter Kuppeln leben möchten, wo die Kuppeln doch die Klimaanlage überflüssig machen. Wehmütig sprechen sie von den Abenden der Großfamilie unter dem Granatapfelbaum; sie verstehen nicht, wie ihre Kinder oder vielleicht sogar sie selbst – als sie jung waren und noch Toren – freiwillig auf den Duft der Rosen und das Plätschern des Wassers verzichten konnten. Die alten Leute, die Greise, die ihr Leben lang vielleicht nie aus Isfahan herausgekommen sind, wissen um den Wert und die Lebensqualität der alten Wohnhäuser. Man braucht Isfahan also nie verlassen zu haben, um das Bewußtsein zu haben. Oder man muß um die Welt gereist sein, um das Bewußtsein zu erlangen: Architekten, die im Ausland studiert haben, Isfahanis, die von Reisen die Sanierung europäischer Altstädte kennen, Iraner, die im Westen leben. Hier und da kauft einer von ihnen ein altes Haus, renoviert es, vielleicht um selbst darin zu wohnen, vielleicht um sein Büro dort zu haben, vielleicht um ein Restaurant oder ein Café zu eröffnen. Hier und da fliegt einer aus Köln nach Isfahan, um von seinem Preisgeld eines dieser Häuser vor der Abrißbirne oder dem Gartenschlauch zu retten.
Im November war ich eine Woche in Isfahan. Eine Woche lang hörte ich immerfort, wie unpraktisch diese alten Häuser seien. Es brauchte eine Weile, bis ich den Makler davon überzeugen konnte, daß ich ein altes Haus nicht etwa kaufen wollte, um es abreißen und einen Appartementblock an seine Stelle setzen zu lassen.
− Sie wollen darin leben?, fragte der Makler.
− Ja, antwortete ich.
− Ach.
− Ist das so ungewöhnlich?
− Nein, nein. Aber das Haus steht unter Denkmalschutz, das können Sie nicht einfach abreißen.
− Eben deswegen möchte ich es kaufen.
− Aber dann können Sie es nicht weiterverkaufen.
− Ich möchte es ja auch nicht weiterkaufen, sondern es renovieren und meine Wasserpfeife im Garten rauchen.
− Wasserpfeife? Sie rauchen Wasserpfeife?
− Ja, Wasserpfeife.
− Der Makler schaut mich schweigend an.
− Na ja, sagt er schließlich, es finden sich immer Wege, so ein Haus abzureißen.
− Ich möchte es nicht abreißen, sondern renovieren.
− Ach so.
Ich blicke den Makler an und weiß genau, was er denkt: Die spinnen, die Westler. Er findet mich sympathisch, er will mir weiterhelfen, er beginnt nachzudenken.
− Ich habe da ein wirklich todschickes Haus an der Hand, genau das, was Sie suchen: Sie können morgen einziehen. Und alt ist es auch, praktisch aus der Steinzeit.
− Wie alt denn?
− Dreißig, vierzig Jahre, mindestens.
− Nein, ich meine wirklich alt.
− Richtig alt?
− Ja, aus Lehm, und mit einem Brunnen und einem Granatapfelbaum im Innenhof.
− Sie haben vielleicht Ideen. Möchten Sie eine Winston?
− Nein danke, ich rauche Wasserpfeife.
Ein paar Minuten später erklärt der Makler seinem Kollegen, wonach ich suche:
− Ja, eines von diesen alten Häusern.
− Wieso das denn? Will er es abreißen lassen?
− Nein, der Herr ist aus dem Westen.
− Ach so. Aus dem Westen.
Stimmt! Ich komme aus dem Westen. Es ist ein westliches Bewußtsein, mit dem ich durch Isfahan streife. Ein westliches Bewußtsein haben die Freunde in Isfahan, die mich anstifteten, ein altes Haus zu kaufen. Sie alle sind weitgereist und wünschen sich, daß Leute wie ich, die von auswärts kommen, ihre Ideen in die Stadt tragen. Und sie wissen: Hätte ich ein Haus in Isfahan, würden unsere Freunde aus dem Westen es nutzen, sie würden die Stadt besuchen, eine Zeitlang dort leben und ihre westliche Kultur gerade dadurch verbreiten, daß sie die Größe der lokalen Kultur entdecken. Das ist gut für die Stadt, sagen sie. Wenn die Westler sich für die alten Häuser begeistern, werden auch immer mehr Isfahanis beginnen, sich für die Häuser zu interessieren.
Das Haus, das ich kaufen wollte, sollte unbedingt in Dscholfa sein. Dscholfa ist das armenische Viertel Isfahans, das Christenviertel. Ich dachte immer, wenn ich schon ein Haus in Isfahan kaufe, dann dort – nicht nur, weil es ein besonders ruhiges und schönes Viertel ist oder weil es sich dort freier leben läßt als in den übrigen Vierteln der Stadt. Die Freunde aus dem Westen, die mich in Isfahan besuchen würden, würden in der Nachbarschaft von dreizehn Kirchen wohnen. Sie würden auf die Straße treten und Armenisch hören. Ohne daß ich noch Worte verlieren müßte, würden sie den größten der vielen Reichtümer Isfahans erkennen: Die Vielfalt, die diese Stadt bietet, den Reichtum des Individualismus, die Partikularität nicht bloß der Architektur, sondern wichtiger noch der Weltanschauungen und Lebensentwürfe. Fünf Religionen und vier Sprachen beherbergt Isfahan: neben den Muslimen die Christen in Dscholfa, die Juden mit ihren zwanzig Synagogen allein im Stadtteil Dschubareh, die Zoroastrier und die Bahai; außer dem Neupersischen das Armenische, das alte Persisch der Juden und das noch ältere Persisch der Zoroastrier. Man muß nichts idealisieren, auch Isfahan hat Massaker und Vertreibungen erlebt, und nach der Islamischen Revolution ist die Situation insbesondere für die Bahai unerträglich geworden. Aber wenn man alten Reiseberichten glaubt und mit Menschen von heute spricht, hat sich Isfahan von anderen iranischen Städten auch dadurch unterschieden, daß es Vielfalt für selbstverständlich hielt – so wie das kölsche Versprechen, daß jeder Jeck anders ist, von den Kölnern vielfach verraten worden ist und doch das Lebensgefühl der Stadt bis heute ausmacht.
Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen, Ethnien und Sprachen besteht in Isfahan bis zum heutigen Tag fort – ja, es ist noch immer selbstverständlich. Zu selbstverständlich, wie mir gelegentlich scheint, so selbstverständlich wie die alten Häuser, um deren Erhalt sich nur wenige Menschen kümmern. Meinen Cousinen fällt kaum auf, wie besonders diese Vielfalt ist; sie haben immer schon ihre jüdischen oder christlichen Freundinnen gehabt. Ich bin es, dem es auffällt. Und natürlich fällt es mir aus keinem anderen Grund auf als dem, daß ich aus dem Westen komme. Gewiß ist die Toleranz dem Westen nicht in die Wiege gelegt gewesen. Aber nun, da der Westen seine ursprüngliche kulturelle und religiöse Vielfalt bereits weitgehend vernichtet hat, ist die Toleranz – bei allen gravierenden Mängeln – hier doch eher verwirklicht als irgendwo anders auf der Welt. Als Muslim genieße ich in Köln Freiheiten, die einem Christen in Isfahan verwehrt sind – angefangen von der Freiheit der Kleidung bis zur Freiheit, Staatsoberhaupt zu werden oder auch nur Bürgermeister. Ich wünsche mir, daß sich diese westliche Freiheit überall in der islamischen Welt durchsetzt. Die meisten Iraner wünschen sich das.