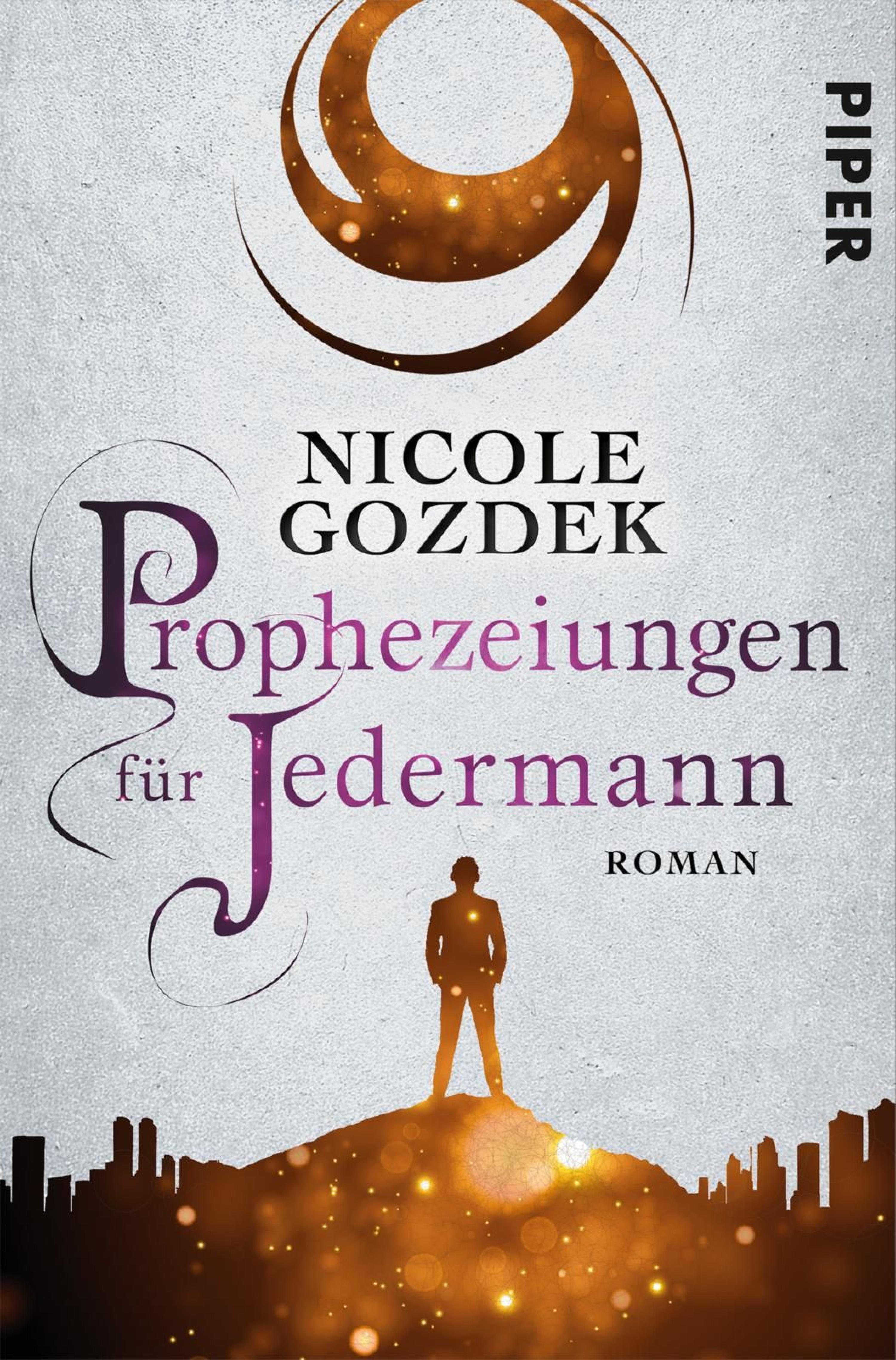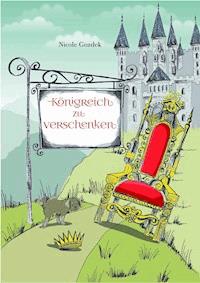Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
"Rache ist süß, Ein Unglück kommt selten allein, Liebe macht blind..." Sie sind mehr als nur Sprichwörter. Unsichtbar und unsterblich leben sie unter uns. Einer von ihnen ist Murphy, die Verkörperung von Murphys Gesetz: Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Er liebt es, Chaos zu verbreiten, Dinge zu zerstören und den Menschen Streiche zu spielen. Als jedoch eines Tages Murphys Chaosmagie Amok läuft und das Leben seines Rivalen Archie (Rache ist süß) zerstört, schwört dieser, Murphy das Leben zur Hölle zu machen. Doch Murphy wäre nicht Murphy, wenn er sich dies einfach gefallen lassen würde, und so entbrennt innerhalb kürzester Zeit ein Kleinkrieg, der die Gemeinschaft der Lebenden Sprichwörter zu spalten droht...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Murphy
Rache ist süß
Nicole Gozdek
Copyright © 2017 by
Astrid Behrendt
Rheinstraße 60
51371 Leverkusen
http: www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Laura Evers
Korrektorat: Michaela Retetzki
Satz: Marlena Anders
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Marie Graßhoff
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-456-7
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
1. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen
2. Ein Unglück kommt selten allein
3. Wenn man vom Teufel spricht
4. Hochmut kommt vor dem Fall
5. Aller guten Dinge sind drei
6. Rache ist süß
7. Schlaf ist die beste Medizin
8. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus
9. Lachen ist die beste Medizin
10. Unverhofft kommt oft
11. Erstens kommt alles anders, zweitens als man denkt
12. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
13. Eine Hand wäscht die andere
14. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
15. Angriff ist die beste Verteidigung
16. Frechheit siegt
17. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende
18. Dicht daneben ist auch vorbei
19. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
20. Das fünfte Rad am Wagen sein
21. Eile mit Weile
22. Ein Leben wie eine Hühnerleiter: kurz und beschissen
23. Geld allein macht nicht glücklich
24. Trautes Heim, Glück allein
25. Auf jeden Regen folgt auch Sonnenschein
26. Kindermund tut Wahrheit kund
27. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt
28. Liebe macht blind
29. Guter Rat ist teuer
30. Pech in der Liebe, Glück im Spiel
31. Der Wunsch ist der Vater des Gedanken
32. Liebe geht durch den Magen
33. Probieren geht über Studieren
34. Gott bestraft den Hochmütigen
35. Hinterher ist man immer klüger
36. Das Leben ist kein Zuckerschlecken
37. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung
38. Das Genie beherrscht das Chaos
39. Die Hoffnung stirbt zuletzt
40. Der Klügere gibt nach
41. Alles neu macht der Mai
42. Geben ist seliger denn nehmen
Ende
Personenregister
Danksagung und Nachwort
Über die Autorin
Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen
Kennt ihr das? Ihr seid im Stress, weil ihr einen wichtigen Termin habt, und ausgerechnet dann lässt der Fahrstuhl ewig auf sich warten, die Autobatterie streikt und zu allem Überfluss fährt euch dazu auch noch der Bus oder die U-Bahn direkt vor der Nase weg und lässt sich selbst davon nicht aufhalten, dass ihr rennt, brüllt und dabei wild mit den Armen wedelt.
Es sind Tage mit wichtigen Ereignissen wie das Vorstellungsgespräch beim Wunsch-Arbeitgeber, das erste Date, die Besichtigung für die Traumwohnung, der erste Tag im neuen Job oder andere bedeutende Anlässe, an denen ihr denkt, dass es wie verflucht zugeht. Dann schiebt ihr die Schuld auf das Schicksal, dumme Zufälle, Gott, den Teufel, mieses Karma und was weiß ich noch alles.
Doch ihr irrt euch.
Einige von euch haben sicher schon einmal von Murphys Gesetz gehört: Alles, was schiefgehen kann, geht auch schief.
Es ist die perfekte Erklärung dafür, dass der Wecker natürlich dann den Geist aufgibt, wenn ihr ihn am nötigsten braucht, oder dafür, dass die Waschmaschine ausgerechnet dann kaputtgeht, wenn unerwartet eine größere Reparatur am Auto ansteht und ihr gerade den Sommerurlaub für die Familie fest gebucht habt – es finanziell also sowieso schon eng ist – und ihr ihn nicht mehr stornieren könnt, ohne das Geld für die Reise zu verlieren.
Wenn eure Verzweiflung und euer Frust am größten sind, glaubt ihr für einen Moment, eine lachende Stimme zu hören, die sich über euch und euer Pech lustig macht. Dann jedoch denkt ihr, dass ihr euch getäuscht haben müsst. Schließlich seid ihr ganz allein oder alle anderen um euch herum machen mitfühlende Gesichter. Wer hätte euch denn auslachen sollen? Es ist doch niemand da, der sich vor lauter Schadenfreude über euer Unglück ergötzt.
Ihr irrt euch.
Die lachende Stimme, das istmeine.
Ich lache immer, wenn etwas schiefläuft.
Denn es ist meine Schuld. Nicht die des Universums, des Teufels, des Zufalls oder irgendwelcher anderer bösen Mächte. Ich gebe es gerne zu.
Nur zu, schiebt die Schuld für eure Missgeschicke sowie für eure kleinen und großen Katastrophen in Zukunft gerne auf mich!
Wer ich bin?
Mein Name ist Murphy.
Ein Unglück kommt selten allein
Mein Wecker klingelt um kurz nach sieben Uhr. Es ist Montag, der Beginn einer ganz normalen Arbeitswoche, deshalb hatte ich meinen Wecker aufgezogen und mich zeitig zu Bett begeben. Ja, ich habe nach wie vor so ein altes Ding, das man selbst aufziehen muss. Ich mag die lieber als Wecker, die mithilfe von Batterien oder elektrischem Strom funktionieren. Nicht nur, weil ich das Ticken so angenehm finde. Schließlich weiß ich selbst am besten, was bei dem neumodischen Mist alles schiefgehen kann. Je komplizierter etwas ist, desto eher lässt es dich im Stich.
Mein altmodischer mechanischer Wecker hat dagegen noch nie versagt. Als er klingelt, stelle ich ihn aus und gähne. Ich habe beschlossen, diese Woche Frühschicht zu machen – es ist ganz angenehm, wenn man sein eigener Arbeitgeber ist und sich seine Arbeitszeiten selbst einteilen kann. Manchmal stehe ich erst mittags oder nachmittags auf, je nachdem ob ich gerade in Berlin die Spätschicht-Arbeiter, die Shopper oder die Nachtschwärmer ärgern will oder mich mein Job in ein anderes Land mit einer anderen Zeitzone führt.
Auch wenn ich meinen Wohnsitz schon seit einigen Jahren in Berlin habe, so bin ich beruflich doch häufig außerhalb unterwegs.
Warum ich mein Quartier in Deutschlands Hauptstadt aufgeschlagen habe, kann ich nicht sagen. Es lag jedenfalls nicht an den Politikern. Die finde ich so dermaßen langweilig und nervtötend, dass ich ihnen, wenn möglich, aus dem Weg gehe. Leider ist es natürlich nicht immer machbar – in dieser Hinsicht ist eine Großstadt ebenfalls ein Dorf – und falls ich den Langweilern doch mal auf irgendeinem Empfang oder einer Party begegne, wo sie großspurig ihre Reden halten oder aufgeblasen in die Kameras der Presseleute lächeln, dann spiele ich ihnen hin und wieder einen Streich. Danach darf man in der Zeitung ihre Fotos bewundern, auf denen sie übergossen mit Champagner dastehen, sich überraschend auf dem Hosenboden sitzend wiederfinden oder ihnen ein Vogel auf den piekfeinen Anzug geschissen hat. Die meisten Missgeschicke landen dabei noch nicht einmal in der Presse, sogar Fotografen und Journalisten kann man kaufen. Aber mir reicht es, wenn ich weiß, dass mein Streich funktioniert hat, ich brauche keine Beweise ihrer öffentlichen Blamage. Bedauerlicherweise hat noch keiner von ihnen die Lektion begriffen und geht meinen Veranstaltungen aus dem Weg.
Ja, meinen Veranstaltungen. Ich habe eine ganze Reihe davon: Geburtstage, Preisverleihungen, Einweihungen, Umzüge, Scheidungen, erste Dates, Führerscheinprüfungen, Klausuren, Feiertage wie Weihnachten und Ostern und viele mehr. Hochzeiten, Verlobungsfeiern und Hochzeitsanträge liebe ich ganz besonders. Gutes Essen, viel Drama, ganze Sturzbäche von Tränen, bis die Veranstaltung vorbei ist – und niemand vermutet, dass ich meine Hand bei manchen Minikatastrophen und Beinaheweltuntergängen im Spiel gehabt habe. Mal ehrlich, dramatischer als eine angespannte Braut an ihrem Hochzeitstag, die bei jeder Kleinigkeit, die nicht zu hundert Prozent wie geplant verläuft, am liebsten die ganze Hochzeit absagen würde, geht es nicht.
Vorstellungsgespräche, Geschäftsessen oder Meetings mit wichtigen Kunden hingegen werden auf die Dauer langweilig. Die Möglichkeiten, wie ich sie boykottieren kann, wiederholen sich irgendwann.
Anders sind da Hochzeiten, Hochzeitsanträge und Geburtstagsfeiern. Heutzutage will jeder ein ganz einmaliges und erinnerungswürdiges Event aus diesen besonderen Ereignissen machen – und das lässt mir ebenfalls viele Möglichkeiten, mich kreativ zu verwirklichen. Hochzeiten am Strand, Geburtstagsfeiern auf einem Schiff, Anträge beim Fallschirmspringen oder auf einem Berggipfel und viele verrückte Ideen mehr wären vor einhundert Jahren undenkbar gewesen. Ein Hoch auf den Fortschritt!
Alles wird ständig komplizierter. Die Menschen machen jetzt Urlaub, benutzen täglich komplexe technische Geräte, steigen in Flugzeuge und jetten ans andere Ende der Welt – oder sogar bis zum Mond! Alles ist möglich, selbst als Kind ins falsche Flugzeug zu steigen (Ich liebe die »Kevin allein«-Filme! Sie sind eine Hommage an mich und an mein Gesetz!), am Flughafen zu stranden, ungewollt zum Schmuggler zu werden und vieles mehr. Früher war manchmal das Aufregendste, was ich anstellen konnte, das Bett unter einem Liebespärchen beim außerehelichen Seitensprung zusammenbrechen zu lassen, der Rest ihres Lebens verlief im stets gleichen, langweiligen Trott. Ganz ehrlich, die Unsterblichkeit kann manchmal verdammt ätzend sein.
Die Menschen im 21. Jahrhundert jedoch haben Freizeit, sie haben Hobbys, sie machen Urlaub, sie wechseln den Beruf, sie haben Ansprüche, sie versuchen, aus ihrem Leben auszubrechen, sich kreativ zu verwirklichen, sie haben Geld, das sie mit vollen Händen ausgeben, und es vergeht kaum eine Woche, in der sie nicht auf irgendeiner Veranstaltung unterwegs sind. Klar, das ist für mich mehr Arbeit, aber auch mehr Abwechslung als in manchen Jahrhunderten davor.
Und weil mir meine Arbeit inzwischen wieder Spaß macht, springe ich nun gut gelaunt aus dem Bett, dehne mich einmal und gehe dann zum Kleiderschrank. Meinem Spiegelbild schenke ich dabei keine Beachtung – mal ehrlich, wieso können manche Leute stundenlang vor dem Ding stehen und sich selbst anstarren, bevor sie morgens in die Gänge kommen? Lasst es euch von jemandem, der so lange gelebt hat wie ich, gesagt sein: Ihr wacht nicht eines Tages auf und seid plötzlich ein anderer. Das passiert nur ganz, ganz selten. Nicht einem von hundert oder einem von tausend, nicht einmal einem von einer Million oder von einer Milliarde.
Mir ist es passiert. Aber ich bin ja auch anders. Ich bin kein normaler Mensch.
Deshalb sehe ich auch keinen Tag älter aus als fünfundzwanzig, obwohl ich das schon lange nicht mehr bin. Mein Gesicht ist ein Allerweltsgesicht, durchschnittlich attraktiv, bartlos. Ich muss mich morgens noch nicht einmal rasieren, vielleicht hat mich das Rasieren aus diesem Grund schon immer so fasziniert. Eins von meinen täglichen Ritualen ist es daher, jemand anderem dabei zuzugucken. Erst danach kann ich ganz normal in den Tag starten.
Ich öffne den Schrank, wodurch ich meinen Anblick in der Spiegeltür nicht mehr ertragen muss, und greife hinein, um ein Hemd und eine Hose auszuwählen. Da ich beschlossen habe, in Deutschland zu bleiben, sind es Sommersachen. Jetzt im Mai ist es bereits ungewöhnlich heiß – die ideale Zeit für Eiskugelunfälle.
Nachdem ich mich angezogen habe, trinke ich etwas Wasser und besorge mir beim Bäcker nebenan ein belegtes Brötchen. Das Praktische ist: Dadurch, dass mich niemand sehen kann, muss ich auch nichts bezahlen. Für die Menschen bin ich unsichtbar. Ich kann einfach hinter die Theke gehen, mir ein Brötchen aussuchen, es nehmen, es unsichtbar machen und wieder hinausschlendern, ohne dass mich jemand einen Dieb nennt.
Warum ich überhaupt auf Nahrung und Schlaf angewiesen bin, weiß ich nicht. Ich habe es nie hinterfragt. Es ist einfach so. Vielleicht könnte ich ganz normal weiterexistieren, wenn ich ab morgen nichts mehr esse oder trinke, andererseits wozu sollte ich das ausprobieren? Ich liebe gutes Essen und leckere Getränke. Und zum Glück gibt es stets wieder neue Gerichte, Rezepte und kulinarische Kreationen, sodass mir diese Angewohnheit nie langweilig wird.
Der Nachteil an meiner Unsichtbarkeit ist natürlich, dass die Menschen mir nicht ausweichen können. Wie häufig ich schon angerempelt worden bin! In Großstädten, in denen sich die Menschen drängen, ist es ganz besonders schlimm.
Warum ich dann ausgerechnet nach Berlin gezogen bin? Nun, hier passiert auch mehr als in einem langweiligen Dorf. Und ich bin gerne dort, wo ich Spaß haben kann.
Inzwischen sehe ich das Angerempeltwerden nicht mehr als lästige Nebenwirkung meiner Andersartigkeit. Und warum sollte ich das auch? Mir tut es ja nicht weh und die Menschen, die mich anrempeln, tragen dann plötzlich ihren Kaffee auf dem Hemd oder der Bluse, bekleckern sich mit Eis oder sonstigen Leckereien für unterwegs, lassen ihre Handys oder andere für sie wichtige Gegenstände fallen oder stürzen und verletzen sich. Eins jedoch ist immer gleich: Jeder von ihnen flucht und ärgert sich. Das ist Musik in meinen Ohren.
Nach dem Verzehr des Brötchens mit Ei konzentriere ich mich und springe.
Im nächsten Moment befinde ich mich in einem kleinen Badezimmer mit langweiligen weißen Fliesen und einem einfachen Badezimmerschrank von IKEA und starre den Mann an, der nur in seiner Unterwäsche bekleidet vor dem Waschbecken steht und zum Rasierer greift.
Es geht los!
Aufregung erfasst mich. Ich weiß nicht, wer der Mann ist. Er ist vielleicht vierzig Jahre alt oder ein, zwei Jahre älter, hat eine beginnende Glatze und erste graue Haare auf dem Kopf. Der Rest ist dunkelbraun oder schwarz, das kann ich bei der schlechten Beleuchtung nicht erkennen. Bei meiner Ankunft habe ich nämlich als Allererstes die Birne in der Deckenbeleuchtung zerstört. Leider ohne dass es dem Mann aufgefallen wäre. Anscheinend ist er noch nicht ganz wach.
»Ehrlich? Ich finde dich schon wieder in einem Badezimmer beim nächsten Rasierunfall?«
Ich zucke nicht zusammen, als sich nun Ein Unglück kommt selten allein neben mir materialisiert. Unglück sieht aus wie ein Junge von vielleicht neun oder zehn Jahren und ist eine echte Nervensäge. Er fühlt sich von Unfällen und Missgeschicken angezogen und taucht regelmäßig dort auf, wo ich gerade arbeite, und fällt mir auf den Wecker.
»Was willst du, Nervensäge?«, frage ich grob, während der Mann, in dessen Badezimmer wir uns aufhalten, endlich bemerkt hat, dass seine Deckenlampe ihn im Stich gelassen hat, und nun das Licht am Badezimmerschrank einschaltet.
»Ich heiße nicht Nervensäge«, sagt die Nervensäge und verzieht verärgert das Gesicht. Er sieht aus, als würde er gleich anfangen loszubrüllen, doch das stört mich nicht. Schließlich kann uns der Mensch weder sehen noch hören. Selbst wenn das seine Vorteile hat, so bedeutet dies bedauerlicherweise, dass Wesen wie ich und Unglück nur uns und die anderen haben, um uns zu unterhalten. Und die kleine Plage hat beschlossen, dass sie mein Freund sein will, und lässt sich leider auch nicht durch Ignorieren, Unhöflichkeiten oder Streiche davon abbringen. Ich hätte gedacht, dass er spätestens nach einem oder zwei Jahrzehnten begreifen würde, dass er unerwünscht ist, jedoch ärgerlicherweise geht er mir sogar nach über einem Jahrhundert immer noch täglich auf den Keks.
»Ich weiß, Unglück«, erwidere ich genervt, während der Mann seinen Rasierer ansetzt. Er benutzt keinen elektrischen, was ein Fehler ist, denn der Schnitt am Kinn lässt ihn augenblicklich wie ein kleines Schweinchen bluten und panisch nach dem Handtuch neben dem Waschbecken greifen. Ich lache.
»Mein Name ist Friedrich«, erklärt mir der kleine Unglücks-Schmarotzer mit aller kindlichen Würde, die er aufbringen kann. »Was will ich von einem Schwachkopf auch anderes erwarten? Du kannst dir genauso wenig neue Tricks ausdenken, wie du dir meinen Namen merken kannst. Jeden Tag das Gleiche! Was ist so spannend an Männern, die sich beim Rasieren schneiden?«
»Das verstehst du nicht.«
»Da hast du recht. Bei Archie wäre es jedenfalls lustiger gewesen«, behauptet der Stachel in meinem unsterblichen Fleisch dann auch noch und ich knurre.
Wenn ich den Namen schon höre! Archie! Ich nenne ihn stattdessen Arsch, doch der Blödmann begreift noch nicht einmal, dass ich ihn beleidige! Nach seiner Theorie bin ich ein Franzmann und kann seinen Namen einfach nicht richtig aussprechen. Wie doof muss man sein, um zu überhören, dass ich akzentfreies Deutsch – und übrigens auch jede andere Sprache der Welt – spreche?
Archie ist ein lästiger Plagegeist, noch mehr als Friedrich. Die anderen behaupten ständig, wir seien uns ähnlich. Sie müssen blind sein, wir sind uns überhaupt nicht ähnlich! Archie hat ein Putten-Gesicht mit runden, rosigen Wangen, umrahmt von goldenen Locken. Kennt ihr die Decken- oder Wandgemälde in alten Kirchen oder Museen, auf denen kleine, dicke Engel abgebildet sind? Archie könnte dafür als Kind Modell gestanden haben. Inzwischen sieht er aus wie Anfang zwanzig und obwohl er etwas abgenommen hat, so wird er wohl nie gertenschlank sein – erst recht nicht, da wir Unsterblichen uns körperlich nicht mehr sonderlich verändern. Er liebt Süßigkeiten und ist ständig am Naschen, wenn wir uns sehen.
Dummerweise ist er ebenfalls im Katastrophen-Geschäft tätig und so habe ich häufiger mit ihm zu tun als mit den anderen. Der Einzige, den ich noch häufiger sehe als Arsch, ist Friedrich und ratet mal, ob ich darüber glücklich bin. Der kleine Unglücksrabe wird zwar von Missgeschicken angezogen, allerdings ist er zu faul, um sich selbst etwas auszudenken. Das Einzige, was er kann, ist Meckern und Kritisieren.
»Wenigstens habe ich Ideen!«, fauche ich ihn daher an. »Denk dir erst einmal selbst etwas aus, bevor du mich kritisierst!«
Der Junge grinst nur fies. »Wer sagt denn, dass ich das nicht mache?«, fragt er und tut sehr geheimnisvoll. Er will, dass ich neugierig werde und nachhake, doch darauf kann er lange warten.
Ich ignoriere ihn. Mein Opfer hat inzwischen den harmlosen kleinen Schnitt mit einem Pflaster überklebt und sitzt schweißgebadet in der Küche, wo er sich von seiner Lebensgefährtin oder Ehefrau einen Whiskey einschenken lässt.
Ernsthaft? Was ist das denn für ein Weichei?! Wenn er Angst hat, sich beim Rasieren zu schneiden, soll er einen elektrischen Rasierer verwenden!
Angewidert wende ich mich ab. Mein morgendliches Ritual bringt irgendwie gar keinen Spaß mehr. Nicht nur, dass Friedrich reingeplatzt ist, was er schon lange nicht mehr gemacht hat, auch die Reaktion des Opfers selbst ist nicht lustig, sondern einfach nur erbärmlich.
Schlecht gelaunt schließe ich die Augen und konzentriere mich. Im nächsten Moment bin ich in München und von Friedrich ist zum Glück nichts mehr zu sehen oder zu hören.
Es wird Zeit, mit der Arbeit zu beginnen, beschließe ich, während die Morgensonne mir ins Gesicht scheint und die letzten Schlechte-Laune-Falten vertreibt.
Wenn man vom Teufel spricht
Ich habe mir kein bestimmtes Ziel ausgesucht, daher stehe ich jetzt in einer mir unbekannten, von Autos befahrenen Münchener Geschäftsstraße und sehe mich erst einmal in Ruhe um.
Es gibt Apotheken, Bäckereien, Restaurants, eine Buchhandlung, einen Metzger und dazu einige andere Geschäfte, aber zurzeit ist noch wenig los. Kein Wunder, es ist ja erst kurz vor acht.
Schulkinder laufen lachend und lärmend an mir vorbei, doch ich ignoriere sie. Sie erinnern mich zu sehr an Friedrich und ich habe beschlossen, dass ich diesen Montagmorgen genießen will, und das geht nur ohne ihn. Daher konzentriere ich mich auf die Erwachsenen in meiner Nähe.
Zahlreiche Männer, Frauen und Jugendliche stehen in den beiden Bäckereien an. Langweilig!
Gedankenverloren löse ich mehrere Paar Schnürsenkel, lasse den Kleber an den hochhackigen Absätzen einer elegant gekleideten Dame, die achtlos an mir vorbeihetzt, verschwinden, genieße einen kurzen Moment lang ihr derbes Gefluche, das gar nicht zu ihrem vornehmen Äußeren passt, und entdecke dann mein erstes Opfer.
Es ist eine junge Frau von Mitte oder Ende zwanzig mit langen brünetten Haaren, die sie zu einem praktischen Zopf zusammengebunden hat. Ihr weißes T-Shirt und die lange weiße Leinenhose schreien geradezu nach meiner Aufmerksamkeit. Ich grinse erfreut.
Viele behaupten ja gerne, dass Menschen, die tierlieb sind, keine schlechten Menschen sein können. Vermutlich bilden sie sich ein, dass Tiere einen siebten Sinn für das angeborene Böse haben oder einen ähnlichen Blödsinn. Ich hätte ihre Theorie im Handumdrehen widerlegen können, aber leider sieht oder hört mich ja keiner von ihnen.
Ihr müsst nämlich wissen, Tiere liebenmich.
Ehrlich! Egal, ob Hunde, Katzen, Pferde, Vögel, Insekten oder Amphibien, sie alle freuen sich jedes Mal so unbändig, wenn ich ihnen meine Aufmerksamkeit schenke, dass sie alles tun wollen, was mich glücklich macht.
Und ratet mal, was mich glücklich macht.
Ich habe ein paar meiner tierischen Anbeter ganz in meiner Nähe entdeckt und zu mir gerufen. Dann hole ich tief Luft, hebe um der Dramatik willen den Arm, zeige auf mein Opfer und rufe: »Attacke!«
Die Frau kreischt laut, als sich ihr ein Schwarm Tauben im Sturzflug nähert. Dann beginnt das Bombardement und sie schreit noch lauter.
Platsch. Plitsch, platsch. Platsch!
Die Tauben landen mehrere gute Treffer, bevor sie abdrehen müssen. Ich klatsche begeistert, während sie ein paar Meter weiterfliegen, auf Markisen, Dachüberständen und Laternen Platz nehmen und zufrieden gurren.
»Das habt ihr sehr gut gemacht!«, lobe ich sie.
»So eine SCHEISSE! Verdammter MIST!«
Die Flüche der Frau bringen mich zum Lachen. Nun schenke ich ihr erneut meine volle Aufmerksamkeit. Das T-Shirt und die Hose sind nicht länger rein weiß, sie sind gesprenkelt, marmoriert, gemustert oder wie auch immer man die unregelmäßig verteilten Kleckse aus Taubenscheiße nennen will, die nun auf der Vorderseite ihrer Kleidung kleben. Etwas ist ebenfalls auf ihren weißen Turnschuhen, ihrer Handtasche und ihren Haaren gelandet.
Ich taufe mein Opfer kurzerhand in Taubenkunstwerkum.
Taubenkunstwerk greift wie ein Rohrspatz schimpfend in ihre Handtasche, um aus deren Untiefen feuchte Tücher hervorzukramen.
Mein lieber Scholli! Das habe ich jetzt nicht erwartet!
Ich empfinde beinahe etwas wie Respekt für Taubenkunstwerk, als es ihr gelingt, einen Teil der Scheiße mit ihrer hinterhältigen Allzweckwaffe zu entfernen. Unerwartet fängt sie bei ihrer Handtasche an. Mal ehrlich, manche Frauen haben eindeutig die falschen Prioritäten!
Mitleidige Passanten nähern sich jetzt Taubenkunstwerk und bieten ihre Hilfe an. Als zwei weitere Frauen der inzwischen sieben Schaulustigen und vier hilfsbereiten Damen und Herren feuchte Tücher zücken, erkenne ich, dass ich die Feuchttücher-Hersteller demnächst unbedingt mal besuchen sollte. Diese Mistkerle machen mein Geschäft kaputt! Das geht gar nicht!
Kurzerhand verpasse ich den feuchten Tüchern einen Extraschuss Nässe und verfolge grinsend, wie Taubenkunstwerk jetzt ahnungslos überall Flecken hinterlässt. Momentan wischt sie sich Exkremente aus den Haaren, während sie vom Taubenangriff erzählt und hin und wieder wütende Blicke in Richtung meiner Freunde wirft, die zwar weiterhin glücklich gurren, jedoch längst das Interesse an ihr und den anderen Passanten verloren haben. Bislang hat keiner Brötchenkrümel oder etwas ähnlich Spannendes fallen lassen.
»Diese Scheißviecher sollte man abknallen!«, empört sich ein Herr im schicken Anzug laut. Seine Aktentasche weist ihn als irgendeinen Bürohengst aus, der vermutlich zu Hause dafür den dummen Esel spielen darf. Meine Sympathie kann er damit trotzdem nicht erlangen. Er hat meine Freunde bedroht!
»Na, warte!«, drohe ich ihm.
Wütend kneife ich die Augen zusammen und konzentriere mich. Eigentlich ist es nicht schwer, was ich tue. Ich brauche mir nämlich nur etwas bildlich vorzustellen, so wie die beiden goldfarbenen Verschlüsse des braunen Aktenkoffers, den der Anzugträger in der Hand hält. Ich sehe in meiner Vorstellung, wie die Verschlüsse in Sekundenschnelle altern, das Metall weich wird und der Schließmechanismus ausleiert. Es ist egal, wie gut die Verschlüsse am Koffer befestigt sind. Ich denke nur: »Ab mit euch!«, sie gehorchen und lösen sich mit einem leisen Plopp.
Es gibt einen überraschenden Knall, als eine Hälfte des Aktenkoffers auf dem Boden aufschlägt. Das Gesicht des taubenfeindlichen Arschlochs ist sehenswert, als sein Blick verdutzt auf den Griff in seiner Hand fällt, die immer noch brav den Aktenkoffer festhält.
Mit einem Rascheln rutschen lose Papiere und Akten aus dem aufgeplatzten Koffer. Ein Apfel kullert über den Fußgängerweg und landet auf der Straße, wo er von einem achtlosen Autofahrer platt gefahren wird. Mehrere Kugelschreiber fallen aus einer kleinen Innentasche, die nun kopfüber Richtung Boden zeigt.
Nun flucht auch Taubenfeind, während Taubenkunstwerk mit der Reinigung ihres Schadens aufgehört hat, um ihn und die Kofferkatastrophe anzustarren.
Hilfreiche Gutmenschen hasse ich wie die Pest. Leider sind in dieser Menge ebenfalls ein paar von ihnen vertreten, während ich nur einen Gleichgesinnten entdecken kann, der sich ein schadenfrohes Grinsen verkneift. Entweder mag er Taubenfeind nicht oder er findet Taubenkunstwerk gelungen, nur leider traut er sich nicht, seine Gefühle offen zu zeigen. Ich habe da weniger Hemmungen: Ich lache.
Die Unterhaltung meiner beiden Opfer mit den Schaulustigen ist inzwischen recht laut geworden. Taubenfeind will natürlich sofort die Hersteller seines anscheinend minderwertigen Aktenkoffers auf ein Vermögen verklagen, da nun seine wichtigen Papiere endlich mal ein bisschen Frischluft haben schnuppern dürfen und fröhlich auf dem Gehweg liegen. Sie dürfen ihre Freiheit nicht allzu lange genießen, denn die Gutmenschen sammeln die Papiere, Akten und Kugelschreiber wieder ein. Den Apfel können sie jedoch nicht mehr retten.
Der schimpfende Anzugträger beruhigt sich daraufhin so weit, dass er sich ein gegrummeltes Dankeschön für seine Helfer abringen kann, packt alles wieder in den unschuldigen Koffer, schließt ihn und hält ihn dann mit beiden Händen zu, während er weitereilt. Kurz darauf verschwindet er im Büro eines Versicherungsmaklers. Na, das passt ja. Dann weiß er wenigstens, wem er den Schaden zu melden hat.
Nachdem Taubenfeind verschwunden ist, löst sich auch die Menge um Taubenkunstwerk endlich auf und die Menschen erinnern sich wieder, dass sie ebenfalls Termine haben und zur Arbeit, zum Arzt oder wo auch immer hinmüssen. Sie lassen Taubenkunstwerk allein zurück, ohne zu ahnen, dass sie mir damit ein hilfloses Opfer ausliefern.
Nun gut, sie wäre auf jeden Fall hilflos und mein Opfer, denn wie soll sie sich gegen mich wehren? Sie hat ja keine Ahnung, dass es mich gibt und ich sogar direkt neben ihr stehe, als sie den Schlüssel aus ihrer Handtasche kramt, um die Tür zur Apotheke zu öffnen, in der sie arbeitet.
Ich sorge dafür, dass ihr der Schlüssel aus den feuchten, wenn auch inzwischen wieder sauberen Händen gleitet und würge damit meinen neuen Gegnern, den Feuchttücher-Herstellern, erneut einen rein, die nun die Schuld für das nächste Missgeschick ihrer Kundin tragen dürfen. Es klirrt nicht, als der Schlüssel unten aufkommt, denn Taubenkunstwerk steht nach wie vor auf dem kleinen Gitterrost, der als Fußabtreter fungiert. Natürlich fällt der Schlüssel ungehindert durch die schmalen Ritzen und landet weich auf den dort am Boden angesammelten Blütenblättern. Wofür haltet ihr mich? Für einen unfähigen Chaosstifter wie Friedrich?
Wenn man vom Teufel spricht …
»Krass!«
Unglücksrabe Friedrich steht plötzlich neben mir und mustert das lebende Kunstwerk staunend. Obwohl die Frau Haare, Handtasche und Turnschuhe größtenteils säubern konnte, hatte sie mit den Feuchttüchern beim T-Shirt und der Leinenhose nicht viel Erfolg. Das Einzige, was sie mit ihrer Wischerei erreichen konnte, ist, dass die Flecken etwas blasser geworden sind und die nassen Stellen nun allen Passanten einen Blick auf ihre Unterwäsche gestatten. Und so kann Friedrich meine Künste bewundern, was er zu meinem Erstaunen auch tut. Vermutlich fällt meine Begrüßung daher weniger gereizt aus, als sie es andernfalls gewesen wäre.
»Wie hast du mich gefunden?«, frage ich resigniert.
»Das verrate ich dir nicht«, meint der Junge und kratzt sich am Kopf. Vermutlich verstecken sich ganze Schuppen-Dörfer unter den ungekämmten hellbraunen Haaren. Friedrich scheint nicht viel von Körperpflege zu halten, denn seine halblange Mähne sieht aus, als sei sie schon eine Weile nicht mehr gewaschen oder geschnitten worden.
»Ich habe nachgedacht«, fährt der Junge nach einer kleinen Pause fort, in der wir in einträchtigem Schweigen beobachten, wie die Apotheken-Verkäuferin sich bemüht, den Gitterrost aus dem Boden zu hebeln. Sie hat sich dafür hinknien müssen, was sie wohl nicht besonders stört. Kein Wunder, der Straßendreck an ihren Knien fällt unter den bereits vorhandenen Flecken auf ihrer Hose nicht weiter auf.
»Und das ist etwas so Besonderes, dass du mir davon erzählen musst?«, kann ich mir die nächste Stichelei nicht verkneifen. »Glückwunsch, Friedrich! Du hast das Denken entdeckt!«
Ich hätte mir die Bemerkung sparen können, denn der Junge macht den Eindruck, als habe er sie überhaupt nicht gehört. Nervös kaut er auf seiner Unterlippe, starrt zu Boden und wippt auf den Füßen vor und zurück. Schließlich sieht er auf.
»Bringst du mir bei, wie man anderen Leuten Streiche spielt?«, platzt er heraus und schaut mich hoffnungsvoll an.
Wie bitte?! Ich höre wohl nicht richtig!
»Was willst du?! Ich soll dein Lehrer werden?«, vergewissere ich mich daher vorsichtshalber. Taubenkunstwerk hat inzwischen den Schlüssel aus dem Auffangbecken gefischt und den Gitterrost wieder eingesetzt. Gerade will sie den Schlüssel in die Tür stecken und ihn im Schloss herumdrehen, als ich verstört dafür sorge, dass er entzweibricht.
»Du hattest recht«, gibt Ein Unglück kommt selten allein zu. »Ich spiele den anderen keine Streiche oder sorge dafür, dass etwas schiefläuft, so wie du oder Archie. Niemand hat mir je gezeigt, wie das geht. Gut, ich habe auch nie gefragt. Hin und wieder passiert mal was, aber das ist dann Zufall. Ich kann meine Kräfte nicht steuern! Oder gar beiläufig einsetzen, so wie du mit dem Schlüssel gerade eben. Ich brauche jemanden, der mir zeigt, wie das funktioniert!«
»Dann frag Archie! Er freut sich sicher, wenn er dein Mentor sein darf.«
So leicht werde ich Friedrich jedoch nicht los. »Aber du bist besser!«, beharrt er, während ich Taubenkunstwerk ihrer schlechten Laune und ihrem Anruf beim Schlosser überlasse und die Straße entlangmarschiere. Die Apotheke wird heute wohl mit einiger Verspätung öffnen.
Mein Plagegeist folgt mir natürlich. Subtile Hinweise wie diese hat er noch nie verstanden.
»Haha!«, mache ich schließlich. »Ich glaube dir kein Wort! Vorhin hast du mich immerhin noch als einfallslos bezeichnet. Und nun willst du von mir lernen? Gib es zu! Archie hat deine Bitte abgelehnt und nun kommst du zu mir, um dich wieder bei mir einzuschleimen!«
»Ich habe Archie gar nicht gefragt«, kommt es leise von der linken Seite und ich bleibe überrascht stehen, um ihn anzustarren. Verschwunden sind das Selbstvertrauen, die Herausforderung und der Spott, an die ich mich schon so gewöhnt habe. Stattdessen sieht er mich so flehentlich an, dass ich gar nicht anders kann.
Ich werde gemein.
»Warum sollte ich ausgerechnet dich unterrichten wollen?«, höhne ich.
»Weil …«
Friedrich findet keine Worte und verstummt. Bevor er doch noch mit einem Grund aufwartet und ich das Wortgefecht gegen ein Kind verliere, mache ich mich vom Acker und springe zurück nach Berlin.
Hochmut kommt vor dem Fall
Das Springen, Teleportieren oder wie auch immer man es sonst nennen will, ist einer der größten Vorteile der Unsterblichkeit. Ich kann morgens in Berlin aufwachen, etwas Chaos in eine Hollywood-Hochzeit bringen, den Ausblick von der Zugspitze genießen, zum Mittagessen mal kurz nach Rom oder Venedig springen, um die original italienische Küche zu genießen, auf der Chinesischen Mauer entlangspazieren, bei den australischen Surfern und Beachboys für etwas Unheil sorgen, bei streng geheimen Meetings dabei sein, kostenlos Konzerte, Kino-Premieren oder Sportveranstaltungen besuchen, hin und wieder eine Hochzeit auf einem von sechs verschiedenen Kontinenten crashen, ein erstes Date vermasseln und vieles mehr. Und das an einem einzigen Tag.
Oder ich kann ganz einfach in meine Wohnung zurückkehren, wenn ich keine Lust mehr auf Arbeit habe, den anderen Lebenden Sprichwörtern wie Friedrich aus dem Weg gehen will oder nur mal eine kurze Pause brauche. Gut, zugegeben, bei manchen von ihnen handelt es sich lediglich um Redewendungen, aber sie nennen sich eben so.
Ja, es gibt noch andere wie mich.
Nun ja, vielleicht nicht genau so wie mich – es gibt nur einen Murphy –, aber ihr versteht schon, was ich meine. Von vielen habt ihr sicher schon gehört: Aller guten Dinge sind drei. Alter geht vor Schönheit. Blut ist dicker als Wasser. Morgenstund hat Gold im Mund – das hat sie wirklich. Alle Zähne sind aus reinem Gold und selbst die Zunge ist goldfarben. Es sieht unheimlich aus.
Andere sind weniger bekannt. Wahrscheinlich haben nur wenige von euch schon mal von Der Teufel ist ein Eichhörnchen gehört. Ein echt fieser Genosse. Wir beide sind schon ein paarmal aneinandergeraten und leider nicht im Guten auseinandergegangen. Seitdem flüchte ich und springe sofort irgendwo anders hin, sobald ich ein Eichhörnchen sehe.
Allerdings ist Eichhörnchen nicht der einzige Unsterbliche, dem ich aus dem Weg gehe. Die Nacht ist keines Menschen Freund schert sich beispielsweise wenig darum, dass ich ein Unsterblicher und kein Mensch bin. Eigentlich gilt die Vereinbarung, dass wir unsere Kräfte nicht gegeneinander einsetzen, aber Nacht hält sich nicht daran. Vielleicht hat niemand ihm etwas von dem Gesetz erzählt, ich weiß es nicht. Freiwillig ist Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus garantiert nicht bei Nacht vorbeigekommen und hat ihm erklärt, dass er die Regeln befolgen muss. Bei uns anderen hat Krähe das natürlich getan. Von ihrem endlos währenden Gekrächze, bis ich endlich eingewilligt habe, tun mir immer noch die Ohren weh.
Doch ich halte mich an die Vereinbarung. Sonst hätte ich Archie oder Friedrich schon längst einen Katastrophentag beschert, der sich gewaschen hat.
Ich seufze bei diesem schönen Gedanken und trete ans Fenster, um von dort aus über Berlin zu schauen. Meine Wohnung liegt ziemlich weit oben in einem Hochhaus ohne funktionierenden Aufzug, was mich nicht stört, wie ihr euch denken könnt. Das Gebäude ist heruntergekommen, vieles ist kaputt oder funktioniert nicht richtig.
Einer der Nachteile, wenn ich irgendwo wohne, ist, dass meine Kräfte ebenfalls im Schlaf wirken und willkürlich Dinge oder Ereignisse in meiner Umgebung beeinflussen. Daher die defekten Fahrstühle, die trotz wöchentlicher Reparaturen einfach nicht funktionieren wollen. Inzwischen haben die Eigentümer aufgegeben und die Mieter benutzen die Treppen.
Ja, das Hochhaus ist trotzdem bewohnt. Wer hier wohnt, hat keine Alternative. Berlin ist teuer, der verfluchte Turm – Warum eigentlich nicht Murphys Turm? –, wie sie das Gebäude nennen, ist billig. Hier leben Nutten, Drogensüchtige, Squatter, der Abschaum der Gesellschaft.
Und ich.
Dass ich eine der Wohnungen okkupiere, fällt gar nicht weiter auf. Von den Eigentümern kommt selten jemand vorbei. Denn Mängel, von denen sie nichts wissen, müssen sie nicht teuer reparieren lassen. Und dann sind da ja auch noch die nicht funktionierenden Aufzüge und der Turm hat über dreißig Stockwerke.
Ich lebe in der achtundzwanzigsten Etage, nicht direkt unter dem Dach, was mir die Bewohner vom Leib hält, die sich hin und wieder trotzdem bis ganz nach oben quälen, um den wunderschönen Ausblick über Berlin bei guter Sicht zu genießen, aber doch so weit oben, dass ich der einzige Bewohner auf meiner Etage bin. Mit anderen hätte Sport ist Mord auch seine Freude gehabt. Mehrfach achtundzwanzig Stockwerke rauf- und runterlaufen an einem Tag, wer tut sich das schon freiwillig an?
Verständlicherweise bekomme ich nie Besuch, bezahle nie Miete, zwacke Strom, Wasser und Heizung einfach von den anderen ab und bin zufrieden, wenn ich den übrigen Bewohnern und den anderen Unsterblichen so aus dem Weg gehen kann. Unter uns herrscht die ungeschriebene Regel, dass wir einander nie zu Hause besuchen. Die Regel hat wohl mehr Morde unter unseresgleichen verhindert als Krähes Gesetz. Nach mehreren Jahrhunderten (in meinem Fall) oder Jahrtausenden der Unsterblichkeit kann niemand die Gesellschaft der anderen ununterbrochen ertragen.
Daher bin ich sehr schockiert, als ich plötzlich ein Geräusch höre und eine Präsenz in meiner Wohnung spüre, die ganz klar einem von uns gehört.
Es ist Arsch.
Gut, ihr könnt ihn meinetwegen Archie nennen, mir egal, ich nenne ihn trotzdem Arsch. Denn er ist einer. Nicht nur, weil er unaufgefordert in meinen Rückzugsort geplatzt ist.
Der Katastrophen-Stümper wirkt heute anders als sonst. Ich brauche einen Moment, um den Grund zu erkennen.
Arsch sieht wütend aus.
Ich glaube, ich habe sein Putten-Gesicht bisher nie zornig verzogen gesehen. Eine wirklich Furcht einflößende Grimasse bekommt er mit seinen rundlichen Wangen und puppenhaften Gesichtszügen natürlich nicht hin. Er sieht lächerlich aus. Beinahe hätte ich vergessen, dass ich sauer auf ihn bin.
»Habe ich dich etwa zu mir eingeladen, Arsch? Verschwinde sofort von hier!«, zische ich ihn an.
»Ich heiße Archie!«, erklärt mein ungebetener Besucher wie automatisch zum wiederholten Mal und holt danach tief Luft. »Was zum Teufel hast du mit Friedrich gemacht?«
Da ich mit dieser Frage überhaupt nicht gerechnet habe, starre ich ihn einen Moment lang nur verdutzt an. »Nichts«, sage ich schließlich.
»Lüg nicht!«, fordert Archie empört.
Langsam werde ich richtig sauer. Immerhin ist er uneingeladen in meine Wohnung geplatzt und nun beleidigt er mich. Das geht zu weit!
»Als ob ich das nötig hätte!«, erkläre ich ihm von oben herab. »Ich weiß zwar nicht, was es dich angeht, aber ich halte mich an die Regeln. Im Gegensatz zu dir! Also hau endlich ab! Du bist hier nicht willkommen!«
Erst jetzt scheint Arsch zu begreifen, dass er in meine Wohnung und mein Territorium eingedrungen ist. Er wird blass.
»Sorry«, murmelt er verlegen.
»Wie hast du mich überhaupt gefunden?«, frage ich. Nicht dass es ein Telefonbuch oder ein Meldeamt für uns geben würde. Und ich habe gedacht, dass wir uns nicht einfach so gegenseitig aufspüren können. Doch da habe ich mich anscheinend geirrt. Nicht nur Friedrich, sondern jetzt auch Arsch sind ein stichhaltiges Gegenargument für meine Hypothese.
»Du hast Friedrich also wirklich nichts getan?«, kontert Arsch stattdessen und wirkt leicht skeptisch.
»Nein!«
»Warum ist er dann bei mir aufgetaucht, in Tränen aufgelöst, und konnte mir nur deinen Namen sagen, als ich ihn fragte, was los ist?«
Dieses kleine Biest! Natürlich ist er gleich bei seinem strahlenden Helden petzen gegangen!
»Das lag mit Sicherheit nicht an mir! Ich habe ihn nicht anders behandelt als sonst! Und nur, weil ich ihn nicht als Lehrling haben wollte …«, rechtfertige ich mich.
»Aha!«, unterbricht mich Archie triumphierend. »Das ist es! Du hast seine Gefühle verletzt!«
Er starrt mich vorwurfsvoll an und schüttelt missbilligend den Kopf. Für einen Augenblick erinnert er mich an meinen Vater, trotz Putten-Gesicht.
»Sind wir hier im Kindergarten?«, will ich wissen. »Pfui! Du warst unartig, geh in deine Ecke und denk über dein Verhalten nach?«
»Friedrich ist ein Kind, Murphy!«, sagt Arsch mit solchem Ernst, dass ich mir hier wie der Bösewicht vorkomme, obwohl ich nichts falsch gemacht habe.
»Spinnst du? Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber mit über hundert Jahren ist er definitiv kein Kind mehr, egal, wie alt er aussieht!«
Arsch seufzt tief. »Tue ihm einfach den Gefallen, Murphy! Bitte! Es bedeutet ihm so viel. Du bist sein großes Vorbild. Er sieht zu dir auf, wie du weißt.«
Nein, weiß ich nicht. Auf welchem Planeten lebt er denn? Alles, was ich von Friedrich höre, ist, wie toll Archie doch ist. Archie hat dies und das gemacht. Kennst du schon den neuesten Streich, den Archie verübt hat? Und so weiter und so fort. Von Heldenverehrung und Vorbildfunktion in meinem Fall können wir da definitiv nicht sprechen.
»Nein, tut er nicht. Er hat mich nur gefragt, weil du es nicht machen wolltest«, entgegne ich entschieden. Die Schuld lasse ich mir nicht zuweisen!
»Bitte?«, wundert er sich. »Er hat mich nie gefragt!«
Sieht verdammt überzeugend aus, seine Unschuldsmiene. So ein Putten-Gesicht ist also doch zu etwas gut.
»Wer’s glaubt, wird selig«, sage ich und zeige dann zur Tür. Arsch starrt mich verdutzt an. »Was soll das?«
»Da du anscheinend das Springen verlernt hast: Dort ist die Tür. Danke für den Besuch, das sollten wir wiederholen. Vielleicht, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen.«
Ja, die verschiedenen Formen der Unhöflichkeit habe ich drauf. Arsch auch, denn er erkennt endlich, dass er unerwünscht ist, und verschwindet. Ohne sich zu verabschieden. Unzivilisierter Bastard!
Jetzt brauche ich einen Tapetenwechsel und frische Luft. Ich entscheide mich für einen Besuch in Hamburg. An den Landungsbrücken atme ich tief ein und starre auf die Elbe, auf der wie immer viel los ist. Etliche Leute flanieren an mir vorbei, ein paar rempeln mich an und wirken verdutzt, einige Touristen wollen zur Hafenrundfahrt, andere mit der Fähre rüber nach Finkenwerder. Und dies ist nur ein Teil des üblichen Schiffsverkehrs.
Ich werde ruhiger. Bislang war der Tag, mal abgesehen von Taubenkunstwerk und Taubenfeind, nicht sehr erfolgreich. Mein Arbeitspensum leidet unter den Heimsuchungen durch Friedrich und Arsch. Obgleich ich mein eigener Chef bin, mein Tagespensum muss ich auf jeden Fall schaffen.
Es wird euch vielleicht wundern, aber auch ich bin vor den Auswirkungen meiner Magie nicht gefeit. Nicht ohne Grund benutze ich einen mechanischen Wecker und habe keine elektrischen Geräte in meiner Wohnung. Nachts kann ich meine Kräfte nämlich nicht steuern. Radiowecker, Fernseher, Computer, Mikrowellen, Herde, Rauchmelder, Telefone, Kühlschränke – all das sind Dinge, die ich nicht besitze. Bei mir hält Technik nie sehr lange, sogar wenn ich sie nicht zerstören will. Ich habe mich daran gewöhnt und das meiste ist sowieso unnützes Zeug. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es all das nicht gab. Für mich sind ein WC und eine Dusche schon ein gewaltiger Fortschritt. Mehr Luxus brauche ich nicht.
Ich merke, dass meine Gedanken abgeschweift sind, als ich nach einer Weile die Präsenz eines anderen Unsterblichen spüre, der in einiger Entfernung durch die Gegend schlendert. Hochgeschreckt starre ich erst auf die Uhr, fluche, weil es mittlerweile schon nach elf ist, und drehe mich dann um.
Es ist das Schleimmonster.
Natürlich gibt es keine Sprichwörter über Schleimmonster! Idioten!
Das ist mein Spitzname für Hochmut kommt vor dem Fall. Gut, wer Hochmut nicht kennt, der wundert sich jetzt sicher über die Bezeichnung, die anderen werden verständnisvoll nicken.
Es ist nicht so, dass Hochmut hässlich ist. Im Gegenteil, sie ist sogar recht schön anzuschauen – wenn man sich die Nase zuhält. Ihre eigene Nase hält sie nicht ohne Grund stets nach oben. Sie kann sich vermutlich selbst nicht riechen.
Leider hat Hochmut auch eine hässliche Seite. Aus ihren Füßen tritt ein für die Menschen unsichtbarer Schleim aus. Die Fußstapfen aus Schleim sind wie tickende Zeitbomben. Du weißt nie, wann die Schleimbombe explodiert. Dieser unsichtbare Schleim ist lediglich für uns Unsterbliche zu sehen, leider auch zu riechen. Das Schleimmonster ist daher kein gern gesehener Partygast, wie ihr euch vorstellen könnt.
Wenn ein Mensch nun auf eine dieser Bomben tritt, kann es sein, dass in zehn Fällen gar nichts passiert und der elfte dann die Schleimbombe zündet. Dann wird der Schleim plötzlich spiegelglatt. Und zack! Dort liegt ein gestürzter Mensch, der sich nicht erklären kann, was passiert ist, und wieder ist ein Sprichwort bewiesen.
Da der Geruch langsam unerträglich wird, trotz einer recht angenehmen Brise an diesem heißen Maitag, und ich schon zu lange gefaulenzt habe, beschließe ich, mir nun endlich mein nächstes Opfer zu suchen. Gerade hatte ich die perfekte Idee, die ich unbedingt ausprobieren muss.
Aller guten Dinge sind drei
Konzentriert denke ich an meinen Zielort, nach einmal Blinzeln bin ich auch schon da.
Paris. Die Stadt der Liebe.
Aktuell jedoch ebenfalls der Schauplatz für eines der größten Tennisturniere der Welt. Und heute ist der erste Turniertag der French Open, den will ich natürlich nicht verpassen.
Sportveranstaltungen sind toll. Besonders, wenn es sich um große Wettbewerbsveranstaltungen handelt. Ich liebe Olympia, Welt- und Europameisterschaften, die Champions-League, Formel 1-Rennen und alle anderen Sportevents, in denen die Emotionen schnell hochkochen.
Dummerweise haben solche Großevents den Nachteil, dass ich ständig jemandem aus der Freakshow begegne, wie ich die anderen gerne nenne. Und bei jeder zweiten Veranstaltung begegne ich Sport ist Mord.
Der Psycho steht direkt vor mir, als ich mich auf der Zuschauertribüne materialisiere. Nur knapp vermeide ich ein Zusammenzucken. Vor ihm will ich mir keinesfalls eine Blöße geben.
»Murphy«, grüßt er, nickt mir einmal kurz zu und lässt den Blick dann wieder über die Zuschauer gleiten.
Ich erschaudere, obgleich sich der kalte Blick nicht gegen mich richtet. Wenn ihr Sport sehen könntet, würdet ihr ihm wohl schmachtende Blicke zuwerfen oder ihm respektvoll zunicken, denn der Mann ist über einen Meter neunzig groß, schlank, durchtrainiert und hat ein attraktives Gesicht. Ich musste mir schon etliche Schwärmereien von weiblichen Dummbatzen aus der Freakshow über seine majestätische Nase, seine strahlend blauen Augen, seine goldenen Haare und seine Grübchen anhören. Dummerweise lächelt Sport nur dann, wenn er gerade ein neues Opfer gefunden hat.
Ihr haltet mich für schlimm? Ich bin harmlos. Ungefährlich. Auch wenn ich zugegebenermaßen schadenfroh bin.
Aber ich bin kein Psycho. Mir bringt es keinen Spaß, jemanden möglichst schmerzhaft umzubringen.
Sport ist Mord macht in diesem Moment seinem Namen wieder alle Ehre. Ein alter Mann greift sich plötzlich röchelnd an den Hals. Er bekommt keine Luft mehr, da Sport mit der Rechten seine Luftröhre zudrückt und sie langsam zerquetscht. Von der Tragödie bekommt außer mir niemand etwas mit. Der Alte kann nicht um Hilfe rufen, dafür hat Sport gesorgt. Seine linke Hand liegt fest über dem Mund des Mannes.
Unten auf dem Platz geht das Tennismatch weiter. Der Ballwechsel muss spannend sein, denn die Zuschauer um uns herum springen auf, jubeln und schreien, während ich alles andere tun will, als dem grausamen Schauspiel vor meinen Augen zuzuschauen und zu klatschen. Leider kann ich meinen Blick nicht abwenden. Ich wage es nicht, Sport den Rücken zuzukehren. Beinahe wäre ich woandershin teleportiert, aber ich muss an mein Tagespensum denken, also bleibe ich gezwungenermaßen stehen.
Als es wieder ruhiger wird und die Spieler eine Pause machen, ist der alte Mann schon längst tot. Morgen wird dann in den Zeitungen stehen, dass der Turnier-Mörder wieder zugeschlagen hat. Und Europol und das FBI werden weiter einem Phantom nachjagen, das sie niemals schnappen können.
Mir bringt dieses Match keinen Spaß. Nachdem Sport endlich verschwunden ist – ich will gar nicht wissen, wohin –, gehe ich zum nächsten Platz weiter und sehe dort eine Weile zu. Sie sind bereits im 3. Satz und die beiden Spieler sind mit Feuereifer bei der Sache.
Umso besser.
Grinsend lasse ich meine Fingerknochen knacken und atme tief durch. Selbstverständlich brauche ich diese theatralischen Gesten nicht wirklich, zumal mich ja niemand sieht, aber sie helfen, um mich zu beruhigen. Bald habe ich die unangenehme Begegnung mit Sport und seinem Opfer vergessen.
Dann lege ich los.
Zack!
Ein Stöhnen geht durch die Menge. Der Aufschlag ist im Netz gelandet.
Zack!
Ein Fluch ertönt vom Spieler, der es nicht fassen kann, dass er den Aufschlag nun bereits zum zweiten Mal versemmelt hat. Doch er ist ein Profi und so flucht er nur ein bisschen mehr als sonst, als er jeden Aufschlag dieser Runde ins Netz schlägt.
Nun ist der andere an der Reihe. Sein schadenfrohes Grinsen wische ich ihm schnell aus dem Gesicht, heute schreibe ich ausgleichende Gerechtigkeit ganz groß. Bald ist es sein Gegner, der wieder lachen und grinsen kann. Das Spiel geht an ihn, ohne dass der Ball nur einmal übers Netz geflogen wäre und er sich hätte anstrengen müssen.
Die Journalisten sind hochaufmerksam, als der erste Pechvogel die Bälle von einem Balljungen entgegennimmt und seine Pechsträhne brechen will. Natürlich lasse ich ihn nicht.
Die Zuschauer stöhnen und springen auf, als auch dieses Spiel zu null an den Gegner des Aufschlägers geht. Drei verlorene Spiele in Folge, ohne dass die Spieler über den Sandplatz hetzen mussten, gab es vermutlich noch nie. Mich hat nun der Ehrgeiz gepackt. Ich treibe den Satz hoch bis zum Tiebreak und die Spieler von einem Wutanfall zum nächsten. Der Schiedsrichter hat beide Kontrahenten bereits ermahnt und Opfer Nummer eins benötigte einen neuen Schläger, nachdem er seinen alten zu Boden geschmettert und kaputt gemacht hat. Natürlich habe ich da ebenfalls ein bisschen nachgeholfen. Als die Aufschlagspunkte der Bälle im Netz endlich auf beiden Seiten dasselbe Wort ergeben, gratuliere ich mir selbst.
Welches? Nun, dreimal dürft ihr raten.
»Murphy? Ein wenig selbstgefällig heute?«, ertönt eine Stimme neben mir, die ich sogar über den Lärm der Menge und der Journalisten gut hören kann.
Eine schlanke Frau mit langen blonden Haaren kommt näher. Sie trägt ein weißes Sommerkleid, das tadellos sitzt und keinen einzigen Fleck aufweist. Allein deswegen hätte ich am liebsten meine Hände in den roten Sand auf dem Platz gedrückt und sie danach an ihr abgewischt. Aber nein, sie muss ja wieder perfekt aussehen und dazu noch meinen Tag ruinieren!
Trinity streicht sich die langen Haare nach hinten, bevor sie mich missbilligend ansieht. »Es ist keinem von uns geholfen, wenn die TV-Leute erkennen, dass du die Spieler deinen Namen ins Netz hast schreiben lassen. Unsere Existenz ist aus gutem Grund geheim, vergiss das nicht!«, rügt sie mich, wobei sie wie eine gutmeinende Lehrerin wirkt und ich wie ein dummer kleiner Junge. »Ich habe eingreifen müssen, damit das nicht geschieht.«
»Du hast was getan?!«
Ich fasse es nicht! Wieso muss sie sich ständig einmischen? Trinity ist schlimmer als Friedrich. Schlimmer als Archie. Lästiger als die Gutmenschen. Kein Wunder, denn sie ist Aller guten Dinge sind drei und gerade hat sie wieder einmal meinen perfekten Tag ruiniert.
Das Schlimmste ist wohl, dass sich meine Gegenspielerin nicht einmal als solche sieht. Sie denkt, sie hilft mir. Wie gestört ist das denn? Will ich etwa, dass sie nun dafür sorgt, dass der dritte Satz an Opfer Nummer eins geht und damit auch das Match? Dass sich die Kameraleute und Journalisten auf die beiden stürzen und sie zum Match des Jahrhunderts befragen? Zwischendurch klingelt beim Manager des Siegers das Telefon und er hetzt aufgeregt zu seinem Spieler. Ich könnte kotzen, als ich höre, wie er seinem bislang recht unbekannten Klienten berichtet, dass Hollywood angerufen hat und seine Geschichte inklusive dieses Matches verfilmen will.
Doch es kommt noch schlimmer.
Eine weltberühmte Sängerin tritt aus ihrer Loge und geht zum unglücklichen Verlierer, begrüßt ihn herzlich, um ihm dann im nächsten Moment schöne Augen zu machen und als kleinen Trostpreis einen Exklusivauftritt von ihr zu schenken.
»Aller guten Dinge sind drei?«, höhne ich und spucke vor ihr aus. »Wann kapierst du endlich, dass das für mich nie gilt? Immer wenn du auftauchst, machst du alles kaputt! Und dann soll ich mich freuen, weil du mir hilfst? Bist du irre? Bescheuert? Oder einfach nur strohdoof?«
Aller guten Dinge sind drei, oder einfach nur Trinity genannt, wirkt zutiefst verletzt. Es dauert nicht lange und Jeder ist seines Glückes Schmied steht neben ihr und legt tröstend den Arm um sie. Trinitys Bruder ist genauso nervtötend wie sie, aber um einiges schlauer und mit seinen breiten Schultern und muskulösen Armen normalerweise jemand, dem ich aus dem Weg gehe.
Leider erinnere ich mich daran erst, als er mir mit all seiner Kraft eine verpasst hat und ich aus meiner Ohnmacht erwache. Mir dröhnt der Schädel und mein Körper fühlt sich an, als wäre eine Rinderherde – alias die Zuschauer – einmal über mich drübergetrampelt. Ich schwöre Schmied laut fluchend Rache.
»Ähem!«, räuspert sich da jemand missbilligend und keckernd neben mir. »Hat da jemand das Abkommen vergessen, dem er zugestimmt hat?«
Die schwarze Krähe sitzt neben mir auf dem Boden und mustert mich über ihren spitzen Schnabel hinweg tadelnd. Meine Gegner haben mich anscheinend in einen Gang geschleppt und an der Wand liegen lassen. Vermutlich hatten sie ein schlechtes Gewissen, als die Zuschauer mich auf dem Weg von und zu ihren Plätzen als Fußabtreter benutzt haben. Ich höre den Kommentator draußen den Zwischenstand im nächsten Spiel ansagen und frage mich, wie lange ich bewusstlos gewesen bin. Vermutlich zu lange.
»Wie spät ist es?«, frage ich Krähe.
»Woher soll ich das wissen?«, entgegnet sie gleichgültig. »Sehe ich etwa so aus, als würde ich eine Armbanduhr oder ein Handy bei mir tragen und könnte mal eben die Zeit ablesen? Ist es nicht egal, wie spät es ist? Zunächst einmal hätten wir zwei ein dringenderes Problem zu klären als die Uhrzeit! Du hast die Regeln verletzt!«
»Gar nichts habe ich!«, wehre ich mich sauer gegen die Unterstellung. »Erklär das Schmied! Er hat seine Kräfte gegen mich eingesetzt und nicht umgekehrt! Was du daran hättest erkennen können, dass ich hier bewusstlos auf dem Boden lag.«
Unparteiisch ist Krähe natürlich kein Stück, in ihren Augen bin ich ständig der Böse.
»Was hast du angestellt?«, will sie misstrauisch wissen. »Schmied hätte niemals einen Streit begonnen!«
»Vielleicht solltest du das auch einmal Trinity erklären. Am besten in Worten, die ihr Ameisengehirn versteht! Sie hat mit ihren Kräften meinen entgegengewirkt!«, ärgere ich mich laut, während ich mich langsam aufsetze. Ich habe selten körperliche Beschwerden, aber von Schmieds Hieb ist mir tatsächlich schwindelig. Zum Glück klingen die anderen Schmerzen langsam ab.
»Ah!«, macht Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. »Verstehe! Du warst unhöflich gegenüber seiner Schwester. Wusste ich es doch!«
Und schon bin ich wieder der Böse. Na klasse!