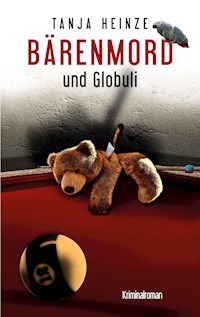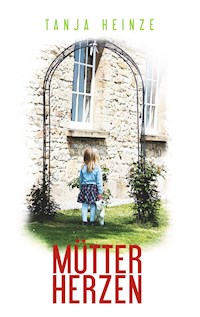
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Februar 1950 verlässt Marie Ansorge mit ihren zwei Schwestern Oberschlesien. Auf schicksalhafte Weise trennen sich im Hochsauerland die Wege der jungen Frauen, und Marie findet in einem Wuppertaler Mutter-Kind-Heim Unterkunft. Ihre erste Liebe ist unglücklich und hat Folgen… Was macht eine schwangere junge Frau zu dieser Zeit, angewiesen auf einen Mann, der sie versorgt? Welche Überraschungen hält das Leben für ihre kleine Tochter bereit? Begleiten wir die Frauen auf einer Zeitreise durch ihr Leben. Eine Geschichte voller Überraschungen, die zeigt, dass immer wieder ein Licht leuchtet, auch wenn die Nacht am finstersten ist. Nach einer wahren Begebenheit. Mit Gedichten von Claus Wallbaum. „Atmosphärisch dicht und ohne überflüssiges Pathos, mit kurzen wie feinen Charakterdarstellungen, zeichnet Tanja Heinze in ihrem achten Roman eine Biografie, die fesselt.“ Manfred Bube, Wuppertaler Rundschau
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roman
Im Februar 1950 verlässt Marie Ansorge mit ihren zwei Schwestern Oberschlesien. Auf schicksalhafte Weise trennen sich im Hochsauerland die Wege der jungen Frauen, und Marie findet in einem Wuppertaler Mutter-Kind-Heim Unterkunft. Eine erste unglückliche Liebe hat Folgen… Was macht eine schwangere junge Frau zu dieser Zeit, angewiesen auf einen Mann, der sie versorgt? Welche Überraschungen hält das Leben für ihre kleine Tochter bereit? Begleiten wir die Frauen auf einer Zeitreise durch ihr Leben. Eine Geschichte voller Überraschungen, die zeigt, dass immer wieder ein Licht leuchtet, auch wenn die Nacht am finstersten ist.
Nach einer wahren Begebenheit.
Mit Gedichten von Claus Wallbaum.
Autorin
Tanja Heinze, 1975 in Wuppertal geboren, lebt und arbeitet in dieser Stadt bis heute. Sie studierte Philosophie an der Bergischen Universität Wuppertal.
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Februar 1950
Aufbruch ins Ungewisse: April - Mai 1950
Hoffnungsschimmer: Mai 1951 - Oktober 1951
Ohnmacht: Januar 1952 - Oktober 1953
Unter Zwang
Sonne, komm bald wieder: März 1954 - April 1957
Mutterschaft: Mai 1960
Geburtstage: November 1962 - November 1965
Gemeinde: August 1966 - Mai 1971
Supernova: Oktober 1979
Licht und Schatten: September 1979 - Mai 1980
Alpha und Omega: Mai 1980 - November 1981
Schwestern: November 1981 – April 1984
Schicksalsstunden: Mai 1994 - Februar 1996
Marie: Mai 1996 - Januar 2012
Abenddämmerung: Dezember 2015 - Februar 2017
Engelszungen: März 2017
Quer durch die Hölle: Oktober 2017
Der Galgen
Geburt des Frühlings
Nachwort von Roswitha Brigitte Klein / Gitte Groß
Prolog
Februar 1950
Schnee bedeckte die Felder, und es war bitterkalt. Die Russen zeigten sich Ende Februar 1950 immer noch präsent, und die Menschen in Oberschlesien fürchteten die rote Armee. Marie meinte, das Donnern des Krieges zu hören, den Widerhall der verlorenen Schlacht. Sie und ihre Familie waren der Vertreibung entgangen, hatten Obdach gefunden auf dem Hof der Gluters. Doch ihre Zukunft auf dem Land war ungewiss. Sie schnallte den Gürtel ihres schwarzen Wintermantels enger, aber ihr wollte nicht warm werden.
„Marie“, hörte sie ihn rufen. „Beeil dich. Ich bin in der Scheune.“
Sie lief schneller, konnte es nicht erwarten, ihn wiederzusehen.
Er stand im Eingang des kleinen Gebäudes, in dem das Stroh für das Vieh aufbewahrt wurde. Bei seinem Anblick beschleunigte sich ihr Herzschlag. Der stattliche, dunkelhaarige junge Mann war äußerlich unversehrt von der Front zurückgekehrt.
„Rolf“, rief sie und flog in seine ausgebreiteten Arme.
„Ich habe mich nach dir gesehnt“, flüsterte er ihr ins Ohr.
Er nahm ihre Hand und führte sie zur Leiter, über die sie zu den Strohballen gelangten.
„Ich war schon oben und habe einen Ballen aufgeschnitten“, sagte er, ihr den Vortritt lassend.
Marie war entzückt von dem Nest, das er ihnen bereitet hatte. Sie kuschelte sich an ihn und erwiderte bereitwillig seine Küsse.
„Rolf, weiter dürfen wir nicht gehen“, hauchte sie nach einer Weile.
„Marie, Marie“, keuchte er. „Ich kann jetzt nicht aufhören.“
Erregt schob er ihren schweren Rock hoch und riss an den Strumpfhaltern.
„Rolf, ich habe Angst“, flüsterte Marie.
„Ich werde dir nicht weh tun“, versprach Rolf atemlos. Er griff nach dem Schlüpfer aus Wolle und zog ihn ihr vom Leib.
Minuten später lagen sie erschöpft nebeneinander. Blut lief an Maries Beinen herunter. Sie zitterte am ganzen Körper.
„Du hast mir doch wehgetan“, sagte sie unter Tränen.
„Das gehört beim ersten Mal dazu. Ich habe ein Tuch für dich eingesteckt. Hier.“ Er reichte ihr ein Stück Stoff und setzte sich auf. „Richte dein Kleid. Wir müssen reden.“ Er sah ihr dabei zu, wie sie sich säuberte und wieder anzog. Ihre schmalen Finger bebten, während sie die Strumpfhalter schloss. Er liebte zarte Frauen mit blonden Locken. Wie schön sie ist, dachte er seufzend. Er bedauerte, dass sie arm wie eine Kirchenmaus war. Gestern hatte der Familienrat getagt, und die Entscheidung war gefallen.
„Warum müssen wir reden?“, wollte Marie wissen. Ihre graugrünen Augen glänzten von den letzten Tränen.
„Ich kann dich nicht heiraten“, erwiderte er schonungslos.
„Was soll das bedeuten?“ Marie schüttelte verständnislos den Kopf. „Das sagst du mir jetzt, nachdem wir gerade…“ Sie brach ab.
„Marie, sei vernünftig“, fuhr Rolf fort. Er rutschte näher zu ihr und legte den Arm um sie. „Ich kann das schließlich nicht allein entscheiden. Meine Eltern, Onkel und Tanten haben ein Mitspracherecht. Es ist nicht leicht, in der Nachkriegszeit den Hof zu halten. Wir brauchen Geld. Ich muss die Margarete heiraten, versteh das doch.“
Marie befreite sich aus seiner Umarmung.
„Die Margarete? Ich dachte, sie sei fett wie ein Schwein und habe Zähne wie eine Kuh. Das waren doch deine Worte.“ Die Tränen waren schlagartig versiegt. Vor Wut ballte sie die Hände zu Fäusten.
„Beruhige dich, mein Herz“, versuchte Rolf die aufgebrachte Neunzehnjährige zu beschwichtigen. „Ich liebe sie nicht, werde ihr ein Kind machen, und das war es. Wir treffen uns heimlich weiter. Das, was wir gerade getan haben, können wir wiederholen. Es wird sich nichts ändern. Bisher mussten wir uns schließlich ebenfalls verstecken.“
„Das kannst du vergessen“, schrie Marie. Vor Aufregung war ihr die Röte ins Gesicht gestiegen. „Werde glücklich mit Margarete. Mich wirst du nicht wiedersehen.“ Sie sprang auf und schlüpfte in ihren Mantel. Unglücklich kletterte sie die Leiter runter und rannte hinaus in die Kälte.
„Marie, was ist mit dir? Du zitterst ja“, erkundigte sich Gunhilde Ansorge besorgt. „Setz dich an den Tisch. Ich habe Graupensuppe mit Speck gekocht. Zum Glück gibt es den wieder mit den Lebensmittelkarten zu kaufen.“
Marie hängte den nassen Mantel zum Trocknen über die Stuhllehne. In der kleinen Wohnung auf dem Gluter-Hof war es angenehm warm. Ihre Schwestern saßen bereits vor zwei dampfenden Schalen und löffelten ihre Suppe.
„Rolf wird die Bocksche Margarete heiraten“, erwiderte Marie leise.
Gunhilde reichte ihr eine Suppenschale und einen Löffel.
„Überrascht dich das?“, fragte sie mit hochgezogenen Augenbrauen. „Die Meiers brauchen Geld. Und die hässliche Margarete braucht einen Mann. Der Rolf hat dir schöne Augen gemacht, jetzt heiratet er eine andere. Iss etwas. Solange er dir kein Kind angedreht hat, ist alles gut. Du warst doch vernünftig, oder?“
Marie nickte eifrig und widmete sich der Suppe.
„Hier in diesem kleinen Kaff Sterda, das auf keiner Landkarte verzeichnet ist, gibt es keine Perspektiven für uns. Ich werde hier nicht bleiben und versauern, Mutter“, warf die gerade volljährig gewordene Anna ein. Von den Schwestern war sie die Kräftigste. Rundlich und dunkelhaarig glich sie eher dem verstorbenen Vater als Gunhilde, die so blond wie Marie und die siebzehnjährige Lotta war. Diese sagte: „Ich stimme Anna zu. Der Krieg ist vorüber. Die Gluters werfen uns bestimmt bald vom Hof, damit Platz für die zukünftigen Ehemänner der Zwillinge wird. Warum machen wir uns nicht auf den Weg nach Eisenach? Das sind nur zehn Kilometer Fußmarsch. Klara wird uns gewiss eine Weile bei sich aufnehmen. Ihr Max liebt sie abgöttisch und schlägt ihr keinen Wunsch ab.“
„Ich werde ihr schreiben“, entgegnete Gunhilde nachdenklich. Sie vermisste ihre älteste Tochter, das musste sie sich eingestehen.
Ehrfurchtsvoll blickten die vier Frauen auf die Wartburg. Imposant und eindrucksvoll schien sie über Eisenach zu wachen. Der Krieg hatte ihr nichts anhaben können, und hier, im Osten von Eisenach, am Berg direkt neben dem Wald, hatte sich die Bevölkerung langsam von den Schrecken des Krieges erholt. Die zerstörten Häuser wurden von Schnee bedeckt, die Stimmung war zuversichtlich.
„Kommt rein, die Burg könnt ihr später bestaunen“, sagte die dreiundzwanzigjährige Klara zu der Mutter und den Schwestern. „Max kommt erst am Abend.“ Sie nahm ihre Mutter liebevoll in den Arm. Zwar ähnelten auch Marie und Lotta Gunhilde, doch Klara glich ihr am meisten.
„Ihr habt es schön hier“, bemerkte Gunhilde. „Max scheint dich gut zu versorgen.“
„Ich zeige euch das Zimmer, in dem ihr schlafen werdet.“ Klara führte die vier eine Holztreppe hoch in den zweiten Stock. Das Haus ihres Mannes war für zwei Personen sehr geräumig, für sechs Menschen auf Dauer jedoch zu klein. „Ich habe es euch gemütlich gemacht.“ Sie deutete auf drei dicke Matratzen, eng nebeneinander auf den Boden gelegt. Innerlich bezweifelte Klara, dass diese Konstellation lange gut gehen würde. Sie kannte ihre Schwestern, vor allem Anna und Marie. Die mussten hinaus in die Welt. Sie würde verhindern, dass ihre Mutter mit ihnen durch die Lande zog. Die Wirren des Krieges und der Tod ihres Mannes hatten ihr arg zugesetzt. Sie hatte etwas Behaglichkeit verdient.
Aufbruch ins Ungewisse
April - Mai 1950
Tränen standen Gunhilde in den Augen, als die drei vor ihr standen, eingepackt in ihre Wintermäntel, mit dicken Tüchern um die Köpfe gewickelt und mit Reisesäcken auf die Rücken geschnallt.
„Wieso wartet ihr nicht, bis es wärmer geworden ist?“, fragte sie zum wiederholten Male. „Max war gut zu euch. Klara und er würden euch gerne weiter Obdach gewähren.“
„Mutter“, machte sich Klara bemerkbar. „Die drei möchten ihre eigenen Wege gehen. Wir müssen sie ziehen lassen.“ Im Geheimen war sie froh, dass ihre Schwestern Eisenach verlassen würden. Sie hatte bemerkt, dass Max begehrliche Blicke auf ihre jüngste Schwester Lotta warf.
„Es ist bereits Mitte April, die Tage werden länger, und wir möchten nicht warten“, sagte Anna resolut.
„Du hast gut reden“, entgegnete Gunhilde unwirsch. „So schnell konnten wir nicht gucken, wie du dir Müllers Franz geangelt hast.“
„Mutter, sei froh, dass er uns auf der Reise begleiten wird“, sagte Anna. „Er hat sich Pferde geliehen und ein Fuhrwerk. Damit kommen wir in den Westen und sind die Russen los. Bis Hersfeld sind es lediglich knappe sechzig Kilometer. Von dort aus wird sein Freund das Gefährt zurück nach Eisenach kutschieren.“
„Seht. Er kommt“, warf Marie aufgeregt ein. Vor Anspannung war ihr flau im Magen. Am frühen Morgen hatte sie vor lauter Nervosität das Frühstück nicht bei sich behalten können.
„Rappen“, stellte Klara bewundernd fest. „Wo hast du die stattlichen Pferde ergattern können, Franz?“
Der kriegsversehrte, hinkende Mann mit dem roten Haar grinste stolz.
„Zahlt sich aus, dass ich während des Krieges und danach beim Schmied ausgeholfen habe.“ Er griff in seine Manteltasche und zog eine zerknitterte Zigarettenschachtel heraus. Anstalten, den Kutschbock zu verlassen, machte er nicht. „Los jetzt. Steigt auf. Ich möchte noch vor Einbruch der Dunkelheit in Wildeck ankommen.“
„Warum in Wildeck?“, fragte Gunhilde erstaunt. Aus den Augenwinkeln heraus betrachte sie besorgt ihre zweitjüngste Tochter. Marie war auffallend blass um die Nase. Die morgendliche Übelkeit war ihr nicht entgangen.
„Wildeck liegt etwa auf halber Strecke. Franz hat in einer evangelischen Kirchengemeinde für zwei Nächte für uns Asyl beantragt“, mischte sich Anna stolz ein. Sie griff nach dem von der Schwester bereitgestellten Weidenkorb mit Käse, Wurst, eingelegtem Gemüse und Obst. Energisch wuchtete sie ihn auf das Gefährt. „Dreißig Kilometer zurückzulegen, sollten wir heute schaffen.“
Franz klopfte ihr wohlwollend auf die runde Schulter.
Plötzlich unterbrach das Knattern von Motorrädern die morgendliche Ruhe. Zwei Männer, in lange Ledermäntel gekleidet, mit grauen Schirmkappen auf den Köpfen und Springerstiefeln an den Füßen, hielten neben dem Fuhrwerk.
„Kuda, kuda?“, bellte einer der beiden. „Wohin?“
Die Frauen zogen verängstigt die Köpfe ein. Die Brutalität der Russen während des Krieges war nicht vergessen. Gunhilde zog vorsichtig den Ärmel ihres Strick-Pullovers über ihre Armbanduhr.
„Wir haben in Eisenach keine Arbeit“, antwortete Franz so fest, wie er es vermochte. „Die Frauen müssen einen Broterwerb finden. Hier ist kein Platz für uns.“
„Was ist im Korb?“, fragte der andere Russe und sprang vom Motorrad. Er entfernte die Decke des Weidenkorbes und grinste hämisch. „Igor“, sagte er und langte hinein. „Blutwurst. Und Schinken. Gut.“
„Beschlagnahmt“, stellte Igor fest. „Ihr dürft fahren.“ Die zwei Russen stopften die Lebensmittel in die Satteltaschen und brausten davon.
„Im Westen werden wir zumindest die roten Teufel los sein“, meldete sich Lotta mit bebender Stimme zu Wort. Fürsorglich legte Marie den Arm um die jüngste Schwester.
„Schweine“, schimpfte Klara, griff nach dem Korb und machte sich auf den Weg, ihn erneut zu füllen. Derweil umarmten die Schwestern Gunhilde. Das Erlebnis mit den Alliierten bestärkte sie in ihrem Wunsch, nach Westen zu ziehen.
„Schrecklich“, hauchte Lotta Marie ins Ohr.
Die zwei Schwestern lagen, eng aneinander gekuschelt, unter der dicken Wolldecke, die der Pfarrer ihnen zur Verfügung gestellt hatte. Ihr provisorisches Bett war rechts neben dem Altar der evangelischen Kirche im Wildecker Stadtteil Bosserode errichtet worden. „Mach, dass sie damit aufhören, Marie. Solche Geräusche habe ich nie zuvor gehört. Haben Anna und Franz Streit? Ich habe solche Angst.“
Marie biss die Zähne zusammen. Die Bilder von vor sieben Wochen mit Rolf in der Scheune drängten sich ihr auf. Sie erinnerte sich an seine Zärtlichkeiten und die verletzenden Worte danach, an den durchdringenden Schmerz. Auf einmal saß sie senkrecht auf der Matte, und Lotta sah sie mit großen Augen an.
„Was ist los? Möchtest du nachsehen, was die zwei hinter dem Altar machen?“, fragte sie hoffnungsvoll.
„Lotta“, erwiderte Marie gepresst. „Weißt du noch, was die Schweine manchmal machen, damit es Ferkel gibt?“
„Sicher, der Eber besteigt die Sau“, antwortete Lotta sofort. Plötzlich prustete sie los. „Du meinst, Franz besteigt Anna?“
„Das gehört zum Leben dazu. Liebes, hat Mutter dich nicht aufgeklärt?“, wollte Marie entsetzt wissen.
„Nein“, antwortete die Schwester ehrlich. „Also machen Menschen das auch. Wie furchtbar. Mich wird niemand besteigen. Das schwöre ich dir.“
Marie kuschelte sich wieder an Lotta und zog die Decke hoch bis zu ihren kalten Nasenspitzen.
„Komm, wir schlafen“, flüsterte sie. „Der Lärm wird gleich aufhören, und morgen möchte Franz weiter.“
Wenig später wurde es ruhig im Kirchenschiff, und sie lauschte den regelmäßigen Atemzügen der jüngeren Schwester. Marie jedoch fand keinen Schlaf. Mit Schrecken war ihr bewusst geworden, dass ihre Monatsblutung bereits zwei Wochen überfällig war.
„Lotta?“, schrie Marie in den Nebel. Es war Anfang Mai, und die kleine Truppe war in dem Städtchen Winterberg im Hochsauerland angekommen. Heute hatte Marie ihren Schwestern und Franz während des Frühstücks mitgeteilt, dass die mit Rolf in der Scheune verbrachte Zeit im November Folgen haben würden. Anna und Franz waren gelassen geblieben. Franz hatte gar lapidar gesagt: „Bleibe am besten in Winterberg und suche dir einen Kerl, bevor dein Bauch dick wird. Hübsch genug bist du, um ein Kuckucksei zu vertuschen. Aber du solltest dich mit der Suche beeilen.“
In Winterberg waren sie bei einer gastfreundlichen Bauersfamilie untergekommen, die ihnen einen warmen Platz im Kuhstall zur Verfügung stellte. Dafür mussten sie hart arbeiten. Es galt, Mai-Rübchen zu ernten, den Hof zu fegen und das Vieh zu füttern. Als Lohn bekamen sie gut zu essen, und Anna wurde immer fülliger. Maries Bauch wölbte sich leicht, doch ansonsten zehrte die Schwangerschaft mit der einhergehenden Übelkeit sie aus. An ihren Mundwinkeln hatten sich Risse gebildet, die trotz der Extraportion Milch, die die aufmerksame Bäuerin ihr zuteilte, nicht verschwinden wollten. Das Fleisch, das notwendig für sie war, konnte sie nicht schlucken. Es blieb ihr im Halse stecken.
„Lotta, wo bist du?“, rief Marie verzweifelt. Es war für junge Frauen immer noch gefährlich, in den Abendstunden allein unterwegs zu sein. Marie machte sich schreckliche Vorwürfe, dass sie dem Mädchen die Nachricht von ihrer Schwangerschaft nicht schonender beigebracht hatte. Am Morgen war es einfach aus ihr herausgeplatzt. Lotta hatte geweint und geschrien, dass ihre beiden Schwestern Säue seien. Anna und Franz hatten gelacht und obszöne Bemerkungen gemacht, die Lotta die Schamesröte in die Wangen getrieben hatten.
Marie verfluchte die Nebelschwaden, die ihren Blick verschleierten. Sie ahnte, wo es ihre jüngste Schwester hingezogen hatte. Endlich erreichte sie die Grünfläche mit dem Heckenlabyrinth, das bei Exerzitien genutzt wurde. Sie raffte ihren schweren Rock und rannte weiter zur Eingangspforte des kleinen Klostergebäudes. Mit ganzer Kraft klopfte sie an. Ihr Herz pochte vor Aufregung.
„Sie wünschen?“, wurde sie von einer rotwangigen Frau in Nonnentracht begrüßt.
„Ich suche meine jüngere Schwester. Sie heißt Lotta, Lotta Ansorge.“ Hoffnungsvoll sah Marie die Nonne an.
Diese faltete die Hände vor der Brust.
„Ihre Schwester ist zu uns geflüchtet“, sagte sie ruhig. „Sie sehnt sich nach Sicherheit im Glauben. Ihre Reise ist zu Ende. Der Platz Ihrer Schwester ist bei Gott, bei uns. Es ist ihr sehnlichster Wunsch, die Gelübde abzulegen und Gottes keusche Braut zu werden.“
„Mein Gott“, entfuhr es Marie. Sie fröstelte in der trüben Feuchtigkeit vor der Pforte.
„Gott sucht sich seine Bräute, mein Kind“, fuhr die Nonne seelenruhig fort. „Sie, Mädchen, suchen einen weltlichen Bräutigam.“ Wissend deutete sie mit dem Finger auf die leichte Wölbung unter Maries Mantel. „Aber Ihr Kind frisst Sie auf. Sie müssen essen, auch wenn Ihnen übel ist. Die Übelkeit wird vorbeigehen. Warten Sie einen Moment.“ Die Nonne schloss die schwere Eichenholztür und verschwand im Gebäudeinneren.
Zitternd wartete Marie auf ihre Rückkehr. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete sich die Pforte erneut. Die Nonne hielt einen Sack in der Hand, dem sie einen versiegelten Krug entnahm.
„Das ist ein Sud aus Ingwer, Fenchel, Zitrone, Minze und Liebstöckel. Trinken Sie jeden Morgen ein Glas davon. Nach vierzehn Tagen werden Sie beschwerdefrei sein.“ Liebevoll lächelte sie Marie an. „Und jetzt gehen Sie, mein Kind. Machen Sie Ihrer Schwester und sich den Abschied nicht unnötig schwer. Heute trennen sich Ihrer beiden Wege. Vielleicht werden Sie sich eines Tages wiedersehen. Lotta hat uns berichtet, dass Sie in Begleitung einer weiteren Schwester reisen, die in einer unsittlichen Beziehung mit einem Mann lebt. Verlassen Sie die zwei. Reisen Sie allein weiter. Gott segnet jedes ungeborene Leben.“
Maries Augen füllten sich mit Tränen. Mit bebenden Fingern nahm sie den Krug an sich.
„Wo soll ich bloß hin?“ Eine erste Träne rann über ihr mageres Gesicht. „Anna und Franz möchten bald zum Bodensee aufbrechen.“
„Hier.“ Die Nonne langte in die Tasche ihrer Kutte. „Das ist eine Adresse in Wuppertal. Dort gibt es ein Mutter-Kind-Heim, dessen Leiterin ich gut kenne. Im Industriegebiet unseres von den Briten vor vier Jahren frisch gegründeten Nordrhein-Westfalen gibt es Perspektiven für Arbeit. Reisen Sie über Iserlohn. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.“ Sie machte mit der Hand das Kreuzzeichen, lächelte ein letztes Mal und ließ Marie in der hereingebrochenen Dunkelheit zurück.
„Du läufst in dein Unglück, Marie. Höre nicht auf die Worte einer religiösen Fanatikerin. Wie willst du allein nach Wuppertal gelangen?“, hallten Annas Worte in Maries Kopf nach. Sie stand am Ortsausgang und hielt den Griff des von der Bäuerin gestifteten Koffers in den Händen. Der Nebel des gestrigen Abends war einem klaren Morgenhimmel gewichen, der Hoffnung auf einen milden Tag erweckte. Mehrere Autos fuhren achtlos an der wartenden Frau vorüber. Zwei Stunden versuchte Marie bereits, sich bemerkbar zu machen. Niedergeschlagen überlegte sie, den Weg zurück zum Bauernhof anzutreten, als plötzlich ein hellblauer VW-Bus vor ihr zum Stehen kam. Drei grell geschminkte Frauen in bunten Kleidern blickten sie interessiert an. „Wer bist du denn, Mädchen?“, wollte eine dunkelhaarige Frau Mitte dreißig wissen, die das Steuer in den Händen hielt.
Unsicher lugte Marie ins Innere des Busses. Sie entdeckte allerlei Köstlichkeiten, die ihren Appetit jedoch nicht anregten, eine Matratze und Rotweinflaschen.
„Ich bin Marie Ansorge“, sagte sie schließlich leise.
„Hübsches Kind“, warf eine rothaarige, dralle Frau ein, die in der zweiten Reihe saß.
„Die Rote hinten heißt Carmen, ich bin Isabella, und unser Nesthäkchen ist Monique“, erklärte die Fahrerin. „Wohin führt dich dein Weg?“
„Ich möchte nach Wuppertal ins Mutter-Kind-Heim“, antwortete Marie leise.
„Hat dir einer ein Kind gemacht?“, wollte Carmen mit weit aufgerissenen Augen wissen. „Hier gibt’s Schafe genug. Wollte dir niemand aushelfen?“
„Schafe?“ Marie zuckte verständnislos mit den Schultern.
„Lass es gut sein, Carmen“, mischte sich wieder die Frau hinter dem Steuer ein. „Das ist keine von uns.“
„Aber sie steht hier und wartet darauf, dass ein Auto anhält“, entgegnete die jüngste der drei Frauen bissig.
„Nach Wuppertal fahren wir nicht, aber wenn du magst, nehmen wir dich bis nach Menden mit.“ Auffordernd öffnete Isabella die Beifahrertür.
Marie zögerte nur kurz. Mochten die drei Frauen ihr auch fremdartig erscheinen, in weiblicher Gesellschaft fühlte sie sich gut aufgehoben. Sie nickte zustimmend, und Monique, eine kleine Frau mit dünnen, blonden Haaren, sprang aus dem Gefährt, um ihr mit dem Gepäck zu helfen.
Kurze Zeit später zockelte der kleine Bus seines Weges.
„Hast du einen Führerschein?“, wollte Marie erstaunt wissen. „Wo ist dein Mann, der dir die Erlaubnis dazu erteilt hat?“
„Mein Mann?“, lachte Isabella. „Du bist ein Herzchen. Ich brauche weder Ehemann noch Führerschein, um zu überleben.“
„Männer brauchst du wohl, Bella“, sagte Carmen augenzwinkernd.
„Kerle meinst du“, erwiderte Isabella gelassen. „Mache unsere Mitfahrerin nicht verlegen. Sie hat ja keine Ahnung von unserem Broterwerb.“
Langsam wurde es Marie mulmig, und diesmal lag das nicht an ihrer Schwangerschaft. Der Dunst von Rotwein lag in der Luft, und es roch nach Schweiß.
„Was hast du mit den Schafen gemeint, Carmen?“, wollte sie trotz allem neugierig wissen.
„Mit Schafdarm kannst du den…“, begann die Gefragte, wurde jedoch energisch von Isabella unterbrochen.
„Mädchen, du weißt, wie du zu dem kleinen Wesen in deinem Bauch gekommen bist?“, fragte sie behutsam, und Marie nickte.
„Es war mein erstes Mal.“ Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
„Wurde dir etwa Gewalt angetan?“, wollte Carmen wissen.
Marie schüttelte den Kopf, fasste sich ein Herz und erzählte Rolfs und ihre Geschichte.
„Du musst Geld dafür nehmen, dass so ein Bock über dich steigen darf“, ereiferte sich Monique. „Aber so sind die Mannsbilder. Junge, unschuldige Mädchen sind besser als wir und zudem noch umsonst zu kriegen.“
„Seid ihr etwa …“, Marie stockte verlegen.
„Ja“, entgegnete Carmen bitter. „Wir sind Huren, Nutten, Prostituierte. Was glaubst du, was im Krieg passiert wäre, hätten wir unsere Arbeit nicht gemacht? Etliche Frauen wurden vielleicht verschont, weil die blutrünstigen Russen uns besucht haben.“
„Carmen, jetzt gib dem Mädchen was zu essen und schenke ihr Wein ein, damit die Farbe in ihr Gesicht zurückkehrt“, ordnete Isabella an.
Gehorsam trank Marie und aß etwas kalten Braten und ein Stück Brot. Zu ihrer Überraschung behielt sie alles bei sich, und Wärme breitete sich in ihr aus. Obwohl es erst später Vormittag war, sank sie auf dem Beifahrersitz in tiefen Schlaf.
Wortfetzen durchdrangen Maries Träume.
„Was machen wir mit ihr?“, hörte sie eine wohlklingende Frauenstimme fragen. „Wir können sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen.“
„Wir sind Huren, keine Samariterinnen“, entgegnete eine schnippische Stimme. „Wir haben am Abend viel zu tun, vergesst das nicht.“
„Ich frage Madame Bluret, ob das Kind für eine Nacht ein Zimmer bekommen kann“, sagte wieder die angenehme Frauenstimme.
Marie schlug die Augen auf. Sie hatte einen schalen Geschmack im Mund, und ihr Kopf brummte.
„Ich habe Durst“, machte sie sich unsicher bemerkbar und blickte sich um. Jemand musste ihr den Mantel ausgezogen und als Decke übergelegt haben. Das dicke Tuch, das ihren Kopf vor Wind und Wetter geschützt hatte, lag neben ihr.
„Du verträgst nichts“, kicherte die Frau mit den roten Haaren. Carmen, erinnerte sich Marie vage. „Zwei Gläser Rotwein und schon sinkst du in einen Dornröschenschlaf.“ Sie reichte Marie eine Flasche mit Wasser.
„Wo sind wir hier?“, wollte Marie wissen, nachdem sie ihren Durst gelöscht hatte.
Die Sonne schien durch die Fenster des VW-Busses und belebte ihre Sinne.
„Das ist das Rathaus von Menden“, erklärte Isabella und zeigte auf ein unversehrtes, helles und mehrstöckiges Gebäude, dessen Turm und Torbögen mit goldenem Stuck geschmückt waren.
„Danke fürs Mitnehmen“, sagte Marie und griff nach ihrem Koffer und dem Kopftuch. „Ich werde sehen, ob mir jemand Obdach gewährt. Dafür bin ich bereit zu arbeiten.“
„Warte, Mädchen“, mischte sich Isabella ein. Sie blickte in den Rückspiegel, seufzte und fuhr sich durch die dunklen Locken. „Ich hoffe, die Wellen halten den Tag und die Nacht durch.“
„Später sind die Kerle zu betrunken, um sich an deinen Haaren zu stören“, bemerkte Monique lakonisch.
„Jedenfalls, Marie, du kommst mit uns zur Fröndenberger Straße“, erklärte Isabella resolut. „Mache dir keine Sorgen. Du wirst mit den alten Säcken nichts zu tun bekommen. Madame Bluret hat das Herz auf dem rechten Fleck, du wirst sehen.“
Es dauerte nicht lang, bis das Gefährt vor einem mittelgroßen, unscheinbaren Gebäude zum Stehen kam. Isabella hupte dreimal, und Sekunden später trat eine dicke, dunkelhäutige Frau ins Freie. Aufgrund ihrer Körperfülle schien ihr das Gehen Schwierigkeiten zu bereiten. Sie erinnerte Marie an einen watschelnden Pinguin. Die Prostituierten verließen den Bus, und Marie tat es ihnen nach. Sie schwitzte unter ihren Wintersachen. Für den sich ankündigenden Sommer benötigte sie dringend leichtere Bekleidung.
„Das ist nicht euer Ernst“, entfuhr es der dicken Frau entsetzt. Sie wackelte auf Marie zu und kniff ihr in die Wange. „Dieses magere Vögelchen muss erst gemästet werden, bevor ein Mann an ihr Gefallen findet. Wo habt ihr die aufgegabelt?“
„Madame Bluret, lassen Sie mich kurz erklären“, bat Isabella rasch und zog sie von Marie weg. Eine Weile tuschelten die beiden miteinander. Madame Bluret schien hin und her gerissen zu sein. Schließlich zuckte sie ergeben mit den runden Schultern.
Wenig später fand sich Marie entkleidet in einem blau gekachelten Raum wieder, in dessen Mitte eine rosafarbene Badewanne stand. Zwei kichernde Frauen, ungeschminkt, in einfachen Kitteln, ließen dampfendes Wasser in die Wanne laufen.
„Steig rein“, forderte die jüngere der beiden Marie auf. Diese kam der Aufforderung nur zu gerne nach und kletterte hinein. Die sie umgebenden Dampfschwaden rochen nach einer Mischung aus Lavendel und Zitrone. Wohlig ließ sie es zu, dass die Frauen ihre Haare wuschen.
„Seid ihr auch Prostituierte?“, fragte sie nach einer Weile.
„Aber nein“, entgegnete die Ältere belustigt. „Ich bin Janna, und das ist meine Schwester Stine. Wir sind Madame Blurets Mädchen für alles. Eine schöne Arbeit ist das. Viel Geld bringt sie uns nicht, aber wir haben weiche Betten, volle Bäuche und saubere Anziehsachen. Sollen wir dich waschen, oder möchtest du dich selbst säubern?“ Fragend reichte Janna, eine Frau mit Pockennarben und klaren, fröhlichen Augen, ihr ein Stück Kernseife und einen Schwamm.
„Ich mache das schon“, sagte Marie bereitwillig.
„Du bist guter Hoffnung“, bemerkte Stine, äußerlich mit ihren runden, glatten Wangen und den hinter dicken Brillengläsern versteckten Augen das komplette Gegenteil der älteren Schwester. „Möchtest du für Madame Bluret arbeiten, bis dein Bauch zu dick sein wird?“
„Um Himmels Willen, nein“, rief Marie entsetzt, während sie sich ausgiebig schrubbte. „Ich möchte nach Wuppertal ins Mutter-Kind-Heim.“
„Schade, dass du, wenn du wieder Speck auf den Rippen hast, zu hübsch sein wirst, um hier wie wir als Dienstmädchen zu arbeiten. Du wärest eine nette Gesellschaft“, sagte Janna bedauernd.
„Zum Glück sind wir zu hässlich, um als Huren durchzugehen“, warf Stine grinsend ein. „Madame Bluret ist gut zu uns. Und zu dir auch. Schau“, sie deutete mit der Hand auf ein luftiges, langärmliges, dunkelrotes Kleid. „Sie hat uns aufgetragen, dir frische Sachen bereitzulegen, die du behalten darfst. Und jetzt beeile dich. Wir sollen dich in die Küche begleiten, damit du was Anständiges zu dir nimmst, bevor wir dich in einem abgelegenen Zimmer verstecken. Heute Abend feiert Madame Bluret ihren Geburtstag. Hier wird der Bär los sein.“
Hoffnungsschimmer
Mai 1951 - Oktober 1951
„Schwester Magdalena, Gitte schläft“, flüsterte Marie der Ordensschwester mit den sanften dunklen Augen zu. „Darf ich wirklich gehen?“
Schwester Magdalena nickte wohlwollend. Sie hatte die aus Oberschlesien angereiste junge Frau ins Herz geschlossen. Ihre Ordensschwester aus Winterberg hatte Marie Ansorge das Elisabethheim empfohlen. Hier hatte man sich der noch minderjährigen werdenden Mutter angenommen. Die junge Frau hatte der Nonne von ihrer aufregenden Reise berichtet. Eine Madame Bluret, über die die Ordensfrau lieber nicht nachdenken mochte, hatte ihr das Geld für die Zugfahrt von Menden nach Wuppertal gegeben.
Am dreißigsten November 1950 war Gitte Ansorge auf die Welt gekommen. Obwohl erstgebärend, war die Geburt komplikationslos verlaufen. Einen Monat später war Marie zwanzig geworden. Bereitwillig hatte sie akzeptiert, dass die Nonnen die Vormundschaft übernommen hatten, nicht nur für Marie, sondern auch für Gitte.
„Bleib bei Angela, und sei pünktlich um zehn Uhr zurück.“ Schwester Magdalena umfasste Maries zartes Handgelenk und geleitete sie zur Tür, die vom Kinderschlafsaal zum Flur führte.
Als Marie das Mutter-Kind-Heim verließ und in die Maisonne trat, erwachten ihre Lebensgeister. Zum ersten Mal, seit sie die Mutter in Eisenach verlassen hatte, fühlte sie sich lebendig und frei. Das von Madame Bluret gestiftete rote Kleid hatte sie enger gemacht, sodass es ihre zierliche Figur betonte. Aus dem restlichen Stoff hatte sie ein Tuch genäht, das ihre blonden Locken aus der Stirn hielt. Sie bemerkte Angelas neidvollen Blick. Im Gegensatz zu Marie kämpfte diese gegen ihre Schwangerschaftspfunde. Seit Kurzem hatte sie einen Freund, der sogar ein Auto besaß. In dieses stiegen die zwei Frauen ein, und Hans-Jürgen kutschierte sie stolz zum Tanzlokal Richter in der Beek.
Aufgeregt betrat Marie das Fachwerkhaus. Die weit aufstehenden Fenster ließen die laue Sommerluft ins Innere. Darüber war sie froh, denn es roch nach Zigarettenrauch und abgestandenem Bier. Eine Tapete in Zierfliesenoptik, mit floralem Muster und sogar Reitern auf Pferden, schmückte die Wände. Auf der kleinen, erhöhten Bühne spielte eine Jazz-Kapelle zum Tanz auf. Schüchtern sah sich Marie um. Ihre Begleiterin grüßte fröhlich in die Menge, und plötzlich fühlte sie sich wie ein fünftes Rad am Wagen.
„Angela, ich sehe nirgendwo einen freien Sitzplatz“, sagte sie eingeschüchtert zu der drallen Halbitalienerin.
„Du sollst tanzen, nicht sitzen“, erwiderte diese, und Hans-Jürgen umfasste ihre Hüfte und drehte sie im Kreis.
„Auf dem Stehtisch dort hinten habe ich unsere Getränke platziert.“ Er deutete mit dem Finger auf einen Tisch etwas entfernt von der Kapelle. „Ich habe dir ein Glas Wein ausgegeben, damit du lockerer wirst.“ Er lachte und machte sich mit Angela auf den Weg zur Tanzfläche. Marie war der rothaarige Mann mit dem hageren Gesicht unsympathisch. Sie würde sich nicht mit einem fünfzehn Jahre älteren Mann einlassen, da konnte er noch so reich sein.
Vorsichtig nippte sie an dem schweren Rotwein. Sie erinnerte sich nur zu gut an die Fahrt im VW-Bus der Prostituierten und an die Wirkung, die das alkoholhaltige Getränk auf sie gehabt hatte. Auf einmal hörte sie lautes Gelächter hinter ihrem Rücken. Irritiert drehte sie sich um. Ein Mann, der in ihrem Alter zu sein schien, hielt sich vor Lachen den Bauch. Dabei schaute er genau in ihre Richtung. Ihre Blicke trafen sich, und das Lachen ebbte ab. Er wurde gar ernst, und Marie errötete. Rasch wandte sie sich ab und ihr Augenmerk erneut dem Weinglas zu. Nur wenige Sekunden später spürte sie eine Hand auf ihrer Schulter. Erschrocken zuckte sie zusammen.
„Ich wollte Sie nicht erschrecken“, hörte sie eine angenehm tiefe Männerstimme sagen. Leicht bewegte sie den Kopf zur Seite und versank in braunen, von dichten Wimpern umrahmten Augen. „Werner Roth“, stellte sich der Mann vor. Er trug eine enge, graue Stoffhose und ein schlichtes, weißes Hemd. „Ich habe Sie nie zuvor hier gesehen. Sie wären mir im Gedächtnis geblieben. Darf ich fragen, wie Sie heißen?“
„Marie Ansorge“, antwortete sie schüchtern.
„Möchten Sie tanzen?“, fragte Werner freundlich.
„Nein, bitte nicht“, erwiderte Marie. In ihrem bisherigen Leben war kein Platz für Tanz gewesen, und sie hatte Angst davor, sich zu blamieren.
„Lediglich eine halbe Stunde haben wir dich allein gelassen, und schon hat Werner ein Auge auf dich geworfen“, sagte Hans-Jürgen lachend und klopfte Werner kameradschaftlich auf die Schulter.
Augenblicklich rückte Marie ein Stück von Werner ab. Jemanden, der mit Hans-Jürgen befreundet war, wollte sie nicht näher kennenlernen.
„Es ist eine Schande, dass es solange dauerte, bis ich die schönste Frau des Abends bemerkt habe“, konterte Werner. „Leider verwehrt sie mir das Vergnügen eines Tanzes.“
„Die kann nicht tanzen“, mischte sich Angela hämisch ein. Maries Schönheit war ihr ein Dorn im Auge. „Sie ist ein Flüchtlingsmädchen aus Oberschlesien. Statt zu tanzen, musste sie Ställe ausmisten.“
„Das sieht man den zarten Händen nicht an“, bemerkte Werner und zwinkerte Marie zu.
Die freundliche Geste und die netten Worte wärmten ihr Herz.
„Darf ich Ihnen ein weiteres Glas Wein ausgeben?“, erkundigte er sich höflich, auf das von Marie halb geleerte Glas deutend.
Sie zögerte kurz, rang sich ein Lächeln ab und nickte schließlich zustimmend.
Der Abend verging wie im Flug. Viel zu früh musste Hans-Jürgen die zwei Frauen zurück ins Mutter-Kind-Heim bringen.
„Ich komm gleich wieder, Werner“, sagte er augenzwinkernd. „Hast du Lust auf eine Partie Skat?“
„Wenn du dich traust, mit mir zu spielen…“, feixte der Angesprochene und nahm einen großen Schluck Bier. Seine Wangen waren bereits vom Alkohol gerötet, und er roch leicht nach Schweiß, als er Marie zum Abschied die Hand reichte. „Ich werde Sie Mittwoch nach der Arbeit zum Spaziergang abholen, Marie.“