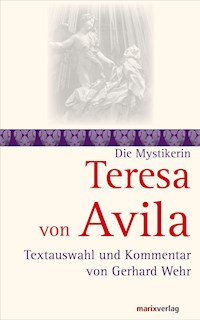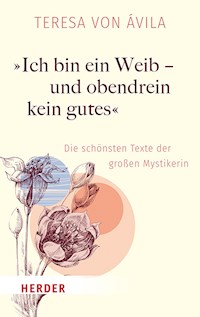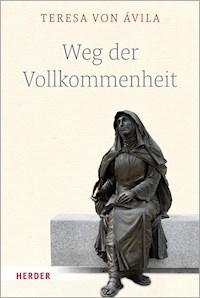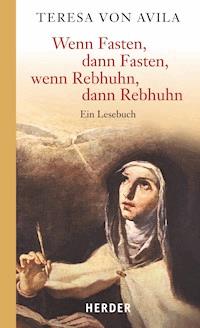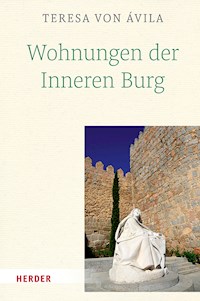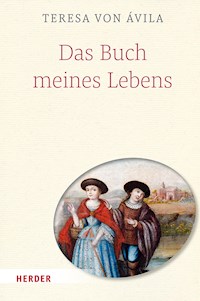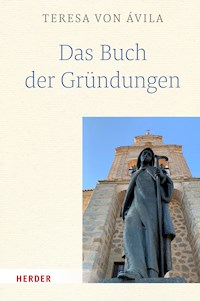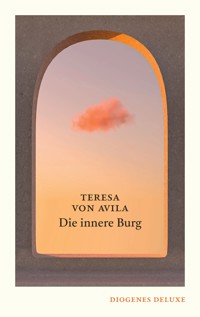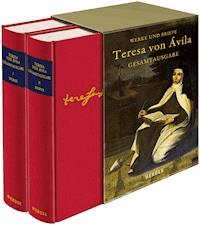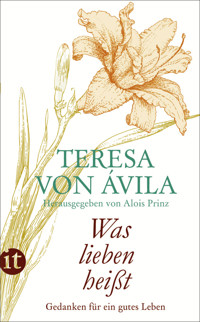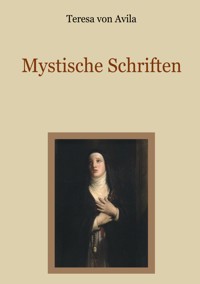
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Nichts soll dich ängstigen; nichts dich erschrecken! Alles vergeht; Gott bleibt derselbe; Geduld erreicht alles. Wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen; Gott nur genügt." - Teresa von Avila. Der Weg zur Veredlung der menschlichen Seele, das "Wie?" und "Wohin?" hat die heilige Autorin vor über 450 Jahren in ausführlichen Schriften dargelegt, welche in dem vorliegenden Band vereinigt sind. Vom Geist der ewigen Wahrheit erfüllt, sollen sie auch heute dem suchenden Christen als Leitung zur liebenden Gottheit dienen. In diesem Buch sind enthalten: 1. Die Seelenburg. 2. Gedanken über die Liebe Gottes. 3. Rufe der Seele zu Gott. 4. Weg der Vollkommenheit. 5. Leitsätze und Denksprüche. 6. Ermahnungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 859
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Seelenburg – Gedanken über die Liebe Gottes – Rufe der Seele zu Gott – Weg der Vollkommenheit – Leitsätze – Denksprüche – Ermahnungen
Aus dem Spanischen
übersetzt
von
P. Aloysius Alkofer,
O. Carm. Disc.
Schätze der christlichen Literatur Band 39
Nichts soll dich ängstigen; nichts dich erschrecken!
Alles vergeht; Gott bleibt derselbe; Geduld erreicht alles.
Wer Gott besitzt, dem kann nichts fehlen; Gott nur genügt.
– Teresa von Avila
Inhalt.
Vorwort.
Einführung.
1. Die Seelenburg.
2. Gedanken über die Liebe Gottes.
3. Rufe der Seele zu Gott.
4. Weg der Vollkommenheit.
5. Leitsätze und Denksprüche.
6. Ermahnungen.
Vorwort.
DIE „Seelenburg“, auch Buch der „Wohnungen“ genannt, ist wohl eines der schönsten literarischen Werke, die je menschliche Intelligenz hervorgebracht hat. Sie ist ein Meisterwerk der Mystik und auch das Meisterwerk der heiligen Theresia. In anschaulicher Weise macht sie uns mit den Gunstbezeigungen Gottes vertraut, die zur Rechtfertigung und Heiligung der Seele führen, und belehrt uns über den Fortschritt der schon begnadigten Seele bis zur höchsten Entfaltung des geistlichen und mystischen Lebens, die in der umgestaltenden Liebe Gottes, im Einwirken der Gaben des Heiligen Geistes, in den übernatürlichen Tugenden und Vollkommenheiten begründet ist. Aus diesem Grunde ist gerade dieses Werk der Heiligen so gesucht von allen, die dem Gnadenwalten Gottes in der Seele des Menschen verständnisvoll gegenüberstehen. Und wenn Dr. Joseph Pieper in einer Rezension des „Lebens“ der Heiligen sagt: „Niemand kann die Frage Was ist der Mensch? auch nur annähernd beantworten, der nichts von den mystischen Möglichkeiten weiß“, so lenkt er damit das Augenmerk der gottsuchenden Seele gerade auf die mystischen Werke der Heiligen, und nicht zuletzt auf die „Seelenburg“, in der wir noch in höherem Maße als im „Leben“ einen „überlegenen und klarsichtigen Wegweiser zum Seinskern des wahren christlichen Lebens“ finden.
Möge nun die „Seelenburg“ viele heilsbegierige Leser finden und ihnen reichen Nutzen bringen für ihr eigenes Seelenleben sowie auch zur Leitung anderer ihnen anvertrauten Seelen!
Regensburg, 16. Juli 1937.
Einführung.
I. Seelenburg.
ES war im Frühjahr 1577. Die heilige Theresia befand sich eben in Toledo. Pater Gracián O.C.D., damals Apostolischer Kommissar und damit auch der Obere der Karmeliten, unterhält sich mit der heiligen Mutter im Sprechzimmer der Karmelitinnen von Toledo über Fragen des geistlichen Lebens. Die Heilige weist bei dieser Gelegenheit darauf hin, daß sie über diesen und jenen Punkt schon ausführlich in ihrer Autobiographie geschrieben habe. Wohl, meinte darauf Pater Gracián; doch da jenes Buch (das „Leben“) von der spanischen Inquisition zurückgehalten werde und infolgedessen nicht gelesen werden könne, werde es gut sein, wenn sie über diese Dinge ein neues Buch schriebe, ohne darin sich selbst zu nennen.
Die Heilige wehrte sich gegen dieses Ansinnen und meinte: „Warum soll ich über so erhabene Dinge schreiben? Das ist Sache der Theologen; sie haben darüber Studien gemacht. Es gibt ohnehin schon so viele Bücher, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Ich bin dazu völlig ungeeignet usw.“
Doch Pater Gracián bestand auf seinem Wunsch und wies den Einwand, daß darüber gelehrte Theologen schreiben sollten, zurück mit dem Hinweis, daß sie, die Heilige, auf diesem Gebiet besondere Erfahrung habe, und daß darum das, was sie aus eigener Erfahrung darüber sagen könne, weit nützlicher sei und besser verstanden werde, als was gelehrte Doktoren aus Büchern zusammentragen.1
Als bald danach auch Dr. Velásquez Domherr von Toledo und damals Beichtvater der Heiligen, dem Theresia das Ansinnen bzw. den Auftrag des Paters Gracián unterbreitete, diesen Auftrag unterstützte, beugte sich die Heilige dem höheren Willen ihrer Oberen; und obwohl an Jahren schon weit vorgerückt – sie zählte damals 62 Jahre –, von Krankheiten geschwächt und von Arbeiten aller Art überhäuft, machte sie sich daran, den ihr gegebenen Auftrag auszuführen.
Dies der Anstoß zum Buche: Die „Seelenburg.“
Als nun die Heilige am Vorabend des Festes der Heiligsten Dreifaltigkeit darüber nachsann, was sie zum Gegenstand ihrer Schrift nehmen sollte, da gab ihr Gott selbst den Fingerzeig dazu. In einer wunderbaren Vision ließ er seine treue Dienerin folgendes schauen: Etwas wie eine Burg, aus leuchtendem Kristall aufgebaut, erhob sich vor ihren staunenden Augen. In dieser Burg waren deutlich verschiedene Abteilungen oder Wohnungen zu erkennen. In der innersten dieser Wohnungen thronte der König der ewigen Herrlichkeit, dessen strahlender Glanz die Wohnungen dieser Burg durchdrang und ihnen unsagbare Schönheit verlieh. Dieses himmlische Leuchten war aber nur im Inneren der Burg zu gewahren; außerhalb derselben war alles in Dunkel gehüllt, voll Schmutz und Natterngezücht und giftigem Gewürm. Darin erkannte die Heilige die Schönheit einer Seele, die im Stande der Gnade ist. Gleich darauf änderte sich das Bild: Das Licht verschwand, und ohne daß der Herr der Glorie die Wohnung verließ, verdunkelte sich der Kristallpalast und ward schwarz und unsagbar häßlich; und das Natterngezücht und das Gewürm, daß zuerst außerhalb der Burg war, kroch ins Innere derselben. Dieses zweite Bild faßte Theresia auf als ein Sinnbild von der Häßlichkeit der Seele im Stande der Sünde.2
Das Geschaute nahm nun Theresia zur Grundlage für ihre Schrift, zu deren Abfassung sie gleich am folgenden Tage, dem Feste der Heiligsten Dreifaltigkeit, 2. Juni 1577, in Toledo schritt3, und die sie nach einer Unterbrechung von mehreren Monaten – sie siedelte im Juli des gleichen Jahres in das Josephskloster nach Avila über und konnte sie erst im Oktober wieder fortsetzen – am 29. November 1577 in Avila vollendete.4 Sie betitelte diese Schrift: „Castillo Interior“ („Innere Burg“ oder, wie es gewöhnlich im Deutschen wiedergegeben wird, „Seelenburg“) oder auch „Moradas“ (Wohnungen).
Wir brauchen uns nicht darüber zu wundern, daß Theresia in so kurzer Zeit das äußerst schwierige und heikle Thema, das in der „Seelenburg“ behandelt wird, so meisterhaft und restlos löste. Abgesehen von ihrer reichen Erfahrung auf dem Gebiete des mystischen Erlebens, offenbart sich darin auch wieder ihr großes Genie. Und außerdem lag der Inhalt bzw. der Grundbau dieses Werkes schon seit vielen Jahren im Bereich ihres Gedankengutes. Schon in frühen Jahren, erzählt sie uns selbst, hat auf sie eine Stelle des Evangeliums, nämlich die Worte: „Intravit Jesus in quoddam castellum“, einen besonderen Eindruck auf ihr Gemüt gemacht. Und als sie später (um 1556) sich mit der Lektüre des damals in geistlichen Kreisen geschätzten Werkes des Franziskaners Bernardin de Laredo: „Subida al Monte Sion“ beschäftigte und darin unter anderem las, daß die Wohnung Gottes in der Seele des Gerechten gleich sei einer festen Burg, aus Diamanten und Edelsteinen erbaut, da hatte dieses Bild vom Wohnen Gottes in der Seele wie in einer Burg in der Phantasie Theresias schon greifbare Gestalt angenommen. Bereichert und ausgeschmückt mögen diese Vorstellungen noch geworden sein durch die Überreste und Erinnerungen aus ihrer jugendlichen Beschäftigung mit Romanlektüre von Ritterkämpfen und Ritterburgen. Und so fließt das romantische und mystische Element in diesen Vorstellungen in eins zusammen. Dazu kam, daß sie um das Jahr 1565 eine Vision hatte, in der sie die Seele in Form eines Spiegels schaute, der nach allen Seiten wie eine Lichtkugel sein Licht ausstrahlte, und im Mittelpunkt derselben Christus, thronend in herrlichem Glanze. So berichtet die Heilige selbst in ihrem „Leben.“ Und wiederum schreibt sie im „Weg der Vollkommenheit“ (Kap. 3.), also gleichfalls um 1565, von dem König, der sich in die Festung zurückzieht, während die Feinde ins Land eindringen. Im 29. Kapitel des gleichen Werkes führt sie diesen Gedanken noch weiter aus, wenn sie die Seele als Wohnung Gottes mit einer Burg vergleicht, die aus lauterem Gold und kostbaren Edelsteinen erbaut ist und darum wahrhaft würdig des großen Königs, dem sie zu eigen. Ausdrücklich fügt sie hier noch bei: „Dieser Palast, diese Burg ist eure Seele; wenn die Seele rein und mit Tugenden geschmückt ist, so gibt es keinen auch noch so herrlichen Palast, der mit ihr verglichen werden könnte … Und darin wohnt der König der Herrlichkeit.“ – Im Jahre 1572 nimmt die Heilige wiederum diesen Gedanken auf, wenn sie in den „Rufen der Seele“ (16) von dieser Festung spricht und von dem, der sie bewohnt. Eine weitere Anspielung auf diesen Gedanken finden wir schließlich um das Jahr 1577, kurz vor Abfassung der „Seelenburg“, wenn sie in einem Liede singt: „Eres mi casa y morada!“ („Meine Burg bist du und mein Gezelt!“)
Die Idee also, die diese wunderbare Schrift, die „Seelenburg“, durchdringt und trägt, ist schon lange vorher in ihrer Seele lebendig gewesen. Darum ist auch die „Seelenburg“ nicht ein künstlich aufgebautes Gebilde, wie so manche ähnliche Werke über das übernatürliche Seelenleben, sondern ist von Anfang bis zum Ende erlebt, ist aus ureigenem seelischen Erleben herausgewachsen.
Das Bild von der Burg mit den verschiedenen Abteilungen oder Wohnungen bildet das alle Teile dieser Schrift einigende und umschlingende Band und ist für die heilige Verfasserin der Ausgangspunkt zu ihrer Abhandlung über das höhere Gnadenleben. In ihr sehen wir die Seele stufenweise die einzelnen Wohnungen durchschreiten und sich wandeln von einer unvollkommenen, ja sündigen Seele, wie sie anfangs ist, zur auserlesenen Braut des Herrn, die, mit dem Geschmeide ihrer Tugenden geziert, das Auge des göttlichen Bräutigams entzückt, der mit ihr, im Innersten dieser Wohnung weilend, die mystische Vermählung vollzieht. Und der Schlüssel zu dieser Burg und zu den einzelnen Wohnungen ist das Gebet, dessen verschiedene Stufen, Eigenschaften und Wirkungen die Heilige im Verlauf der Schrift in einzigartiger Weise schildert, mit einer geradezu bezaubernden Schönheit von Bildern und Vergleichen und mit einer Gedankentiefe, wie sie eben nur der heiligen Theresia zu eigen ist und vergeblich bei anderen mystischen Schriftstellern gesucht wird.
Die Einteilung der „Seelenburg“ in sieben ungleich große Abschnitte entsprechend den sieben Wohnungen der Burg, hat wiederum zur Grundlage die sieben Stufen des Gebetes, welche die Seele durchwandeln muß, um zum inneren Gemach der Burg zu gelangen. Das Ganze zerfällt, wie im „Weg der Vollkommenheit“, in zwei größere Teile, deren einer die aktiven Wege der Seele, d. i. das aktive oder diskursive Gebet (1. bis 3. Wohnung), der andere die passiven Wege oder das beschauliche Gebet (4. bis 7. Wohnung) behandelt.
Der große Wert dieser Schrift liegt darin, daß die heilige Verfasserin in erhabenerem Schwung der Ideen und zugleich mit größerer Klarheit und Genauigkeit als in ihren anderen Werken in ihr das Wesen und die Wirkungen des gewöhnlichen und übernatürlichen Gebetes mit seinem Gefolge von göttlichen Gaben und Tugenden und außerordentlichen Gnadenerscheinungen aufzeigt. Hat sie es doch geschrieben, als sie Dank der göttlichen Gnadenerweise viel reichere Erfahrungen auf dem Gebiete des übernatürlichen Seelenlebens gesammelt hatte und auch das Material der Darstellung mit größerer Meisterschaft beherrschte. Darum dürfte gerade die „Seelenburg“ wohl unter allen Werken, die zu dieser Frage erschienen sind, das wertvollste und wichtigste sein. Und es ist infolgedessen auch, wie ein bedeutender zeitgenössischer Mystiker, Pater Arintero O. Pr., eingesteht, für alle späteren Autoren auf diesem Gebiet zur Norm und Grundlage geworden; denn Theresia hat es verstanden, in das Chaos der Anschauungen und Begriffe vom übernatürlichen Seelenleben durch ihre klare Sprache wundervolle Ordnung zu bringen.
Über das Schicksal dieser unschätzbaren Handschrift, die gegenwärtig im Karmelitinnenkloster von Sevilla aufbewahrt wird, wissen wir, daß die Heilige sie dem Pater Hieronymus Gracián zur Aufbewahrung übergab, um sie vor dem Zugriff der Inquisition zu retten. Von Pater Gracián ging sie in die Hände der Schwester Maria vom heiligen Joseph, Priorin von Sevilla, über; und die Schwestern von Sevilla waren von da an, mit Ausnahme weniger Jahre, die treuen Hüterinnen dieses kostbaren Schatzes. 1587 wurde die Handschrift der ehrwürdigen Schwester Anna von Jesus übergeben, die damals die Schriften der heiligen Mutter für Pater Ludwig de León O.S.A. sammelte, der die erste Gesamtausgabe derselben vorbereitete. Nach Vorbereitung dieser Ausgabe schenkte Pater Gracián die Handschrift einem gewissen Don Pedro Cerezo Pardo, einem der größten Wohltäter der karmelitanischen Reform. Als im Jahre 1617 dessen Tochter Katharina im Kloster der Karmelitinnen von Sevilla den Schleier nahm, brachte sie außer einer reichen Mitgift auch die Handschrift der „Seelenburg“ als köstliche Morgengabe mit, wo sie dann auf Kosten einer anderen eintretenden Novizin, Doña Johanna de Mendoza, Tochter des Herzogs von Béjar, den ihrem inneren Wert gebührenden Einband: Beleg mit silbergetriebenen Platten mit vergoldetem Schmuck und Emailverzierungen, erhielt.
Im Druck erschien die „Seelenburg“ zum erstenmal in Salamanka 1588 in der schon erwähnten Gesamtausgabe der Schriften der Heiligen Theresia durch Ludwig de León, die dann schon im Laufe der folgenden Jahre wiederholt aufgelegt wurde. eine besonders wertvolle Einzelausgabe der „Seelenburg“ ward im Jahre 1882, anläßlich der dritten Zentenarfeier des Todestages der Heiligen, durch Kardinal Joachim Lluch O. Carm., Erzbischof von Sevilla, bewerkstelligt.
II. Gedanken über die Liebe Gottes.
NAHE Verwandtschaft mit der „Seelenburg“ verrät das Schriftchen „Gedanken über die Liebe Gottes“ (Conceptos del amor de Dios). Es sind dies Erwägungen zu einigen Stellen des Hohenliedes. Wie in der „Seelenburg“, dem „Leben“ und dem „Weg der Vollkommenheit“ ist auch in dieser kleineren Schrift die Grundeinstellung der Heiligen ein näheres Eingehen auf das Wesen der höchsten Stufen der Beschauung. Auch dieses Werkchen ist wie die übrigen in erster Linie an die geistlichen Töchter der großen Reformatorin gerichtet, um sie zu noch größerem Streben nach Vollkommenheit anzuspornen.
Beim täglichen Breviergebet stieß die Heilige oft auf Stellen aus dem Hohenliede, die, freilich für den gewöhnlichen Laien unverständlich, auf Theresia stets, als der Ausdruck der bräutlichen Liebe zwischen Christus und der Seele dank einer besonderen Erleuchtung Gottes erfaßt, einen tiefen Eindruck machten und in ihrer von der göttlichen Liebe glühenden Seele den besten Wiederhall fanden. In diesem Sinne wollte denn auch die Heilige diese Stellen aufgefaßt und von ihren geistlichen Töchtern erfaßt wissen.
Nach einer kurzen Einleitung legt die heilige Verfasserin in sieben Kapiteln die mystischen Erwägungen dar, welche die biblischen Worte ihr nahelegten.
Über die Zeit des Entstehens dieser Schrift wissen wir nichts Bestimmtes. Jedenfalls wird deren Abfassung, soweit aus einigen Bemerkungen der Verfasserin zu entnehmen ist, in die Jahre 1571 bis 1573 zu setzen sein.
Die Originalhandschrift dieses Werkchens existiert leider nicht mehr. Der Dominikaner Pater Yanguas, ihr damaliger Beichtvater, dem Theresia die Schrift zur Einsicht unterbreitete, befahl ihr nämlich, dieselbe zu verbrennen, mit der Begründung, es gezieme sich nicht für eine Frau, Erwägungen zum Hohenliede anzustellen oder gar zu schreiben. Und die Heilige, gehorsam wie immer, verbrannte sofort das Original. Doch hatten ihre geistlichen Töchter, freilich ohne Wissen der heiligen Mutter, schon verschiedene Abschriften, mit größerer oder geringerer Genauigkeit, hergestellt. Und so ist uns die Schrift dank dieser Abschriften erhalten geblieben, wie solche in Alba de Tormes, in Baeza, Consuegra und in der Nationalbibliothek von Madrid (herstammend von dem Einsiedlerkloster der Karmeliten von Ronda) aufbewahrt werden.
Die „Gedanken über die Liebe Gottes“ erschienen zum erstemal im Druck, und zwar im spanischen Original, in Brüssel im Jahre 1611, mit Einleitung und Anmerkungen des Paters Hieronymus Gracián, der 1607 nach Flandern gekommen war und dort, wie schon vorher in Italien, sich eifrig um die Veröffentlichung der Werke der heiligen Theresia bemühte. Diese Ausgabe, die schon im folgenden Jahre neu aufgelegt wurde, bildete dann in den kommenden Jahren, aber ohne die Einleitung und Anmerkungen des Paters Gracián, die Vorlage zur wiederholten Neuausgabe derselben in Verbindung mit den Gesamtschriften der Heiligen.
III. Rufe der Seele zu Gott.
DIESE „Rufe der Seele“ sind der Aufschrei der von der göttlichen Liebe wunden Seele in jenen erhabenen Augenblicken, da der göttliche Bräutigam in der heiligen Kommunion sich aufs Innigste mit ihr vereinigt hat. Sie verdanken nämlich ihr Entstehen dem Herzensbedürfnis Theresias, ihren Gefühlen der Liebe und Hingebung an den göttlichen Geliebten, von denen ihr Herz in den Augenblicken nach der heiligen Kommunion übervoll war, Ausdruck zu geben. Sie hätte in solchen seligen Stunden der innigsten Vereinigung mit ihrem göttlichen Bräutigam wie die Braut im Hohenliede durch die Straßen und Plätze der Stadt eilen und allen von ihrem übergroßen Glück der Liebe zu Christus erzählen mögen. Da sie dies nicht konnte, mußte sie diesen ihren Gefühlen höchster Wonne, ihren Klagen ob des allzulangen Weilens auf dieser Welt, fern vom Geliebten, ihrem leidenschaftlichen Verlangen nach immerwährendem Vereintsein mit ihm, ihrem Flehen nach baldigem Aufgelöstwerden in Christus, wenigstens auf dem Papiere Ausdruck verleihen. So sind diese Prunkstücke katholischer Mystik entstanden, die an lyrischem Schwung und Schönheit der Sprache, an Innigkeit der Liebe nicht mehr ihresgleichen haben in der gesamten mystischen Literatur.
Auch über die Zeit des Entstehens dieses Schriftchens wissen wir nichts sicheres. Allein da diese „Rufe“ auf der gleichen Linie liegen wie ihr bekanntes Lied: „Ich sterbe, weil ich nicht sterben kann“, das wohl in die Zeit der mystischen Verlobung Theresiens mit Christus zu setzen ist, also in die Jahre 1569, 1570, so dürfte wohl auch diese Schrift um diese Jahre entstanden sein; jedenfalls nicht nach dem Jahre 1572 oder gar erst um 1579, wie die Bollandisten wollen, noch auch um 1559, wie die französischen Herausgeber der Werke unserer Heiligen annehmen möchten.
Auch diese Schrift ist nicht im Original auf uns kommen, sondern nur in Abschriften, deren eine dem P. Ribera S. J., einem der Beichtväter der Heiligen, vorgelegen hat. Im Druck erschienen die „Rufe der Seele“ zum erstenmal zusammen mit den anderen Werken der Heiligen in der editio princeps des Paters Ludwig de León, Salamanka 1588.
IV. Weg der Vollkommenheit.
ALS die heilige Theresia im Auftrag ihrer Seelenführer ihre Selbstbiographie das „Leben“ geschrieben hatte, worin sie auch vieles über das innere Leben eingeflochten, bekamen ihre geistlichen Töchter, die Karmelitinnen des ersten Reformklosters zum heiligen Joseph in Avila, auf irgendwelchen Umwegen davon Kenntnis. Sie drangen darum in ihre heilige Mutter, sie möchte ihnen von jenen geistlichen Schätzen doch auch mitteilen. Da jedoch das „Leben“ viele Nachrichten über noch lebende Personen enthielt, sowie aus verschiedenen anderen Gründen, schien es nicht geraten, es den Schwestern zum Lesen zu geben. Anderseits wollte aber die heilige Reformatorin der Bitte ihrer geistlichen Töchter doch nur zu gerne willfahren. Im Einverständnis bzw. im direkten Auftrag ihres Beichtvaters, P. Báñez O. Pr., machte sie sich denn daran, eigens für ihre Töchter des heiligen Klosters von Avila praktische Abhandlungen über das Gebet bzw. das innere Leben zu schreiben, die deren Verhältnissen und Fassungsvermögen angepaßt wären. So entstand, wie die Heilige selbst in der Vorrede dieses Werkes andeutet, die Schrift, die die heilige Verfasserin selbst „Camino de perfección“, „Weg der Vollkommenheit“, überschrieb, manchmal aber auch nur das „Kleine Büchlein“ („el librito pequeño“) oder auch das „Paternoster“ nannte.
Die Idee, daß das Gebet ein Weg (camino), und zwar der vorzüglichste, sei, auf dem man zum Gipfel der Vollkommenheit gelangen könne, hat die Heilige wohl aus dem damals sehr verbreiteten Werk des Franziskaners Osuna „El Tercer Abecedario“ geschöpft, das sie ja nachweisbar fleißig als Lektüre benützte. Darin heißt es nämlich im vierten Kapitel: „Das Gebet ist ein sehr sicherer Weg, auf dem wir uns zum Gipfel der Liebe erheben können.“ Vielleicht hat sie auch noch jene andere Schrift eines unbekannten Franziskaners gekannt, die im Jahre 1532 unter dem Titel: „Camino de la perfección del alma“ in Sevilla erschienen war. Doch wenn auch der Titel und vielleicht auch die erste Idee entlehnt sein mögen, der Inhalt der Schrift selbst ist von jenen beiden erwähnten ganz und gar verschieden.
Die beiden anderen Namen, welche die Heilige diese ihrer Schrift noch gibt, wie „Paternoster“ oder „Das kleine Büchlein“, sind nur metonymisch zu nehmen, d. h. sie finden nur auf den einen oder anderen Teil des ganzen Werkes ihre Anwendung. Wenn sie z. B. von diesem Werk als dem „librito pequeño“ (das „kleine Büchlein“) spricht, mein sie damit hauptsächlich den ersten Teil des „Weges der Vollkommenheit“, der in den Kapiteln 1 – 25 eine Reihe asketischer Ratschläge und Mahnungen über das Tugendleben und das innerliche Gebet (Betrachtung) enthält. Wenn sie dagegen vom „Paternoster“ spricht, so versteht sie darunter wohl in erster Linie den zweiten Teil des gleichen Werkes, der in den Kapiteln 26 – 42 in Form eines Kommentars zum Vaterunser eine wundervolle Abhandlung über das mystische Gebet bringt.
Der Charakter des „Weges zur Vollkommenheit“ ist ein wesentlich praktischer, ich möchte fast sagen apostolischer; es ist feuriger Kampfruf zur Gegenreformation. In die Stille Abgeschiedenheit des St.-Josephs- Klosters von Avila dringen traurige Nachrichten von jenseits der Pyrenäen, wie auch schon in Frankreich die Häresie wütet und sich immer weiter ausbreitet, wie vor allem das heiligste Altarsakrament profaniert wird. Das Herz der von der göttlichen Liebe entflammten Reformatorin möchte bei dieser traurigen Kunde zerspringen vor Schmerz. Darum ruft sie, voll des heiligen Eifers, ihre geistlichen Töchter auf zur Sühne und zum Gebet. „Meine Schwestern“, ruft sie aus, „jetzt ist wahrhaft keine Zeit mehr, in unseren Gebeten dem lieben Gott unsere kleinlichen egoistischen Anliegen vorzutragen; jetzt handelt es sich um größere Dinge! Die Häresie wütet, das Sakrament wird geschändet, ein ungeheurer Brand verzehrt die Christenheit, und Jesus sieht sich von neuem zum Tode verurteilt. An uns ist es, Sühne zu leisten und Christi Evangelium durch treue Gefolgschaft zu schützen. Helft mir, Schwestern, vom Herrn diese Gnade erbitten, daß das Unheil nicht noch weiter um sich greife und täglich immer Seelen zugrunde gehen! Dazu hat euch der Herr hierhergeführt; das ist euer Beruf; das soll eure Beschäftigung sein; dafür sollen eure Tränen fließen; darauf sollen eure Gebete abzielen.“
Das hört sich an wie ein Schlachtruf, der, voll des übernatürlichen Heldentums, das Werk eröffnet und das ganze Werk durchströmt und der auch der Sprache seine Form gibt: kurze, scharf geprägte Sätze, die sich vielfach wie militärische Befehle ausnehmen. Überhaupt ist das ganze Buch ein Werk, das von jugendlicher Kraft durch und durch gesättigt ist. The-resia tritt uns darin entgegen in der Vollkraft der Begeisterungsfähigkeit ihrer Rasse. Sie, die Erbin des Blutes der Ahumada und Cepeda, will auch ihren geistlichen Töchtern etwas von ihrer Eroberungslust, freilich auf geistlichem Gebiete, mitteilen. Und dieser Geist des Heldentums, der sie seit vielen Jahren beseelt und treibt, findet in der Gründung des St.Josephs-Klosters und der darauffolgenden Gründungen von geistlichen Stoßtrupps, bestehend aus heroischen Seelen, die sich für die Rettung der unsterblichen Seelen im stillen Beten und Büßen opfern und den Himmel bestürmen, ihre entsprechende Krönung und Erklärung.
Dem entspricht dann auch der Inhalt des Werkes, der ein vorwiegend praktisch-asketischer ist: Erziehung der Schwestern zu vollkommenem, übernatürlichem Heldentum. Darum im ersten Teil (Kap. 4 – 15) weise Mahnungen der heiligen Verfasserin zur Übung der wahren schwesterlichen Liebe, zur Loslösung von allem Geschöpflichen, zur wahren Demut des Herzens; ferner Ratschläge über das innerliche Gebet (Kap. 16 – 25), denen dann im zweiten Teil (Kap. 26 – 42) Erwägungen über das Vaterunser folgen mit herrlichen Ausführungen über die Stufen des Gebetes der Sammlung, der Ruhe, der Vereinigung sowie über die Gefahren für geistliche Seelen.
Die Abfassungszeit dieses kostbaren Werkes fällt in das Jahr 1565, wie aus einer gelegentlichen Bemerkung der Heiligen zu entnehmen ist (Vorrede zum „Weg zur Vollkommenheit“); und zwar schrieb sie es im St.Josephs-Kloster zu Avila. Das Original dieser Handschrift befindet bzw. befand sich bis zum Ausbruch der spanischen Revolution (1936) in der Bibliothek des Escorial, des alten Schlosses der spanischen Könige, wohin es 1592 durch König Philipp II. nebst verschiedenen anderen Handschriften der heiligen Theresia gebracht wurde.
Doch schrieb die Heilige selbst dieses Werk noch ein zweites Mal, und zwar in Toledo, wahrscheinlich im Jahre 1570, nachdem sie schon mehrfache Erfahrungen in der Leitung dieses ihres ersten Reformklosters sowie anderer Gründungen gemacht hatte. Und in dieser neuen Fassung hat die Heilige selbst verschiedentlich Verbesserungen angebracht, manche Sätze der alten Fassung weggelassen, neue hinzugefügt, überhaupt vieles in einer besseren Form und in einem ernsteren Ton gebracht als in jener, die ausschließlich für ihre Töchter des St.-Josephs-Klosters bestimmt war, in der ein mehr herzlicher, intimer Ton vorherrscht. Das Original dieser zweiten Fassung befindet sich im Karmelitinnenkloster in Valladolid, und nach dieser Handschrift wurde die späteren Drucke des Werkes hergestellt.
Außer diesen beiden Originalhandschriften existieren noch einige Abschriften des Werkes von zweiter Hand, die schon zu Lebzeiten der Heiligen, zumeist von ihren geistlichen Töchtern, nach dem Original von Valladolid, mit mehr oder minderer Genauigkeit gemacht worden waren, nämlich in Salamanka, Toledo und Madrid.
Da im Laufe der Jahre immer weitere Abschriften vom Original gemacht wurden, und das oft mit nicht unerheblichen Abweichungen vom Urtext, fürchtete die Heilige, der wegen der Erziehung ihrer Töchter zu dem ihr vorschwebenden Ideal der Vollkommenheit dieses Werk sehr am Herzen lag, es möchte diese ihre ursprüngliche Idee zu sehr verwischt und in verstümmelter Form den späteren Geschlechtern überliefert werden. Darum dachte sie selbst ernstlich daran, es dem Druck zu übergeben. Zu diesem Zweck verhandelte sie denn im Jahre 1579 mit einem großen Freunde und Förderer der karmelitanischen Reform, Don Teutonio de Braganza, Erzbischof von Chora, zwecks Drucklegung. Doch sollte die heilige Verfasserin diese nicht mehr erleben, da es erst ein Jahr nach ihrem Tode, 1583, in Chora, durch Bemühung des obengenannten Don Teutonio de Braganza im Druck erschien.
Eine zweite Ausgabe des Werkes erschien schon zwei Jahre darauf, 1585, in Salamanka durch P. Hieronymus Gracián O. C. D., und eine weitere 1586 in Valencia. Einen nicht unbedeutenden Fortschritt gegenüber diesen drei Erstlingsausgaben stellt die neue Ausgabe des „Weges der Vollkommenheit“ dar, die im Jahre 1588 durch Pater Ludw. De León O. S. A. in Salamanka zusammen mit dem „Leben“ hergestellt wurde, da dieser sich genauer an das Original hielt und auch Verbesserungen, welche die Heilige selbst noch in manchen Abschriften angebracht hatte, berücksichtigte. Eine Ausgabe der Originalhandschrift vom Escorial erfolgte zum erstenmal 1861 durch D. Vicente de la Fuente in seiner Bibliotheca de Autores Españoles in Madrid.
Die neueste Originalausgabe des „Weges der Vollkommenheit“ durch P. Silverio de S. Teresa C. D., die als III. Band der Gesamtausgabe der heiligen Theresia 1916 in Burgos erschien und die auch unserer deutschen Übertragung zugrunde liegt, ist genau nach der Originalhandschrift von Valladolid hergestellt.
1 So berichtet Pater Hieronymus Gracián selbst in seinem Buch Dilucidario del verdadero espiritu (Madrid 1608), p. 15.
2 So erzählt es die Heilige selbst einige Jahre später dem Pater Didakus de Pepes aus dem Orden des heiligen Hieronymus, späteren Bischof von Tarazona. (Sie dazu die Anmerkungen des Paters Gracián zum „Leben“ der heiligen Theresia von Pater Ribera.)
3 Siehe Vorwort der Heiligen zur „Seelenburg.“
4 Bemerkungen der Heiligen am Anfang des 4. Hauptstückes der 5. Wohnung.
IHS
Diese Abhandlung mit dem Titel Seelenburg schrieb Theresia von Jesu
aus dem Orden unserer Lieben Frau vom Berge Karmel für ihre
Schwestern und Töchter aus dem Orden der
Unbeschuhten Karmelitinnen.
Die Seelenburg.
IHS
1. Nur wenige Aufträge, die mir im Gehorsam erteilt wurden, sind mir so schwergefallen wie der jetzige Befehl, über das Gebet zu schreiben. Einerseits scheint mir der Herr dazu weder geistige Befähigung noch Lust zu geben, andererseits merke ich schon seit drei Monaten ein solches Sausen und so große Schwäche im Kopfe, daß ich selbst die notwendigen Geschäftssachen nur mit Mühe erledigen kann. Weil ich aber weiß, daß die Kraft des Gehorsams auch unmöglich scheinende Dinge leicht zu machen pflegt, so wird mein Willensentschluß sehr gern zur Tat, obwohl er der Natur sehr schwerzufallen scheint. Der Herr hat mir eben noch nicht so viel Tugend verliehen, um ohne großes Widerstreben von seiten der Natur gegen die fortdauernde Krankheit und die vielen Beschäftigungen kämpfen zu können. Möge der Herr, der in seiner gnadenvollen Erbarmung schon andere, schwerere Dinge für mich vollbracht hat, und auf dessen Barmherzigkeit ich auch jetzt vertraue, das tun, was ich selbst nicht vermag!
2. Nach meinem Dafürhalten werden wohl meine Worte nicht viel anders lauten als bei anderen Anlässen, bei denen der Auftrag zum Schreiben an mich erging; vielmehr fürchte ich, es werde fast alles wieder dasselbe sein. Es geht mir hier geradeso wie gewissen Vögeln, die man sprechen lehrt und die immer dasselbe wiederholen, weil sie nicht mehr können, als man sie lehrte oder was sie gehört haben. Will der Herr, daß ich etwas Neues sage, so wird es Seine Majestät geben; wenn nicht, so wird er mir in Erinnerung bringen, was ich sonst schon gesagt habe; denn auch damit wäre ich zufrieden. Ich habe ein so schlechtes Gedächtnis, daß ich mich freuen würde, einiges von dem, was nach Aussage anderer gut geschrieben war, richtig wiederzugeben, wenn etwa das früher Geschriebene verlorengegangen wäre. Sollte mir aber der Herr auch dies nicht gewähren, so wird mir doch davon, daß ich mich im Gehorsam abmühe und mein Kopfleiden vermehre, ein Gewinn bleiben, wenn auch sonst niemand einen Nutzen von meiner Arbeit hat.
3. So beginne ich denn in meinem jetzigen Aufenthaltsorte, im Karmel zum heiligen Joseph in Toledo, den an mich ergangenen Auftrag zu vollführen. Es ist heute das Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit des Jahres 1577. Ich unterwerfe mich in all meinen Darlegungen dem Urteil jener sehr gelehrten Männer, die mir diesen Auftrag gegeben haben. Sollte ich etwas sagen, was mit der Lehre der heiligen römischkatholischen Kirche nicht übereinstimmt, so geschieht es aus Unwissenheit und nicht aus Bosheit. Dies darf man gewiß glauben, sowie auch, daß ich überhaupt, Dank der Güte Gottes, dieser Kirche allezeit unterworfen war und noch bin und es auch fortan sein werde. Er sei gepriesen und verherrlicht in Ewigkeit! Amen.
4. Einer von denen, die mir diesen Auftrag zum Schreiben erteilten, sagte mir, daß die Nonnen unserer Lieben Frau vom Karmel das Bedürfnis hätten, über einige das Gebet betreffende Zweifel von jemand aufgeklärt zu werden. Nach seiner Ansicht würden Frauen die Redeweise von ihresgleichen besser verstehen, und in Anbetracht ihrer Liebe zu mir brächten ihnen meine Worte mehr Nutzen als die einer anderen Person. Deshalb sei er der Überzeugung, daß es für diese nicht ohne Belang sein werde, wenn es mir gelinge, ihnen etwas zu sagen. Ich werde darum in dieser Schrift nur zu ihnen reden, und dies um so mehr, als ich die Meinung, sie könnte auch noch anderen nützen, für Torheit gelte. Unser Herr wird mir eine große Gnade erweisen, wenn sich irgendeine von diesen Nonnen durch meine Worte angeregt fühlt, ihn ein wenig mehr zu loben. Seine Majestät weiß wohl, daß ich nichts anderes im Auge habe; selbstverständlich müssen die Nonnen einsehen, daß das Gute, das ich etwa vorbringen werde, nicht von mir stammt. Sie haben keinen Grund, anders zu denken, und sollten sie es dennoch, so hätten sie ebensowenig Verstand, als ich Fähigkeit besitze, über dergleichen Dinge zu schreiben, wenn nicht der Herr in seiner Barmherzigkeit mir diese Fähigkeit gibt.
I. Wohnung.
1. Hauptstück.
Die Schönheit und Würde unserer Seelen. Ein Gleichnis zum besseren Verständnis. Die Heilige spricht von dem Gewinn aus diesem Verständnis und der Erkenntnis der Gnaden, die wir von Gott empfangen. Die Pforte zu dieser Burg ist das Gebet.
1. Als ich heute zu unserem Herrn flehte, er möchte für mich reden, weil ich nicht wußte, was ich sagen und wie ich das mir vom Gehorsam aufgetragene Werk beginnen sollte, bot sich mir, um gleich anfangs eine Grundlage zu haben, ein Gleichnis dar, das ich jetzt erwähnen will. Betrachten wir unsere Seele als eine Burg, die ganz aus einem Diamant oder sehr klarem Kristall hergestellt ist; dort gibt es viele Gemächer, gleichwie auch im Himmel viele Wohnungen sind.5 Ja, meine Schwestern, wenn wir es recht bedenken, so ist die Seele des Gerechten nichts anderes als ein Paradies, in dem der Herr, wie er selbst sagt, seine Lust hat. Wie meint ihr nun, muß die Wohnung beschaffen sein, in der ein so mächtiger, so weiser, so reiner und an allen Gütern so reicher König sich ergötzt? Ich finde nichts, womit ich die erhabene Schönheit und Fähigkeit einer Seele vergleichen könnte. Und wahrlich, so scharfsinnig auch unser Verstand sein mag, er wird es doch nicht dahin bringen, diese zu erfassen, sowie er auch nicht dazu gelangen kann, Gott zu begreifen, der selbst sagt, daß er uns erschaffen nach seinem Bilde und Gleichnis.6 Es wäre darum eine vergebliche Mühe, wollten wir die Schönheit dieser Burg ergründen, obwohl zwischen der Seele und Gott ein Unterschied ist wie zwischen einem Geschöpfe und dem Schöpfer, weil ja auch die Seele ein Geschöpf ist. Übrigens genügt der Ausspruch der göttlichen Majestät, daß die Seele nach Gottes Bild erschaffen ist, um daraus auf ihre große Würde und Schönheit schließen zu können.
2. Es ist aber nicht wenig zu bedauern und keine geringe Schande, wenn wir durch eigene Schuld uns selbst nicht kennen und nicht wissen, wer wir sind. Wäre es, meine Töchter, nicht eine große Unwissenheit, wenn jemand auf die Frage nicht zu antworten wüßte, wer sein Vater, wer seine Mutter, welches seine Heimat sei? Schon dies wäre ein Zeichen von großer Unvernunft, die sie aber noch unvergleichlich steigern würde, wenn wir uns nicht um die Erkenntnis unser selbst kümmerten, sondern uns nur mit unserem Leibe befaßten; (ja, es wäre höchst unvernünftig), wenn wir nur so obenhin, vielleicht aus der Erfahrung oder durch den Glauben, wissen, daß wir eine Seele haben, selten aber an die Güter denken würden, die sie in sich schließen kann, und uns weder ihren hohen Wert noch auch den vergegenwärtigen, der sie bewohnt. Dies ist auch der Grund, warum man sich so wenig darum kümmert, ihre Schönheit mit aller Sorgfalt zu bewahren. Alle unsere Sorge ist nur auf die rohe Einfassung, auf die Ringmauern der Burg, d. i. auf unseren Leib, gerichtet.
3. Denken wir uns also, diese Burg habe, wie schon erwähnt, viele Wohnungen, die einen oben, die anderen unten, wieder andere an den Seiten; im Innersten der Burg aber, in der Mitte von all diesen Wohnungen, sei die vornehmste, in der zwischen Gott und der Seele sehr geheime Dinge vorgehen. Dieses Gleichnis müßt ihr im Gedächtnis bewahren! Vielleicht gefällt es dem Herrn, daß ich durch dasselbe in euch einigermaßen das Verständnis für die Gnaden, die Gott nach seinem Wohlgefallen den Seelen verleiht, sowie für deren Vielgestaltigkeit wecken kann, soweit ich dies als möglich erkenne; denn alle diese vielfachen Gnaden kann niemand, am allerwenigsten ein so armseliges Geschöpf wie ich, erkennen. Beschenkt euch dann der Herr mit solchen Gnaden, so wird es für euch ein großer Trost sein, zu wissen, daß dies möglich ist; gewährt er sie aber nicht, so wird das Wissen um diese Gnaden zum Anlaß werden, seine große Güte zu preisen. Wie uns die Betrachtung der himmlischen Dinge und des Genusses der Seligen keinen Nachteil bringt, sondern vielmehr Freude in uns weckt und uns mit dem Bestreben beseelt, auch zu diesem Genusse zu gelangen, ebensowenig wird uns die Erkenntnis zum Nachteil sein, daß ein so großer Gott selbst in dieser Verbannung so übelriechenden Würmern sich mitteilt und sie mit einer so unendlichen Güte und unermeßlichen Barmherzigkeit liebt. Nach meiner Überzeugung fehlt es dem sehr an Demut und Nächstenliebe, dem die Erkenntnis der Möglichkeit schaden würde, daß Gott schon in dieser Verbannung eine so große Gnade verleiht. Wie wäre es sonst möglich, daß wir uns nicht freuten, wenn Gott einem unserer Brüder dergleichen Gnaden spendet, da ihn dies ja nicht hindert, sie auch uns zu verleihen? Wie wäre es möglich, daß wir uns nicht freuten, wenn die göttliche Majestät ihre Wunderwerke, an wem es auch immer sei, offenbart? Der Herr mag seine Gnaden zuweilen wohl nur zu dem Zwecke spenden, damit seine Werke offenbar werden. Darauf wies er selbst hin, als ihn die Apostel betreffs des Blindgeborenen7, dem er das Augenlicht gab, fragten, ob dieser wegen seiner Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern mit Blindheit gestraft worden sei. Und so geschieht es denn, daß der Herr manchen seine Gnaden nicht deshalb mitteilt, weil diese heiliger sind als andere, sondern damit seine Größe offenbar werde, wie wir dies am hl. Paulus und an Magdalena sehen, sowie auch, damit wir ihn preisen in seinen Geschöpfen.
4. Man könnte einwenden, solche Dinge schienen unmöglich, und es sei nicht gut, den Schwachen Ärgernis zu geben. Allein es ist weniger verloren, wenn diese nicht daran glauben, als wenn man den Fortschritt jener zu fördern unterläßt, denen Gott seine Gnaden erweist, die sich freuen und zu innigerer Liebe dessen ermuntert werden, der ihnen so große Erbarmungen erzeigt. Zudem weiß ich, daß ich zu solchen rede, bei denen keine Gefahr des Ärgernisses vorhanden ist; denn sie glauben und wissen, daß Gott noch viel größere Beweise seiner Liebe gibt. Übrigens weiß ich auch, daß einer, der dies nicht glaubt, davon auch nichts erfahren wird; denn der Herr liebt es gar sehr, daß man seinen Werken keine Grenzen setze. Möchte dies, meine Schwestern, bei jenen aus euch nie vorkommen, denen der Herr diesen außerordentlichen Weg versagt!
5. Wir wollen nun wieder zu unserer schönen und wonniglichen Burg zurückkehren und sehen, wie wir in sie eintreten können. Dies scheint zwar eine unsinnige Rede und dasselbe zu sein, wie wenn ich zu jemand sagen würde, er solle in ein Zimmer gehen, in dem er schon ist; denn wenn diese Burg unsere Seele ist, so folgt ja klar, daß wir nicht hineinzugehen brauchen, weil beides, die Burg und die Seele, dasselbe ist. Ihr müßt jedoch wissen, daß man in sehr verschiedener Weise an einem Orte sein kann. Viele Seelen halten sich nur innerhalb der Ringmauern der Burg auf, wo die Wachen stehen, und kümmern sich nicht, in die Burg selbst zu kommen; sie wissen auch nicht, was dieser kostbare Palast in sich birgt, wer darin wohnt, noch auch, welche Gemächer er hat. Ihr werdet schon vernommen haben, daß der Seele in einigen Büchern, die vom Gebete handeln, der Rat gegeben wird, in ihr Inneres einzukehren; das gleiche sage ich auch hier.
6. Ein sehr gelehrter Mann bemerkte unlängst mir gegenüber, daß die Seelen, die das Gebet nicht üben, einem vom Schlagfuß gelähmten oder gichtbrüchigen8 Körper gleichen, der zwar Füße und Hände hat, aber sich nicht bewegen kann. Und so ist es in der Tat. Es gibt Seelen, die so elend und gewohnheitsmäßig, so mit äußerlichen Dingen beschäftigt sind, daß es ihnen unmöglich scheint, in ihr Inneres einzukehren. Denn die Gewohnheit, immer mit den kriechenden und anderen Tieren, die sich um die Burg herum aufhalten, umzugehen, hat sie diesen fast gleich gemacht. Obwohl von so edler Natur und fähig, mit Gott selbst zu verkehren, bleiben sie doch in ihrem bedauerlichen Zustand. Wenn solche Seelen sich nicht bemühen, ihr Elend einzusehen und ihm abzuhelfen, werden sie, weil sie ihren Blick nicht auf sich selbst richten, zu Salzsäulen, ähnlich dem Weibe Lots, die sich umwandte und zurücksah.9
7. Soviel ich verstehen kann, ist die Pforte, durch die man in diese Burg eingeht, das Gebet und die Betrachtung. Ich meine hier nicht bloß das innerliche Gebet, sondern auch das mündliche, das, um ein Gebet zu sein, ebenso wie jenes mit Aufmerksamkeit und Überlegung verrichtet werden muß. Denn ein Gebet, bei dem man nicht bedenkt, mit wem man redet, um was man bittet, wer der ist, der da bittet, und jener, den man bittet, nenne ich gar nicht Gebet, mag man dabei auch noch so eifrig seine Lippen bewegen. Und wäre es, wenn man auf das Gesagte nicht achtet, doch manchmal ein Gebet, so nur insofern, als man die Worte schon öfters im Munde geführt hat. Wenn aber jemand mit der Majestät Gottes wie mit seinem Sklaven zu reden gewohnt wäre, und, ohne zu bedenken, ob er etwa unrecht rede, nur sagte, was ihm in den Mund kommt oder was er durch öfteres hersagen auswendig weiß, so hielte ich dies nicht für Gebet. Gott verhüte, daß ein Christ also bete! Was euch betrifft, meine Schwestern, so hoffe ich, die göttliche Majestät werde nicht zulassen, daß so etwas vorkomme, weil ihr ohnehin gewohnt seid, euch mit innerlichen Dingen zu beschäftigen; denn dies ist ein sehr gutes Mittel zur Bewahrung vor solcher Unvernunft.
8. Von jenen lahmen Seelen aber wollen wir nicht weiter reden. Wenn der Herr nicht selbst kommt und sie wie den Kranken, der dreißig Jahre lang am Teiche lag, aufstehen heißt, so sind sie sehr unglücklich und in großer Gefahr. Ich will also von anderen Seelen reden, die endlich doch noch in die Burg eingehen. Diese haben, obgleich sie noch tief in der Welt stecken, doch wenigstens ein gutes Verlangen. Sie empfehlen sich dann und wann unserem Herrn und denken, wenn auch nicht lang, über sich selbst nach. Ein und das andere Mal im Monat beten sie mündlich, wenn auch mit tausend Gedanken an ihre Geschäfte, in die sie fast beständig vertieft sind, die sie so sehr fesseln, daß sie selbst die Notwendigkeit erkennen, sich davon loszumachen. Manchmal nehmen sie sich dies auch vor; denn wo ihr Schatz ist, da ist auch ihr Herz.10 Aber sie haben schon viel gewonnen, wenn sie sich selbst erkennen und einsehen, daß sie den rechten Weg nicht gehen, auf dem man zum Eingang in die Burg gelangt. Am Ende treten sie doch noch in die ersten Gemächer des Erdgeschosses ein; allein die Menge des Ungeziefers, das sie mit sich nehmen, läßt sie die Schönheit der Burg nicht sehen und gestattet ihnen keine Ruhe. Sind sie indessen nur eingetreten, so haben sie dadurch schon viel getan.
9. Es mag euch, meine Schwestern, scheinen, als treffe dies bei euch nicht zu, weil ihr, dank der Güte des Herrn, nicht zu solchen Seelen gehört. Aber ihr müßt Geduld haben, da ich euch anders nicht zu erklären wüßte, wie ich einige innere Zustände des Gebetes verstehe. Der Herr gebe, daß ich wenigstens auf diese Weise das Rechte treffe; denn was ich euch erklären möchte, ist sehr schwer zu verstehen, wenn man hierin keine Erfahrung besitzt! Habt ihr sie aber, so werdet ihr auch einsehen, daß ich nicht umhin kann, auch das zu berühren, vor dem uns der Herr in seiner Barmherzigkeit bewahren wolle.
2. Hauptstück.
Häßlichkeit einer im Stande der Todsünde sich befindlichen Seele. Der Herr hat einer Person etwas davon geoffenbart. Einiges über die Selbsterkenntnis. Dieses Hauptstück ist wegen einiger darin berührter wichtiger Punkte besonders nützlich.
1. Ehe ich fortfahre, möchte ich euch darauf hinweisen, den traurigen Anblick zu betrachten, den diese so schöne und glänzende Burg, diese orientalische Perle gewährt, wenn die Seele in eine Todsünde fällt. Ist sie ja doch der Baum des Lebens, der inmitten der lebendigen Wasser des Lebens, d. i. in Gott, gepflanzt ist. Die Finsternis, die eine solche Seele befällt, ist noch weit dichter als alles, was dunkel, düster und schwarz ist. Verlanget, um dies einzusehen, nicht mehr zu wissen als das eine: Dieselbe Sonne, die der Seele zuvor einen solchen Glanz und solche Schönheit verlieh, ist, wenngleich noch im Mittelpunkte der Seele befindlich, doch nur so in ihr, als wäre sie nicht darin. Obwohl die Seele dieselbe Fähigkeit hat, die göttliche Majestät zu genießen, wie der Kristall, die Strahlen der Sonne aufzunehmen, so hat sie doch an der göttlichen Gnadensonne keinen Anteil. Nichts kommt ihr da zugute, weswegen alle guten Werte, die sie im Stande der Todsünde verrichtet, unfruchtbar sind für den Erwerb der Seligkeit. Da sie nicht aus dem Urquell, aus Gott, hervorgehen, der unsere Tugend zur Tugend gestaltet, sondern aus der Trennung von Gott, so können sie seinen Augen nicht gefallen. Geht ja doch auch die Absicht dessen, der eine Todsünde begeht, nicht dahin, Gott zu gefallen, sondern dem Teufel sich gefällig zu erzeigen. Wie dieser die Finsternis selbst ist, so ist jetzt auch die arme Seele eine gleiche Finsternis geworden.
2. Ich kenne eine Person, der unser Herr die Beschaffenheit einer Seele zeigen wollte, die sich im Stande der Todsünde befindet. Nach Aussage dieser Person könnte kein Mensch sündigen, wenn er dies erkennen würde, müßte er sich auch, um die Gelegenheit zur Sünde zu meiden, den größten erdenklichen Leiden aussetzen. Sie war darum von dem innigsten Verlangen beseelt, alle Menschen möchten dies erkennen. Und so möget denn auch ihr, meine Töchter, das gleiche Verlangen haben und Gott eifrig für jene bitten, die sich in diesem Zustand befinden und mit ihren Werken ganz in Finsternis gehüllt sind. Wie die Bächlein, die aus einer ganz klaren Quelle hervorfließen, alle rein sind und klar, so werden auch die Werke einer Seele, die im Stande der Gnade ist, angenehm in den Augen Gottes und der Menschen. Sie entspringen eben aus dieser Quelle des Lebens, an der die Seele gleich einem Baume gepflanzt ist. Von ihr hat dieser Baum seine Anmut und Fruchtbarkeit, weil das Wasser dieser Quelle ihn erhält und bewirkt, daß er nicht verdorrt, sondern gute Früchte bringt. Wenn aber die Seele sich aus eigener Schuld von dieser Quelle entfernt und an ein ganz schmutziges und übelriechendes Wasser sich verpflanzt, so wird ihr daraus auch nur Schmutz und Verderben zufließen.
3. Hier ist zu bemerken, daß die im Seelengrunde sich befindliche Lebensquelle und hellstrahlende Sonne ihren Glanz und ihre Schönheit nicht verlieren; sie bleiben im Innern, und nichts kann sie ihrer Schönheit berauben. Wenn aber über einen der Sonne ausgesetzten Kristall ein ganz schwarzes Tuch gebreitet wird, so ist es klar, daß die Sonne mit ihrem Lichtglanze auf den Kristall nicht wirken kann, obwohl er auf ihn fällt.
4. O ihr durch das Blut Christi erkauften Seelen, erkennt doch euren Zustand und habt Erbarmen mit euch selbst! Wie ist es möglich, daß ihr bei dieser Erkenntnis euch nicht bemüht, das den Kristall verhüllende Pech hinwegzuschaffen? Bedenket doch, daß ihr euch nie mehr des Lichtes der göttlichen Gnadensonne erfreuen werdet, wenn euer Leben in diesem Zustande endet! O Jesus, was ist es doch um den Anblick einer Seele, die von diesem Lichte getrennt ist! In welch traurigem Zustand sind da die Gemächer der Burg! In welcher Verwirrung befinden sich ihre Inwohner, die Sinne! Mit welcher Blindheit sind die Seelenvermögen, diese Befehlshaber, Verwalter und Hofmeister der Burg geschlagen! Welch schlimmes Regiment führen sie! Und endlich, was für Früchte kann ein Baum hervorbringen, der auf einem solchen Grund, d. i. auf den Teufel gepflanzt ist?
5. Ich hörte einmal einen Geschäftsmann sagen, er wundere sich nicht so sehr über das, was ein Mensch im Stande der Todsünde tut, als vielmehr über das, was er nicht tut. Gott bewahre uns in seiner Barmherzigkeit vor einem so großen Übel, wie die Todsünde es ist; denn solange wir leben, gibt es für uns nichts, was (so sehr) den Namen eines Übels verdient, als dieses, weil es ewige Übel ohne Ende nach sich zieht. Dieses Übel, meine Töchter, ist es, vor dem wir uns fürchten und vor dem bewahrt zu bleiben wir Gott in unseren Gebeten bitten sollen; denn wenn er nicht die Stadt behütet, so ist all unsere Mühe vergebens11, da wir die Armseligkeit selbst sind. Die obenerwähnte Person sagte auch, sie habe aus der ihr von Gott erwiesenen Gnade zwei Vorteile gewonnen. Der erste Vorteil für sie war eine überaus große Furcht vor jeder Beleidigung Gottes, weshalb sie angesichts der furchtbaren Nachteile, die daraus entstehen, immer zu ihm gefleht, er möge sie nicht fallen lassen. Der andere Vorteil war der, daß ihr jene Offenbarung zu einem Spiegel der Demut diente, worin sie erkannte, daß alles Gute, das wir tun, seinem Ursprung nach nicht von uns, sondern von jener Quelle kommt, an die der Baum unserer Seele gepflanzt ist, und von jener Sonne, die unseren Werken Wärme spendet. Dies, sagte sie, trat ihr so klar vor Augen, daß sie das Gute, das sie tue oder tun sehe, immer auf seinen Grund zurückleite, da sie erkenne, daß wir ohne die Hilfe Gottes nichts vermögen. Die Folge davon sei, daß sie sogleich Gott lobe und meistens gar nicht an sich selbst denke, wenn sie etwas Gutes getan.
6. Ziehen auch wir, meine Schwestern, diese zwei Vorteile aus dem Gesagten, so ist die Zeit, die wir, ich auf das Schreiben und ihr auf das Lesen, verwendet haben, gewiß nicht verloren. Die Gelehrten und Weisen verstehen freilich diese Wahrheiten sehr gut, aber unsere weibliche Ungeschicktheit bedarf einer solchen Art der Belehrung. Vielleicht will der Herr aus eben diesem Grunde, daß dergleichen bildliche Vergleiche uns zur Kenntnis gebracht werden. Möge Seine Majestät uns die Gnade verleihen, daß wir sie verstehen und Nutzen daraus ziehen!
7. Diese geistigen Dinge sind für das Verständnis so dunkel, daß einer, der so wenig weiß wie ich, viel Überflüssiges und auch Ungereimtes sagen muß, um etwas Passendes vorzubringen. Wer diese Schrift liest, muß Geduld haben wie ich, die ich schreibe, was ich selbst noch nicht weiß; denn wenn ich das Papier zur Hand nehme, bin ich manchmal in Wahrheit wie eine Törin, die nicht weiß, was sie schreiben und wie sie beginnen soll. Indessen sehe ich wohl ein, daß es für euch nützlich ist, wenn ich auch, so gut ich es vermag, einige Vorgänge des inneren Lebens erkläre. Denn wir hören immer davon reden, wie vorteilhaft die Übung des Gebetes sei, und unsere eigenen Satzungen schreiben uns so viele Gebetsstunden vor; aber man erklärt uns über das Gebet nicht mehr, als was wir selbst zu tun imstande sind, während uns über die übernatürlichen Dinge, die Gott in einer Seele wirkt, hier wenig gesagt wird. Gibt man uns nun darüber Aufschluß und führt man uns auf mannigfache Weise in deren Verständnis ein, so muß es uns ein besonderer Trost sein, dieses innere himmlische Kunstwerk zu betrachten, das von den Sterblichen so wenig gekannt ist, obwohl viele daran vorbeigehen. Der Herr hat mir zwar schon bei Abfassung meiner anderen Schriften einiges Verständnis davon verliehen; ich sehe aber ein, daß ich damals manches, besonders die schwierigsten Punkte, nicht so gut verstanden habe, wie seit dieser Zeit. Es ist nur zu bedauern, daß ich, um diese Dinge erklären zu können, vieles sagen muß, was euch ohnehin schon sehr bekannt ist; denn bei meiner Ungeschicklichkeit kann ich nicht anders.
8. Kehren wir nun wieder zu unserer Burg mit ihren vielen Wohnungen zurück. Ihr dürft euch diese Wohnungen nicht als aneinandergereiht vorstellen, sondern müßt eure Augen auf den Mittelpunkt, d. i. auf das Gemach oder den Palast, in dem der König wohnt, richten. Betrachtet als Bild dieses Palastes die schmackhafte, von vielen Schalen eingeschlossene Frucht der Zwergpalme! Diese Schalen muß man abtöten, um auf den eßbaren Kern zu kommen. Ebenso sind um dieses Gemach herum und über ihm viele andere Gemächer. Wenn wir nämlich von der Seele sprechen, müssen wir immer den Begriff Fülle, Weite und Größe damit verbinden; nichts davon ist übertrieben, weil die Seele viel mehr zu fassen imstande ist, als wir uns denken können. Allen Gemächern aber teilt die in diesem Palaste leuchtende Sonne sich mit.
9. Es ist von großer Wichtigkeit, daß man eine Seele, die wenig oder viel Zeit euf das Gebet verwendet, ja nie beenge und gleichsam in einen Winkel einzwänge. Man lasse sie vielmehr diese Wohnungen, oben und unten und an den Seiten, frei durchwandeln, da ihr Gott eine so hohe Würde verliehen hat. Man zwinge sie nicht, lange Zeit nur in einem Gemache zu bleiben, und wäre es auch das Gemach der Selbsterkenntnis. Diese Erkenntnis – man verstehe mich recht –ist jedoch auch für jene, die der Herr schon in sein eigenes Gemach hat eintreten lassen, sehr notwendig. Wie hoch sie auch stehen mögen, so kann doch nie etwas diese Selbsterkenntnis ersetzen, und sie selbst könnten nicht darauf verzichten, wenn sie auch wollten; denn die Demut ist der Biene gleich, die beständig im Bienenstock den Honig bereitet. Ohne diese Tugend geht alles verloren. Wir müssen jedoch bedenken, daß die Biene nicht unterläßt, auch auszufliegen, um den Blütensaft heimzubringen. Ebenso soll auch die Seele, das glaube sie mir, zuweilen von der Betrachtung ihrer selbst zur Betrachtung der Größe und Majestät Gottes sich erheben. Hier wird sie ihre Niedrigkeit besser erkennen als in sich selbst und auch freier werden von dem Ungeziefer, das mit ihr in die ersten Gemächer der Selbsterkenntnis eingekehrt ist. Ist es auch, wie gesagt, ein großer Erweis der Barmherzigkeit Gottes, wenn er uns anregt, in der Selbsterkenntnis uns zu üben, so gilt doch auch hier das Sprichwort: „zu wenig und zu viel verdirbt das Spiel.“ Glaubt es mir, wir erwerben uns durch Gottes Kraft weit höhere Tugend, als wenn wir immer nur auf dem Boden unserer eigenen Armseligkeit betrachtend verweilen.
10. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug erklärt habe. Denn die Selbsterkenntnis ist so wichtig, daß ich nicht eine Nachlässigkeit bei deren Erwerb wünschte, selbst wenn ihr euch auch bis zum Himmel erhoben hättet; denn so lange wir auf Erden leben, ist uns nichts notwendiger als die Demut. Darum sage ich wiederholt: Es ist gut, ja sehr gut, daß man zuerst in jenes Gemach einzutreten sich bemüht, in dem man sich mit der Erkenntnis seiner selbst befaßt, ehe man sich zu den anderen Gemächern zu erheben sucht; denn die Selbsterkenntnis ist der Weg dahin. Können wir auf dem ebenen und sicheren Wege gehen, warum sollten wir uns Flügel wünschen zum Fliegen, statt auf diesem Wege weiter voranzuschreiten? Indessen werden wir nach meiner Ansicht doch nie zur vollkommenen Selbsterkenntnis gelangen, wenn wir uns nicht auch befleißigen, Gott kennenzulernen; denn durch die Betrachtung seiner Größe werden wir unsere Armseligkeit, durch den ernsten Blick auf seine Reinheit unsere Befleckung erkennen; die Betrachtung seiner Demut aber wird uns zeigen, wie weit wir noch von dieser Tugend entfernt sind.
11. Daraus ergibt sich ein zweifacher Gewinn. Fürs erste erscheint offenbar das Weiße weit mehr in seiner Weiße neben dem Schwarzen, während im Gegenteil das Schwarze neben dem Weißen mehr in seiner Schwärze vor das Auge tritt. Fürs zweite wird unser Verstand und unser Wille mehr veredelt und fähiger zu allem Guten, wenn wir uns bestreben, uns selbst und zugleich Gott kennenzulernen. Treten wir aber niemals aus dem Schlamme unseres Elendes heraus, so bringt uns dies großen Nachteil. Ich habe oben von jenen, die im Stande der Todsünde leben, gesagt, wie schwarz und übelriechend die Wasser seien, aus denen sie ihre Nahrung schöpfen. Dies möchte ich als Gleichnis auch hier gebrauchen. Ich sage nicht, daß jene, die immer nur auf dem Boden der Betrachtung ihrer eigenen Armseligkeit stehenbleiben, in derselben Lage sind; davor bewahre uns Gott! Aber wenn sich solche Seelen gar nicht höher hinaufschwingen, so werden sie immer das aus diesem oben entspringende Wasser der Beängstigungen, des Kleinmutes und der Verzagtheit in sich aufnehmen. Tausend Gedanken werden sie da beunruhigen und verwirren, wie z. B.: Werden nicht andere ihre Augen auf mich richten? Wird mir der Wandel auf diesem Wege keinen Nachteil bringen? Darf ich es wagen, ein solches Werk zu unternehmen? Ist es nicht Hoffart, ist es recht, wenn ein so armseliges Geschöpf wie ich mit dem so erhabenen, innerlichen Gebet sich befaßt? Wird man mich nicht für besser halten als andere, die diesen Weg nicht gehen? Übertreibungen sind auch auf dem Wege der Tugend zu vermeiden. Als eine so arme Sünderin werde ich, wenn ich falle, nur um so tiefer hinabzustürzen. Vielleicht werde ich auf diesem Wege nicht voranschreiten und so den Guten nur schaden. Eine Person wie ich bedarf keiner Besonderheiten usw.
12. Ach, meine Schwestern, welchen Schaden wird der Teufel diesen Seelen durch Einflüsterung solcher Gedanken schon zugefügt haben! Denn dies alles sowie der Umstand, daß solche Seelen immer nur bei der Betrachtung ihres eigenen Elendes stehenbleiben, scheint ihnen nur Demut zu sein; ich könnte noch vieles Derartige anführen. Auf solche Weise verkehrt der Teufel die Selbsterkenntnis zu ihrem Schaden, und wenn wir uns niemals über uns selbst erbeben, so wundere ich mich nicht, daß wir dies und noch mehr zu befürchten haben. Darum, meine Töchter, sage ich, daß wir unsere Augen auf Christus, unser höchstes Gut, und auf seine Heiligen richten müssen. Von ihnen werden wir die wahre Demut lernen; so wird, wie gesagt, unser Verstand veredelt, die Erkenntnis unseres eigenen Nichts aber wird uns nicht niederdrücken und verzagt machen. Ist die Selbsterkenntnis auch nur die erste Wohnung, so ist sie doch schon sehr reich und so kostbar, daß die Seele weiter voranschreiten wird, wenn sie sich des dort sich befindlichen Ungeziefers erwehrt. Aber die listigen Nachstellungen und Kunstgriffe des Teufels sind furchtbar; er will damit verhindern, daß die Seele zur Selbsterkenntnis gelange und sich auf den Wegen, die sie wandelt, zurechtfinde.
13. Über diese erste Wohnung könnte ich aus eigener Erfahrung sehr gute Aufschlüsse geben. Darum sage ich: man stelle sich nicht wenige, sondern unzählige Gemächer vor; denn auf die mannigfachste Weise treten die Seelen in sie ein. Sie alle haben eine gute Absicht; der Teufel aber hat immer Schlimmes vor. Darum mag er wohl in jedem dieser Gemächer viele Legionen von bösen Geistern zum Kampfe gegen diese Seelen aufbieten, um sie vom Fortschreiten in die anderen Gemächer abzuhalten; und da die Armen es nicht merken, täuscht er sie auf die mannigfachste Weise. Soviel vermag er nicht mehr über jene, die dem Gemache des Königs schon näher stehen. Hier aber, wo die Seelen noch verstrickt sind in die Welt, versenkt in deren Genüsse und eingenommen für deren Ehren und Ansprüche, sind die Vasallen der Seele, die ihr von Gott gegebenen Sinne und natürlichen Vermögen, noch nicht stark genug; darum werden solche Seelen leicht überwunden, obgleich sie das Verlangen haben, Gott nicht zu beteidigen, und gute Werke vollbringen. Die auf dieser Stufe sich befindlichen Seelen müssen möglichst oft zur göttlichen Majestät ihre Zuflucht nehmen, die gebenedeite Gottesmutter und die Heiligen Gottes zu Fürbittern wählen und sie anflehen, für sie zu streiten, weil die eigenen Dienstleute noch zu wenig Stärke haben, um sich zu verteidigen. Übrigens muß uns Gott auf jeder Stufe die Stärke zum Streite verleihen. Seine Majestät gewähre sie uns um ihrer Barmherzigkeit willen!
14. O wie armselig ist doch das Leben, in dem wir uns befinden! Meine Töchter, ich habe schon anderswo ausführlich von dem Nachteil gesprochen, den uns der Mangel an rechtem Verständnis der Selbsterkenntnis und Demut bringt; darum will ich hier nicht weiter davon reden, wenn auch dieses Verständnis das Notwendigste für uns ist. Der Herr gebe, daß ich wenigstens etwas zu eurem Nutzen gesagt habe!
15. Ihr müßt wissen, daß von dem Lichte, das aus dem Palaste des Königs kommt, fast noch nichts, in die erste Wohnung dringt. Sie ist zwar nicht ganz finster und schwarz, wie wenn die Seele sich in der Todsünde befindet; aber sie ist doch einigermaßen verdunkelt, so daß einer das Licht nicht sehen kann, der in ihr ist. Die Schuld liegt, ich weiß mich nicht besser verständlich zu machen, nicht an dem Gemache, sondern an dem vielen bösen Gezücht von Nattern, Vipern und anderen giftigen Tieren, die zugleich mit der Seele in das Gemach eingedrungen sind und sie das Licht nicht schauen lassen. Geradeso, wie wenn jemand in ein von der Sonne hell erleuchtetes Zimmer tritt, aber die Augen voll Staub hat, so daß er sie kaum öffnen kann. Die Wohnung ist zwar Licht, aber wer sich darin befindet, erfreut sich des Lichtes nicht, da die wilden und sonstigen Tiere ihn daran hindern; sie blenden seine Augen, so daß er außer ihnen nichts sehen kann. So muß es meiner Ansicht nach einer Seele ergehen, die zwar in keinem bösen Zustand sich befindet, aber doch, wie gesagt, in weltliche Dinge so verstrickt und von zeitlichen Gütern, Ehren und Beschäftigungen so eingenommen ist, daß diese er nicht gestatten, ihre eigene Schönheit zu schauen und zu genießen, wenn sie auch ernstlich wollte; allem Anschein nach kann sie sich so großer Hindernisse nicht entledigen. Und doch ist es, um in die zweite Wohnung eingehen zu können, durchaus notwendig, daß jede Seele, je nach ihrem Stande, danach trachte, es der unnötigen Dinge und Geschäfte zu entschlagen. Daran ist so viel gelegen, daß ich es für unmöglich halte, in die Hauptwohnung zu gelangen, wenn damit nicht der Anfang gemacht wird; ja wenn jemand auch schon in die Burg eingetreten ist, so wird er doch nach meinem Dafürhalten in dem Gemach, in dem er sich eben befindet, nicht ohne große Gefahr sein. Denn unter so diesen giftigen Tieren kann er unmöglich durchkommen, ohne nicht hin und wieder angegriffen zu werden.
16. Wie traurig wäre es aber, meine Töchter, wenn jene durch eigene Schuld wieder in das Getümmel der ersten Wohnung zurückkehren würden, die wie wir, frei von solchen Hemmnissen, schon viel weiter vorgeschritten und in andere geheime Wohnungen der Burg eingedrungen sind! Ach, um unserer Sünden willen wird es viele geben, die sich wieder in ihr früheres Elend stürzen, nachdem sie Gott begnadigt hat! Hier, im Orden, sind wir bezüglich der äußeren Dinge frei von Gefahren; der Herr gebe nur, daß wir es auch bezüglich des Inneren seien und bleiben mögen! Hütet euch deshalb, meine Töchter, vor fremden Sorgen! Bedenket, daß nur in wenigen Wohnungen dieser Burg die bösen Geister auf den Kampf verzichten! In einigen sind zwar die Mieter, wie ich die Vermögen der Seele genannt zu haben glaube, stark zum Streite; allein es ist sehr notwendig, daß wir den Ränken des Teufels gegenüber beständig auf der Hut sind, damit er nicht in der Gestalt eines Engels des Lichtes uns täusche. Denn es gibt eine Menge Dinge, durch die er uns schaden kann; er schleicht sich allmählich ein, so daß wir den Schaden nicht eher bemerken, als er eingetreten ist.