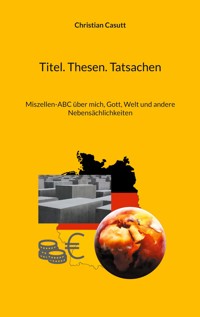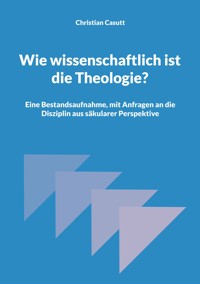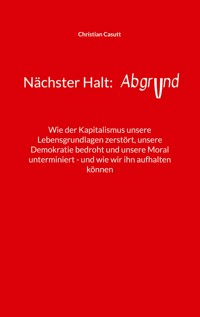
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Den modernen Kapitalismus unserer Zeit kennzeichnen die gleichen Merkmale wie seit seinem Aufkommen im Zuge der industriellen Revolution. Und dennoch erleben wir heute, nach der umfassenden Deregulierung der Finanzmärkte im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts, einen neuen, entfesselten Finanzkapitalismus, einen Kapitalismus 2.0, der seine Zerstörungskraft deutlich erweitert hat. Das Buch belegt anhand vieler Fakten, wie der (Finanz-)Kapitalismus als »Gesellschaftsform« in wichtige Bereiche unseres Lebens eindringt und dort seine Profitgier ungehemmt entfaltet. Es zeigt auf, dass die Großkrisen der Zeit, Klimakrise, Demokratiekrise und wachsende Ungleichheiten sich nicht nur gegenseitig überlagern und miteinander verflochten sind, sondern im Kapitalismus ihren eigentlichen Urgrund haben. Im Unterschied zu anderen Büchern des Genres wird die besondere Rolle des Ungleichgewichts zwischen Finanz- und Realwirtschaft hervorgehoben, ein Ungleichgewicht, das den »Turbolader« im Finanzkapitalismus antreibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Den Kleinschürfern in der Demokratischen Republik Kongo gewidmet
Inhalt
0 Einstieg
1 Kapitalismus, der Zerstörer
2 Der Kapitalismus zerstört unsere Lebensgrundlagen
3 Der Kapitalismus bedroht unsere Demokratie
4 Kapitalismus und Moral: Unsere imperiale Lebensweise
5 Der Finanzkapitalismus als Kapitalismus 2.0
6 Enttäuschte Hoffnungen, entzauberte Mythen: Die Resilienz des Kapitalismus
7 Was getan werden müsste, um dem Kapitalismus die Zähne zu ziehen
8 ... und warum es nicht geschehen wird
9 Ausstieg
ANHANG
Anmerkungen
Literatur
0 Einstieg
Denn die einen sind im Dunkeln – und die andern sind im Licht.
Und man sieht nur die im Lichte – die im Dunkeln sieht man nicht.
Bertold Brecht, Dreigroschenoper
Den modernen Kapitalismus unserer Zeit kennzeichnen die gleichen Merkmale wie seit seinem Aufkommen im Zuge der industriellen Revolution: Privateigentum an Produktionsmitteln, Profitorientierung, Wettbewerb auf Märkten und vor allem das Mantra: »mit Wachstum zum Wohlstand«. Und dennoch erleben wir heute, nach der umfassenden Deregulierung der Finanzmärkte im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts, einen neuen, entfesselten Finanzkapitalismus, einen Kapitalismus 2.0, der seine Gier und Zerstörungskraft deutlich erweitert hat. Trotz zahlreicher Krisen, die der Kapitalismus selbst verursacht und ihn oft an den Rand seiner Existenz treiben (Klimakrise, Finanz- und Schuldenkrise, Pandemie), erweist er sich immer wieder als überaus resilient und setzt seinen destruktiven Kurs unbehindert fort: Er zerstört unsere Lebensgrundlagen, er bedroht unsere Demokratie und unterminiert unsere Moral. Wenn wir ihn nicht rechtzeitig stoppen, dann gilt: nächster Halt: Abgrund.
Ich bin, Jahrgang 1956, im Wohlstand der Nachkriegsjahre aufgewachsen. In einem Elternhaus, das man nicht als wohlhabend, aber als gut mittelschichtig bezeichnen kann. Die Wirtschaftswunderzeit der 1960er- und ersten Hälfte der 1970-er Jahre waren wie bei vielen so auch bei uns eine Zeit des steigenden Konsums. Und auch die Jahre danach waren für unsere Familie gute Zeiten, materiell und auch sonst.
Wenn ich heute dieses Buch gegen den Kapitalismus, in dem ich groß geworden bin, schreibe, dann hat das sicher auch mit meiner Sozialisation in den frühen 1970er-Jahren zu tun, nach Studentenrevolte, nach dem (viel zu zarten, vor allem späten) Beginn der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, in der Zeit von Willy Brandt (»Mehr Demokratie wagen«) und vielen anderen Erscheinungen, die alle grosso modo als politisch links zu verorten waren. Mit dem heutigen Wissen und der damaligen Einstellung würde ich jetzt bestimmt zum Umsturz, zur Revolution aufrufen. Das möchte ich heute nicht mehr. Aber eines treibt mich über die vielen Jahre seit 1972 um – wenn ich dieses Jahr einmal als repräsentativen Fixpunkt meiner damaligen prägenden Zeit ansetze –, und das ist die Ungerechtigkeit in Deutschland und der Welt, die sich heute in nichts so sehr deutlich macht wie in der immer weiter zunehmenden Ungleichheit zwischen Arm und Reich, in der stetig auseinandergehenden Schere zwischen denen, die im Wohlstand leben (»die im Licht«) und denen die in Armut, in Unfreiheit oder in anderen prekären Zuständen verweilen müssen (»die im Dunkeln«). Und in dieser immer weiter wachsenden Ungleichheit habe ich bereits früh erkannt und sehe es bis heute unverändert so, dass es die kapitalistische Wirtschaftsform ist, die dafür verantwortlich ist. Eine so immense Ungleichheit, wie wir sie heute erleben, in Deutschland, in Europa, aber auch zwischen den reichen und armen Ländern der Welt, ist eine empörende Ungerechtigkeit. Der Kapitalismus, der heute als Gesellschaftsform alle Bereiche unseres Lebens durchdringt, ist nicht human, nicht sozial, nicht demokratisch, nicht naturliebend und nicht wirklich werthaltig. Was liegt also näher als ihn abzuschaffen?
Der Text, den ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, hier vorlege, möchte zweierlei zu gleich sein: Essay und Traktat. Wenn Sie seine Thesen und Ausführungen für ungenügend erachten, vielleicht seine Zielrichtung gänzlich verwerfen sollten, dann haben Sie den Text vermutlich als Traktat gelesen und seinen essayistischen Anspruch übersehen. Falls Sie das Buch rundheraus und vollständig befürworten sollten – was mir natürlich deutlich mehr zusagte –, dann bliebe dennoch bei mir ein kleiner Zweifel, ob es mir gelungen ist, seine grimmige Ernsthaftigkeit, die eines Traktats nämlich, richtig zu übermitteln.
Mir geht es beim Schreiben dieses Buches darum, bei den Leser:innen einen »Katharina Blum«-Effekt auszulösen (ohne mich mit dem großartigen Heinrich Böll auf gleiche Stufe stellen zu wollen).1 Das Buch soll unterhalten und zugleich aufrütteln. Es behandelt als Essay die Frage »worin liegt die Ursache all der Krisen, die wir heute und bereits seit vielen Jahren erleben?« und beantwortet als Traktat diese Frage, unterlegt mit zahlreichen Fakten, mit: »der Kapitalismus ist es, vor allem der immer gefräßigere Finanzkapitalismus«. Und dennoch bleibt es essayistisch dabei, dass die Frage eine Frage bleibt, die nach angemessenen Antworten verlangt, vor allem nach der entscheidenden Antwort »wie und womit wir diesen Zerstörer Kapitalismus überwinden und eine neue, bessere Gesellschaftform aufbauen können«. Auch einen kleinen Beitrag zum Einstieg in diese Fragestellung versucht das Buch zu geben.
Das Vorhaben, die These vom Kapitalismus als dem großen Zerstörer zu belegen, gehe ich in acht Schritten (Kapitel) an. Das auf diese Einleitung folgende Kapitel 1 klärt einige Begriffe zur kapitalistischen Wirtschaftsform, zu Wettbewerb, Wachstum und Globalisierung, und problematisiert den Begriff der »sozialen Marktwirtschaft«. Anschließend nimmt Kapitel 2 ein Thema auf, zu dem in den meisten Gesellschaften breite Übereinstimmung vorherrscht: den Klimawandel und alle weiteren beängstigenden Bedrohungen, die das Potenzial haben, unserer Lebensgrundlagen zu zerstören. Und vermutlich werden die meisten Menschen sogar darin übereinstimmen, dass hier der Kapitalismus zumindest als eine wichtige Ursache dieser Malaise in Betracht kommt. Das Kapitel 3 widmet sich der Entwicklung der Demokratie(n) unter dem Einfluss und zunehmendem Druck des Kapitals, das die Demokratie nicht als Staatsform benötigt oder gar wertschätzt, sondern lediglich als Wegbereiterin und Förderin für ihre profitablen Geschäfte. Da der Kapitalismus aber blind für das Soziale in den Gesellschaften ist, neigt er dazu, die Demokratien an den Rand ihrer Existenz zu drücken, sodass diese drohen, ins Illiberale oder Autokratische abzurutschen.
Im Kapitel 4 steht unsere »imperiale Lebensweise« im Mittelpunkt. Dieser Begriff kennzeichnet den simplen, aber folgenreichen Umstand, dass wir in den reichen Ländern des globalen Nordens unser Leben prinzipiell auf Kosten der Menschen im globalen Süden führen, was sich leicht anhand der globalisierten Lieferketten verdeutlichen lässt, die bei den Rohstoffen unserer Produkte beginnen und bei der Entsorgung unserer Abfälle und dem (für uns) nicht mehr Verwendbarem enden. Kapitel 5 wirft einen Blick auf den Finanzkapitalismus, der als Turbokapitalismus seit der Deregulierung der Finanzmärkte zum Ende des vergangenen Jahrhunderts das metastasierende Krebsgeschwür schlechthin repräsentiert, das Ausbeutung und Mehrwert des »Webstuhl- und Dampfmaschinen-Kapitalismus« eines Karl Marx um Dimensionen übertrifft. Dem Finanzkapitalismus mit seiner Entkopplung von der Realwirtschaft widmet sich im Übrigen das ganze Buch.
Mit enttäuschten Hoffnungen und entzauberten Mythen, die sich im und um den Kapitalismus entwickelt haben, beschäftigt sich Kapitel 6. Hier geht es um die Fossilwirtschaft, die — obwohl moralisch vollständig desavouiert – sich als erstaunlich vital erweist, es geht um grüne Hoffnungen, die nicht aufgehen, um den demokratischen Staat, der durch die Bedingungen des Kapitals seine Handlungsfähigkeit immer mehr einbüßt, und es geht um unsere Moral, die sich vom Kapital so leicht bestechen lässt, um vom Kuchen, den uns das Kapital in pawlowscher Manier vor die Nase hält, immer mehr abzubekommen. Wenn wir – anders als in Kapitel 6 gezeigt – frei in unseren Entscheidungen wären, müssten wir den Kapitalismus abschaffen. Welche Maßnahmen hierzu denknotwendig wären, wird in Kapitel 7 angerissen, ohne dass hier der Anspruch eines komplett durchdachten und ausformulierten Modells erhoben wird.
Kapitel 8 bildet dann die Antithese zum vorangegangenen Kapitel. Es macht noch einmal deutlich, warum es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Ansätze zu einem »geordneten« Rückbau des Kapitalismus und Aufbau einer alternativen, menschenwürdigen Wirtschafts- und Gesellschaftsform, umgesetzt werden. Einer von mehreren Faktoren hierfür stellt die gegenwärtige geopolitische Lage dar. Ohne eine apokalyptische Entwicklung zu beschreiben, zeichnen sich doch soziale Kipppunkte im globalen Süden und globalen Norden ab, die das Potenzial haben, den Kapitalismus in eher chaotischer Weise zu stürzen. Das Schlusskapitel 9 findet dann doch einen etwas versöhnlicheren Ausgang, ohne Hollywood-Ende zu sein. Unsere Vernunft, unsere Kreativität und unser Humanismus müssen noch einmal eine große Kraftanstrengung erbringen, um in einem universalistischen, kosmopolitischen Angang eine bessere Welt ohne Kapitalismus zu schaffen. Vielleicht ist es dafür doch noch nicht zu spät. Das Potenzial in der Welt ist jedenfalls ohne Zweifel vorhanden ...
1 Kapitalismus, der Zerstörer
»Natürlich kann sich der Kapitalismus an ganz viele Sachen anpassen, aber er kann nicht aufhören, wachsen zu wollen, und er kann nicht aufhören, sich an Profit zu orientieren.«
Eva von Redecker2
Der moderne Kapitalismus hat viele Gesichter. Sie zeigen sich an verschiedenen Orten und in verschiedener Gestalt. Manche versuchen uns mit einem Lächeln von der Harmlosigkeit seiner Absichten zu überzeugen, manche drohen mit deutlicher Mimik. Manche suggerieren über einen verschleiernden Begriff, dass er gar nicht hinter der Maske steckt, sondern ein wohlwollender anderer. Aber er ist immer präsent. Er durchdringt auf diesem Planeten unser aller Leben in allen Bereichen. Er, der Kapitalismus.
Ob es das überbordende Warenangebot in unseren Geschäften und im Internet ist, ob es Hunger und Armut im globalen Süden sind, ob es der anonyme Milliardär oder der gewiefte Hedgefonds-Manager ist, ob es Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte sind, ob es Pandemien und Kriege sind, ob es die stetig wachsenden Berge an Plastikmüll und Computerschrott sind, ob es die rücksichtslose Ausbeutung unseres Planeten ist, ob es die Klimakatastrophen und die sterbenden Arten sind, ob es sich als soziale Marktwirtschaft bezeichnet oder als dirigistische Staatswirtschaft vorstellt, immer ist er es, der sich dahinter verbirgt, der steuert und die Fäden in der Hand hält. Er, der Kapitalismus.
Es wird den Leser/die Leserin nicht verwundern, dass die zentrale These des Buches lautet: Der Kapitalismus ist der große Zerstörer. Dies ist nicht weit entfernt von den Aussagen der US-amerikanischen Philosophin und Feministin Nancy Fraser, die mit Ihrem Werk»Der Allesfresser«3 eine zeitgemäße Kapitalismuskritik bot. Und in der Tat: Der Kapitalismus ist ein Allesvertilger, der hin und wieder dazu neigt, die eigenen Grundlagen und Bedingungen seiner Existenz zu verzehren. Es ist dann immer der Staat, der ihn rettet, ihm ein weiteres Mal »Kredit« gewährt und ihm ermöglicht, mit neuem Schwung sein zerstörerisches Werk fortzusetzen.
Wenn ich hier von »dem Kapitalismus« spreche, ist allerdings festzustellen, dass es sich bei diesem nicht um ein simples, unkomplexes Konzept handelt. Kapitalismus ist kein Objekt, das man anfassen kann. Was man mit den Sinnen erfassen kann, sind lediglich seine Wirkungen. Üblicherweise verbindet man mit dem Kapitalismus zweierlei: das Privateigentum an den Produktionsmitteln und den Wettbewerb auf Märkten. Unternehmen wandeln Produktionsmittel in Waren und Dienstleistungen, um sie auf Märkten anzubieten und an Abnehmer zu veräußern. Die auf Karl Marx zurückgehende Formel hierfür lautet: G W G‘ (Geld Ware oder Dienstleistung mehr Geld). Ziel des Prozesses der Umwandlung der Produktionsmittel ist also der Gewinn/der Profit, der zum großen Teil beim Unternehmenverbleibt.
Es gibt sicher noch einige weitere Merkmale kapitalistischer Wirtschaftsweise, wie z.B. ein Kreditwesen zur Finanzierung von Investitionen, eine arbeitsteilige Gesellschaftsstruktur und anderes mehr. Ein entscheidendes Kennzeichen des Kapitalismus, vor allem in Würdigung seines zerstörerischen Potenzials, ist der ihm immanente Zwang zum Wachstum. So wie das einzelne Unternehmen sich im Wettbewerbmit anderen misst und in diesem Messen eine Dynamik entfaltet, immer wieder neue Produkte zu entwickeln und von diesen immer mehr abzusetzen, so messen sich die Staaten dieser Welt ebenso mit ihren Wachstumsraten, basierend auf den in den Ländern produzierten Waren und Dienstleistungen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und seine Veränderungen gehören für die Ökonomen dieser Welt zu einer Art Lingua Franca des Wirtschaftslebens. Sie zeigen gleichzeitig den Investoren (Kapitaleigner, »Kapitalisten«) dieser Welt den Weg, den ihr Kapital einschlagen sollte. Dort, wo die größten Wachstumsraten erzielt werden, versprechen auch die Investitionen den größten Profit. Im Umkehrschluss wird ein Land, das kein Wachstum aufweist, dessen BIP vielleicht zurückgeht, möglicherweise sogar ein paar Jahre in Folge, zu einem »kranken Mann« (warum eigentlich männlich?) gestempelt. In Deutschland kennt man dies ...
Und die Menschen, die im Erwerbsleben stehen, spüren nicht nur den Wettbewerb, sondern verspüren auch den Antrieb zum »Wachstum«. Wachsen sollen das Einkommen und der Konsum, gleichzeitig die Gestaltungsmöglichkeiten und die Lebensfreude. Auch unseren Kindern bringen wir früh bei, etwas zu »leisten«, damit »man es später besser hat im Leben«, möglichst auch mehr zu leisten als andere, ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen kann wertvoll sein. Wachstum und Wachstumszwang gehören zum Kapitalismus, mehr noch als Privateigentum an Produktionsmitteln und Märkte.
Wenn Wachstum unter Wettbewerbsbedingungen zum Maßstab wird, gibt es neben den Gewinnern auch Verlierer, und diese sind üblicherweise deutlich zahlreicher als jene. Ungleichheit innerhalb von Gesellschaften und zwischen Gesellschaften ist nicht per se ein konstituierendes Merkmal kapitalistischer Wirtschaftsweise, aber notwendig ihre Folge. Dies war zu Zeiten der Dampfmaschinen nicht anders als heute in der Ägide von Kryptowährungen und künstlicher Intelligenz. Nur dass wir es heute mit einem Ausmaß an Ungleichheit zu tun haben, die früher kaum denkbar war. Während rund 733 Millionen Menschen auf der Welt Hunger leiden4 und fast 3,6 Milliarden Menschen unter der Armutsgrenze von 6,85 US-Dollar leben5, leisten sich die rund 2.800 Milliardäre einen gigantischen Lebensstandard.6 Während die Zahl der Armen seit 1990 bis heute in etwa unverändert geblieben ist, stoßen jede Woche vier neue Milliardäre zum exklusiven Klub hinzu. Ein Problem dieser Milliardäre – eines unter vielen – ist ihr gewaltiger »CO2-Fußabdruck«.7 Auch in diesem zeigt sich eine Facette der zahlreichen Ungleichheiten auf diesem Planeten.
In allem erkennen wir, dass Kapitalismus mehr ist als eine Form des Wirtschaftens. Kapitalismus ist eine Gesellschaftsform. Nancy Fraser formuliert treffend:
»Der [...] Kapitalismus ist aber auch tief in scheinbar nicht ökologische Formen sozialer Ungerechtigkeit verwickelt, von der Klassenausbeutung über rassistisch-imperialistische Unterdrückung bis hin zu geschlechtlicher und sexueller Dominanz. Und auch in auf den ersten Blick nicht ökologischen gesellschaftlichen Schieflagen spielt der Kapitalismus eine zentrale Rolle: in Krisen der Fürsorge und der sozialen Reproduktion, der Finanzen, der Betreuungsketten, der Löhne und der Arbeit, der Regierungsführung und der Entdemokratisierung.«8
Wenn wir von »dem Kapitalismus« sprechen, sollten wir eine Unterscheidung im Hinterkopf haben, nämlich die zwischen Real- und Finanzwirtschaft. Bei der Realwirtschaft haben wir es mit dem »klassischen« Kapitalismus zu tun, der noch bis zum Ende der 1970er-Jahre vorherrschend war und der durch Waren- oder Dienstleistungsproduktion und das oben genannte Marx‘sche Profitgesetz G W G‘ gekennzeichnet ist. Mit der Deregulierung der Finanzmärkte9 gewann die Finanzwirtschaft zunehmend an Bedeutung und ist heute der unbestreitbar dominante Aspekt des Kapitalismus. Die Ökonomen verwenden für das wertmäßige Verhältnis zwischen beiden (Finanz- und Realwirtschaft) den Begriff der »Finanztiefe«. Betrachtet man nur den Wert der weltweit umlaufenden Aktien und Anleihen (der Finanzmärkte), so ergibt sich bereits ein Verhältnis zur Realwirtschaft (gemessen am Welt-BIP, der Weltproduktion an Waren und Dienstleistungen) von 4:1 (eine Finanztiefe von 400 Prozent). Nimmt man noch Derivate hinzu, muss man von einem Verhältnis von mindestens 10:1 ausgehen.10 Manche sprechen insgesamt – unter Einschluss aller übrigen Finanzgeschäfte – von einem astronomischen Verhältnis von 50:1 oder darüber hinaus.11 Wir werden die Konsequenzen, die sich aus diesen Umständen ergeben, im Kapitel 5 weiter untersuchen. Deutlich wird aber bereits, dass der Kapitalismus als Finanzkapitalismus ein anderes Gesicht hat als der alte Kapitalismus der Realwirtschaft, ein Gesicht, hinter dem sich ein weitaus größeres Zerstörungspotenzial verbirgt. Auch dürfte anhand der Finanztiefe klar sein, dass das Profitgesetz G W G‘ im Finanzkapitalismus durch ein neues Gesetz ergänzt werden muss, nämlich G G‘. Aus Geld wird mehr Geld – ohne den Umweg über eine Warenproduktion. Und dieses Gesetz nimmt mehr und mehr Raum ein.