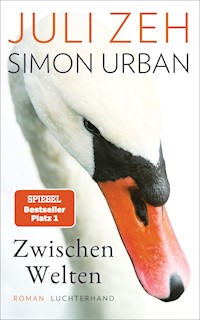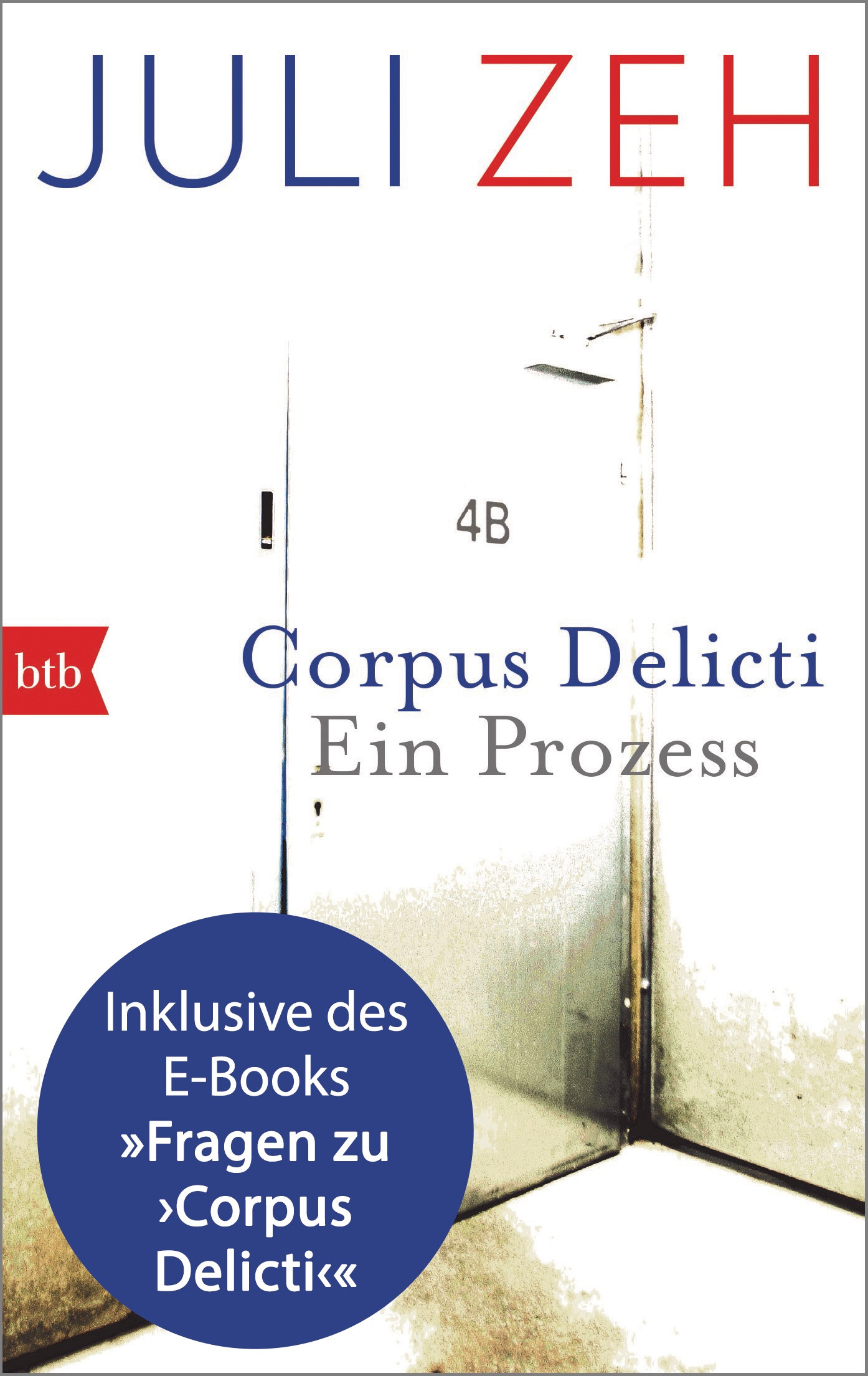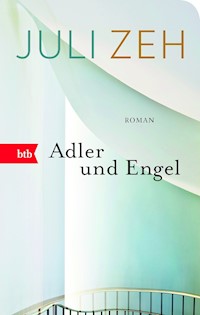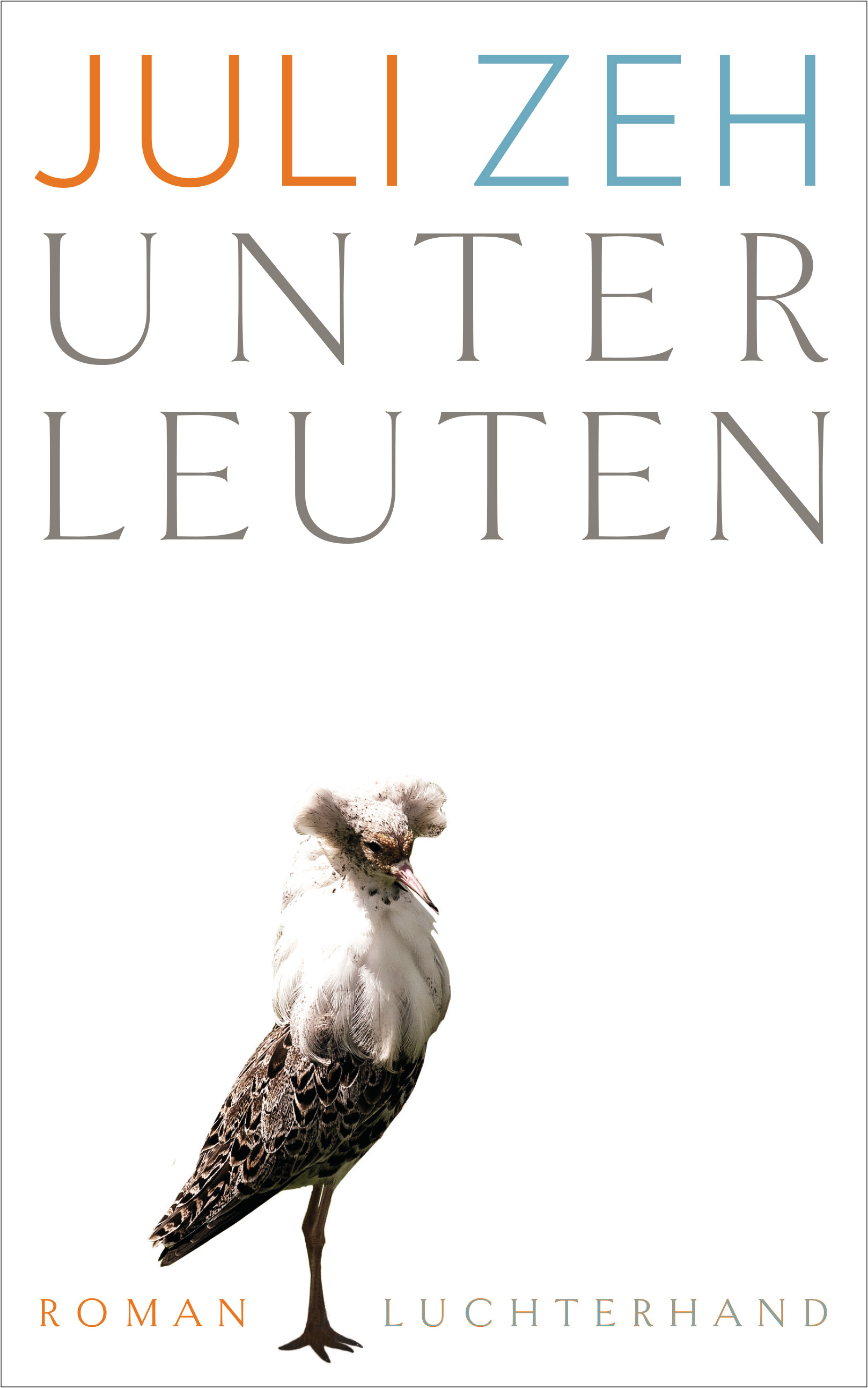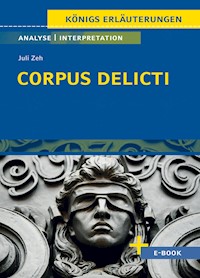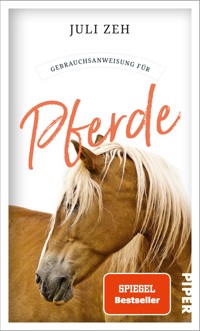9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die NSA-Affäre hat viele Internet-Nutzer verunsichert und verwirrt. Wir, die Politikverdrossenen, die »Einfach- so-Egozentriker«, die Selbstquantifizierer, melden uns hektisch von Facebook und Co. ab. Juli Zeh, die einen weltweiten Schriftstellerprotest gegen die Überwachung initiiert hat, sieht das nicht ein. Engagiert verteidigt sie die Freiheit des Wortes und ermutigt uns, sie ebenfalls einzufordern. Sie hinterfragt, warum wir uns ein vorgefertigtes Schema von »Glück« überstülpen lassen, das »gesamtgesellschaftliche Zirkeltraining« klaglos mitmachen und uns so zu einer einheitlichen Masse entwickeln, die ihre Mündigkeit verspielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Titel
Vorbemerkung
Auf der anderen Straßenseite (2005)
Gute Nacht, Individualistinnen (2006)
Zeit war Geld (2006)
Das Flaggschiff der politischen Resignation (2006)
Wer hat mein Lieblingsspielzeug zerbrochen? (2006)
Zu wahr, um schön zu sein (2006)
Gigagroße Semi-Diktatur (2007)
Kostenkontrolle oder Menschenwürde? (2007)
Folterjuristen (2008)
Verteidigung des Virtuellen (2008)
Vater Staat und Mutter Demokratie Rede im Rahmen der 16. Schönhauser Gespräche (2008)
Goldene Zeiten(2008)
Plädoyer für das Warum Rede anlässlich der Verleihung des Carl-Amery-Literaturpreises (2009)
Null Toleranz (2009)
Fest hinter Gittern (2009, mit Rainer Stadler)
Schweinebedingungen (2009)
Deutschland dankt ab (2010)
Das Mögliche und die Möglichkeiten Rede an die Abiturienten (2010)
Das tue ich mir nicht an (2011)
Mörder oder Witzfiguren (2011)
Leere Mitte (2011)
Die Sache »Mann gegen Frau« (2011)
Nothing left to lose (2011)
Hölle im Sonderangebot (2012)
Baby Love (2012)
Eine Geschichte voller Missverständnisse (2012, mit Ilija Trojanow)
Selbst, selbst, selbst (2012)
Das Diktat der Krise (2012)
Stille Schlachtung einer heiligen Kuh (2012)
Das Lächeln der Dogge (2013)
#neuland (2013)
Wird schon (2013)
Digitaler Zwilling (2013)
Nachts sind das Tiere (2013)
Was wir wollen Rede auf der Netzkultur-Konferenz der Berliner Festspiele (2013)
Wo bleibt der digitale Code Civil? (2014)
Letzte Ausfahrt Europa (2014)
Offener Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 15. Mai 2014
Reizklima (2014)
Nachweise
Zur Autorin
Zum Buch
Impressum
Juli Zeh
Nachts sind das Tiere
btb
Impressum
Vorbemerkung
Die vorliegenden Essays und Reden sind nicht thematisch gruppiert, sondern chronologisch angeordnet. Sie stellen eine Auswahl aus dem publizistischen Schaffen der Autorin dar und umfassen nahezu ein Jahrzehnt der politischen Einmischung, der kritischen Analyse gesellschaftlicher Phänomene und des Eintretens für eine humanistische, freiheitlich geprägte Geisteshaltung. Die Beiträge wurden überarbeitet.
Auf der anderen Straßenseite (2005)
Mit den Menschenrechten ist es eine komische Sache. Ähnlich wie bei den zehn Geboten meint jeder zu wissen, was drinsteht. Soll er sie aber zitieren, kommt er zu seiner eigenen Überraschung nicht über die ersten Artikel hinaus. Naja, das mit der Würde. Dann Gleichheit, Leben, Freiheit, vielleicht noch Sklaverei- und Folterverbot. Danach, seien wir ehrlich, wird’s dünn.
Aber die Menschenrechte sind ein ganz besonderer Text. Sie sind eine Botschaft, die die Menschheit an sich selbst geschrieben hat – und möglicherweise die einzige Botschaft der Welt, bei der es nichts ausmacht, wenn niemand ihren Inhalt kennt. Egal, wo wir sie aufschlagen, hineinblättern und zu lesen beginnen, wir können uns darauf verlassen, mit dem Gelesenen einverstanden zu sein. Ausgeschlossen, dass wir denken wollten: Ich lehne es ab, das Recht auf körperliche Unversehrtheit zu schützen! Oder: Meiner Meinung nach ist Redefreiheit eine schlechte Idee. – Es geht schon längst nicht mehr darum, die Menschenrechte gut oder schlecht zu finden. Sie sind gut, scheint uns, ja, vermutlich sind sie Ausdruck des Guten an sich. Man kann ihre unzureichende Umsetzung kritisieren, die Tatsache, dass sie bis heute unverbindlich und nirgendwo einklagbar sind. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der den Wert und die Richtigkeit ihres Inhalts bestreitet.
Ist das nicht phänomenal? Ein zehnseitiger Text, und alles, was er enthält, ist wahr und trifft zu! Jeder Schriftsteller müsste die Vereinten Nationen um ihr Werk beneiden.
Solche Worte schreibe ich mit ambivalenter Ironie. Auf der einen Seite verblüfft es mich tatsächlich, ganz ironiefrei und im positiven Sinn, dass in einer Gesellschaft, die gern mit Begriffen wie »Werteverlust«, »Orientierungslosigkeit« oder gar »Amoralität« belegt wird, in Wahrheit ein Konsens von nie da gewesener Breite über die Grundvorstellungen vom Guten und Wünschenswerten existiert.
Auf der anderen Seite aber birgt der fast schon kindlich-naive Glaube an Sinn und Nutzen der Menschenrechte eine nicht unerhebliche Gefahr für ihre Wirksamkeit.
Dabei geht es mir an dieser Stelle nicht darum, ob und inwieweit die Idee universeller Rechte für die internationale Interessenpolitik instrumentalisiert wird. Auch nicht darum, ob »Universalität« überhaupt mehr sein kann als eine Fiktion angesichts des westlich-europäischen Hintergrunds der in der UNO-Erklärung enthaltenen Gedanken. Ebenso wichtig wie solche Fragen der »großen Politik« ist der Blick auf die persönlichen Wertvorstellungen und Grundsätze jedes Einzelnen von uns. Hier nämlich führt der oben erwähnte Glaube zu einem unangenehmen Mangel an Distanz.
Mit Menschenrechtsverletzungen ist es anscheinend wie mit Bildern auf großen Plakatwänden: Man erkennt sie immer nur von der anderen Straßenseite aus. Undenkbar, in Deutschland könnte mit dem Menschenrechtsverständnis etwas nicht in Ordnung sein (abgesehen vielleicht von klitzekleinen Kleinigkeiten). Jedes Land meint, es habe die Forderungen des UNO-Papiers vortrefflich erfüllt, während anderswo – leider, leider – noch immer erhebliche Defizite bestünden. Behaupten die Türkei oder China, im eigenen Haus stehe es mit Freiheit, Gleichheit und Würde zum Allerbesten, verziehen wir höhnisch den Mund – um gleich darauf zu verkünden, in Deutschland seien Menschenrechtsverletzungen natürlich völlig abwegig. Und das kommt uns noch nicht einmal komisch vor.
So ist das mit dem Glauben, ob an die zehn Gebote oder an die hehren Ideale der UNO: Er ist stark, schön und gut für die Seele. Aber er ist nicht immer der Königsweg zu Gerechtigkeit und notwendiger Selbstkritik.
Bürgerrechtler in Deutschland und anderen Ländern der westlichen Hemisphäre warnen seit Beginn des Anti-Terror-Kriegs davor, die Errungenschaften eines langen Freiheitskampfes aufgrund von panischen Sicherheitsbedürfnissen leichtfertig aufzugeben. Solche Menschenrechts-Unken erklärt man gern für hysterisch (so schlimm sei es ja noch nicht) oder für blind (der Ernst der Lage dürfe nicht verkannt werden).
Rasterfahndungen, staatliche Zugriffe auf private Konten, erweiterte Abhörbefugnisse und die Registrierung unbescholtener Bürger mithilfe von Fingerabdrücken sind Praktiken, die uns vor Kurzem noch als Paradebeispiele für menschenrechtsverachtendes staatliches Handeln erschienen wären. Heute aber gelten derartige Maßnahmen als »notwendig«. Während die Bilder von Misshandlungen im Gefängnis von Abu Ghraib für Entsetzen sorgen, diskutieren gleichzeitig anerkannte deutsche Juristen in anerkannten Fachzeitungen über die Frage, ob Foltermethoden gegenüber bestimmten Delinquenten nicht erlaubt sein sollten.
Man muss nicht weit gehen, nicht einmal bis auf die andere Straßenseite, um zu erkennen, dass sich auch in unserem Land ein bedenklicher Bewusstseinswandel breitmacht. Auf einmal wird immer öfter die schlecht verkleidete Frage gestellt, ob man sich individuelle Freiheitsrechte angesichts von Terror, Wirtschaftskrise und sozialer Bedrohung noch »leisten« könne. Plötzlich sind Menschenrechte ein Schönwettervergnügen, dem man getrost in Friedenszeiten frönen kann. Sobald aber ein Konflikt auftaucht, ein Sicherheitsproblem, das als schwerwiegend empfunden wird, scheint es Wichtigeres zu geben. Dann soll pragmatisches Handeln sich durchsetzen gegen die Ansichten realitätsfremder Idealisten.
Wer so denkt, hat überhaupt nichts verstanden. Menschenrechte sind keine Luxusspielzeuge für verwöhnte Wohlstandskinder. Sie sind keine nette, flüchtige Idee, die es im Ernstfall dem realpolitisch Eigentlichen unterzuordnen gilt. Sie sind über Hunderte von Jahren gewachsen und leidenschaftlicher Ausdruck einer Geistesgeschichte, die uns an den (glücklichen!) Punkt gebracht hat, an dem wir heute stehen. Die Rechte des Einzelnen wurden einer in großen Teilen blutigen Geschichte abgerungen, und sie sind ein Lernerfolg aus schlechten Erfahrungen mit überbordender staatlicher Macht.
Das Vertrauen in ihre bedingungslose Einhaltung ist im Grunde ein gutes Zeichen, ein Ausdruck von Treue zum eigenen Land und seiner Demokratie. Es darf aber nicht dazu führen, den einmal erreichten Standard für selbstverständlich zu halten. Aus dem Gefühl von Selbstverständlichkeit wird schnell Gleichgültigkeit. Und schließlich Erstaunen darüber, auf unbemerkte Weise verloren zu haben, was man doch sicher glaubte.
Gute Nacht, Individualistinnen (2006)
Neulich nach einer Podiumsdiskussion. Ich bin von der Bühne geklettert, stehe im Foyer der Sendeanstalt herum und halte mich an einem Glas Rotwein fest. Das Publikum strebt aus dem Saal, um an der Garderobe nach Mänteln zu suchen oder die angebotenen Getränke entgegenzunehmen. Der Moderator ist mit einem anderen Talk-Gast in eine Fortführung des Gesprächs vertieft. Plötzlich kommen drei Frauen auf mich zu. Sie sind Mitte fünfzig, gut gekleidet und setzen die Füße so resolut auf den Boden, dass ich ahne, was sie von mir wollen.
Der Schweiß sei ihnen ausgebrochen. Auf den Unterarmen hätten sich die Haare aufgestellt. Es habe ihnen die Kehlen zugeschnürt und die Mägen umgedreht.
»Wie«, frage ich vorsichtig, »lautet die Anklage?«
Zweimal hätte ich mich während der Diskussion als »Jurist« und einmal als »Autor« bezeichnet! Man ist gekommen, um ein weibliches Suffix einzutreiben.
Das passiert mir nicht zum ersten Mal. Seufzend entschuldige ich mich. Erkläre, dass das Weglassen der Endung »-in« keiner antifeministischen Programmatik, sondern purer Achtlosigkeit entspringe (man glaubt mir nicht). Ergänze, dass die Berufsbezeichnung »Autor«, ähnlich dem englischen »author«, einen neutralen Klang für mich besitze (man glaubt mir noch weniger). Verlange, nicht auf ein role model reduziert zu werden und reden zu dürfen, wie mir der Schnabel gewachsen ist (man wird wütend).
Auf einem öffentlichen Podium sei ich eine öffentliche Person, heißt es, und hätte mich dieser Verantwortung zu stellen.
Das verpflichte mich nicht zu einem Auftritt als feministische Frontfigur, gebe ich zurück.
Die drei Frauen wetzen ihre unlackierten Fingernägel und treten einen Schritt auf mich zu. Um einer lautstarken Protestaktion zuvorzukommen, ergehe ich mich in beschwichtigenden Ausführungen.
Ich sei eine Nachgeborene. Ein Nutznießer, Pardon, eine Nutznießerin vergangener Schwesternkämpfe. Der lebende Beweis, dass die Emanzipation wenigstens in Teilen der Gesellschaft glücklich ins Ziel gelaufen sei.
Ob ich mich denn gar nicht mit der Frauenbewegung identifiziere?
»Nein«, behaupte ich forsch. »Ich identifiziere mich nicht einmal mit der Frau.«
Das anschließende Schweigen hat die Kälte eines blankgezogenen Schwerts. Ein Kellner bringt das nächste Glas Wein und ignoriert meine hilfesuchenden Blicke. Es wird höchste Zeit für einen Themawechsel.
»Lassen wir doch die Geschlechterfrage einmal beiseite«, schlage ich vor, »und betrachten das Problem von einer anderen Seite.«
Meine Gesprächspartnerinnen fixieren mich angriffslustig. Friedensangebot abgelehnt. Mir bleibt die Flucht nach vorn.
»Dem weiblichen Geschlecht anzugehören, ohne sich darüber zu definieren«, sage ich, »hat nichts mit Verrat an der weiblichen Sache zu tun. Auf ähnliche Weise lebe ich in Deutschland, ohne mich als Deutsche zu fühlen.«
Den erneut aufkeimenden Widerstand ersticke ich unter einer Lawine von Beispielen: »Ich wurde in Bonn geboren und bin keine Rheinländerin. Ich habe zehn Jahre in Leipzig gewohnt und weiß mit den Begriffen Ossi und Wessi nichts anzufangen. Ich spreche keinen Dialekt, trete keinen Vereinen bei und fiebere für keine Fußballmannschaft. Genau genommen schreibe ich sogar Bücher, ohne mir Rechenschaft darüber abzulegen, was eine Schriftstellerin ist.«
Ob ich sie auf den Arm nehmen wolle?
»Meiner Erfahrung nach«, füge ich, mutig geworden, hinzu, »folgt aus solchen Etikettierungen vor allem eins: ein Haufen Ärger.«
Ob ich deshalb beschlossen hätte, mich jeder Form von Identität krampfhaft zu verweigern?
Darüber muss ich nachdenken. Wahrscheinlich ist meine Identität, sofern ich jemals eine hatte, soeben dem Ansturm der drei Erinnyen zum Opfer gefallen.
»Einer Identität liegt keine Entscheidung zugrunde«, widerspreche ich, »sondern eine Entwicklung. Ich werde Ihnen die Zusammenhänge aufzeigen. Wollen wir uns irgendwo hinsetzen?«
Die drei Frauen schütteln die Köpfe. Ich sortiere Standbein und Spielbein und hole tief Luft.
»Den Angehörigen meiner Generation«, sage ich, »brachte man in der Schule bei, dass Nation, Volk, Kultur oder Rasse niemals mehr zählen dürfen als das Individuell-Menschliche. Wir lernten, den eigenen Kopf zu gebrauchen, Autoritäten zu hinterfragen, kollektiven Überzeugungen zu misstrauen. Unsere Sätze beginnen wir nicht mit: Das ist folgendermaßen …, sondern mit: Meiner Meinung nach …, oder: Ich glaube … Und woran glauben wir? An gar nichts. Jedenfalls nicht an objektive Wahrheiten, sondern höchstens an subjektive Erfahrung.«
Worauf ich hinauswolle?
»Moment«, sage ich. »Schon als Kind war mir klar, dass allen Menschen, egal ob Mann oder Frau, schwarz oder weiß, der gleiche Wert zukommt. Man zwang mich nicht, in die Kirche zu gehen. Ich brauchte keine bestimmten Bücher zu lesen; ebenso wenig waren mir irgendwelche verboten. Ich musste keine politische Richtung gut finden und bin meinen Eltern und Lehrern bis heute dankbar dafür.«
»Wie schön«, spotten meine Zuhörerinnen.
»Wir kommen zum entscheidenden Punkt«, sage ich. »Heute flößt mir der Anblick eines Uniformierten oder einer Flagge Unbehagen ein. Politische Parolen klingen lächerlich, manche widerlich, die meisten überflüssig in meinen Ohren. Ich identifiziere mich nicht nur nicht mit der Frauenbewegung. Auch Vokabeln wie Gott, Heimat, Sozialdemokratie, Vaterland oder Familie lösen keine spezifischen Gefühle in mir aus. In der Wahlkabine weiß ich nicht, wo ich mein Kreuz machen soll. In den Zeitungen lese ich, dass ich einer unpolitischen, verhuschten, irgendwie desorientierten Generation angehöre. Und von Ihnen erfahre ich nun, dass ich keine Identität besitze.«
»Sie waren es doch, die behauptet hat …«, sagt eine der Frauen.
»Jeder Mensch braucht eine Identität«, sagt eine andere.
»Jeder Mensch braucht eine Persönlichkeit«, gebe ich zurück. »Die Identität, von der wir sprechen, meint nicht die Übereinstimmung eines Menschen mit sich selbst. Sie meint Zugehörigkeit oder Abgrenzung in Bezug auf Gruppen. Auch ›die Frau‹ ist eine Gruppe.«
»Unpolitisch sind Sie aber wirklich«, sagt die dritte Frau vorwurfsvoll, »wenn Ihnen alles egal ist.«
Mir ist keineswegs alles egal, sonst hätte ich die drei Frauen nicht erfunden und würde diesen Essay nicht schreiben.
»Von wegen egal«, rufe ich deshalb. »Es ist nur so, dass ich mich keinem politischen Lager zugehörig fühle. Ich pflege ein Konglomerat von Ansichten, die in ihrer Gesamtheit weder parteiprogrammatischen Schemata noch der Stoßrichtung einer gesellschaftlichen Gruppierung entsprechen. Ich vermag nicht einmal zu sagen, ob ich rechts denke – oder eher links. Vermutlich bin ich ein radikaler Individualist.«
Ein dreistimmiges Aufstöhnen eint die gegnerische Front.
»Eine Individualistin«, versuche ich.
Daran hat es diesmal nicht gelegen.
Wie schrecklich, finden die drei Frauen. Fast könne ich ihnen leid tun. Diese geistige Heimatlosigkeit sei schockierend, schwindelerregend, ein Abgrund.
»Nein«, sage ich. »Sie ist wunderbar. Noch immer zukunftsweisend. Sie ist das, was die Aufklärung gewollt hat. Sie ist die Haltung eines Menschen, der nicht den Vorgaben von Obrigkeiten, Moden oder dem Zeitgeist vertraut, sondern die individuelle Vernunft gebraucht. Allerdings zeigt sie seit Neuestem ein seltsames Gesicht. Sie hindert am öffentlichen Sprechen.«
Wie ich das meine, wollen die Frauen wissen.
Ich weise auf ein Plakat, das die Veranstaltung ankündigt, die wir gerade hinter uns haben: Schriftsteller und Politik – ein Antagonismus?
Darüber, finden die Frauen, werde doch quer durch die Jahrzehnte gestritten.
»Während der vergangenen Wahl«, sage ich, »waren die überzeugtesten Vertreter des Standpunkts, ein Autor habe sich um seinen eigenen Kram zu kümmern, ausgerechnet – Schriftsteller. Und dabei wurden nicht einmal ästhetische Aspekte ins Feld geführt. Es ging nicht ums Kunstschaffen, sondern um öffentliches Verhalten.«
Endlich ist der Themawechsel geglückt. Drei abwartende Augenpaare sehen mich an.
»Ständig war zu hören«, sage ich, »dass sich ein Autor vor keinen Karren spannen lassen dürfe. Wer einigermaßen bei Trost und klarem Verstand sei, könne niemals repräsentativ sprechen, sondern nur für sich selbst. Sie wissen ja: Man beginnt seine Sätze mit: Meiner Meinung nach …, oder: Ich glaube …«
Weiter, fordern meine Zuhörerinnen.
»Für einen Individualisten«, sage ich, »hat die Vorstellung, mit Parteifarben in Verbindung gebracht zu werden, etwas Unappetitliches. Andererseits ist das öffentliche Für-sich-selbst-Sprechen eine diffizile Angelegenheit. Es kennt keine Schlagworte, durch deren Gebrauch sich die Komplexität eines Themas reduzieren ließe. Ohne einen Baukasten aus abrufbaren Meinungsversatzstücken muss das Rad bei jeder Äußerung neu erfunden werden. Der Individualist hofft nicht, die Massen zu überzeugen. Sein höchstes Ziel besteht darin, mithilfe wohlbegründeter Argumente etwas Sinnvolles zum Diskurs beizutragen. Dabei muss er dem Bewusstsein standhalten, dass er in einer Welt ohne objektive Wahrheiten nicht recht haben kann und deshalb auch nicht recht bekommen wird. Er setzt sich der Lächerlichkeit des Versuchs aus, trotzdem etwas Verbindliches sagen zu wollen. Seine Gegner werden sich nicht nur in einem, sondern in allen Lagern finden. Er kann sich nicht auf den Rückhalt von Anhängern, Parteifreunden, Gleichgesinnten stützen. Wer wird ihm zur Hilfe eilen, wenn ihn die Medienwelt wegen einer unbedachten Aussage in Stücke reißt? Die anderen Schriftsteller? Jene etwa, die am liebsten für sich selbst sprechen?«
Nachdenklich sehen die drei Frauen sich an. Ich nippe an meinem Wein.
»Ich weiß nicht«, meint die erste. »Wie soll jemand, der repräsentatives Sprechen ablehnt, überhaupt etwas Politisches äußern?«
»Politik«, sagt die zweite, »ist schließlich kein Ein-Mann-Betrieb.«
»Sondern eine Art Mengenlehre«, fügt die dritte hinzu.
Ich stelle das Glas beiseite, um die Hände zum Gestikulieren freizuhaben.
»Jetzt wird’s spannend«, erwidere ich. »Wagen wir ein Gedankenspiel. Der Individualist ist das Gegenteil eines Gruppentiers. Unser politisches System konstituiert sich aber wesentlich über den Zusammenschluss von Einzelnen zu Interessengruppen. Also gibt der Individualist nicht nur einen schlechten öffentlichen Redner ab, sondern auch einen schlechten Teilnehmer an repräsentativer Demokratie.«
»Weil er nicht kompromissbereit ist?«, fragen die Frauen.
»Weil er sich nicht mit überindividuellen Zusammenhängen identifiziert. Er hat Schwierigkeiten, Zeit und Kraft in ein Vorhaben zu investieren, das die Unterordnung unter einen gruppendefinierten Sinn verlangt. Damit wird er in politischen Fragen nicht nur sprach-, sondern auch handlungsunfähig.«
»Politikverdrossenheit«, murmeln die Frauen.
»Parteienverdrossenheit«, sage ich. »Aber aus anderen Gründen, als bislang angenommen wird. Möglicherweise steckt hinter dem allgemeinen Unbehagen, das gern als Misstrauen gegenüber der Leistungsfähigkeit oder Integrität unserer Politiker gewertet wird, ein tiefer gehendes Problem. Nämlich eine Geisteshaltung, die sich nicht gut mit der demokratischen Idee verträgt und trotzdem im Angesicht des demokratischen Selbstverständnisses als fortschrittlich gewertet werden müsste.«
Die erste Frau schüttelt den rotgefärbten Pagenkopf, die zweite streicht sich über die kurze Igelfrisur.
»Können Sie das beweisen?«, fragt die dritte.
»Manchmal erkennt man ein Phänomen an den Gegenreaktionen, die es provoziert«, spekuliere ich. »Vor wem haben Staat und Gesellschaft heutzutage am meisten Angst? Nicht der Kommunismus droht unseren Untergang herbeizuführen. Es sind auch nicht andere Staaten, die wir fürchten. Es ist nicht einmal eine bestimmte gesellschaftliche Schicht, auch keine identifizierbare Gesinnung. Es sind Einzelwesen. Als Medienerscheinungen heißen sie Steuersünder oder Sozialschmarotzer, Topmanager oder Terroristen. Frei flottierende Subjekte, die hermetischen Interessen folgen. Was macht ein Schäfer, dessen Schafe scheinbar chaotisch durcheinanderlaufen? Er zählt. Er verlangt Kontrolle. Informationen, Fakten. Was, wenn die neue Datensammelwut einen verzerrten Reflex auf den real existierenden Individualismus darstellte? Auf den unterschwelligen Eindruck, unsere Gesellschaft bekomme es mit einer uferlosen, schwer beherrschbaren Atomisierung zu tun?«
Den Frauen wird das Gespräch zu heiß. Sie schauen sich im Foyer um, das sich zusehends von Abendgästen leert. Der Kellner bietet eine letzte Runde an; wir lehnen ab.
Ob denn Individualismus jetzt etwas Böses sei, fragt die Rotgefärbte schließlich. Gar dem Terrorismus verwandt?
»Nein«, protestiere ich. »Höchstens ist er ein zu wenig erforschtes Phänomen, das unreflektierte Ängste hervorruft. Im Grunde haben wir ihn immer gewollt. Die oft beklagte Ideenlosigkeit der Politik ist doch Merkmal einer lang gehegten Wunschvorstellung: Sie entspricht dem entideologisierten System. Die Politik ist pragmatisch und verwaltet Interessen, während Sinnstiftung Sache des Einzelnen bleibt. Jetzt müssten wir nur noch rauskriegen, wie wir damit umzugehen haben.«
»Und wie?«, fragt die zweite Frau.
»Eine Frage von philosophischem Gewicht«, sage ich. »Der Mensch ist nun mal ein Loch im Nichts. Vielleicht würde es schon helfen, wenn wir das Problem als ontologisch und nicht als sozial oder politisch bewerten würden. Dann könnten wir versuchen, die Angst vor dem In-der-Welt-Sein auf andere Weise auszuhalten als durch das konfliktträchtige Streben nach Identität.«
»Hat sie uns jetzt Loch genannt?«, fragt die dritte Frau.
»Geht’s auch konkreter?«, fordern die anderen beiden, die mit Blicken bereits den Ausgang suchen.
»Nun ja«, sage ich. »Wenn man den Individualismus ernst nimmt, würde es wahrscheinlich nicht schaden, unser politisches System gedanklich weiterzuentwickeln. Meist ist es übel ausgegangen, wenn Mentalitäten die Realitäten zu überholen begannen.«
Wir schlendern gemeinsam zur Garderobe. Ich helfe der Rothaarigen in den Mantel, ohne dass es zu einer Auseinandersetzung über geschlechtsspezifisches Rollenverhalten kommt.
»Denken Sie an etwas Bestimmtes?«, fragt die Frau mit der Igelfrisur.
»Ein Individualist«, sage ich, »würde sich in unserer Welt mit Sicherheit behauster fühlen, wenn seine Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht ausschließlich an die bestehenden Partei-Formationen geknüpft wären.«
»Plebiszite?«, fragt die Dritte argwöhnisch. Sie trägt eine Brille und erinnert mich bei genauem Hinsehen an meine frühere Sozialkundelehrerin.
»Was Besseres«, sage ich. »Wie wäre es, wenn jeder Bürger einen Bruchteil seiner Lohn- oder Einkommenssteuer Jahr für Jahr auf verschiedene Ressorts verteilen könnte? Wenn er seine Finanzmittel jenen Sachgebieten widmen würde, die ihm am Herzen liegen und in denen seiner Meinung nach gute Arbeit geleistet worden ist? Der Effekt wäre durchschlagend, die Meinungsvielfalt bliebe gewahrt. Wir könnten aktiv politisch sein, ohne uns vor der Links-Rechts-Falle zu fürchten. Es wäre kein unauflösbarer Widerspruch mehr, die Politik zur Privatsache erklärt zu haben.«
»Hm«, machen die drei Frauen.
»Nur so eine Idee«, sage ich.
»Würden Sie dem Referat für Frauenfragen ein paar Bruchteilprozente zukommen lassen?«
»Nicht ausgeschlossen«, sage ich unbestimmt.
»Gute Nacht, Schriftsteller«, sagen die drei Frauen.
»Gute Nacht, Individualistinnen«, sage ich.
Zeit war Geld (2006)
Mein fiktiver Freund F. lebt im Dunkeln. Die Jalousien seiner Wohnung sind Tag und Nacht geschlossen. Auf dem Boden des Arbeitszimmers stapeln sich Pizzakartons. Der Schreibtisch verschwindet unter Coladosen und halb leeren Chipstüten. Irgendwo am rechten Rand der Tischplatte befindet sich ein leeres, krümelfreies Quadrat, in dem die optische Maus hin und her wandern kann. Am frühen Nachmittag kriecht F. aus dem Bett und nimmt in Begleitung einer Tasse Pulverkaffee vor dem Bildschirm Platz. Dort verharrt er in gekrümmter Haltung, von wenigen Ausflügen ins Bad oder zum Kühlschrank unterbrochen, bis er in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages mit geröteten Augen auf sein zerwühltes Lager sinkt. Mein Freund F. ist ein Eingeborener des Informationszeitalters.
Den größten Teil seiner Zeit verbringt F. in einer Welt, in der die Menschen weitgehend staatsfrei zusammenleben. Dort gibt es keine Hierarchien, kaum Gesetze, keine Polizei. Die Menschen interessieren sich nicht für Äußerlichkeiten. Gesellschaftlicher Status oder Kleidermoden sind ihnen fremd. Was zählt, sind geistige und handwerkliche Fähigkeiten sowie die Bereitschaft, an einer gemeinsamen Sache mitzuarbeiten. Notwendige Arbeitsteilung wird nicht mithilfe eines Geldsystems organisiert, sondern nach dem Tauschprinzip. Die Angehörigen dieser Gesellschaft tragen keine Baströckchen oder Perlenketten. Sie tragen Kopfhörer und Kassengestell. Ihr Land befindet sich auch nicht auf einem Atoll im Südpazifik, sondern mitten im Herzen des Turbokapitalismus. Am Nabel des technischen Fortschritts. An den Schaltstellen der hochzivilisierten, postindustriellen globalisierten Welt. Und trotzdem so weit weg, dass es von Generationsethnologen und Zeitgeistforschern selten betreten wird.
Genau genommen handelt es sich weniger um ein Land als um ein Selbstverständnis. Seine Anhänger nennen es Open Source. Wenn sich mein Freund F. mit dem Schreibtischstuhl herumdreht, um über dieses Thema zu sprechen, entfaltet sich eine zu hundert Prozent religionsfreie Weltanschauung, von deren Reichweite die transzendental obdachlose Gesellschaft jenseits der geschlossenen Jalousien nicht einmal zu träumen wagt.
Das oberste Gebot der Open-Source-Idee sieht auf den ersten Blick weniger wie eine ethische Überzeugung als nach technischer Richtlinie aus: der Quellcode (Source Code), also der von Menschen lesbare, in einer Programmiersprache verfasste Text eines Computerprogramms, darf nicht geheim gehalten werden; er muss jedem Interessierten offenstehen. Um zu erklären, was Softwarelizenzen mit Gesellschaftsordnung zu tun haben, beginnt F. nicht anders als die Bibel am Ausgangspunkt der Ereignisse, soll heißen: im Paradies.
Als die ersten Bäume im Garten Eden gepflanzt wurden, war Freund F. noch nicht einmal geplant, geschweige denn geboren. In den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts begannen Computerbesessene in den USA, an einer technischen Revolution zu arbeiten. Am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelten die beteiligten Experten neben Programmen für Großrechner eine neue Identifikation, die unter dem Dach des Begriffs »Hacker« ein terminologisches Zuhause fand. Bevor der Ausdruck unter die Räder des Alles-ist-schrecklich-Diskurses geriet, bezeichnete er keineswegs einen Computerkriminellen, der die Sicherheitssysteme privater Unternehmen oder öffentlicher Einrichtungen knackt. Gemeint war vielmehr ein Programmierer, der sich auf der Suche nach Lösungen von kreativer Experimentierfreude leiten lässt. Nach einem viel zitierten Bonmot ist ein Hacker jemand, der einen Weg sucht, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann.
Im Rahmen der Open-Source-Szene folgen Hacker beim Umgang mit den gewissermaßen im Minutentakt auftauchenden Problemen einer bestimmten Methode.
Und die funktioniert so: Der Hacker definiert ein technisches Ziel, das mithilfe eines noch zu schreibenden Programms erreicht werden soll. Er gibt das Ziel und die entstandenen Schwierigkeiten gemeinsam mit einem ersten Lösungsansatz allgemein bekannt. Die Angesprochenen erhalten sämtliche Informationen, die zum Lösungsversuch geführt haben, und somit das Recht, die erstmalig verbreitete Version des Programms zu benutzen, zu testen und weiterzuentwickeln. Mit diesem Recht geht die ungeschriebene Verpflichtung einher, den Quellcode der ursprünglichen Lösung sowie alle darauf basierenden Verbesserungsvorschläge ebenfalls frei zugänglich zu machen. Auf diese Weise wird Schritt für Schritt und unter Ausnutzung einer Ressource, die sich als kollektive Kreativität bezeichnen ließe, ein optimiertes Resultat erreicht. F. bekommt rote Backen, wenn er nur daran denkt.
Neuartig daran ist nicht das Arbeitsverfahren. Das Prinzip offener Quellen und freien Gedankenaustauschs regiert seit jeher das akademische Leben. Die zeitliche und intellektuelle Begrenztheit jedes Einzelnen macht Zusammenarbeit mit anderen zu einer zwingenden Voraussetzung des wissenschaftlichen Fortschritts. Grund für rote Backen bietet eine kleine, aber feine Besonderheit: In der Welt der Universitäten und Forschungsinstitute ist das Ideen-Sharing für gewöhnlich so lange frei, wie es sich im prä-ökonomischen Stadium des reinen Erkenntnisstrebens bewegt. Das Programmieren von Software hingegen ist weniger Wissenschaft als Technik. Es geht nicht um Erkenntnis, sondern um die Entwicklung von Erzeugnissen, die sich – quod erat demonstrandum! – durchaus für die marktwirtschaftliche Verwertung eignen. Aus den »optimierten Resultaten«, die mithilfe der Open-Source-Methode gewonnen wurden (und werden), ist nicht nur eine Epochenwende, sondern auch ein milliardenschwerer Wirtschaftszweig hervorgegangen. Anders gesagt: Auf der Spielwiese der Hacker geht es eigentlich um Geld. Um verdammt viel Geld. Ökonomische Verwertbarkeit aber verlangt nicht »Offenheit«, sondern genau das Gegenteil: Sie bedarf der Verknappung von Ressourcen. Was allgemein zugänglich ist, besitzt keinen monetären Gegenwert. Trotzdem wurden der Personal Computer, das Internet, die ersten Betriebssysteme, Webbrowser und Computerspiele nicht in schalldichten Kammern von wenigen, zur Geheimhaltung verpflichteten Spezialisten erfunden. Sie entstanden unter den Händen von Hackern, das heißt: aus offener Kooperation.
Freund F. kennt drei Gründe für dieses Phänomen. Eins: In einem hierarchisch strukturierten und kontrollierten Arbeitsverfahren wären die umwälzenden Entwicklungen gar nicht zustande gekommen – oder jedenfalls nicht in so kurzer Zeit. Zwei: Zu Anfang unterschätzte die Computerindustrie die potenzielle Marktfähigkeit von Software. Als Stellvertreter eines flächendeckenden Irrtums fragte der Vorstandsvorsitzende der Digital Equipment Corporation noch im Jahr 1977: »Warum sollte irgendjemand einen Computer zu Hause haben wollen?« Diese Fehleinschätzung überließ das Feld für einen langen Zeitraum den freischaffenden Enthusiasten. Drei: F. zeigt auf seine schlecht sitzende Hose, die fehlende Frisur und das ganze unaufgeräumte Zimmer, in dem es verdächtig nach Randgruppe riecht. Die vielleicht wichtigste Ursache für das Funktionieren der Open-Source-Gemeinde besteht in der Existenz von Typen wie ihm.
Denn F. interessiert sich nicht für Geld. Dieser harmlosen Aussage wohnt ein so hoher Skandalwert inne, dass F. gleich prophylaktisch mit der Entkräftung eines Vorurteils beginnt: Er ist keineswegs im Hauptberuf Sohn, im Nebenberuf Student und in der Freizeit arbeitslos. Als Requisiten eines gesellschaftsfähigen Lebens kann er feste Freundin, Kinderwunsch und Steuererklärung vorweisen. Mit Programmieren verdient er, was er zum Leben braucht. Er könnte jedoch noch viel mehr verdienen, wenn er nicht einen Großteil seiner Zeit in Projekte investieren würde, für die er kein Geld bekommt. Zum Beispiel in die Entwicklung von Kword, einem freien Textverarbeitungsprogramm für die Benutzeroberfläche KDE. Seine Mitstreiter, mit denen er täglich im Internet kommuniziert, sind von Beruf Systemadministratoren, Informatiker oder Grafiker, manche auch Lehrer, Werbetexter, Schüler oder Studenten. Auf die Frage, was sie dazu treibt, bis zu sechs Stunden täglich einer unbezahlten Beschäftigung zu widmen, antworten sie: Fun and world domination in sight. Der unverzichtbare Smiley hinter dieser Äußerung ist deutlich zu hören. Was andere »Arbeit« nennen, ist für den Hacker eine Mischung aus Vergnügen und guter Sache. Er hat Spaß am Knobeln, an gelingender Kommunikation und gegenseitiger Bestätigung. Und er geht davon aus, dass Gerechtigkeit in einer Wissensgesellschaft den freien (also: kostenlosen) Zugang zu Informationen verlangt. Deshalb wird die künstliche Verknappung von leicht reproduzierbaren Informationen abgelehnt. Monopole wie Microsoft, die durch die Geheimhaltung von Quellcodes ein Vermögen verdienen, stellen ein Feindbild dar. Die Ausbreitung des konkurrierenden freien Betriebssystems Linux wird als gemeinsamer Erfolg gefeiert.
Die Konsequenzen dieser Einstellung sind von erheblicher Reichweite. Der Hacker kündigt einem Dogma die Gefolgschaft, das im Gewand eines harmlosen Sprichworts als heimliche Königin unsere Gesellschaft beherrscht: Zeit ist Geld. Das herkömmliche Verständnis von Arbeit sieht vor, dass ein Mensch seine Zeit an Interessierte verkauft, indem er seine Dienste anbietet oder ein Produkt herstellt. Dafür bekommt er Geld, das er wiederum in Güter investieren kann, die eine Verkörperung der Arbeitszeit anderer Menschen darstellen. Und so fort. Notwendige Schubkraft erhält der Kreislauf durch den bewussten oder unbewussten Glauben, bezahlte Arbeit sei mehr als notwendiges Übel – nämlich eine Art heiliger Bürgerpflicht. In seinem Aufsatz »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« führt der Soziologe Max Weber diese Mentalität auf eine protestantische Auffassung zurück, nach der diesseitiger ökonomischer Erfolg als sicheres Zeichen für Gottes Gnade gelten darf. Wer so denkt, arbeitet nicht nur für Brötchen, sondern auch für sein Seelenheil und damit für einen Platz inmitten derer, die alles richtig machen. Zwar zählt heutzutage wohl niemand mehr Gottes Liebe am Inhalt seines Geldbeutels ab. Häufig jedoch überleben die alltäglichen Fernwirkungen religiöser Lehren ihren eigenen Ursprung. Fünfhundert Jahre nach der Reformation spielt man hierzulande nicht Tennis, sondern »arbeitet« an seiner Rückhand. Und wer seinen Job verliert, fürchtet nicht nur finanzielle Probleme, sondern soziale Degradierung und Isolation, kurz: den Verlust einer ganzen Existenz.
Indem mein Freund F. bei seiner Tätigkeit das Lustprinzip über das Erwerbsprinzip stellt, betreibt er die Re-Individualisierung seiner wichtigsten nicht erneuerbaren Ressource: Lebenszeit.
Das hieraus resultierende Selbstverständnis ist nicht computergebunden. Zwar wecken Computer offensichtlich auf magische Weise den Spieltrieb des Menschen. Dennoch kann auch Hacker sein, wer kaum in der Lage ist, einen Monitor von einer Mikrowelle zu unterscheiden. Vordenker der Open-Source-Bewegung wie Linus Torvalds, geistiger Vater von Linux, wie der finnische Philosoph Pekka Himanen und der amerikanische Soziologe Manuel Castells subsumieren unter den Hacker-Begriff einen Menschentypus, der Geld zusehends durch andere Kommunikationsmittel ersetzt und seinen Handlungen »Unterhaltung« als höchstes Ziel voranstellt – wobei Unterhaltung in diesem Sinne weniger mit PlayStation 2 als mit der Entfaltung von kreativer Aktivität zu tun hat. Der Hacker ist in einem Umfeld glücklich (und effektiv!), in dem hierarchische und soziale Kontrollmechanismen von individuell-selbstregulativen Organisationsformen abgelöst werden.
Dass die Dynamik der Open-Source-Methode nicht nur in der Software-Welt wirkt, lässt sich an Phänomenen wie der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia beobachten. An ihr arbeiten Tausende von Menschen aus allen Lebensbereichen, durch nichts verbunden als durch einen Internetzugang und den Wunsch, gemeinsam die größte Wissenssammlung der Welt zu erschaffen. Sie ignorieren die Tatsache, dass es die Wikipedia nach unserem gängigen Menschenbild gar nicht geben dürfte. Spätestens seit den Lehren von Thomas Hobbes gehen wir davon aus, dass homo homini lupus est und dass dieser raffgierige und zerstörungswütige Wolf im Menschenpelz kontrollfreie Räume dazu nutzt, um den Krieg aller gegen alle vom Zaun zu brechen. Mit einer kleinen Handvoll Wiki-Skandalen, die in den letzten Monaten das öffentliche Interesse weckten, scheinen sich die Medien um eine Bestätigung dieser These zu bemühen. Ein paar spaßig gemeinte Falscheinträge können jedoch kaum darüber hinwegtäuschen, dass die auf Goodwill, Selbstreinigung und autonome Regulierung setzende Wikipedia vor allem eins tut: Sie funktioniert.
Bevor mein Freund F., ganz Lamm im Nerd-Pelz, die Kopfhörer wieder aufsetzt und sich dem Bildschirm zuwendet, lässt er sich zu einer Prognose hinreißen: Der Erfolg von Open-Source-Produkten und ihren Entwicklern wird die dazugehörige Arbeitsmethode Schritt für Schritt in wirtschaftliche Unternehmen hineintragen. Irgendwann wird die Welt begreifen, dass sie nicht von Gerechtigkeit faseln und gleichzeitig Information als den einzigen unerschöpflichen Rohstoff unserer Zeit nach dem Eisberg-Prinzip verteilen kann: Die kleine Spitze hält den großen Rest unter Wasser. Eine Gesellschaft aus Individualisten wird freie Zeiteinteilung, Selbstorganisation und Vertrauen in den Kooperationswillen ihrer Mitglieder zu ihren Grundpfeilern erheben müssen, wenn sie sich und ihr Wirtschaftssystem im Gleichgewicht halten will. Sie wird lernen, das bislang kaum erforschte Potenzial zu nutzen, welches in der Open-Source-Methode und ihren Anhängern liegt. In Endlichkeit, Amen.
Während ich F.s gekrümmten Rücken betrachte, esse ich die letzte Chipstüte leer. So also sieht ein Bewohner der Insel der Seligen aus. Höchstwahrscheinlich werden Typen wie F. die Welt nicht in einen Paradiesgarten verwandeln. Aber jedenfalls haben Menschenbilder und gesellschaftliche Visionen die Angewohnheit, die Bühne des Geschehens in seltsamen Gewändern und von unerwarteter Seite zu betreten. Allein das ist schon ein Grund für rote Backen. Und für ein bisschen mehr Menschenliebe.
Das Flaggschiff der politischen Resignation (2006)
Es ist wie ein Wunder. Vor der Bundestagswahl im September 2005 war unsere Republik dem Untergang geweiht. Mit schreckgeweiteten Augen sahen wir der ökonomischen Verelendung entgegen. Naturkatastrophen, Kulturkampf und globalisierte Heuschreckenschwärme rüttelten an den Zäunen unserer Vorgärten. Dann kam der Regierungswechsel. Heute, liest man in den Zeitungen, seien wir Exportweltmeister und die drittstärkste Wirtschaftsnation der Welt.
Das waren wir vorher schon. Auch bei den Arbeitslosenzahlen und dem zerrütteten Zustand der sozialen Sicherungssysteme hat sich wenig getan. Geändert hat sich das Wetter und die Stimmung im Land. Beides ist nicht den Taten der großen Koalition zu verdanken. Dennoch unterstützt das Wahlvolk mit fantastischen Zustimmungsquoten eine Kanzlerin, der es bislang gerade mal gelungen ist, bei ihren Antrittsbesuchen in den Hauptstädten nicht vom roten Teppich zu fallen. Statt konsequente Fortführung begonnener Reformen einzufordern, winken die Bürger glotzäugig die größte Steuererhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik durch und lassen sich durch die Fußball-WM von Hartz-IV-Streit, Föderalismusproblemen und völlig unklaren Vorhaben auf dem Gesundheitssektor ablenken. Seit Nicht-Regieren eine eigene Kunstform geworden ist, treibt es erstaunliche Blüten.
Welches Geheimnis verbirgt sich hinter Merkels Erfolgen? Ein bewährter »Trick« postfeministischer Frauen besteht darin, sich kräftig unterschätzen zu lassen, um dann durch Einhaltung der Normal-Null-Linie den Eindruck einer brillanten Leistung zu erzeugen. Auch hat Angela Merkel die abgekühlten transatlantischen Beziehungen auf kuschelige Zimmertemperatur angewärmt. In der schnelllebigen Mediengesellschaft ist der Irakkrieg auf diese Weise wie durch Zauberhand zu einem Problem der Ära Schröder geworden, und jene Deutschen, die noch vor wenigen Jahren in Millionenscharen gegen die militärische Intervention im Nahen Osten demonstrierten, gönnen sich heimlich ein erleichtertes Aufatmen.
Darüber hinaus scheint die Kanzlerin eine Glückssträhne zu haben. Erst macht sich Gerhard Schröder zum Reform-Buhmann, woraufhin sich Merkel als Mutter der Mäßigung präsentiert. Gleichzeitig bindet die Vogelgrippe für Wochen die Untergangsängste der deutschen Hysterikernation, sodass sich der Staat – ebenso wie beim glücklich aufgelösten Geiseldrama um zwei Leipziger Ingenieure – zur Abwechslung mal wieder als liebender Vater zeigen kann. Zu allem Überfluss lässt eine zaghafte Besserung der Wirtschaftsdaten die Stimmungsmache der Medien in die nächste Haarnadelkurve gehen. Über alldem strahlt die Kanzlerin als eine Ikone der Ermüdeten, als Flaggschiff der politischen Resignation. Denn das vorherrschende Gefühl ist nicht Zuversicht. Sondern Erleichterung über eine Pause im notorischen Gejammer.
Und genau hier liegt ein verblüffendes Phänomen. Einst galt die Auseinandersetzung um rivalisierende politische Ideen als das Wesen der Demokratie. Heute wird Angela Merkel dafür gepriesen, dass sie ultimative Harmonie in die politische Debatte gebracht hat. Die Wähler sind glücklich, wenn die endlose Streiterei einem Ringelpiez mit Anfassen weicht. Man setzt sich an einen Tisch, ist nett zueinander und erklärt kleine Brötchen zum gemeinsamen Leibgericht. Das funktioniert, weil ein uneingeweihter Beobachter niemals entscheiden könnte, welcher Minister zu welcher Partei gehört. Auf beiden Seiten des politischen Lagers regiert aufgeklärte Sozialdemokratie, gepaart mit einem Wirtschaftsliberalismus (Neudeutsch: »Sachzwang«), der allseits als unausweichlich empfunden wird. Selbst die Chefin einer konservativen Partei würde es nicht wagen, sich zur Gruppe der Starken und Erfolgreichen zu bekennen. Sie dürfte nicht laut sagen, dass sie ihre Arbeitskraft den ökonomischen und kulturellen Trägern dieses Systems widmen will, statt sich vom Wehklagen über soziale Ungerechtigkeiten paralysieren zu lassen. Das käme einer Eintrittskarte zum Club der Unmenschen gleich. Auf der anderen Seite besitzt die Kanzlerin nicht genügend Macht (oder Bereitschaft), um Wirtschaft und Industrie, die sich permanent auf die Härten der Globalisierung berufen, in ihre Schranken zu weisen.