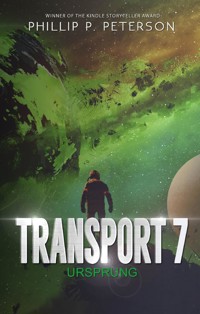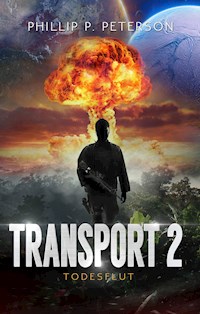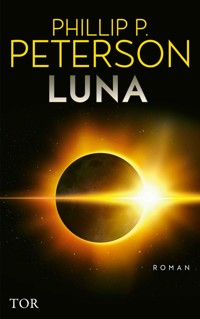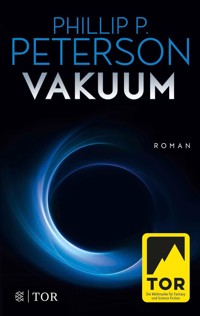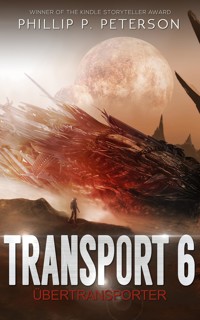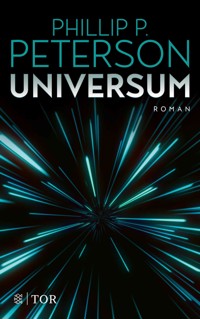14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Panik, Planlosigkeit, politisches Totalversagen - für diese Krise sind wir nicht bereit. Der neue Katastrophen-Thriller von Bestseller-Autor Phillip P. Peterson. Das Forschungszentrum in Köln ist das fortgeschrittenste seiner Art und das Vorzeigeprojekt der deutschen Regierung. Hier wird an Nanotechnologie experimentiert, um winzige Maschinen zu schaffen, die unser Leben von Grund auf verändern können. Das Versprechen ist groß, das Restrisiko vernachlässigbar. Heißt es. Doch gerade als der Bundeskanzler zu Besuch kommt, gelingt es Terroristen, die Anlage mit einer explosiven Drohne zu beschädigen. Sämtliche Sicherheitsvorkehrungen versagen, und Nanomaschinen gelangen in die Umwelt. Als sie anfangen, sich unkontrolliert zu vermehren, ahnen nur wenige, welch ungeheure Katastrophe sich anbahnt. Für Leser von Marc Elsberg, Michael Crichton, Andreas Eschbach oder Uwe Laub
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 872
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Phillip P. Peterson
Nano
Jede Sekunde zählt
Thriller
Über dieses Buch
Das Forschungszentrum in Köln ist das fortgeschrittenste seiner Art und das Vorzeigeprojekt der deutschen Regierung. Hier wird an Nanotechnologie experimentiert, um winzige Maschinen zu schaffen, die unser Leben von Grund auf verändern können. Das Versprechen ist groß, das Restrisiko vernachlässigbar. Heißt es.
Doch gerade als der Bundeskanzler zu Besuch kommt, gelingt es Terroristen, die Anlage mit einer explosiven Drohne zu beschädigen. Sämtliche Sicherheitsvorkehrungen versagen, und Nanomaschinen gelangen in die Umwelt. Als sie anfangen, sich unkontrolliert zu vermehren, ahnen nur wenige, welch ungeheure Katastrophe sich anbahnt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Phillip P. Peterson arbeitete als Ingenieur an zukünftigen Trägerraketenkonzepten und im Management von Satellitenprogrammen. Neben wissenschaftlichen Veröffentlichungen schrieb er für einen Raumfahrtfachverlag. »Transport« war sein erster Roman, der zum Bestseller wurde. Mit »Paradox« gewann er 2015 den Kindle Storyteller-Award. Zu seinen literarischen Vorbildern gehören die Hard-SF-Autoren Stephen Baxter, Arthur C. Clarke und Larry Niven.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2022 Peter Bourauel
Für diese Ausgabe:
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt a.M.
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491456-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Nachwort des Autors
0
19. Oktober
Leos Herz dröhnte wie ein Presslufthammer, als er mit seinem Kleinwagen vor der Schranke des Forschungszentrums hielt. Er musste ruhig bleiben und durfte sich seine Nervosität nicht anmerken lassen. Um keinen Preis! Wenn der Wachmann Verdacht schöpfte, dann war er verloren.
Leo atmete tief ein und ließ die Scheibe herunter.
Der Wachmann trat zu ihm ans Fenster. Er trug eine blaue Uniform mit einer antiquiert wirkenden Schirmmütze, unter der einige graue Haare hervorlugten.
Leo versuchte sich an einem harmlos wirkenden Lächeln, von dem er sicher war, dass es eher wie eine Grimasse aussah, und hob den Gästeausweis in die Höhe.
Der Wachmann scannte den Strichcode. Ein Bildschirm im Pförtnerhäuschen zeigte ihm die Ergebnisse. »Kann ich mal bitte das Formular sehen?«
Leo hatte es auf dem Beifahrersitz liegen. Er griff danach und reichte es dem Mann. Dabei zitterten seine Hände wie verrückt, er konnte nichts dagegen tun.
Der Wachmann nahm das Formular, das Leos Daten aus seinem Personalausweis, den Zweck des Besuchs, den Namen und den Zielort enthielt. Leo hatte es gerade im Zentrum neben der Pforte abgeholt und ausgefüllt.
Die Daten stimmten, für seinen Besuch im Forschungszentrum hatte er einen hinreichend plausiblen Grund. Aus dem Formular alleine konnte der Wachmann keinen Verdacht gegen ihn ableiten.
»Zum Metallurgielabor?«, fragte der Uniformierte.
Leo nickte. Er hatte von dort einen Auftrag ergattert. Genau zur rechten Zeit. »Ja, zum Metallurgielabor.«
»Wissen Sie, wo das ist?«, fragte der Wachmann.
Leo nickte wieder. »Ja, ich weiß, wo ich hinmuss.« Er hatte sich den Lageplan des Forschungszentrums, den es auf der Homepage im Internet gab, präzise eingeprägt. Er wusste, wo das Labor für Metallurgie lag, und er wusste ganz genau, wo das Labor für Nanotechnologie war.
»Gut«, sagte sein Gegenüber und gab Leo die Papiere und den Ausweis zurück.
Wieder zitterte Leos Hand.
»Ist alles in Ordnung?« Der Wachmann hob die Brauen.
Leo versuchte es mit einem Grinsen. »Zu viel Kaffee. Mal wieder.«
Der Uniformierte zuckte mit den Schultern. »Das kenne ich. Sie sollten mich mal nach einer Nachtschicht sehen.« Er trat einen Schritt zurück und betrachtete Leos Transporter. »Können Sie bitte mal aussteigen und mir die Ladefläche zeigen?«
Leo holte tief Luft. Das war unüblich, wenn Firmen in das Forschungszentrum fuhren, um Aufträge zu erfüllen oder Lieferungen abzugeben, aber er hatte damit gerechnet. »Wegen des Bundeskanzlers?«, fragte er scheinheilig. Natürlich kannte er die Antwort.
Der Wachmann seufzte. »Wegen des Bundeskanzlers.«
Leo stieg mit pochendem Herzen aus und ging um das Auto herum. Er öffnete die Tür zur Ladefläche und blickte auf das Chaos, das er absichtlich angerichtet hatte.
Überall lagen Metallteile, Werkzeuge, Winkel, Schrauben, Bolzen und Stangen herum. Leo hatte extra noch Schläuche und leere Kartons hineingeworfen. Einer oberflächlichen Betrachtung hielt der Wagen stand, aber wenn der Wachmann genauer hinsah, würde Leo sofort auffliegen.
Der Uniformierte blickte an ihm vorbei. Er brummte laut. »Und da wollen Sie noch irgendwas finden?«
Leo lachte hölzern. »Sieht zwar nicht so aus, aber hat ein ausgeklügeltes System.«
»Dass Ihr Chef Ihnen das durchgehen lässt …«
»Oh, ich bin mein eigener Chef«, sagte Leo.
»Ein-Mann-Unternehmer?«, fragte der Wachmann.
Leo nickte. »Ja, aber wenn es so weitergeht, werde ich mir noch ein paar Hände einstellen müssen.«
»Wäre ja gut für Sie …«
»Aber der Papierkram«, klagte Leo. »Weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe.«
Es lief wie am Schnürchen. Der Wachmann stellte zwar Fragen, aber im Grunde genommen war der Typ handzahm und ließ sich mit Smalltalk ablenken. Leo musste nicht mal lügen, es stimmte ja alles, was er sagte.
Sein Gegenüber betrachtete ihn eingehend. »Was liefern Sie denn in das Institut für Metallurgie?«
»Ach, nur so’n Ständer.«
Der Wachmann runzelte die Stirn. »Ständer?«
Leo sprang in den Transporter hinein, schob dabei etwas von dem ganzen Zeug beiseite und schlug mit der flachen Hand auf eine verwinkelte Konstruktion aus Streben. »Für irgendein Instrument. Keine Ahnung, was die da für Experimente machen.«
Der Wachmann lachte. »Kenn ich. Meine Frau fragt mich immer, was die im Forschungszentrum so treiben, aber was soll ich ihr sagen? Ist mir alles zu hoch.«
»Ich will es auch gar nicht wissen.« Das war Leos erste Lüge. Er hatte sich sehr genau darüber informiert, was für Experimente im Forschungszentrum durchgeführt wurden – und welche bald durchgeführt werden sollten.
Der Wachmann winkte ab. »Ist okay. Ich habe genug gesehen. Der Aufwand tut mir leid, aber wegen des Besuchs des Bundeskanzlers sollen wir ganz genau hinsehen. Alles fein.«
Offenbar hatte der Wachmann nicht genau genug hingesehen.
Leos Anspannung löste sich etwas. Beinahe hätte er laut aufgeatmet. »Ist ja kein Problem.« Er wollte aus dem Transporter springen, stolperte nach hinten, ein Karton verrutschte. Leider genau der Karton, der nicht verrutschen sollte.
Der Wachmann stutzte und blickte auf den durchsichtigen Plastiksack und die braune Substanz darin. »Was ist das denn für ein Zeug?«
Leo hielt den Atem an. Das war genau das, was nicht hätte geschehen dürfen. Gleich würde der Wachmann nach seinem Funkgerät oder gleich zur Waffe greifen.
Jetzt musste es schnell gehen. Theatralisch schmiss Leo die Hände in die Luft und klatschte. »Ach, da ist er ja!«, rief er.
»Was denn?«
»Kalk«, antwortete Leo. »Und zwar Spezialkalk für meinen Rasen. Haben Sie eine Ahnung, mit wie viel Moos ich mich da rumschlagen muss? Selbst Vertikutieren hilft nicht mehr. Ich habe schon überall danach gesucht.«
Der Wachmann blickte Leo ein paar Sekunden lang schweigend an. »Spricht jetzt nicht gerade für Ihr geniales Ordnungssystem.« Er ging zu seinem Häuschen.
Leo atmete auf. Die Rotoren, die hinter dem angeblichen Kalksack lagen, waren dem Kerl nicht aufgefallen. Schnell legte Leo einen anderen Karton darüber. Dann sprang er aus dem Wagen und schloss die Tür.
Der Uniformierte tippte sich an die Schirmmütze. »Also, gute Fahrt.«
»Danke!«
Leo setzte sich wieder auf den Fahrersitz und startete den Motor. Der Wärter öffnete die Schranke, und Leo fuhr auf das Gelände des Kölner Forschungszentrums für Nanotechnologie.
Check. Die erste Hürde hatte er genommen. Wenn auch nur knapp.
Es ging zunächst hundert Meter geradeaus bis zu einer großen Kreuzung, an der das Casino mit der Mitarbeiterkantine lag. Dort bog er links ab und fuhr direkt zum Gebäude der Arbeitsgruppe für Metallurgie. Das Haus war ein zweigeschossiger Bau aus grauem Blech und sah eher wie eine heruntergekommene Werkstatt als wie ein Hightech-Labor aus. Ein großgewachsener Mann in einem blauen Overall wartete am Eingang. Leo stieg aus und ging auf ihn zu. Der Mann war einen ganzen Kopf kleiner als er, aber das war keine große Kunst. Leo war fast zwei Meter groß, und sein regelmäßiges Krafttraining verstärkte die einschüchternde Wirkung auf andere Menschen noch.
»Leonardo Dunst?«
Leo nickte. »Sie warten doch nicht etwa schon die ganze Zeit auf mich, oder?«
»Die haben mich vom Besucherzentrum angerufen, dass Sie kommen. Sie haben recht lange gebraucht. Ist alles in Ordnung?«
Leo hob entschuldigend die Hände. »Tut mir leid, die haben an der Pforte meinen Transporter durchsucht.«
Der Mann stöhnte. »Ach, sicher wegen des Bundeskanzlers. Die machen wirklich eine Show daraus.«
»Wo soll das Teil hin?«, fragte Leo. Er wollte nicht zu viel quatschen und mimte darum den geschäftigen Handwerker. Nicht, dass er doch noch irgendwie Verdacht erregte.
Der Mann deutete auf den Hof. »Fahren Sie um das Gebäude herum zur Halle. Ich mache Ihnen das Tor auf. Da können Sie es einfach abladen und wir tragen es mit dem Gabelstapler hinein.«
»Gut!«
Leo stieg wieder in den Wagen und folgte der Anweisung. Er wendete und parkte den Transporter mit dem Heck in Richtung Halle.
Er öffnete die Ladefläche und wuchtete die verschweißte Konstruktion aus schwarz lackiertem Stahl heraus. Die Türen verschloss er sofort wieder.
Das Rolltor öffnete sich und der Mann kam wieder nach draußen. Er beugte sich über Leos Konstruktion und fuhr mit der Hand darüber. »Ist gute Arbeit. Ich denke, wir können Sie öfters mal beauftragen.«
Leo grinste. Dazu würde es niemals kommen. »Würde mich freuen, Herr Müller. Sie sind doch Müller, oder?« Er blickte auf den Auftragsschein.
Der Mann im Overall lachte. »Müller ist einer unserer Bürokraten. Aber letztlich ist es mein Auftrag. Wollschläger ist mein Name.«
Sie gaben sich die Hände. Leo ließ sich von dem Mann eine Empfangsbestätigung unterschreiben, die er nicht wirklich brauchte – aber es gehörte sich so, und alles andere würde Verdacht erregen.
Dann verabschiedeten sie sich, und Leo stieg wieder in seinen Transporter. Auch das wäre geschafft. Er startete den Motor.
»Stopp!«, brüllte Wollschläger hinter ihm.
Leo verkrampfte sich. Hatte er einen Fehler gemacht?
Wollschläger trat an das offene Fenster der Fahrerseite. »Wir haben etwas vergessen.« Er streckte die Hand aus.
Leo spürte, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich. »Was denn?«
»Das Besucherformular. Ich muss es unterschreiben und die Zeit eintragen. Sonst denken die nachher noch, Sie wären unbefugt über das Gelände gefahren.«
Und das wäre fatal! Er hatte es ganz vergessen. Leo griff zu dem Dokument auf dem Beifahrersitz.
Er reichte Wollschläger den Schein, der ihn gegen die Karosserie drückte und unterschrieb.
Leo nahm den Wisch wieder entgegen. »Danke!«, murmelte er.
»Bis zum nächsten Mal.« Wollschläger wandte sich ab und ging in Richtung Halle davon.
Leo ließ den Transporter langsam über den Parkplatz zur Straße rollen. Seine Hände umkrampften das Lenkrad. Im Rückspiegel konnte er sehen, wie Wollschläger einen anderen Mann mit einem Gabelstapler herbeiwinkte.
Leo bog auf die Straße ein und holte tief Luft. Er hatte jetzt fünf, maximal zehn Minuten Zeit. Wenn er länger brauchte, würde der Wachmann an der Pforte misstrauisch werden, und dieses Risiko ging er besser nicht ein.
Er fuhr an und musste wieder abbremsen, damit er nicht zu schnell wurde. Kurz darauf erreichte er das Casino und bog dort in die Lieferanteneinfahrt zur Küche. Am Hintereingang parkte gerade ein Kühltransporter, mehrere Männer und Frauen luden Kisten aus und trugen sie nach drinnen.
Leo kurvte um die Ecke und erreichte schließlich einen kleinen Hof. Hier standen Abfallcontainer und Müllsäcke. Er stellte den Transporter quer vor einen Stapel leerer Pappkartons, um ein wenig Sichtschutz zu haben.
Er sprang aus dem Auto, öffnete die Heckklappe und blickte sich ein letztes Mal um. Die nächsten Minuten waren kritisch. Niemand durfte um die Ecke kommen. Es musste schnell gehen.
Er nahm den Drohnenkörper aus einer Kiste und montierte mit schnellen Bewegungen die vier Rotoren. Er hatte die ganze Prozedur so oft trainiert, dass seine Hände völlig ruhig blieben. Den kleinen Sack mit Plastiksprengstoff, den er dem Wachmann als Rasenkalk verkauft hatte, befestigte er unter der schweren Drohne, die ihn ein kleines Vermögen gekostet hatte. Er hatte extra einen Drohnenführerschein gemacht, um sich dieses Modell mit hoher Tragkraft kaufen zu können. Leo aktivierte die Steuerungseinheit, die er selber in langen Nächten zusammengelötet hatte, und verband sie mittels eines langen Kabels mit dem Sprengstoff. Die Zündkapsel steckte er einfach in den Plastiksprengstoff hinein.
Er kontrollierte, dass die Uhr die korrekte Zeit anzeigte, und legte die aktivierte Drohne in einen Pappkarton, den er zu den anderen Kisten im Hinterhof trug und ganz nach hinten stellte. Der Müll würde erst übermorgen abgeholt werden.
Als er endlich wieder losfuhr, atmete er auf. Niemand hatte ihn bemerkt. Sein Plan schien funktioniert zu haben. Zumindest der erste Teil. Der zweite würde morgen ganz ohne sein Zutun ablaufen.
Er fuhr zurück zur zentralen Kreuzung des Forschungszentrums und wollte rechts zur Hauptwache abbiegen, um das Gelände schnellstmöglich zu verlassen. Ein Stück die Straße runter lag das Labor für Nanotechnologie, das er von den Fotos her kannte.
Sein Adrenalinspiegel stieg.
Ihr Arschlöcher, damit kommt ihr nicht durch!
Er wusste genau, wie es ablaufen würde. Er konnte es in seinem Geiste sehen. Das Experiment startete, die Presse und der Bundeskanzler und die Wissenschaftler würden zuschauen und sich nach erfolgreichem Abschluss gegenseitig in die Arme fallen.
Aber dann, wenn das Experiment beendet war, und die Redakteure an ihren Artikeln schrieben, in denen sie behaupteten, dass die Nanotechnik sicher und kontrollierbar sei, dann würde seine Drohne starten.
Er hatte sie mit GPS ausgestattet und einem Programm. Sie würde abheben, selbsttätig zum Labor für Nanotechnik fliegen und dort explodieren. Es war genug Sprengstoff an Bord, um einen Riesenschaden anzurichten.
Und alle Welt würde sehen, dass die Nanotechnik sehr wohl eine Gefahr darstellte und dass schneller etwas passieren konnte, als die Wissenschaftler und Politiker mit ihrem läppischen Geschwätz von einem ›geringen Restrisiko‹ der Bevölkerung einreden wollten.
1
An der Haltestelle Cäsarstraße stieg Ben aus der Stadtbahn. Nur wenige Menschen waren an diesem nasskalten Sonntagabend im Oktober in Köln unterwegs, und Ben ging einfach über die Straße und ignorierte die nahe Ampel. Als er die Bonner Straße hinaufschritt, blies ihm der eisige Wind direkt ins Gesicht. Die Luft trug leichte Nieseltropfen mit sich, die sofort seine Brille benetzten.
Der Herbst war bisher sehr warm und sonnig gewesen, doch nachdem das Wetter vor zwei Tagen gekippt war, bestand kein Zweifel mehr daran, dass der Winter vor der Tür stand. Ben zog sich den Kragen hoch ins Gesicht und ärgerte sich darüber, dass er keinen Schal mitgenommen hatte. Doch der Weg war zum Glück nicht mehr weit. Die Tür zu dem grauen Mehrfamilienhaus mit dem kleinen Kiosk direkt an der Straße stand nur angelehnt. Eiligen Schrittes erklomm Ben die schmale, steile Treppe und stand kurz darauf vor der Wohnung seines Gastgebers. Durch die Tür nahm er gedämpfte Stimmen wahr, also war Emma auch schon da. Ben drückte auf den Klingelknopf. Andrew öffnete und grinste ihn an. »Zu spät. Wie immer.« Er klopfte Ben auf den Rücken. »Schön, dass du da bist.« Andrew redete flüssig Deutsch, aber der Akzent kündete von seiner Herkunft aus Großbritannien.
Ben betrat die Wohnung und hängte seinen grauen Mantel an die Garderobe, dann ging er in das kleine Wohnzimmer. Mit seinen Computerbildschirmen auf zwei nebeneinanderstehenden Schreibtischen, eigenhändig bemalten Actionfiguren auf zahlreichen Regalen, herumliegenden Büchern, elektronischen Platinen auf dem Sofa, eingerahmten und schief hängenden Postern bekannter Science-Fiction-Filme an der Wand und einigen leeren Pizzaschachteln auf dem Boden neben der Heizung war es ohne jeden Zweifel das Reich eines Nerds. Für gesellige Zusammenkünfte war der Raum jedenfalls ungeeignet.
Während Andrew im Badezimmer verschwand, betrat Ben die Kombination aus Küche und Esszimmer. Es roch nach Knoblauch und Oregano. Emma stand neben dem Esstisch aus hellem Holz, der schon bessere Tage gesehen hatte, und trat ihm mit einem Lächeln entgegen, um ihn zu umarmen.
Ihr Parfüm roch nach einer Kombination aus Lavendel und Rose. Ein Hauch einer schwereren Komponente verlieh dem Duft etwas Erotisches. Der Gedanke löste einen leichten Stich in Ben aus und erinnerte ihn daran, dass er sich nach ihrem ersten Kennenlernen in sie verliebt hatte. Erst nach ihrem dritten Aufeinandertreffen im Forschungszentrum hatte er erfahren, dass die mittelgroße, athletische Frau, die sich ihre brünetten, etwas gewellten Haare immer so niedlich zur Seite strich, glücklich verheiratet war und eine kleine Tochter hatte.
Angefreundet hatten sie sich, dank Andrew, trotzdem, und von Zeit zu Zeit trafen sie sich bei einem von ihnen dreien zu einem gemeinsamen Abendessen.
»Schön, dich zu sehen«, sagte Ben.
»Dich auch.« Emma grinste. »Es ist sicher schon über zwei Wochen her.«
»Mindestens«, erwiderte Ben.
Emma lachte. »Da arbeitet man in benachbarten Gebäuden und sieht sich trotzdem so gut wie nie.«
Ben grinste zurück. »Das liegt ja an dir. Du kannst uns ruhig einmal beim Mittagessen Gesellschaft leisten.«
Emma ging nicht darauf ein. Dieses Thema besprachen sie nicht zum ersten Mal. Während Ben und Andrew sich jeden Mittag in der Kantine trafen, schlang Emma während der Arbeit nur schnell ein Brot hinunter, damit sie am Nachmittag früher gehen konnte, um ihre Tochter aus der Kindertagesstätte abzuholen. »Und?«, fragte Emma. »Schon nervös?«
Ben schüttelte den Kopf. »Nicht wirklich.« Na ja, ein bisschen schon.
Emma runzelte die Stirn. »Das glaube ich dir nicht. Ich würde vor Aufregung nicht schlafen können. Schließlich lernt man nicht jeden Tag den Bundeskanzler kennen.«
Andrew betrat das Zimmer. In der Hand trug er eine gerade erst angebrochene Flasche Kölsch. »Natürlich ist Ben nervös. Darum ist er ja überhaupt gekommen. Um sich mit meinem Wein zu vergnügen und dann gut schlafen zu können.«
Ben verzog das Gesicht. Sein Kumpel kaufte den Wein im Supermarkt. »Ich trinke höchstens ein, zwei Gläser.«
Andrew verschwand kurz im Vorratsraum. »Was ist mit dir, Emma? Bier oder Wein?« Emma schüttelte den Kopf. »Weder noch. Ich bin mit dem Auto da.«
Andrew stöhnte. »Wieso das denn?«
»Ich will zeitig im Bett sein. Ich habe morgen früh noch ein Gespräch mit Professor Rappe.«
Ben kniff die Augen zusammen. »Mit Rappe? Morgen?«
Emma nahm von Andrew eine Flasche Cola entgegen und stellte sie auf den Tisch. »Ich weiß auch nicht, was er von mir will. Ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen.«
Andrew schloss die Tür zur Vorratskammer, eine Flasche Wein in der Hand.
Ben seufzte. »Wenn er dich morgen, an seinem großen Tag, noch zu sich zitiert, dann muss es etwas verdammt Wichtiges sein.«
»Das denke ich auch«, sagte Andrew. »Vielleicht hat es etwas mit der Finanzierung deines Projekts zu tun. Vielleicht kriegst du die Gelder für die Verlängerung.«
Emma lachte leise. »Die habe ich mir aus Drittmitteln schon längst selber organisiert. Mein Projekt ist für die nächsten zwei Jahre gesichert. Mit etwas Glück bekomme ich sogar noch einen Doktoranden.«
Ben setzte sich neben Andrew an den Tisch. Er hätte auch gerne einen Doktoranden. Aber im Management des Forschungszentrums gab es nichts zu forschen, also auch keine Doktoranden. »Werden wir ja sehen. So, ich hab gehört, es gibt hier was zu essen?«, fragte Emma.
Andrew sprang auf. »Scheiße! Der Auflauf!« Er lief zur Küchenzeile und bückte sich, um durch das Fenster in den Backofen zu schauen.
»Na, heute etwas übermäßig Knuspriges?«, fragte Emma.
»Nee, braucht noch ein paar Minuten.« Andrew kam zum Tisch zurück.
Ben nippte an dem Wein, verzog das Gesicht und betrachtete das Etikett. Es sollte ein Merlot sein, aber die typisch fruchtige Note fehlte vollkommen. Es war einfach nur bitteres Zeug, durch Zuckerzusatz genießbar gemacht. Hätte er doch selber eine Flasche mitgebracht.
»Musstest du eigentlich eine Sicherheitsüberprüfung machen?«, fragte Emma.
Ben nickte. »Ich musste einen Wisch unterschreiben. Eine Einverständniserklärung, dass ich auf meine Rechte bezüglich des Datenschutzes verzichte und dass der Geheimdienst mich unter die Lupe nehmen kann.«
Andrew runzelte die Stirn. »Und das hast du unterschrieben?«
»Ja«, sagte Ben gequält. »Was blieb mir schon anderes übrig?«
Emma lachte. »Sieh mal einer an. Wenn das Ergebnis stimmt, ist der Herr dann doch gewillt, von seinen Idealen abzuweichen. Wer hätte das gedacht.«
Emma hatte schon recht. Er war immer darauf bedacht, seine Daten zu schützen. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, soziale Medien zu nutzen oder einer Weitergabe seiner Informationen für irgendetwas zuzustimmen. Er hatte sich absichtlich ein Linux-Handy zugelegt, damit er sich nicht den Datenkraken ausliefern musste. Es hatte ihn gewurmt, sich vom Geheimdienst durchleuchten lassen zu müssen, aber als Manager im Forschungszentrum hatte er keine Wahl.
»Wann geht es los morgen?«, fragte Andrew.
»Ich soll um acht bei der Flugbereitschaft im militärischen Teil des Köln-Bonner Flughafens sein. Für noch mehr Sicherheitschecks. Die Maschine des Kanzlers wird dann um neun erwartet.«
»Und du fährst wirklich mit ihm im Auto mit?«, wollte Emma wissen.
Ben nickte. »Ich werde ihn als Experte den ganzen Tag begleiten, um ihm für Fragen zur Verfügung zu stehen.«
»Als Experte.« Andrew lachte. »Als wenn du die Autorität in Sachen Nanotechnik wärst.«
»Ich habe auch meinen Doktor gemacht«, entgegnete Ben etwas zu patzig.
Andrew winkte ab. »Das war doch mehr ein Strategiepapier als eine richtige Forschungsarbeit.«
Emma verdrehte die Augen.
Ben beugte sich über den Tisch. »Ich habe zwei Jahre lang recherchiert und Interviews durchgeführt und ein Jahr an dem Text gefeilt.«
»Du hast die Studien anderer Leute zusammengefasst«, meinte Andrew.
»Dass ich eine Metastudie gemacht habe, heißt nicht, dass es nicht ein Haufen Arbeit war.« Ben bemühte sich, seine Stimme nicht allzu beleidigt klingen zu lassen.
»Jungs«, sagte Emma. »Müsst ihr schon wieder damit anfangen? Können wir nicht einmal ein Abendessen ohne diese leidige Diskussion veranstalten?«
»Aber es ist doch so.« Andrew klang nun seinerseits beleidigt. »Ich mache Forschung. Du machst Forschung. Ben macht Papierkram.«
»Na, danke schön.« Ben verschränkte die Arme vor der Brust.
Andrew hob besänftigend die Hände. »Das ist nicht gegen dich persönlich gerichtet. Es tut mir leid, wenn ich dich damit beleidigt habe. Aber das System ist schlecht.«
»Auch Forschung muss organisiert werden«, meinte Ben. »Mittel sind nicht in unbegrenzter Menge verfügbar. Darum muss man Prioritäten setzen und festlegen, welche Projekte finanziert werden und welche nicht. Es ist doch besser, wenn Wissenschaftler diese Entscheidung treffen, als wenn Politiker es tun.«
»Wissenschaftler, die nicht selber forschen, sind keine Wissenschaftler«, meinte Andrew. »Sie sind es vielleicht früher einmal gewesen, bevor sie von der dunklen Seite der Macht verführt wurden.«
Ben verdrehte die Augen. »Das ist doch albern.«
»Albern?«, brauste Andrew auf. »Ich habe es selbst erlebt. Bei meiner ersten Stelle in Deutschland im Institut für Miniaturisierung. Das Komitee, das über meine Finanzierung entschieden hat, bestand aus einem Mediziner, einem Atmosphärenforscher und einem Biologen. Das war eine rein subjektive Entscheidung von ehemaligen Wissenschaftlern, die sich daran aufgeilten, nun Macht über Budgets zu haben.«
»Wie würdest du es denn machen?«, fragte Ben. Er hatte sich auf ein ruhiges Abendessen gefreut. Aber Andrew war heute wohl besonders streitlustig.
»Ich würde die wissenschaftliche Gemeinschaft darüber abstimmen lassen«, erklärte Andrew. »Dann wäre es eine wirklich demokratische Entscheidung. So, wie es ist, ist es reine Willkür.«
Ben stöhnte. Andrew musste doch klar sein, dass das nicht funktionierte. »Wenn zwanzig Forscher aus der Nanotechnik und zehn Forscher aus der Feststoffphysik über die Zuteilung der Budgets abstimmen, dann steht das Ergebnis bereits vorher fest. Jeder Wissenschaftler stimmt für seinen eigenen Fachbereich, das ist doch sonnenklar.«
Emma hatte sich in ihrem Stuhl zurückgelehnt und starrte die Decke an.
»Schau dich doch nur mal in unserem Institut um.« Andrew gestikulierte wild mit den Armen. »Professor Rappe trifft die Entscheidung, wie das Geld intern verteilt wird, nach eigenem Gutdünken. Wie ein kleiner König. Und das siehst du überall in der Wissenschaft. Das ist doch keine Demokratie. Das ist eine ganz komische Mischung aus Monarchie und Feudalismus.«
Ben schüttelte den Kopf. »Das kann man so auch nicht sagen.«
Andrew tippte mit dem Zeigefinger auf den Tisch. »Aber sicher doch. König Rappe hat ein paar Gruppenleiter mit finanziellen Freiheiten ausgestattet, die dann wie kleine Fürsten auftreten.«
Ben lachte. »Bist doch selber Gruppenleiter, also beklag dich nicht.«
Andrew nickte. »Ja, ich habe einige finanzielle Freiheiten und kann sogar über meine Mitarbeiter verfügen. Aber das ist doch nicht demokratisch. Viel besser wäre es, wenn wir …«
»Andrew«, unterbrach Emma.
Andrews Kopf fuhr zu ihr herum. »Was?«
»Dein Auflauf.«
Emma hatte recht. Es roch nach verbrannten Nudeln.
»Scheiße.« Andrew sprang auf und rannte zum Ofen. Er riss die Tür auf, zog sich zwei dicke Handschuhe an und holte eine Auflaufform heraus. Das Gefäß dampfte.
»Schlimm verbrannt?«, fragte Ben.
Andrew nahm einen großen, grauen Plastiklöffel und stocherte in der Auflaufform herum. »Nee, zum Glück nur oben, wo der Käse ist.« Er schöpfte die schwarze Kruste ab und warf sie in den Mülleimer. Dann stellte er die Auflaufform auf den Tisch.
Ben griff nach dem Löffel und füllte ihnen auf. Rigatoni mit einer hellen Tomatensauce. Es sah so aus, als hätte Andrew nicht wenig Sahne hineingekippt. Ben beschloss, nur eine kleine Portion zu essen, selbst wenn es wider Erwarten gut schmecken sollte. Er ging nicht regelmäßig ins Fitnessstudio und mühte sich mit den Gewichten ab, um sich die Kilos dann mit Pasta wieder anzuessen.
»Also, guten Appetit«, sagte er und spießte sich einige Rigatoni auf seine Gabel. Nach dem ersten Bissen musste er zugeben, dass der Auflauf gar nicht mal schlecht schmeckte. Auch Emma nickte anerkennend. »Hey, wollen wir nächstes Wochenende in den neuen ›Alien‹ gehen? Der läuft am Donnerstag an.«
»Gerne«, sagte Ben. Er hatte die Filmreihe um das außerirdische Weltraummonster schon immer gemocht.
Andrew zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht.«
Ben runzelte die Stirn. »Warum denn nicht?« Eigentlich war sein Freund der Science-Fiction-Fan schlechthin.
»Seit die Alien-Reihe von Disney übernommen wurde, find ich die nicht mehr so toll. Alles so weichgespült mit einer Standardhandlung und totgeschlagen mit Spezialeffekten.«
»Also, mich hat der letzte gut unterhalten«, erklärte Emma.
Andrew ließ die Gabel auf seinen Teller sinken. »Gut unterhalten. Ja, das trifft es genau. Die ersten Filme waren wegweisend. Ridley Scott und James Cameron haben den Science-Fiction-Film auf eine neue Stufe gehoben und absolute Kultfilme gedreht. Die nächsten Teile waren zwar nicht mehr so riesig, aber man konnte zumindest erahnen, dass Fincher und Jeunet eine Vision hatten. Aber danach? Alles nur öde Kommerz-Kacke.«
Ben kicherte. Was Filme anging, war Andrew schon immer speziell gewesen. Ben ging ins Kino, um sich einfach nur zu zerstreuen. Aber er hatte seinen Spaß daran, wenn Andrew bei einigen Drinks nach der Vorführung das Drehbuch, die Spannungskurve oder das Zusammenspiel von Filmmusik und Charakterdarstellungen auseinandernahm. Und natürlich würde er mitkommen, auch wenn er sich jetzt noch zierte.
Nach dem Essen räumten sie gemeinsam den Tisch ab. Andrew deckte die Reste des Essens mit Alufolie ab und stellte sie auf die Arbeitsplatte. Emma wischte mit einem feuchten Lappen über den Tisch, und Ben räumte die Spülmaschine ein.
»Wie sieht es denn bei dir aus?«, fragte Ben. »Auch alles bereit für den großen Tag morgen?«
Andrew nickte. »Wir haben heute noch einen umfangreichen Test des Assemblers gemacht. Die Reaktionskette funktioniert tadellos. Nur auf den letzten Schritt haben wir verzichtet und den Agenten keine Interfaces eingesetzt.«
»Sicher, dass dieser Schritt morgen klappt?«, erkundigte sich Emma. »Es wäre eine ziemliche Blamage, wenn der Bundeskanzler hinter dir steht und die ganze Sache floppt.«
Andrew lachte. »Natürlich haben wir auch den letzten Schritt getestet. Aber an einem Konstrukt, das sich nicht vervielfältigen kann. Es wird funktionieren, glaube mir.«
Ben trank sein Glas leer und goss sich noch einmal ein. Wenn man erst mal ein paar Schlucke von dem Wein genommen hatte, gewöhnte man sich halbwegs an den Geschmack. »Ich hoffe, dass es klappt. Sonst darf ich dem Bundeskanzler erklären, warum die größte Investition seiner Amtszeit ein Fehlschlag war.«
»Viel Geld hat Hütter so im Allgemeinen ja nicht in die Hand genommen«, erklärte Emma. »Klar, unser Institut hätte es ohne ihn nicht gegeben, aber wenn ich mir den Rest Deutschlands anschaue, hat seine Sparsamkeit viel Elend angerichtet.«
»Irgendeiner musste mal diesen Teufelskreis durchbrechen«, meinte Andrew. »Auf jede Krise der letzten dreißig Jahre folgte eine Schuldenaufnahme, und das auf den Markt geworfene Geld hat dann die nächste Krise verursacht.«
Ben seufzte. Die letzten Jahre waren für die deutsche Gesellschaft hart gewesen, aber er war sich nicht sicher, wie viel Schuld daran die Regierung trug. »Hütter konnte nach Einsetzen der Inflation nicht noch mehr Geld in die Wirtschaft pumpen.« Der Kanzler hatte es mit einer behutsamen Förderung bestimmter Wirtschaftszweige statt mit der großen Gießkanne versucht. Doch die Hoffnung, einzelne Leuchtturmprojekte würden die totreglementierte Wirtschaft zum Investieren anregen, hatten sich nicht erfüllt. Mit riesigen Ambitionen gestartet, endeten die vergangenen Monate von Hütters Kanzlerschaft im Katzenjammer explodierender Arbeitslosenzahlen. Die Chancen auf eine Wiederwahl standen gleich null, und so hatte seine Partei den Kanzler dazu gedrängt, den Platz zu räumen, um den Weg für einen Neuanfang freizumachen.
»Ich bin jedenfalls froh, wenn Hütter weg ist«, erklärte Emma mit einer Kälte in der Stimme, die Ben von ihr nicht gewohnt war.
Andrew lachte. »Sagst ausgerechnet du, wo du in Deutschland sowieso nur zu den Kommunalwahlen gehen kannst.«
Das stimmte natürlich. Ben vergaß immer wieder, dass Emma Schweizerin war. Wie Andrew konnte sie bei der Bundestagswahl nur zuschauen. »Jedenfalls sollte es nicht in unserem Interesse sein, wenn die Opposition den Wahlkampf gewinnt.«
Andrew nickte zögernd. »Ja, in die Nanotechnik würde deutlich weniger Geld gesteckt.«
»Weniger Geld?« Emma runzelte die Stirn. »Wenn es nach den Grünen geht, würden sie unserem Institut sofort den Stecker ziehen. Sie hassen Nanotechnik.«
Ben hob beschwichtigend die Hände. »So einfach geht das nicht. Es gibt Verträge, an die sich auch eine neugewählte Bundesregierung halten muss.«
»Ja, zumindest einige Jahre werden wir noch weiterfinanziert«, sagte Andrew. »Aber wenn die mit ihrem Moratorium durchkommen, machen wir hier nur noch Risikostudien.«
»Ich würde es ihnen durchaus zutrauen, den Laden dichtzumachen, uns auf andere Institute zu verteilen und einfach die Konventionalstrafe zu zahlen. Sie haben für morgen wieder zu Demonstrationen aufgerufen.« Emma verdrehte die Augen. »In Bonn auf dem Münsterplatz findet eine große Kundgebung statt, und vor den Toren des Forschungszentrums auch.«
Andrew zog die Stirn in Falten. »Schon wieder? Vielleicht wäre es besser, morgen früher zur Arbeit zu fahren.«
Ben hatte bereits in den Nachrichten von den Demos gehört. »Da sind sicher auch wieder welche von den NoNanos.«
»Ich habe im Internet gelesen, dass sie versucht haben, Leute in das Forschungszentrum zu schmuggeln, um den Test zu sabotieren«, sagte Andrew. »Einen haben sie geschnappt, der versucht hat, sich in der Kantine als Koch zu bewerben.«
»Meint ihr, sie wären imstande, eine Bombe in das Forschungszentrum zu schmuggeln?« Emma blickte Ben nachdenklich an. »Ich wollte eigentlich Elena morgen zur Einweihung mitbringen.«
Ben winkte ab. »Keine Sorge. Die Sicherheitsvorkehrungen sind derart hoch, dass die Spinner keine Chance haben.«
»Bist du sicher?«, fragte Emma.
Ben nickte. »Du musst dir keine Sorgen machen. Bring deine Tochter ruhig mit.«
»Morgen ist ein historischer Tag in der Geschichte der Menschheit«, pflichtete Andrew ihm bei. »Auch wenn Elena erst fünf Jahre alt ist, so kann sie später immer sagen, dass sie dabei gewesen ist.«
»Na schön«, seufzte Emma. »Ich würde sie auch ungern morgen in die Kita geben, wenn die Aktivisten dort vor der Haustür demonstrieren.«
»Wie läuft es eigentlich mit deinen Nanoben?«, fragte Andrew die Kollegin.
Emma schaute ein wenig betrübt drein. »Sehr schleppend. Wir haben einige neue Untersuchungen mit einem Röntgenspektrometer gemacht, aber die Ergebnisse waren nicht eindeutig.«
Bens Kollegin beschäftigte sich mit Nanoben, die gemeinhin als die kleinsten Mikroorganismen der Welt betrachtet wurden. Mit nur wenigen Dutzend Nanometern Durchmesser waren diese erst Ende der Neunzigerjahre entdeckten Strukturen eigentlich zu klein, um als Lebewesen zu gelten. Nach wie vor stritten sich die Wissenschaftler, ob es sich wirklich um Mikroorganismen handelte.
»Wisst ihr denn jetzt, ob sich die Dinger tatsächlich fortpflanzen können?«, fragte Andrew.
Emma hob fast entschuldigend die Arme. »Wir haben noch keine Messergebnisse, die das einwandfrei bestätigen, aber ich gehe fest davon aus, dass sie sich vermehren, wenn wir die richtige Umgebung für sie schaffen. Mit der neuen Ausrüstung sollten wir diese Frage ein für alle Mal klären können.«
Andrew kicherte. »Schielt da etwa jemand auf den Nobelpreis?«
Emma schüttelte den Kopf. »Es ist mir egal, ob ich berühmt werde, Geld oder Preise einsammele. Ich will nur wissen, was es mit diesen Nanoben auf sich hat. Wenn wir herausfinden, wie sie funktionieren, werden wir eine ganze Menge lernen können. Vor allem für die Nanotechnologie. Ich …« Sie hielt inne.
»Ja?«, hakte Ben nach.
»Es könnte sogar sein, dass sie sich auf ähnlichem Weg replizieren wie Andrews Nanomaschinen.«
Andrew lachte auf. »Ach komm, jetzt hör aber auf.«
Emma verzog das Gesicht. »Wir haben keine Spur von RNA, Ribosomen oder anderen aus der Zellbiologie geläufigen Chemikalien finden können. Ihre Replizierung muss auf einem anderen Wege stattfinden als über Zellteilung.«
Ben wusste, dass die Nanobenforschung umstritten war. Einige Wissenschaftler sahen in ihnen nichts weiter als Kristalle, die bestenfalls in einer Nährlösung wuchsen. Er verstand auch nicht, wie man ein solch langweiliges Thema für die eigene Forschung wählen konnte, aber Emma bedeutete es viel.
»Ich werde es herausfinden«, sagte sie mit Trotz in der Stimme. »Und dann wird euch das Lachen vergehen.«
»Ich habe nicht gelacht«, erklärte Ben.
Emma zwinkerte ihm zu. »Das weiß ich auch sehr zu schätzen.«
»Will noch jemand Nachtisch?«, fragte Andrew. »Ich habe Cheesecake im Angebot.«
Ben schüttelte den Kopf. »Danke. Genug Kalorien für heute.«
»Nee, lass mal«, sagte Emma. »Es wird auch allmählich Zeit, zu fahren.«
»Nimmst du mich mit?«, wollte Ben wissen. Es war zwar noch früh, aber er wollte ausgeruht sein, wenn er morgen mit dem Bundeskanzler zusammentraf.
»Klar«, sagte Emma.
Wenige Minuten später saßen sie in Emmas Kleinwagen und fuhren die Bonner Straße hinauf in Richtung Chlodwigplatz. Sie passierten eine kleine Kneipe, vor der zahlreiche Menschen mit Kölschgläsern in der Hand unter einem Wärmestrahler standen und rauchten.
»Deine alte Kiste hält sich nach wie vor tapfer«, kommentierte Ben, der auf dem unbequemen Beifahrersitz hin und her rutschte.
Emma lachte leise. »Mal sehen, wie lange noch. Ich muss nächsten Monat zum TÜV und habe meine Zweifel, dass ich da problemlos durchkomme. Alle zwei, drei Tage geht das Steuergerät in den Motorschutzmodus, und ich muss dann rechts ran fahren und ein paar Minuten warten, bevor ich wieder starten kann.«
»Vielleicht wird es doch langsam Zeit für einen neuen Wagen«, gab Ben zu bedenken. »Wie alt ist er jetzt? Zehn Jahre? Zwölf?«
»Fünfzehn«, antwortete Emma. »Meine Eltern haben ihn mir geschenkt, als ich für das Studium nach Deutschland gezogen bin. Aber er hat noch keine hunderttausend drauf.«
»Aber was nützt dir das, wenn du bei jeder Fahrt Angst haben musst, am Straßenrand zu enden?«
Emma warf ihm einen kurzen Blick zu. »Ich kann mir im Moment halt nun einmal keinen neuen Wagen leisten.«
»Soll doch Claus etwas beisteuern.«
»Hör zu.« Emmas Stimme war plötzlich hart. »Unsere finanzielle Lage ist etwas angespannt. Claus und ich arbeiten im öffentlichen Dienst und das nicht gerade auf einer hohen Stufe.«
»Ich arbeite auch im öffentlichen Dienst. Auf derselben Stufe wie du«, erwiderte Ben.
»Du bist alleine, hast keine Kinder und musst kein Haus abbezahlen.«
»Vielleicht hättet ihr noch ein paar Jahre mit dem Hauskauf warten sollen.«
Emma schnaubte. »Klar. Und mit jedem Jahr ziehen die Preise für Immobilien weiter nach oben. Außerdem war die alte Wohnung zu eng, und du weißt ja sicher selber, wie schwierig es ist, in Köln und Umgebung eine Wohnung zu bekommen.«
»Aber vielleicht …«
Emma brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Entschuldige bitte, Ben, du kannst das aus deiner Perspektive nicht beurteilen. Du bist Single, und da kann man seine Ausgaben einschränken und kommt mit einer kleinen Wohnung auch mal in einem nicht so tollen Viertel hin. Wenn du aber immer darauf schauen musst, ob es in der Nähe deiner Wohnung eine Kita oder vernünftige Schulen gibt, sieht die Sache ganz schnell ganz anders aus.«
Ben blieb still. Natürlich hatte Emma recht. Sie hatte eine Familie, und ihm fehlte jede Ahnung davon, welche Probleme das mit sich brachte. In diesem Moment war er froh, Single zu sein.
Er wandte den Kopf und starrte aus dem Seitenfenster. Gerade fuhren sie über die Severinsbrücke. Es hatte wieder zu nieseln begonnen, und der Rhein versteckte sich in der Dunkelheit der Nacht. Die Lichter eines Flusskreuzfahrtschiffes tauchten gerade unter der Brücke auf, und Ben fragte sich, wer in dieser Jahreszeit wohl eine Urlaubsreise auf dem Rhein unternahm.
Das Schweigen wurde unangenehm. »Wie geht es Claus? Ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Kommt er morgen ins Auditorium?«
Claus Juncker arbeitete bei der Betriebsfeuerwehr des Forschungszentrums. Normalerweise liefen sie sich hin und wieder über den Weg, wenn Emmas Mann seine Inspektionen der Brandsicherheitseinrichtungen machte. Claus war ein netter Mensch, und Ben mochte ihn, aber zu sagen hatten sie sich nichts. Er war ein Mann der Praxis, der sich mit Werkzeug in der Hand wohler fühlte als vor einem Computer oder in einem Besprechungsraum, und der auch in seiner Freizeit mit Vorliebe an seinem Haus herumwerkelte, während Ben sich mit einem Hammer höchstens auf die Finger schlagen würde. Wie dieser Praktiker und die verkopfte Wissenschaftlerin zueinandergefunden hatten, hatte Ben nie verstanden. Aber vielleicht zogen sich hier Gegensätze tatsächlich an. »Ja, er hat Bereitschaftsdienst. Ihr seht euch also morgen.«
Ben schüttelte den Kopf. »Wahrscheinlich nicht. Ich bleibe die ganze Zeit beim Bundeskanzler und bei Rappe. Da gibt es einen abgesperrten Teil im Auditorium, den ich nicht verlassen kann.«
»Abgesperrt?« Emma verzog das Gesicht.
»Es hat zu viele Anfeindungen gegeben«, erklärte Ben. »Und der Sicherheitsdienst hat immer noch Angst, dass sich jemand von den Aktivisten in das Forschungszentrum eingeschmuggelt hat. Die wollen wohl auf Nummer sicher gehen. Ich kann euch nur empfehlen, früh genug da zu sein. Die werden jeden ganz genau kontrollieren.«
»Im Auditorium?«, fragte Emma. »Aber die kontrollieren doch schon an der Pforte wie die Weltmeister.«
Ben erwiderte nichts darauf. Es stimmte schon, die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Die Aktivistenszene wurde immer militanter, und der Bundesnachrichtendienst schloss sogar die Möglichkeit eines Anschlags nicht aus.
»Was denkst du?«, fragte Emma. »Wird es klappen? Ich meine, der Test.«
Ben grinste sie an. »Hast doch gehört, was Andrew gesagt hat. Wenn er sich sicher ist, dann wird der Versuch auch gelingen.«
Emma hielt an einer roten Ampel, die aber sofort darauf auf Grün umsprang. Als sie wieder Gas gab, drehten die Reifen kurz durch.
»Wenn er gelingt, dann bricht morgen für die Menschheit ein neues Zeitalter an.« Emmas Stimme klang merkwürdig belegt.
»Aus dir spricht aber nicht gerade große Begeisterung.«
Emma zuckte mit den Schultern. »Ich sehe die Risiken bei der ganzen Sache.«
Emma hatte sich in der Vergangenheit nicht als Nanokritikerin geoutet. Aber sie hatte auch nie großen Enthusiasmus für die neue Technik aufgebracht. Wenn Ben und Andrew sich begeistert darüber ausgetauscht hatten, war Emma meist still geblieben. »Ich bin mir sicher, dass alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden und dass es nicht zu einem Ausbruch kommt.«
»Das ist mir klar«, sagte Emma kühl. »Andrew hat oft genug über die Schutzmaßnahmen doziert. Es ist nicht der Versuch morgen, der mir Sorge bereitet.«
Ben runzelte die Stirn. »Sondern?«
Emma bog nach rechts auf die Kalker Hauptstraße, und schon passierten sie die Köln Arcaden. Noch zwei Minuten, dann war er zu Hause. »Wenn der Versuch morgen glückt und der Rest der Welt erst mal begreift, was die Technologie zu leisten vermag, wird ein Wettrennen um die Vorherrschaft in der Nanotechnologie ausbrechen. Die Chinesen sind nicht sonderlich weit zurück, die Amerikaner auch nicht, und Russland forscht sicher längst im Geheimen an seinen eigenen Synthesizern. Schon bald werden mehr Staaten über fortgeschrittene Nanomaschinen verfügen, als uns lieb sein kann. Neben der Gefahr eines Unfalls gibt es auch ein erhebliches Missbrauchspotenzial.«
Dem musste Ben widerwillig zustimmen. »Ja, sicher. Aber ich bin davon überzeugt, dass es schnell zu völkerrechtlichen Verträgen kommt. Denk daran: Es gibt nun seit fast hundert Jahren Atomwaffen, trotzdem ist es uns immer gelungen, eine nukleare Auseinandersetzung zu verhindern.«
Emma lachte. »Aber ein paarmal nur knapp, wenn man an Kuba denkt. Und im Gegensatz zur Kerntechnik braucht es bald schon keine großindustriellen Anlagen mehr, um Nanomaschinen herzustellen.«
Ben fand, dass Emma übertrieb. »Bis wir so weit sind, wird es noch mindestens zwanzig Jahre dauern.«
Emma lachte auf. »So schnell, wie die Miniaturisierung voranschreitet? Ich denke, dass wir schon in einigen Jahren so weit sind.«
»Du bist sehr optimistisch. Oder sollte ich sagen, pessimistisch?«
Sie hatten Bens Haus erreicht. Emma setzte den Blinker und hielt den Wagen auf einem Parkplatz vor dem Gebäude an. Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht pessimistisch, sondern realistisch. In Anbetracht der rasanten Fortschritte in vielen Wissensgebieten wartet auf die Menschheit eine enorme Herausforderung. Die Nanotechnik ist nicht die einzige Technologie, die unsere Erde und unsere Gesellschaft dramatisch verändern dürfte. Es wird noch dauern, bis unseren Politikern darauf eine Antwort eingefallen ist, und wenn wir Pech haben, ist bis dahin der Schaden schon angerichtet. Die Entwicklungen gehen einfach zu schnell.«
»Das sagst du, wo du doch selber an vorderster Front forschst.« Jetzt musste Ben lachen.
»Nein«, erwiderte Emma. »Ich erforsche mit den Nanoben einen Mikroorganismus, den es schon gibt. Ich will sie verstehen, das ist alles. Aber Andrew will eine neue Lebensform erschaffen. Eine technische Lebensform, die niemals von selbst auf der Erde entstanden wäre.«
Ben runzelte die Stirn. »Nanomaschinen sind keine Lebensform. Es sind miniaturisierte Roboter. Nichts weiter.«
Emma schaltete den Motor aus. Sofort ließ der warme Luftstrom aus den Schlitzen der Heizung nach, und Ben fröstelte. »Nanomaschinen sind sehr viel mehr als das. Sie können sich reproduzieren, und ihre rudimentären Berechnungseinheiten geben ihnen eine gewisse Form von Intelligenz. Wir haben ihnen sogar beigebracht, miteinander zu kommunizieren, so dass sie ein gewisses Sozialverhalten zeigen, um komplexe Aufgaben gemeinsam zu lösen. Im Grunde tun Andrews Schöpfungen nichts anderes als Zellen. Die Unterschiede zwischen Biologie und Technik verschmelzen in diesen Dimensionen. Wir nutzen sogar Biotechnologie, um die Nanomaschinen herzustellen.«
»Mag sein«, entgegnete Ben. »Aber wie du schon sagtest, wäre die Natur nicht in der Lage, Nanomaschinen mit evolutionären Methoden selber herzustellen. Vielleicht sollte man da die Grenze zwischen natürlichen und künstlichen Lebensformen ziehen.«
Emma nickte. »Möglicherweise hat es einen Grund, warum die Natur diese Form von Leben nicht herstellen kann. Das sollte uns zu denken geben, bevor wir nun mit dieser Technologie herumspielen und mikrominiaturisierte Dinger herstellen, die sich selber replizieren können.«
»Aber wir haben doch alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die man sich nur ausdenken könnte«, wandte Ben ein. »Die Wahrscheinlichkeit, dass Nanomaschinen entweichen, wurde als absolut vernachlässigenswert bezeichnet, und selbst für diesen Fall sind wir vorbereitet. Die Sicherheitsvorkehrungen und Notsysteme sind viel, viel ausgefeilter als an jedem Atomkraftwerk.«
»Ja«, bestätigte Emma. »Das stimmt. Aber es gibt nun einmal keine hundertprozentige Sicherheit. Ein Restrisiko bleibt.«
Ben lachte. »Ein Restrisiko bleibt auch, dass uns heute Nacht ein Asteroid auf den Kopf fällt. Manchmal muss man gewisse Risiken eingehen, wenn man Fortschritte machen will. Außerdem ist es besser, wenn wir jetzt die ersten Schritte mit dieser neuen Technologie machen als ein anderes Land, das es mit den Sicherheitsvorkehrungen nicht ganz so genau nimmt.« Er schüttelte den Kopf. »Ich wusste gar nicht, dass du der Nanotechnologie so ablehnend gegenüberstehst.«
Emma hob abwehrend die Hände. »Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich die Experimente einstellen würde. Es wäre mir nur lieber, wir würden etwas weniger Enthusiasmus und stattdessen etwas mehr Vorsicht an den Tag legen.«
Ben überlegte, ob er etwas erwidern sollte, dann ließ er es. Wenn seine Kollegin trotz ihres Expertenwissens kritisch gegenüber der neuen Technologie eingestellt war, würde sie sich nicht an einem Abend vom Gegenteil überzeugen lassen. Er selbst vertrat die Meinung, dass sie im Moment einen Vorsprung vor den Amerikanern, den Chinesen und den Russen hatten, den sie nicht leichtfertig aufgeben sollten. Die Patente und die Nobelpreise würden nun einmal dem Gewinner des Wettrennens vorbehalten bleiben. Das mussten die Zweifler und die Übervorsichtigen einsehen. Er streckte die Hand nach dem Türgriff aus.
»Eine Sache noch«, sagte Emma.
Ben wandte den Kopf.
»Wenn ein Atomkraftwerk trotz aller Sicherheitsvorkehrungen hochgeht, erwischt es nur einen mehr oder weniger großen Landstrich. Wenn ein Nanosynthesizer einen Defekt hat, dann kann die Kettenreaktion unseren gesamten Planeten vernichten.«
Ben verdrehte die Augen. »Ein populistisches Katastrophenszenario, mehr nicht. Ich wünsch dir eine gute Nacht.« Er stieg aus.
2
20. Oktober
Emma drehte die Musik des Autoradios lauter, um das Gehupe von hinten zu dämpfen. Im Rückspiegel sah sie eine Hand, die sich aus dem Fenster des Beifahrers reckte, um ihr den Mittelfinger zu zeigen. Es mussten Demonstranten sein, die den Sticker mit dem Logo des Forschungszentrums auf dem Kofferraumdeckel bemerkt hatten. Sie hoffte, dass die Insassen nicht auf die Idee kamen, an der nächsten roten Ampel aus dem Wagen zu steigen, um sie zu bedrängen.
Emma passierte die Luftwaffenkaserne des Flughafens Köln-Wahn und fuhr auf dem Linder Mauspfad nach Süden in Richtung Lind. Auch auf den Bürgersteigen waren Demonstranten zu Fuß unterwegs. Viele trugen Parkas wie in den Siebzigern. Einige hielten Schilder und Transparente in die Höhe. Für viele der Aktivisten ging es bei dem Termin wohl mehr um das Event als um idealistische Motive, wobei beides auch Hand in Hand gehen konnte. Je näher Emma dem Forschungszentrum kam, umso mehr Demonstranten waren zu sehen. Es mussten Tausende sein!
Emma schüttelte den Kopf. Sie hätte nicht damit gerechnet, dass es um diese Uhrzeit schon so viele sein würden.
An einer roten Ampel musste sie stoppen. Argwöhnisch warf sie einen Blick in den Rückspiegel und drückte das Knöpfchen der Türverriegelung herunter, aber der Nieselregen hielt die Aktivisten wohl davon ab, den Wagen zu verlassen. Hupe und Mittelfinger reichten offenbar vorerst aus.
Emma fingerte nach ihrem Handy und schickte Claus eine kurze Nachricht. Es war besser, wenn er sich mit Elena früher auf den Weg machte, wenn sie die Pressekonferenz nicht verpassen wollten.
Endlich gab die Ampel den Weg frei, und wenige Minuten später bog Emma auf die Zufahrt des Forschungszentrums, das vor einigen Jahren auf dem verwaisten Grund einer stillgelegten belgischen Kaserne angelegt worden war. Es befand sich mitten in der Wahner Heide. Die Zufahrtsstraße teilte es sich mit dem Gelände des Europäischen Transsonischen Windkanals. Das große, graue Gebäude des Luftfahrtinstituts war in einigen hundert Metern Entfernung zu erkennen, als sie an einer Gabelung rechts abbog.
Ein Polizeibeamter am Straßenrand hob seine Hand, um Emma anzuhalten, winkte sie aber weiter, als sie hinter der Scheibe ihren Ausweis hochhielt, der sie als Angestellte des Forschungszentrums identifizierte. Die Aktivisten hinter ihr schickte der Polizist allerdings fort. Sie mussten sich woanders einen Parkplatz suchen.
Ein Stück voraus war schon die Pforte des Forschungszentrums für Nanotechnologie. Kiefern säumten die asphaltierte Zufahrtsstraße. Auch hier waren Menschenmassen mit Transparenten, Schildern und Bierflaschen in einem langsamen Strom Richtung Forschungszentrum unterwegs. Polizeiwagen standen in regelmäßigen Abständen am Rand. Beamte lehnten mit Funkgerät in der Hand an ihren Fahrzeugen, beschränkten sich aber aufs Beobachten. Immerhin sorgten sie dafür, dass die Demonstranten den Angestellten des Forschungszentrums, die sich auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz befanden, nicht zu nahe kamen.
Auf der Straße stauten sich nun auch Fahrzeuge. Normalerweise gelangte man um diese Uhrzeit noch gut durch die Pforte, aber heute kontrollierten die Sicherheitsangestellten wohl besonders genau. Emma erkannte, dass einige Fahrzeuge zu einem Parkplatz herausgewunken wurden, auf dem Autos mit geöffnetem Kofferraum von weiteren Uniformierten durchsucht wurden.
Es dauerte lange Minuten, bis Emma an die Schranke kam. An normalen Tagen hielt sie lediglich ihre Magnetkarte an ein Lesegerät, aber heute prüften Angestellte die Ausweise. Vor der Baracke, an der Besucher sich anmelden und einen Tagesausweis erhalten konnten, standen etliche hundert Menschen und skandierten Parolen gegen die Nanotechnik, die man genauso auch auf den Schildern und Transparenten lesen konnte.
Nieder mit der Nanotechnik!
Nanotechnik, nein danke!
Ihr spielt mit der Zukunft der Menschheit!
Emma hatte Glück. Sie kannte den Sicherheitsangestellten, der ihr Auto unter die Lupe nahm, flüchtig. Er hieß Tom, den Nachnamen wusste sie nicht. Er hatte ein schmales Gesicht, und graue Haare schauten unter der schwarzen Schirmmütze hervor. Er lächelte, las die Magnetkarte mit einem mobilen Lesegerät und öffnete mit einem Knopfdruck die Schranke.
Emma fuhr auf das Gelände und ließ die pfeifenden Aktivisten zurück.
Hoffentlich würden Claus und Elena noch genauso gut auf das Gelände kommen. Im Zweifelsfall gab es einen Nebeneingang über das nahe gelegene Industriegebiet. Emma nahm sich vor, ihrem Mann später eine Nachricht zu schreiben und ihm diesen Weg zu empfehlen. Jetzt musste sie sich beeilen, um zum Termin mit ihrem Chef nicht zu spät zu kommen.
Am Casino, das an einem kleinen, künstlichen See stand und über eine gemütliche Außenterrasse verfügte, bog Emma links ab. Ihr eigenes Labor war in einer Baracke etwas abseits am Rand des Geländes untergebracht, aber Professor Rappe hatte sein Büro natürlich im Hauptgebäude, das direkt neben dem Auditorium lag, wo am Mittag die große Veranstaltung stattfinden würde.
Emma bog auf den Parkplatz ein, der bereits gut gefüllt war. Sie musste mehrmals wenden, da es kaum noch freie Stellflächen gab. Normalerweise füllte sich der Platz erst nach acht Uhr. In der Einrichtung waren Frühaufsteher nicht in der Mehrzahl. Es herrschte Gleitzeit und die Regeln für Ankunft und Abfahrt an der Arbeitsstätte waren so lax, dass das Forschungszentrum von bösen Zungen auch Freizeitzentrum genannt wurde.
Emma stieg aus und ging auf das Gebäude zu. Der eisige Wind war so stark, dass sie sich ihre Mütze tief ins Gesicht zog. Immerhin hatte der Nieselregen nachgelassen.
Sie ging die paar Stufen bis zum Eingang hinauf. Man erkannte direkt, dass dies der Hauptsitz der Einrichtung war. Während die anderen Gebäude aus Schnellbauelementen gebaut waren, hatte man für das Verwaltungsgebäude hellen Stein gewählt, dessen Quarzeinschlüsse an entsprechenden Tagen im Licht der Sonne funkelten. Es ging das Gerücht um, dass Rappe selbst die Steinbrüche abgeklappert hatte, um in einem Anflug von Perfektionismus das Baumaterial für seinen »Palast« auszusuchen.
Emma ließ den Fahrstuhl links liegen und lief in großen Schritten die Treppe nach oben. Ein Manager im dunklen Anzug mit grauer Krawatte kam ihr entgegen und grüßte sie, aber Emma kannte den Typen nicht, und brummte nur beiläufig.
In der dritten Etage bog sie auf den linken Gang und öffnete die Brandschutztür, auf der in goldenen Lettern das Wort »Administration« aufgeklebt war.
Der Gang war nicht sehr lang und wurde sowohl von einer breiten Fensterfront als auch von zahlreichen Neonleuchten in helles Licht getaucht.
Rappes Büro befand sich ganz am Ende, allerdings war seine Türe stets verschlossen, und alle Besucher mussten zuerst durch das Nebenbüro an seiner Sekretärin vorbei.
Ein Mann eilte aus dem Vorzimmer, großgewachsen und in dunklem Anzug. Er hielt sich ein Handy ans Ohr. Während er Emma zunickte, redete er erregt in sein Telefon. »Verdammt, ich weiß auch nicht, was da abgeht … nein, der Oberbürgermeister ist noch nicht hier … ja, ja, diese verdammten Demonstranten!«
Dann war der Mann verschwunden.
Emma trat auf die Schwelle und blieb stehen. Heike Baumann, die stämmige Sekretärin mit den feuerroten Haaren, blickte kurz vom Bildschirm auf und tippte dann weiter auf ihrer Tastatur. »Sie sind zu spät.«
Emma hob entschuldigend die Arme. »Tut mir leid, aber die Demonstranten …«
»Damit war zu rechnen«, sagte Baumann mit sarkastischem Unterton. »Wären Sie wohl besser früher aufgestanden.«
Emma blieb weiter an der Tür stehen. Sie wusste, wann es sich bei Frau Baumann empfahl, nichts weiter zu sagen. Eigentlich war Rappes Sekretärin ein umgänglicher Mensch und durchaus zu Scherzen aufgelegt. Nur unter Stress wurde sie schlagartig bissig und aggressiv.
Emma wartete, während Baumann ihre Arbeit beendete. Die Tür zu Rappes Büro war verschlossen. Emma hörte aber seine Stimme. Ihr Chef schien zu telefonieren.
Vor Baumanns Tisch stand ein großer Karton mit farbigen Broschüren. Es waren wohl die Mappen, die später bei der Pressekonferenz an die Medien verteilt werden sollten. Alle und alles im Forschungszentrum waren auf diesen Tag ausgerichtet. Und Emma fragte sich wieder, warum sie ausgerechnet heute zu einem Gespräch mit Rappe gerufen wurde. Der musste doch ganz andere Dinge um die Ohren haben, zumal Emma mit dem kommenden Ereignis gar nichts zu tun hatte.
Baumann blickte immer wieder auf ihr Telefon, auf dem ein rotes Licht leuchtete. Als es erlosch, wandte sie sich an Emma. »Sie können jetzt hineingehen.«
Emma nickte nur und trat an die Tür. Sie klopfte und öffnete sofort. »Professor Rappe? Darf ich …?«
Der Institutsleiter schaute auf, einen Kugelschreiber in der Hand, mit dem er gerade auf einem Block Notizen machte. Rappe legte den Stift beiseite und erhob sich. »Ja, kommen Sie herein. Bitte setzen Sie sich.«
Er lächelte nicht, was schon ein schlechtes Zeichen war, da der Mann normalerweise jede Gelegenheit nutzte, um seinen Charme spielen zu lassen.
Hatte sie etwas falsch gemacht?
Emma nahm auf einem der beiden Stühle Platz, die vor dem Schreibtisch standen. Dann setzte sich auch Rappe wieder.
Der Professor war von kleiner Statur und sehr schlank, was ein Ergebnis seines asketischen Lebensstils sein mochte. Bei gemeinsamen Essen hatte er eigentlich immer nur Salat oder Gemüse auf dem Teller, lehnte stets den Sekt ab und begnügte sich mit Sprudelwasser. Aber einige Kollegen sagten, dass der Mann einen guten Whisky bei passender Gelegenheit nicht ablehnte.
Heute trug Rappe einen tadellosen schwarzen Anzug mit blendend weißem Hemd. Beides wirkte so neu, als habe er es extra für den heutigen Anlass erworben.
Aber die Garderobe war nicht der einzige Hinweis darauf, dass heute ein außergewöhnliches Ereignis stattfand. Denn sein Büro war penibel aufgeräumt.
Es war ein ständiger Lacher im Forschungszentrum. Der Institutsleiter, der so besessen auf sich und seinen Körper achtete, war dafür umso nachlässiger mit der Ordnung in seinem Büro. Bei Emmas letztem Besuch hatten sich Aktenordner, wissenschaftliche Papiere, Fachjournale und Notizblöcke nicht nur auf den Tischen, sondern auch auf dem Boden getürmt.
Nun wirkte das Büro, als sei Rappe gerade erst eingezogen.
Aber Emma hätte auch ihr Büro aufgeräumt, wenn sich der Bundeskanzler bei ihr angekündigt hätte. Sie sah zu dem runden Tisch in der Ecke hinüber, mit den vier rundherum angeordneten weißen Lederstühlen, und konnte sich kaum vorstellen, dass in drei Stunden Kanzler Hütter hier mit ihrem Chef zusammensitzen würde, um über die Zukunft des Instituts und des Forschungszentrums zu sprechen. Ein weiteres Mal dachte sie, wie verwunderlich es war, dass Rappe sie heute noch zu sich gebeten hatte.
Ihr Chef seufzte. Er senkte den Blick und hob ein Papier von seinem Schreibtisch auf. Emma kannte es. Es war ihr eigener Fortschrittsbericht, den sie Rappe vor zwei Wochen eingereicht hatte. Eigentlich eine reine Formalität.
»Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht, mir diesen Quatsch hier vorzulegen?« Rappe klang eher ernüchtert als aggressiv.
Emma erschrak. Sie war sich keiner Schuld bewusst. Sie hatte den Bericht nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt. »Was meinen Sie, Herr Professor?«
Er blätterte einige Seiten um. »Das Forschungsprogramm mit Ihren Nanoben. Hier stellen Sie mehrere Möglichkeiten vor, wie diese Dinger entstanden sein können. Einiges davon ist an Unsinn kaum zu überbieten. Man könnte es fast schon als Esoterik bezeichnen.«
Emma schluckte. Daran also stieß sich Rappe.
Er las vor. »Alternative Theorien beziehen sich auf die Einbringung von Nanoben aus dem Weltall, was Exobiologen als Panspermie bezeichnen.« Er hob den Kopf. »Exobiologen?«
»Exobiologie ist die Wissenschaft, die sich mit der theoretischen Struktur außerirdischen Lebens beschäftigt.«
Rappe lachte. Er blickte sie an wie ein Kind, das behauptet hatte, es wäre in der Nacht einer Fee begegnet. »Außerirdische, Frau Hartmann.« Er schüttelte den Kopf. »Sie reden in einem offiziellen Bericht unseres Forschungszentrums von Außerirdischen?«
Emma holte tief Luft. Sie hatte beim Schreiben dieser Passagen ein schlechtes Gefühl gehabt. Sie hätte darauf hören und es lassen sollen. Dennoch war es ihr nicht angemessen erschienen, Theorien anderer Forscher nicht anzugeben, auch wenn sie nicht dem wissenschaftlichen Mainstream entstammten.
»Und es kommt noch besser«, fuhr Rappe fort. »Im nächsten Punkt behaupten Sie sogar, dass es sich bei Nanoben um außerirdische Nanomaschinen handeln könnte.«
Emma richtete sich kerzengerade im Stuhl auf. »Ich habe lediglich die Vielzahl der möglichen Ursprünge dargestellt, die in der Fachliteratur kursieren. Ich …«
»Fachliteratur?« Rappe hob die Augenbrauen. »Ich habe mir die Quelle zu diesem Punkt angesehen. Es handelt sich bei Dr. Weston um einen absonderlichen Physiker, der die Hälfte seiner Zeit damit verschwendet, Science-Fiction-Romane zu schreiben.«
»Aber Weston ist ordentlicher Angestellter des JPL. Das Institut hat seine Arbeit unterstützt und finanziert.«
Rappe klappte ihren Bericht zu. »Frau Hartmann, es gibt Themen, an denen man sich die Finger verbrennt, wenn man sie anfasst. Außerirdische gehören zweifelsohne dazu. Das habe ich Ihnen bereits während des Graduiertencollege deutlich mit auf den Weg gegeben.«
Emma hob entschuldigend die Hände. »Es tut mir leid, ich hätte hier präziser angeben müssen, dass es sich um eher unwahrscheinliche Möglichkeiten handelt.«
»Unwahrscheinlich?« Rappe schüttelte den Kopf. »Unmöglich trifft es wohl besser.«
Emma zeigte auf den Bericht. »Was erwarten Sie von mir? Soll ich das Papier ändern?«
Rappe lehnte sich in seinen Stuhl zurück. »Dafür ist es nun zu spät.«
Zu spät? »Wie meinen Sie das?«
»Das Papier hat längst die Runde gemacht.« Rappe verzog den Mund. »Man lacht schon über uns.«
Emma verstand das nicht. Normalerweise verschwanden die Fortschrittsberichte schnell in Aktenordnern, die dann im Kellerarchiv versauerten. »Wer lacht denn?«
»Alle.« Frust klang in seiner Stimme mit. »Schon seit einiger Zeit macht man sich über Sie mit Ihren komischen Nanoben lustig, die mit dem Kern unserer Forschungsarbeit sehr wenig zu tun haben. Und jetzt, mit diesen abstrusen Schlussfolgerungen? Sie haben uns zum Gespött gemacht.«
Emmas Hals wurde eng. Sie hatte diese Arbeiten so durchgeführt, wie es ihr im Graduiertencollege beigebracht worden war. Also, warum ging Rappe sie nun an? Sie hatte bloß alle konkurrierenden Theorien aufgezählt.
»Es sind keine Schlussfolgerungen, sondern lediglich alternative Erklärungsmöglichkeiten, die sich aus einer Fachliteraturrecherche ergeben haben«, verteidigte sie sich. »Ich habe diese Sichtweisen weder erfunden, noch habe ich sie in dem Bericht vertreten. Ich habe sie nur angegeben, sonst nichts.«
»Es ist schon schlimm genug, dass man sich intern über Sie amüsiert. Was viel schlimmer ist, ist die Tatsache, dass diese absurden Theorien im Bildungsministerium und sogar im Bundeskanzleramt kursieren.«
Emma schüttelte den Kopf. »Im Bundeskanzleramt?« Wieso gelangten ihre Forschungsarbeiten ins Bundeskanzleramt?
Rappe holte Luft. »Wir stehen mit unserer Forschung im Fadenkreuz der Republik. Als Vorbereitung für den heutigen Termin hat man sich natürlich in den entsprechenden Fachreferaten im Kanzleramt unsere Arbeiten angesehen. Hätte ich gewusst, was in Ihrem Bericht steht, hätte ich mich geweigert, ihn weiterzuleiten, aber jetzt ist es zu spät. Ihre Arbeit ist nun ein Punkt auf einer Liste von Dingen, für die ich mich heute Nachmittag rechtfertigen muss. Es ist nicht der problematischste Punkt, aber ganz sicher der peinlichste.«
Um Himmels willen … Hätte sie doch mit der Abgabe des Berichts noch einige Wochen gewartet! Hätte sie die strittigen Passagen einfach weggelassen! Sicher, Emma wollte diesen Möglichkeiten nachgehen, sie durch Experimente entkräften, wie es sich für gute wissenschaftliche Arbeit gehörte. Rappe hatte ohnehin ein Problem mit Kritik. Dass er sich für die Peinlichkeiten anderer zu rechtfertigen hatte, musste geradezu eine Qual für ihn sein.