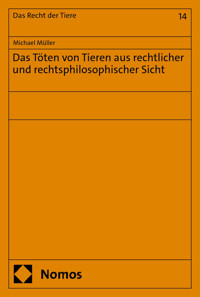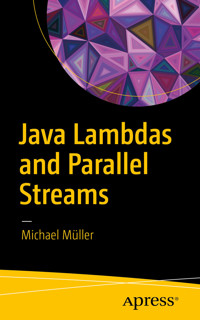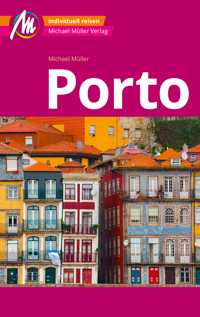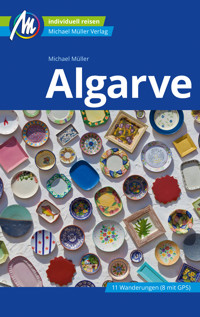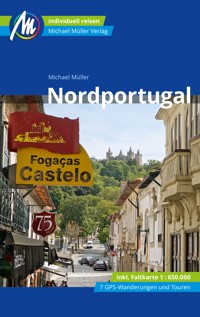Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Storys werden in den Medien in zahlreichen Kontexten erzählt: im Journalismus, in der Werbung, in fiktionalen Formaten wie Romanen und Spielfilmen, aber auch zunehmend in Unterhaltungsformaten wie Reality-TV und Castingshows. Eine der zentralen Erkenntnisse der Erzähltheorie ist, dass narrative Kommunikate (Geschichten) ihre Botschaften nicht nur über die Inhalte (Was wird erzählt?), sondern auch über die Form (Wie wird erzählt?) vermitteln. Der Band »Narrative Medienforschung« stellt auf der Basis semiotischer und erzähltheoretischer Modelle eine Analysemethode vor, mit deren Hilfe auch die »zwischen den Zeilen« vermittelten Bedeutungsstrukturen von Narrationen interpretiert und für die Forschung zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus wird gezeigt, wie »Meta-Narrative«, also narrativ strukturierte Diskurse, analysiert werden können. Schließlich wird die Anwendung der Methode für die Durchführung und Auswertung narrativer Interviews im Rahmen qualitativer Forschung praxisnah demonstriert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Semiotische Grundlagen
2.1 Definition der Semiotik
2.2 Semiotik und Erzähltheorie
2.3 Der Gegenstandsbereich der Semiotik
2.4 Zeichen
2.5 Die Arbitrarität der Zeichen
2.6 Anzeichen, Ikon, kontextgebundenes Zeichen
2.6.1 Anzeichen
2.6.2 Ikon
2.6.3 Kontextgebundene Zeichenäquivalente
2.7 Zeichensysteme (Codes)
2.8 »Langue« (Code) und »parole« (Kommunikat)
2.9 Mediale Kommunikate und ihre Strukturen
2.9.1 Oppositions- und Äquivalenzrelationen
2.9.2 Paradigmatische Wahl
2.9.3 Modellbildung
2.9.4 Signifikanz von Abweichungen
2.9.5 Kontexte
2.9.6 Realitätsbezug und Modus von Kommunikaten
2.9.7 Sekundäre semiotische Systeme
Narrativität
3.1 Erzählen
3.2 Minimalbedingungen für eine Geschichte
3.3 Analysen von Geschichten
3.3.1 Semantische Raumordnung
3.3.2 Ereignis
3.3.3 Grenzüberschreitung
3.3.4 Hierarchisierung der Ereignisse
3.3.5 Exkurs: Ereignisstruktur auf Basis von Ordnungssätzen
3.3.6 Konsistenzprinzip und Extrempunktregel
3.3.7 Kontext-Wissen einer Geschichte
3.4 Figurenfunktionen und Point of View
3.4.1 Figurenfunktionen
3.4.2 Point of View
Meta-Narrative
4.1 Zum Begriff des Meta-Narrativs
4.2 Meta-Narrative und Diskurse
4.3 Beispiel: Die Meta-Narrative des Pegida-Diskurses
4.4 Definition des Begriffs »Meta-Narrativ«
Qualitative Forschung mit narrativen Interviews
5.1 Die Stärken von Narrationen in der qualitativen Forschung
5.2 Zu Begriff und Geschichte des narrativen Interviews
5.3 Die Vorbereitung von narrativen Interviews
5.4 Die Durchführung eines narrativen Interviews
5.5 Das narrative Gruppeninterview
5.6 Die Transkription der Interviews
5.7 Die Auswertung narrativer Interviews
5.8 Beispielanalyse
5.8.1 Interviewleitfaden und Transkript
5.8.2 Semiotisch-narrative Analyse
5.9 Exkurs: Narrative Interviews in sozialen Systemen
Wissenschaftstheoretische und methodologische Hintergründe
6.1 Inhaltsanalyse und semiotisch-narrative Medienanalyse
6.2 Was ist empirisch?
6.3 Der Mythos vom hermeneutischen Zirkel
6.4 Explizitheit der Analyse-Theorie
6.5 Die Gültigkeit von Hypothesen
Bildnachweis
Literatur
Index
1 Einleitung
Erzählen ist eine anthropologische Konstante. In jeder Kultur, in jedem sozialen Milieu, in jedem Alter werden Geschichten erzählt. Selbst die eigene Identität bilden wir erst durch das Bewusstsein über die Geschichten, die unsere individuelle (Auto-)Biografie ausmachen. Ob in der Arbeit, im Beziehungsleben, auf der Party, vor Gericht oder beim Arzt – überall sind Erzählungen ein wesentlicher Teil unserer Kommunikation. Informationen, Argumente und Meinungen werden häufig in Erzählungen verpackt; sie sind zentrale Bedeutungsvermittler und transportieren Werte, sie können abstrakte Sachverhalte und Prozesse veranschaulichen und Emotionen auslösen. Erzählungen sind also wichtige Knoten, mit deren Hilfe wir unsere Kommunikation verankern können. Die Funktionen von Erzählungen fasst Vera Nünning wie folgt zusammen:
»Zum einen ermöglichen Erzählungen Menschen, ihr Leben in Bezug zur Zeit zu setzen und zu verstehen; sie stellen Sinnangebote für die Grunderfahrung zeitgebundener Existenz bereit und sind ein Mittel, mit Wandel sowie Kontingenz umzugehen und Kohärenz sowie Kontinuität zu stiften. Zum anderen wohnt Narrativen eine inhärente Erklärungskraft inne; sie legen auch dort Begründungszusammenhänge nahe, wo diese nicht explizit gemacht werden. Eine Erzählung (…) stiftet Sinn; sie stellt Beziehungen zwischen ihren Elementen her und macht Geschehen verstehbar« (Nünning 2012: 5).
Auch wenn Menschen immer und überall Geschichten erzählt haben, die sich in Mythen und Märchen, in der Literatur und später in Film und Hörfunk niederschlugen, hat das Erzählen in wissenschaftlichen Diskursen außerhalb der Literaturwissenschaft erst seit den 80er Jahren vermehrt Aufmerksamkeit gefunden, zunächst vor allem in Amerika, wo die Funktionen des Erzählens aus der Sicht unterschiedlicher Disziplinen diskutiert wurden (vgl. z. B. den Sammelband »On Narrative« von W. J. T. Mitchel 1980 oder die Arbeiten des Psychologen Jerome Bruner 1986). Ab Mitte der 90er Jahre erreichte dieser »narrative turn« auch Deutschland, einerseits in der philosophischen Reflexion (vgl. z. B. das erstmals 1998 erschienene Buch »Erzähle dich selbst« von Dieter Thomä), anderseits unter dem Begriff »Storytelling« in anwendungsbezogenen Kontexten wie dem Journalismus, der Mediengestaltung oder der Unternehmenskommunikation und-kultur. Es erschien in den letzten 15 Jahren eine Vielzahl von Publikationen, die Anleitungen zum Storytelling etwa im Journalismus (vgl. z. B. Lampert u. Wespe 2011), in PR und Unternehmensberatung (vgl. z. B. Frenzel, Müller und Sottong 2004; Sammer 2014), im Coaching (vgl. Budde 2015) oder in der Psychotherapie (vgl. Hammel 2009) geben. Alle diese Veröffentlichungen beruhen auf sehr unterschiedlichen Konzepten von »Story« oder »Narration«, wie auch Werner Früh und Felix Frey in ihrer Metauntersuchung zur Wirkung von Storytelling anmerken (Früh u. Frey 2014).
Nicht nur aufgrund dieses Storytelling-Trends lässt sich eine deutliche Zunahme an medialen Narrationen in den letzten zwanzig Jahren erkennen. Dies beruht sowohl darauf, dass traditionell non-narrative Formate wie Nachrichten oder Dokumentationen zunehmend narrativ strukturiert werden, als auch darauf, dass neue hybride Formate wie »Scripted Reality« oder cross- und transmediale Erzählformen entstanden sind. Zudem setzen Tages- und Wochenzeitungen immer stärker auf Reportagen anstatt auf reine Meldungen, nicht zuletzt mit dem Ziel, sich gegen den zunehmend dominierenden Online-Nachrichtensektor zu behaupten. Für den Bereich der Unterhaltungsformate sind Narrationen seit jeher essenziell.
Narrationen sind Formen der Kommunikation, die auf spezifische Weise Bedeutung aufbauen: Geschichten vermitteln Inhalte nicht nur über die semiotische Oberfläche der Kommunikation (die z. B. im Roman durch Sätze oder im Film durch audiovisuelle Codes generiert wird), sondern auch und vor allem durch die Art und Weise, wie erzählt wird und welche Weltmodelle und Wertsysteme dadurch explizit oder implizit aufgebaut werden. Um Narrationen dementsprechend adäquat analysieren zu können, benötigt man eine erzähltheoretisch fundierte Analysemethode, wie sie in Kapitel 3 dieses Buches vorgestellt wird.
Die »sekundäre« Konstruktion von Weltmodellen und Bedeutungen durch Geschichten basiert auf den »primären« semiotischen Gesetzen der Kommunikation. Die Semiotik ist die Lehre der Zeichen; sie entstand als theoretisches Modell an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auf der Basis der Arbeiten des amerikanischen Philosophen Charles Sanders Peirce (1839 – 1914) und des Schweizer Sprachwissenschaftlers Ferdinand de Saussure (1857 – 1913)1. Die Semiotik untersucht »alle kulturellen Vorgänge (d. h. wenn handelnde Menschen ins Spiel kommen, die aufgrund gesellschaftlicher Konventionen zueinander in Kontakt treten) als Kommunikationsprozesse« (Eco 1972: 32). Diese Untersuchungen führt die Semiotik mittels eines theoretischen Begriffsapparats durch, dessen zentraler Begriff das »Zeichen« ist.
Ein auf semiotischen Erkenntnissen basierendes praxiserprobtes Instrumentarium zur Analyse von Medien bietet die strukturale Text- bzw. Medienanalyse, wie sie u. a. von Michael Titzmann entwickelt wurde (vgl. Titzmann 1977). Dabei werden die spezifischen semiotischen Strukturmerkmale von medialen Angeboten und deren Funktionen für den Bedeutungsaufbau analysiert. Ein wichtiges Analyse-Tool ist dabei vor allem die Identifizierung von expliziten oder impliziten Relationen zwischen Teilstrukturen oder Einzelzeichen, die Medien verwenden. Die basalen semiotischen und strukturalen Analyse-Tools werden in Kapitel 2 dargestellt; dieses Instrumentarium ist insofern grundlegend, als es zur Analyse aller Formen von medialen Kommunikaten (Zeichenfolgen, die in der Kommunikation ausgetauscht werden) dienen kann. In Ergänzung sind jeweils mediengattungsspezifische Analyse-Tools heranzuziehen, wie sie etwa für den Film von der Filmsemiotik bzw. der Filmnarratologie bereitgestellt werden (vgl. z. B. Gräf et al. 2011; Grimm 1996).
Narrationen spielen nicht nur in einzelnen (medialen) Kommunikaten eine Rolle, sondern auch in gesellschaftlichen Diskursen. Kulturelle Denk- und Handlungsmuster spiegeln sich in den Erzählungen wider, die eine Kultur produziert und sie werden durch diese Erzählungen auch (mit)konstruiert: Insofern ist die semiotisch-narrative Medienanalyse, wenn sie nicht nur auf Einzelerzählungen, sondern zudem auf gattungsübergreifende Erzählkorpora oder kulturelle Alltagserzählungen angewandt wird, auch eine Kulturanalyse. Aufeinander bezogene Erzählinhalte und/ oder Erzählmuster lassen so kulturelle Meta-Narrative erkennen, die ein besseres Verständnis der eigenen, fremden oder diachron zurückliegender Kulturen ermöglichen. Schon 1982 hat Jean-François Lyotard darauf hingewiesen, dass – zumindest gewisse – gesellschaftliche Diskurse narrativ strukturiert sind; er spricht von den »großen Erzählungen« (vgl. Lyotard 72012). Auch die sozialwissenschaftliche Diskursanalyse in der Nachfolge von Foucault (1981) verwendet immer wieder den Begriff des Narrativs. In Kapitel 4 wird vorgeführt, wie die semiotisch-narrative Analyse auf gesellschaftliche Diskurse angewandt werden kann.
Des Weiteren lassen sich die Vorteile von Narrationen, zum Beispiel die von Nünning erwähnte »Erklärungskraft« von Erzählungen, auch für die qualitative Medienforschung nutzen. In den Sozial- und Kommunikationswissenschaften wird das narrative Interview schon seit längerer Zeit in der qualitativen Forschung eingesetzt. In Kapitel 5 wird – nach einer Klärung des Begriffs »narratives Interview« und seiner Ausformungen – erläutert, wie durch die semiotisch-narrative Auswertung von narrativen Interviews tiefenstrukturelle Befunde ermittelt werden können. Abschließend finden sich in Kapitel 6 methodologische und wissenschaftstheoretische Anmerkungen, die für die Einordnung des semiotisch-narrativen Ansatzes und seine praktische Anwendung hilfreich sind.
Zusammengefasst kann die semiotisch-narrative Medienforschung, wie sie in diesem Buch vorgestellt wird, für folgende Forschungsaufgaben eingesetzt werden:
Erstens bietet sie eine Methode für die Analyse von Medienprodukten mit narrativer Struktur (also solchen, die im weitesten Sinne ein Ereignis erzählen) und stellt somit ein praktikables Instrumentarium für die Auswertung von Medieninhalten zur Verfügung.
Zweitens ermöglicht sie es, mediale und gesellschaftliche Meta-Narrative und damit gesellschaftliche Diskurse zu rekonstruieren und zu interpretieren.
Drittens dient sie zur Generierung von qualitativen Forschungsdesigns auf der Basis narrativer Interviews, die mittels einer semiotisch-narrativen Analyse intersubjektiv nachvollziehbare Befunde ermöglichen.
1 Vgl. z. B. Peirce (1983); Saussure (21967).
2 Semiotische Grundlagen
Medien sind Mittel zur Kommunikation. Um mediale Kommunikate analysieren zu können, wird ein Grundverständnis der Mechanismen benötigt, wie Medien Bedeutung aufbauen und diese Bedeutungen (man könnte auch sagen: Inhalte, Botschaften, Informationen etc.) vermitteln. Die Theorie, die dies medienübergreifend untersucht, ist die Semiotik.
Wenn wir hier von Semiotik sprechen, verwenden wir allerdings einen ziemlich unklaren Begriff; wer sich durch die semiotische Einführungsliteratur kämpft oder gar einen Semiotik-Kongress besucht, wird wohl nicht selten das Gefühl bekommen, weniger denn je zu wissen, was Semiotik »eigentlich« ist. Das liegt daran, dass die Semiotik es nie geschafft hat, eine einheitliche Theoriebildung zu betreiben oder zumindest die bestehenden Theorien ineinander übersetzbar zu machen. Gemeinsam ist allen theoretischen Ansätzen, die sich das Etikett »Semiotik« angeheftet haben, nur, dass sie »irgendwas mit Zeichen« zu tun haben; was allerdings Zeichen sind, welche Arten von Zeichen es gibt und was genau der Gegenstandsbereich der Semiotik ist, darüber weichen die einzelnen theoretischen Ansätze stark ab. In diesem Kapitel soll daher keine grundsätzliche Einführung in die sehr unterschiedlichen Denkrichtungen und Theoriemodelle der Semiotik versucht werden (vgl. dazu u. a. Eco 1972; Sottong u. Müller 1998; Volli 2002). Dies würde auch für den Zweck dieses Buches zu weit führen; das Fehlen einer einheitlichen semiotischen Theoriebildung macht in einem Kontext, in dem es um Medienanalyse und Medienforschung geht, einerseits eine pragmatische Entscheidung für einen theoretischen Ansatz nötig, andererseits können einige innerhalb der Semiotik diskutierte Themenbereiche wie etwa »tierische Semiotik« oder »Semiotik der Biochemie« (falls man solche Fragestellungen innerhalb der Semiotik überhaupt für sinnvoll hält) für das Thema Medienanalyse ausgegrenzt werden. Allerdings ist der uneinheitliche und auch bezüglich des Gegenstandsbereichs wenig definierte Zustand der real existierenden Semiotik kein Argument gegen semiotische Theorie allgemein, allenfalls gegen den einschlägigen Wissenschaftsbetrieb. Im Kontext dieses Buch konzentrieren wir uns daher auf die Darstellung und Entwicklung semiotisch fundierter Werkzeuge für die Analyse von Medienprodukten.
2.1 Definition der Semiotik
Der Begriff »Semiotik« ist vom griechischen Wort »semeion« für »Zeichen« abgeleitet (vgl. Sottong u. Müller 1998: 22). Die Semiotik ist eine grundlegende Kommunikations- und Medientheorie auf der Basis des Zeichenbegriffs. Kommunikation geschieht immer mit Hilfe von Zeichen: sprachlichen Zeichen, repräsentiert z. B. durch Lautfolgen oder Intonationen im Fall der gesprochenen Sprache, durch Graphemfolgen im Fall der geschriebenen, oder bildlichen Zeichen wie zum Beispiel den Piktogrammen, die in Bahnhöfen oder Flughäfen den Weg weisen, oder ikonographischen Strukturen, die sich in Traditionen wie etwa der Darstellung christlicher Inhalte in der Malerei herausgebildet haben, oder musikalischen, gestischen, mimischen, modischen etc. Zeichen. Die Semiotik ist damit eine allgemeine Zeichentheorie, die auf der Basis eines allgemeinen Zeichenbegriffs das Funktionieren unterschiedlicher Zeichenarten und Zeichensysteme untersucht und die Strategien des Bedeutungsaufbaus von Zeichenstrukturen (tatsächlichen Äußerungen in der Kommunikation) in unterschiedlichen Kontexten untersucht.
Definition: Semiotik
Semiotik ist eine wissenschaftliche Theorie, die
auf der Basis eines allgemeinen Zeichenbegriffs (der also für alle unterschiedlichen Zeichentypen gelten muss)einerseits Elemente (Zeichenreservoir), Semantik (Bedeutungsgebung), Struktur (Verknüpfungsregeln) und Pragmatik (Anwendungsregeln) von Zeichensystemen,andererseits die Strategien des Bedeutungsaufbaus komplexer Zeichenstrukturen (semiotischer Kommunikate) untersucht.Was dies genau bedeutet, sei kurz am Beispiel des Zeichensystems der Sprache verdeutlicht. Zeichen sind in diesem Fall alle bedeutungstragenden Einheiten, allen voran die Wörter. »Haus« ist also ein Zeichen, »Baum« eines etc. Diese Zeichen können entweder durch eine Folge von Buchstaben (in der geschriebenen Sprache) oder durch eine Folge von Lauten (in der gesprochenen Sprache) realisiert sein. Die Wörter bilden das Zeichenreservoir des Zeichensystems »Sprache«, man kann sie – zum Beispiel in einem Wörterbuch – auflisten. Diese Zeichen haben eine bestimmte Bedeutung (Semantik), »Baum« zum Beispiel »Pflanze mit Stamm und Blättern« (um es nicht biologisch komplizierter zu machen, als nötig), es gibt bestimmte Verknüpfungsregeln, wie man einzelne Zeichen zu Sätzen verbindet (im Fall der Sprache ist das die Syntax), und es gibt pragmatische Regeln für die Anwendung konkreter Zeichen (in welchen gesellschaftlichen Kontexten sagt man »spachteln«, in welchen »speisen«?). Dies wäre der Teil der Semiotik, der Aufbau und Struktur von Zeichensystemen untersucht. Im Fall der natürlichen Sprachen ist dies in den meisten Fällen durch die Sprachwissenschaft schon relativ ausführlich erforscht; im Fall von anderen Zeichensystemen (wie z. B. bildlichen und musikalischen Zeichensystemen) ist dies (noch) nicht in gleichem Maße der Fall.
Zeichensysteme sind jedoch kein Selbstzweck, sondern sind dazu da, kommunikative Äußerungen zu ermöglichen. Im Fall der Sprache können solche Äußerungen vom Alltagsschwätzchen auf der Straße bis zum wissenschaftlichen oder literarischen Buch reichen. Auch für die Erforschung solcher komplexen Zeichenstrukturen liefert die Semiotik Ansätze; sie können im Extremfall aus sehr vielen Zeichen auch unterschiedlicher Zeichensysteme bestehen, wie etwa der Film, der sprachliche, bildliche, musikalische, gestische etc. Zeichen enthalten kann. Denn die Bedeutung solcher komplexen Zeichengebilde ergibt sich nicht einfach aus der Summe der Einzelbedeutungen der verwendeten Zeichen, sondern hängt auch von dramaturgischen (z. B. narrativen) oder semantischen (z. B. was wird als gegensätzlich dargestellt?) Strukturen der Äußerung ab.
2.2 Semiotik und Erzähltheorie
Da dieses Buch sich vorgenommen hat, unter anderem narrative mediale Äußerungen zu analysieren, ist die Semiotik als eine Grundlagentheorie nötig: Sie kann erklären, wie mediale Kommunikate grundsätzlich Bedeutung aufbauen; auf der Basis dieser Bedeutungen können dann komplexere Bedeutungen über narratologische Theorien, die letztlich Erweiterungen der semiotischen Theorie sind, analysiert werden. Semiotische Strategien des Bedeutungsaufbaus liegen jeder Erzählung zugrunde, da Erzählungen immer Zeichen verwenden: sprachliche Zeichen im Fall des Romans, sprachliche und bildliche im Fall des Films, sprachliche, bildliche und musikalische im Fall der Oper etc. Auf der Basis dieser Zeichen und Zeichenstrukturen bauen sie ihre narrativen Strukturen – also ihre Geschichten – auf; die Art und Weise, wie eine Geschichte strukturiert ist, fügt dann natürlich weitere Bedeutungselemente hinzu, die über erzähltheoretische Werkzeuge analysierbar werden. Dazu mehr in Kapitel 3.
2.3 Der Gegenstandsbereich der Semiotik
In einer ersten Annäherung wurde oben formuliert, Semiotik untersuche Kommunikationsakte auf der Basis des Zeichenbegriffs. Nun ist es wichtig, den Gegenstandsbereich der Semiotik noch genauer einzugrenzen. Wenngleich bisweilen versucht wird, auch psychische Aspekte der Kommunikation im Rahmen der Semiotik zu untersuchen (vgl. z. B. Volli 2002: 261 ff.), macht dies sowohl aus einem forschungstheoretischen als auch aus einem praktischen Grund wenig Sinn. Um dies zu begründen, sei an das gängige Kommunikationsmodell erinnert:
Abb. 1: Das klassische Kommunikationsmodell
Diese drei Elemente liegen natürlich jeder Kommunikation zugrunde: Ein Sender – sei dies eine natürliche Person oder eine Institution – erzeugt ein Kommunikat, das sich bestimmter Zeichen (welcher Art auch immer) bedient und sendet dieses über einen Kanal (von der Luft, die Schallwellen in der mündlichen Kommunikation überträgt, bis hin zu komplexen medialen Konstrukten wie das Internet) zu einem oder mehreren Empfängern. Mit diesem Kommunikat will er irgendetwas mitteilen, er verbindet mit seiner Äußerung also eine bestimmte Intention. Ob diese Intention beim Empfänger auch tatsächlich ankommt, ist fraglich; er versteht die Äußerung des Senders auf eine spezifische Art und Weise, die deckungsgleich mit der Intention des Senders sein kann, aber nicht muss: Sender und Empfänger können sich – wie jeder aus der Alltagskommunikation weiß – verstehen oder missverstehen.
In jedem Kommunikationsakt koexistieren daher (mindestens) vier unterschiedliche Prozesse, auch wenn sie in der Realität der Kommunikation nicht immer scharf zu trennen sind:
Ein Prozess der Intentionsbildung auf Seiten des Senders: Jeder Sender verfolgt eine bestimmte Intention, wenn er kommuniziert, sei ihm dies nun bewusst oder nicht; er will eine bestimmte Information übermitteln, beim Empfänger ein Gefühl auslösen (ihn beleidigen zum Beispiel), vermitteln, wie intelligent er ist, oder einfach nur etwas sagen, damit ein unangenehmes Schweigen beendet wird. Diese Absichten können sehr vielfältig sein; eine gute Kategorisierung sind die von dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun entwickelten »Vier Seiten einer Nachricht« (vgl. Schulz von Thun 2005, Bd. 1: 11): Jeder Kommunikationsakt hat danach die vier Aspekte:
Sachinhalt: Irgendein Sachverhalt wird vermittelt, eine Frage gestellt, eine Bewertung geäußert.
Selbstoffenbarung: Der Sender offenbart mit seinem Kommunikationsakt (auch) etwas über sich selbst.
Appell: Der Sender will beim Empfänger mit seiner Äußerung irgendetwas bewirken.
Beziehung: Der Kommunikationsakt drückt auch etwas über die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern aus.
Schulz von Thun gibt selbst ein Beispiel: Der auf dem Beifahrersitz sitzende Mann sagt zu seiner steuernden Frau: »Du, da vorne ist grün!« Der Sachinhalt der Nachricht wäre die Information, dass die Ampel auf Grün umgeschaltet hat, die Selbstoffenbarung der Inhalt: »Ich habe es eilig!«, der Appell die Aufforderung: »Fahr endlich los!«, und der Beziehungsaspekt die Aussage: »Du brauchst meine Hilfestellung« (vgl. ebd.: 25 ff.). Potenziell sind immer alle vier Aspekte präsent; welche tatsächlich in der Intention des Senders liegen und welche beim Empfänger wie ankommen, hängt vom Kontext ab, zum Beispiel von der Beziehung der beiden: Hat sie beispielsweise das Gefühl, er wolle sie immer wieder beim Autofahren bevormunden, wird sie am ehesten auf den Beziehungsaspekt reagieren etc.
Ein Prozess der Konstruktion eines Kommunikats: Der Sender konstruiert seine Äußerung unter Verwendung bestimmter Zeichen, indem er zum Beispiel einen Satz formuliert, einen Text schreibt, ein Video dreht oder eine bestimmte Geste macht. Da er in aller Regel verstanden werden will, bedient er sich zur Konstruktion seines Kommunikats kulturell vorgegebener und codierter Artefakte, zum Beispiel sprachlicher Zeichen: Er wird Wörter des Deutschen oder des Englischen verwenden und nicht irgendwelche beliebigen Laute ausstoßen.
Ein Prozess der Vermittlung der Äußerung: Der Sender muss sein Kommunikat »an den Mann (oder die Frau)« bringen, indem er sie über einen Kanal überträgt: akustische Wellen, elektromagnetische Impulse (bei Telefonen älterer Machart), Datenleitungen, Mikrophon und Lautsprecher, Papier etc. Die Auswahl des Kanals kann auch die Wahlmöglichkeiten für die Konstruktion des Kommunikats beschränken: Über ein herkömmliches Telefon können keine Bilder übertragen werden, über eine Skype-Verbindung sehr wohl. Weiter restringiert werden können Äußerungen durch kulturelle Konventionen oder Vorstellungen, wie Kommunikate in einem bestimmten Kanal auszusehen haben, etwa was »fernsehtauglich« oder »journalistisch« ist. Und natürlich gibt es auch noch das berühmte »Rauschen im Kanal«, also Störungen, unter denen die Vollständigkeit oder Verständlichkeit eines Kommunikats leiden können.
Ein Prozess der Rezeption bzw. des Verstehens auf Seiten des Empfängers: Jeder Rezipient versteht eine Äußerung zunächst auf seine Weise. Es kann sein, dass er nach dem oben beschriebenen Konzept der vier Seiten einer Nachricht eine Äußerung auf einem bestimmten »Ohr« wahrnimmt, etwa als Appell, obwohl der Sender eine andere Lesart »gemeint« hat, es kann sein, dass er aus irgendwelchen Gründen, die seinen konkreten Kontext betreffen, die Äußerung »missversteht«: So haben etwa viele Rezipienten von Goethes Roman »Die Leiden des jungen Werthers« (1774) diesen offenbar dahingehend missverstanden, dass sie ihn als eine Aufforderung zum oder zumindest eine Sanktionierung des Selbstmords lasen, was bekanntlich zu einer Selbstmordwelle unter jungen männlichen Rezipienten geführt hat – obwohl der Text selbst Suizid negativ bewertet (vgl. Goethe 1982). Oder aber er versteht eine Äußerung nicht oder falsch, weil er mit der Bedeutung oder Funktion bestimmter Elemente der Äußerung nicht vertraut ist – etwa weil viele Fremdwörter verwendet werden, er historische Bezüge nicht kennt, oder er Teile der Äußerung bei seiner Rezeption ausblendet.
Innerhalb dieses prozessuralen Ablaufs existiert nur ein unmittelbar zugängliches Artefakt: Das Kommunikat selbst (also die Lautfolge, der Text, der Film etc.), das vom Sender produziert wird. Die Intentionen des Senders und der Verstehensprozess des Empfängers sind allein aus der Äußerung heraus nicht unmittelbar erkennbar; um Wissen darüber zu erlangen, bedarf es weiterer Äußerungen oder Handlungen, wie etwa:
innerhalb eines Gesprächs die Nachfrage des Empfängers, was der Sender gemeint habe, und umgekehrt Nachfragen des Senders über das Verständnis des Empfängers; solche »Aushandlungen« des Intentions- und Rezeptionsprozesses können langwierig und komplex sein, wie jeder weiß, der schon einmal in einen Partnerschaftsstreit verwickelt war;
bei medialen Kommunikaten etwa ein Zusatzdokument des Senders, in dem er seine Intention erläutert (Beispiel: Ein Autor spricht in einem Fernsehinterview darüber, was er mit seinem Roman ausdrücken wollte);
ein Zusatzdokument eines oder mehrerer Rezipienten, in dem dieser seinen Verstehens- bzw. Rezeptionsprozess erläutert (Beispiele: Der Besucher einer Filmpremiere spricht darüber, was ihn an diesem Film berührt hat; eine empirische Befragung sammelt Daten über den Rezeptions- und Verstehensprozess);
Handlungen des Rezipienten, die Rückschlüsse auf sein Verstehen zulassen (Beispiel: Wenn der Küchenhelfer dem Koch auf die Aufforderung »Gib mir mal die Sauciere!« tatsächlich die Sauciere reicht, hat er die Äußerung des Kochs offenbar »richtig« (in der vom Koch intendierten Weise) verstanden).
Verfügen wir über keine derartigen Zusatzkommunikate, können wir über die Intention des Senders oder das Verstehen des oder der Rezipienten nur Mutmaßungen anstellen. Wären wir tatsächlich darauf angewiesen, in der alltäglichen Kommunikation bei jedem Kommunikationsakt die Intentions- und Verstehensprozesse zu rekonstruieren, würde Kommunikation nicht funktionieren, weder die Face-to-Face- noch die mediale Kommunikation: Wir würden uns in einen endlosen Rekurs von Kommunikation über Kommunikation über Kommunikation verstricken.
Referenzgröße jeglichen kommunikativen Akts bleibt die Äußerung bzw. das Kommunikat selbst als einzig objektiv vorliegendes Artefakt (zumindest so lange es keine der genannten Zusatzkommunikate gibt). Kommunikation kann nur funktionieren, weil Gesellschaften oder Kulturen sich darauf geeinigt haben, bestimmte Artefakte mit Bedeutung zu versehen: Sprachliche Kommunikation funktioniert nur, wenn Sender und Empfänger mit denselben Wörtern zumindest im Kern dieselben Bedeutungen verbinden. Und visuelle Kommunikation funktioniert nur, wenn wir uns darauf einigen können, dass ein Fotoportrait von Angela Merkel tatsächlich Angela Merkel abbildet. Eine Grundbedingung für Kommunikation ist also, dass es objektivierbare Bedeutungen von Kommunikaten gibt, die als Referenzpunkt sowohl für den Prozess der Äußerungskonstruktion als auch für den der Rezeption dient: Der Sender muss über das (bewusste oder vorbewusste) Wissen verfügen, wie er eine Äußerung konstruieren sollte, um seine Kommunikationsintention möglichst gut umsetzen zu können, und der Rezipient benötigt Wissen, um die Äußerung decodieren, sie verstehen zu können. Beides setzt objektivierbare Kommunikationsmittel voraus. Dass diese Kommunikationsprozesse in der Praxis nicht immer reibungslos funktionieren, steht auf einem anderen Blatt; es soll hier auch nicht die Wichtigkeit von psychologischer, soziologischer oder kommunikationswissenschaftlicher Kommunikations- und Rezeptionsforschung in Abrede gestellt werden. Es geht hier nur darum, den Gegenstandsbereich der Semiotik gegenüber anderen Forschungsbereichen abzugrenzen und gleichzeitig die Wichtigkeit des Felds der Semiotik zu postulieren: Um Kommunikation zu verstehen, genügt es eben nicht, die Prozesse der Konstruktion und Rezeption von Botschaften beim Sender respektive Empfänger zu verstehen, sondern man muss auch das, was dazwischen ausgetauscht wird, das Kommunikat in seinem Funktionieren verstehen können.
Der Gegenstandsbereich der Semiotik (und damit auch der Narratologie als einem Teilbereich der Semiotik) sind damit Kommunikate und ihre Mittel und Strategien der Bedeutungskonstruktion. Als theoretisch basierte Werkzeuge dienen Semiotik und Narratologie zunächst zur Analyse der objektivierbaren Bedeutung von Äußerungen und damit als Grundlagentheorien für andere mit Kommunikation beschäftigten Disziplinen wie Kommunikationspsychologie, Kommunikationssoziologie, Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie Philologien: Denn sie alle benötigen als Referenz die kulturell kodierten Bedeutungen, die über Zeichen und strukturelle Elemente von Kommunikaten aufgebaut werden. Allein schon, dass man überhaupt von Missverständnissen, Fehlrezeption oder allgemein Kommunikationsproblemen sprechen kann, zeigt ja, dass es eine Referenzgröße geben muss, bezüglich derer Abweichungen überhaupt beschrieben werden können.
Der Gegenstandsbereich der Semiotik ist also das, was »zwischen Sender und Empfänger« (vgl. dazu Sottong u. Müller 1998) liegt, für das in den Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie in den Philologien eine ganze Reihe von Bezeichnungen im Umlauf sind, wie etwa Text, Botschaft, Äußerung, Aussage, Signal, Nachricht etc. Da alle diese Begriffe Assoziationen bzw. Konnotate mittransportieren, die vor allem eine bestimmte Gattung von semiotischen Gebilden fokussieren – so konnotiert der Begriff »Text«, obwohl er auch für Filme z. B. in der Filmwissenschaft verwendet wird (vgl z. B. Gräf et al. 2011: 27), ein sprachliches semiotisches Gebilde – soll hier der allgemeine Begriff des »Kommunikats« eingeführt werden. Das Kommunikat ist also das, was zwischen einem Sender und Empfänger ausgetauscht wird und aus semiotischen Elementen (Zeichen, Zeichenstrukturen ect.) besteht.
Definition: Kommunikat
Als Kommunikat bezeichnet man jedes kulturelle Artefakt, das in einer kommunikativen Situation zwischen Kommunikationspartnern ausgetauscht wird. Kommunikate bestehen aus rein semiotischen Elementen (Zeichen) und/oder aus anderen Artefakten, die in ihrer Verwendung in Kommunikationsakten semiotisiert werden: Wenn ein Gangster einer Geisel ein Messer zeigt, ist dieses Messer zunächst kein Zeichen, wird aber hier als Kommunikat verwendet und dabei mit Bedeutung aufgeladen. Kommunikate können Zeichen aus ganz unterschiedlichen Zeichensystemen verwenden, und kommen sowohl in direkten (Face-to-Face) als auch in medialen Kommunikationssituationen vor: Der Ruf der Mutter auf dem Spielplatz: »Kevin, komm sofort her!« ist ein Kommunikat, ein Spielfilm, der im Fernsehen gesendet wird, ein anderes.
Die semiotisch-narrative Analyse von Kommunikaten – in unserem Fall speziell die von medialen Äußerungen – kann dann in einem zweiten Schritt auch dazu verwendet werden, Zusatzäußerungen zu den Intentions- und Verstehensprozessen zu analysieren (denn dabei handelt es sich ja auch um semiotische Kommunikate); die Methode kann damit zum Beispiel im Kontext von Rezeptions- und Wirkungsstudien eingesetzt werden. Darauf werden wir im Kapitel 5 dieses Buchs näher eingehen.
Semiotik untersucht also nicht »alles, was mit Kommunikation zu tun hat«, sondern beschränkt sich auf einen Kernbereich – die Analyse der objektivierbaren Bedeutungen von Äußerungen. So verstanden ist sie eben auch Grundlage für alle anderen mit Kommunikation beschäftigten Disziplinen.
Abb. 2: Der Gegenstandsbereich der Semiotik
Zusammenfassung: Semiotik
Die Semiotik ist eine wissenschaftliche Grundlagentheorie, die sich auf der Basis des Zeichenbegriffs mit dem Funktionieren von Kommunikation beschäftigt. Gegenstandsbereich der Semiotik sind dabei die Kommunikate, das also, was »zwischen Sender und Empfänger« (vgl. Sottong u. Müller 1998) liegt.
2.4 Zeichen
Grundlage jeder semiotischen Theoriebildung ist der Zeichenbegriff. Zeichen – und da sind sich wohl alle sonst so unterschiedlichen Zeichendefinitionen einig – sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten in Kommunikationsprozessen. Ein Beispiel dafür ist das sprachliche Zeichen »Haus«: Das Wort – ob wir es nun als geschriebenes oder gesprochenes vorfinden – hat grundsätzlich eine Bedeutung, die wir ganz grob als »architektonisches Artefakt, das Menschen zum Wohnen oder zu sonstigen kulturellen Betätigungen (Arbeit, Rituale etc.) dient«, beschreiben. Dieses Zeichen besteht aus noch kleineren Elementen – im Fall der geschriebenen Sprache aus den Buchstaben H, A, U und S, im Fall der gesprochenen aus den Lauten »H A U S« ([has]), die aber – zumindest in diesem Kontext – selbst keine eigenständige Bedeutung haben. Natürlich kann in anderen Kontexten auch ein einzelner Buchstabe Bedeutung haben und damit zum Zeichen werden: Etwa dient in dem Satz »Der Flug nach Berlin ist in A zum Einsteigen bereit« der Buchstabe »A« als Name für ein bestimmtes Gate und wird damit zum Zeichen. Als Bestandteil des Zeichens »Haus« hat das »A« jedoch keine eigenständige Bedeutung.
Jedes Zeichen hat zwei Komponenten: Eine (im weitesten Sinne) materielle – die Graphemfolge »HAUS« bzw. die Phonemfolge »H A U S« ([has]) – sowie eine nicht-materielle semantische, die die Bedeutung festlegt, wie sie oben zu umschreiben versucht wurde. Ferdinand de Saussure, einer der Begründer der Semiotik, hat dafür die Begriffe »Signifikant« (signifiant) und »Signifikat« (signifié) geprägt (vgl. Saussure 21967: 76 ff.).
Definition: Zeichen
Zeichen sind die kleinsten bedeutungstragenden Elemente der Kommunikation; jedes Zeichen besteht aus den beiden Elementen
Signifikant: materieller Zeichenträger
Signifikat: Bedeutung des Zeichens
Das Signifikat eines Zeichens ist ein abstraktes Objekt, das letztlich nur umschrieben werden kann. Grundsätzlich könnte man – in Anlehnung an Wittgenstein (vgl. Wittgenstein 21980: 16) – auch sagen, die Bedeutung eines Zeichens ist seine richtige Anwendung: Wenn also jemand sagt: »Ich gehe jetzt ins Haus«, und er geht dann ins Haus, hat er die Zeichen, die in seinem Satz vorkommen, richtig angewendet, wenn er dagegen nach der Äußerung dieses Satzes in den Zug steigt, hat er dies nicht getan und kennt offenbar deren Bedeutung nicht. (Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, dass der Sprecher seinen Satz ironisch meint und durch ihn ausdrücken möchte, dass er so viel mit dem Zug unterwegs sei, dass er dieses Fortbewegungsmittel schon wie sein zweites Zuhause betrachte; in diesem Fall müsste es – zum Beispiel im mimischen Ausdruck – einen Ironiemarker geben, der den Rückschluss auf diesen ironischen Bedeutungsaspekt klarmacht.) Das wäre eine pragmatische Bedeutungsdefinition; man könnte dann zum Beispiel empirisch beobachten, in welchen Kontexten die kompetenten Benutzer eines Zeichensystems (im Fall der Sprache also die Muttersprachler) ein Zeichen wie benutzen, diese Benutzung beschreiben, und andere Formen der Anwendung als falschen Gebrauch markieren. Tatsächlich funktioniert die Bedeutung von Zeichen letztlich auf diese Weise: Zeichen werden in bestimmten Kontexten in bestimmter Weise gebraucht und erhalten so ihre Bedeutung; viele Zeichen verwenden wir einfach, ohne ihre Bedeutung genau rekonstruieren zu können, und lernen sie, als kleine Kinder zum Beispiel, ohne ihre Bedeutung zu reflektieren.
Versucht man jedoch, das Konzept der Bedeutung eines Zeichens genauer zu analysieren, kommt man nicht umhin, sie wiederum mit Zeichen – in diesem Fall mit sprachlichen Zeichen – zu umschreiben, ähnlich wie Begriffe in Lexika umschrieben werden. Daran ist auch gar nichts Verwerfliches; man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass solche Bedeutungsbeschreibungen (wie die oben für »Haus«) nur Näherungen an die tatsächliche pragmatische Bedeutung von Zeichen sein können; gerade sprachliche und bildliche Zeichen haben viele Bedeutungsnuancen und verändern sich im Gebrauch ständig.
Das Signifikat beschreibt damit den intensionalen Aspekt der Bedeutung, also die Merkmale, die Zeichen (und damit auch den Sachverhalten und Dingen, für die sie stehen) zukommen. Der extensionale Aspekt umfasst dagegen die Menge aller Dinge bzw. Sachverhalte, die von diesem Zeichen bezeichnet werden. Man könnte sich die Extension als eine Aufzählung dieser Dinge und Sachverhalte vorstellen, von denen manche endlich (z. B. die Extension des Zeichens »Fußballweltmeister«), manche abzählbar unendlich (z. B. »natürliche Zahl«), manche überabzählbar unendlich (z. B. »Idee« – beliebig viele Ideen können immer wieder neu entstehen) sind.2
Eine weitere Unterscheidung wird in der Regel innerhalb des Signifikats gemacht: Die zwischen Denotat und Konnotat. Das Denotat ist die Grundbedeutung eines Zeichens, die alle kompetenten Nutzer des Zeichensystems kennen und daher mit ihm verbinden. Die obige Definition des Zeichens »Haus« wäre gewissermaßen dieses Denotat. Konnotate sind Zusatzbedeutungen, die nur bestimmte Gruppen oder Sub-Kulturen mit dem Zeichen verbinden. So wäre etwa das Denotat des sprachlichen Zeichens »Kuh« mit »Säugetier der Gattung Paarhufer, das als Haustier gehalten wird, Gras frisst, Milch gibt und ›Muh‹ schreit etc.« beschreibbar; ein Konnotat, das eine angenommene Gruppe von Hindus innerhalb der kompetenten Sprecher des Deutschen mit diesem Zeichen verbindet, wäre etwa »heilig«. In einer indischen Kultur, deren Mitglieder in der Mehrheit dem hinduistischen Glauben anhängen, würde das Merkmal »heilig« im zum deutschen Wort »Kuh« analogen Zeichen zum Denotat zählen. Zudem können in konkreten Äußerungen oder Medienprodukten zusätzliche Konnotatsmerkmale aktiviert werden, die nur im Kontext dieser Äußerung gelten, wenn etwa in einem Artikel oder einem Film ein bestimmter Begriff in einer vom Normalsprachlichen abweichenden Bedeutung verwendet wird.
Abb. 3: Das Zeichen und seine Elemente
2.5 Die Arbitrarität der Zeichen
Ein wichtiges Merkmal von Zeichen ist nach Saussure seine Beliebigkeit bzw. Arbitrarität (vgl. Saussure 21967: 79). Dies bedeutet, dass es keinerlei innere Beziehung zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten gibt. Für sprachliche Zeichen leuchtet dies unmittelbar ein: Der Signifikant »Haus« (also die Laut- oder Graphemfolge) steht in keiner anderen Beziehung zu dem, was er bezeichnet als der, dass er irgendwann einmal ausgewählt wurde (sei dies durch bewusste Setzung oder durch einen sprachhistorischen Prozess), Häuser zu bezeichnen. Er könnte jederzeit durch eine andere Laut- oder Graphemfolge ersetzt werden: Wenn die Gemeinschaft der Zeichenbenutzer beschließen würde, ab sofort »Fazel« als Signifikant für die Bedeutungsinhalte zu verwenden, für die bisher »Haus« benutzt wurde, würde die Kommunikation genauso funktionieren wie bisher. Derartige Zeichenersetzungen kommen tatsächlich auch immer wieder vor. So bedeutete das Zeichen »wip« im Mittelhochdeutschen »Frau«, während »frouwe« »Herrin« bedeutete und nur auf adelige Frauen angewendet werden konnte. Im Lauf der Sprachgeschichte wurde »wip/Weib« durch »Frau« ersetzt, und »Weib« als eher pejorative Bezeichnung in anderer Bedeutung weiterverwendet. Aber auch in unserer Gegenwart werden Wörter, zum Beispiel solche, die als nicht »politisch korrekt« betrachtet werden, durch mehr oder weniger bewusste Setzungen ersetzt: Anstatt »Neger« sind nun die Signifikanten »Schwarzer« oder »Afroamerikaner« im Gebrauch, anstatt »Mongoloider« »Mensch mit Down-Syndrom«.