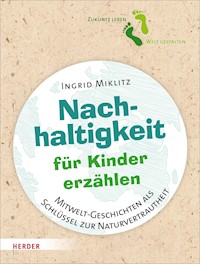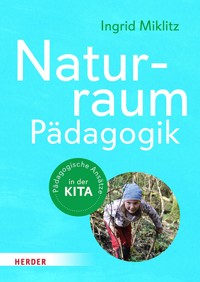
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
In dieser vollständig überarbeiteten Neuausgabe führt Ingrid Miklitz praxisnah in die grundlegenden Ideen der Naturraum-Pädagogik in der Kita ein und zeigt wie pädagogische Fachkräfte Ihre Arbeit nach diesen Elementen ausrichten können. Die Naturraum-Pädagogik nutzt den Wald und die Natur als Lernort, um ganzheitliche Bildungsprozesse in Gang zu setzen. Die Natur wird zum Antrieb für entdeckendes und eigenaktives Lernen mit allen Sinnen. Mit zusätzlicher Erweiterung um die Themen Klimawandel, Wetterextreme und Gefahrensicherung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ingrid Miklitz
Naturraum Pädagogik
Pädagogische Ansätze in der KITA
Aus Umweltschutzgründen wurde dieses Buch ohne Folie produziert.
Neuausgabe 2025
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2019
Hermann-Herder-Straße 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Bildnachweis: alle Fotos © Ingrid Miklitz außer den folgenden Fotos: S. 57: © WikiImages – pixabay.com; S. 58, S. 59: © Anton Kozyrev – shutterstock.com; S. 60 © Gertjan Hooijer – shutterstock.com; S. 61: © Ben_Kerckx – pixabay.com; S. 65: © PublicDomainPictures – pixabay.com; S. 66: © EME – pixabay.com
Satz und Gestaltung: Arnold & Domnick, Leipzig
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN (Print) 978-3-451-03541-8
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83549-0
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83520-9
Inhalt
Einleitung
1. Entstehung und Verbreitung der Naturraum-Pädagogik
1.1 Anthropologischer Exkurs: Die Macht der Gene – Steinzeit trifft auf Neuzeit
1.2 Gesamtgesellschaftliche Entwicklungen bereiten den Boden für eine neue Pädagogik
1.3 Historische Entwicklung der Wald- und Naturkindergärten
1.4 Der klassische und der integrierte Naturkindergarten
1.4.1 Der klassische Kindergarten im Naturraum
1.4.2 Der integrierte Kindergarten im Naturraum
2. Das Konzept „Naturraum-Pädagogik“
2.1 Begriffsbestimmung und Standards
2.2 Die besonderen Bedingungen im Naturraum
2.3 Das Bild vom Kind im Naturraum
2.3.1 Jäger:innen, Sammler:innen und Hüttenbauer:innen
2.3.2 Kinder wollen Spuren hinterlassen
2.3.3 Kinder sehen die Welt anders als Erwachsene
2.3.4 Kinder brauchen Erfahrungen aus erster Hand
2.3.5 Kinder suchen und finden Herausforderungen
2.3.6 Kinder wollen sich nützlich machen (Lebenspraktischer Ansatz)
2.3.7 Kinder interessieren sich für Prozesse des Werdens und Vergehens
2.3.8 Kinder wachsen an schwierigen, „unkomfortablen“ Situationen
2.3.9 Kinder brauchen Zeit, Platz und Stille
3. Kindergarten im Naturraum in der Praxis
3.1 Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte
3.2 Gefährdungen durch den Klimawandel – Grundlagenwissen und Handlungsstrategien
3.2.1 Gefährdungen durch Tiere
3.2.2 Gefährdungen durch Pflanzen
3.3 Regeln im Kindergartenalltag
3.4 Tagesablauf und Rituale
3.4.1 Beispielhafter Tagesablauf
3.4.2 Klimaangepasster Tagesablauf in der warmen Jahreszeit
3.5 Unter Dreijährige
3.6 Bedingungen und Tipps rund um die Waldplätze
3.7 Die Zusammenarbeit mit Jäger:innen und Förster:innen
3.8 Wenn Kinder weglaufen – Aufsichtspflicht im Naturraum
3.8.1 Zur Prävention gehört das Gespräch mit den Eltern
3.8.2 Rechtliche Grundlagen der Aufsichtspflicht
3.9 Verkehrssicherungspflicht im Waldkindergarten
3.9.1 Grundsätze zur Verkehrssicherungspflicht (VSP)
3.9.2 Übertragung der Verkehrssicherungspflicht auf den/die Waldbesitzer:in
3.10 Finanzierung
3.11 Ausstattung und Hygiene
3.12 Gefahren im Wald
3.13 Gesundheitliche Gefahren und medizinische Vorsorgemaßnahmen
3.14 Übergänge
4. Inklusion und Naturraum-Pädagogik
4.1 Aufnahme von Kindern mit Migrationshintergrund
4.1.1 Barrieren für Familien mit Migrationshintergrund identifizieren und abbauen
4.1.2 Natur tut Flüchtlingskindern gut
4.2 Betrachtungen durch die Genderbrille
4.3 Aufnahme von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf
4.3.1 Integration von Kindern mit einem besonderen Betreuungsbedarf
4.3.2 Aufnahme von Kindern mit einer visuellen Beeinträchtigung
4.3.3 Rahmenbedingungen für eine gelingende Inklusion von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf in einem Naturkindergarten
5. Die Gründung eines Naturkindergartens
5.1 Tipps für Neugründungsinitiativen
5.2 Qualität entwickelt sich im Dialog
Anhang
Literatur zum Weiterlesen
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Einleitung
„Mondlandung: „Geht raus spielen!“, sagten die Erwachsenen. Wir wurden nicht auf eine weiche Landung vorbereitet. Wir schlugen auf hartem Boden auf, in wilder Landschaft. Es waren besondere Schmerzen, die wir ertrugen. Wir suchten und fanden Unbekanntes. Wenn es schwierig war, war es gut. Wenn wir scheiterten, war es Ansporn.“ (Miklitz 2015b, S. 5)
Das war einmal. Nostalgiker sprechen von den toughen Kindern der 1960er- und 1970er-Jahre. Wir Kinder gingen ströpen. Beim Ströpen waren wir unter uns. Auf uns allein gestellt. Keine Helikoptereltern funkten dazwischen. Am liebsten stöberten wir in alten Schuppen, verwildertem Brachland und im Wald. Wir waren einfach viel draußen.
Wie erleben Kinder Kindheit heute? Der Kurzfilm „Ein Leben in der Schachtel“ von Bruno Bozzetto (vgl. Kurz und Gut 2015) zeigt eindrücklich die Zwänge des Alltags, die den Menschen von seiner Geburt bis zum Tod begleiten. Es ist ein Leben in „Schachteln“. Die kurzen, flüchtigen Momente des Glücks findet der Protagonist in der Natur. Bereits das Leben eines Vorschulkindes ist eng getaktet. Freiräume für kreative Alleingänge sind rar. Kinder werden oftmals einen Großteil ihrer Kindheit in Innenräumen beaufsichtigt.
Der Impuls für die Entstehung der Naturkindergärten und der Naturraum-Pädagogik ging von den skandinavischen Ländern aus. Naturverbundenheit ist in der norwegischen, schwedischen und finnischen Kultur tief verwurzelt. Hier wurde das „Jedermannsrecht“ begründet: Alle Menschen haben das Recht, die Natur, die sie umgibt, für sich zu nutzen. Dabei wird ein maßvoller Umgang vorausgesetzt. Viele Feste und Rituale sind eng mit dem jahreszeitlichen Geschehen in der Natur verbunden und werden draußen gefeiert. Über Dänemark erreichte die Idee einer Vorschulpädagogik im Naturraum zunächst Flensburg und bald ganz Deutschland. Laut Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten gibt es derzeit ca. 3000 Natur- und Waldkindergärten, Natur und Waldgruppen in Deutschland (vgl. Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten o. A.). Die Konzeption des Naturkindergartens hat die Angebotspalette der Kindertageseinrichtungen bunter gemacht und viele Regeleinrichtungen zu konzeptionellen Veränderungen angeregt.
1 Entstehung und Verbreitung der Naturraum-Pädagogik
1.1 Anthropologischer Exkurs: Die Macht der Gene – Steinzeit trifft auf Neuzeit
Unser Körper hat sich in den zurückliegenden 20.000 Jahren kaum verändert. „Die Steinzeit steckt uns in den Knochen“ titeln Professor Detlef Ganten u. a. in ihrem 2011 erschienenen Buch (vgl. Ganten u.a. 2011). Unsere Vorfahren waren gut zu Fuß. Sie legten am Tag ungefähr 20 Kilometer zurück, waren also mehrere Stunden auf den Beinen. Der Mensch musste laufen, um zu überleben. Jäger:innen und Sammler:innen litten fast nie an den heutigen Volksleiden Arthrose, Arthritis oder Osteoporose. Sie lebten gesünder als die späteren Ackerbauern. Der Mensch ist als Läufer geboren. Und dieses Erbgut tragen wir in uns. Unser Körper passt nicht in unsere heutige Lebensumwelt. Wir muten ihm Dinge zu, auf die ihn die Evolution nicht vorbereitet hat. Ein evolutionäres Erbe ist, dass Fett in den Zellen äußerst effektiv gespeichert wird. Ein Überangebot an „minderwertigen“ Nahrungsmitteln und mangelnde Bewegung sind die Hauptursachen für viele Krankheiten.
„Bei Kindern wachsen die Wirbelkörper noch, und sie reagieren sehr empfindlich auf einseitige Belastungen“ (ebd., S. 94). Die Auswirkungen füllen die Praxen der Orthopäden. Unsere Kinder sitzen zu viel. Die Evolution hat unseren Körper auf ein Leben als „Vielsitzer“ nicht vorbereitet.
„Senk- und Plattfüße, die in fortgeschrittenem Stadium zu starken Schmerzen, Knie- und Rückenproblemen führen können, entstehen vorwiegend durch eine zu schwache Fußmuskulatur. Dies ist bei Kleinkindern zunächst normal, sie bewegen sich in den ersten Jahren auf Senkfüßen. Dann bleiben die Senkfüße bestehen oder verschlimmern sich gar zu Knick- oder Plattfüßen. Halten wir uns also an unsere Vorfahren, die ohne Schuhe auf Achse waren, und lassen unsere Kinder möglichst oft barfuß laufen – am besten in der Natur“ (ebd., S. 96).
Die folgende Gegenüberstellung war Teil der Ausstellung „Steinzeitkinder“ im Neandertal-Museum in Düsseldorf-Mettmann (2013). Die Ausstellung wurde von Linda Owen konzipiert.
Steinzeitkinder
Unsere Kinder
● Der Anteil der Kinder in einer Gruppe liegt bei ca.40 Prozent
● Geborgenheit in der Großfamilie
● Keine Städte, sondern kleine Gruppen
● Mobile Lebensweise als Jäger:innen und Sammler:innen
● Drei Jahre Stillzeit
● Viel Bewegung an frischer Luft
● Ernährung nach den Jahreszeiten
● Im Winter Hunger möglich
● Raubtiere als stets lauernde Gefahr
● Eine Randgruppe: 16 Prozent der Deutschen sind Kinder
● In drei Viertel der deutschen Haushalte leben nur ein bis zwei Personen
● 20 Prozent der deutschen Kinder leben mit einem Elternteil
● Fünf Prozent der deutschen Kinder bekommen keine warme Mahlzeit
● Freizeit: Fernsehen, Hausaufgaben, Freunde treffen
● Jedes fünfte Kind ist übergewichtig
● Fett und Zucker werden zu häufig konsumiert
● ADHS ist die häufigste psychische Erkrankung
Ergänzung d. Verf.:
Kinder helfen schon in jungen Jahren mit
● Jedes dritte jugendliche Mädchen ist essgestört
● Smartphone immer dabei
● Leistungsdruck
● Jeder siebte Jugendliche ist unglücklich
Kinder haben in einem typischen Alltag zu wenig Bewegungsmöglichkeiten. Auf Spielplätzen sitzen Kinder im Sandkasten, auf Rutschen, Wippen oder Schaukeln. Kindergartenräume sind häufig so vollgestellt, dass raumgreifende Bewegungen nicht möglich sind. Erfahren Kinder wenig Bewegung, so vermissen sie diese irgendwann nicht mehr und verlieren durch ihre Umwelt das genetisch angelegte Bedürfnis nach Bewegung.
Organisierte Bewegungsabläufe (etwa in Turn-/Gymnastikräumen) sind kein Ersatz für die Spontaneität eigeninitiierter Bewegungen und Handlungen von im Naturraum agierenden Kindern. Standardisierte Umgebungsqualitäten wirken wie ein schleichendes Sedativum (Beruhigungsmittel). Kein noch so raffiniert ausgestalteter Spielplatz ersetzt zum Beispiel ein Waldstück mit Stöcken, Steinen, Bodenerhebungen und -vertiefungen, Bäumen, Baumstümpfen und vielem mehr. Je größer das Maß an vorgegebener Strukturiertheit durch Menschenhand, umso geringer die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Gestaltung von Bewegungsmodifikationen.
1.2 Gesamtgesellschaftliche Entwicklungen bereiten den Boden für eine neue Pädagogik
Spätestens mit Beginn der Ölkrise (ab 1973) geraten die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und ihre Endlichkeit in den Blickwinkel einer breiteren Öffentlichkeit. In den 1980er-Jahren rüttelt das Schlagwort „Waldsterben“ die Menschen auf. Luftschadstoffe wie Stickoxide und Schwefeldioxid bedrohen Europas Laub- und Nadelbäume. Ein großflächiges Baumsterben im Harz und Erzgebirge setzt die Politiker unter Zugzwang. Die Bevölkerung entwickelt ein Bewusstsein für den Wert der Natur und für deren Bedrohung.
Im Frühjahr 1985 rüttelt ein Artikel in der Zeitschrift „Nature“ die Öffentlichkeit wach: „Starke Verluste des Gesamt-Ozons in der Antarktis“ lautet die Schlagzeile (vgl. Deutschlandfunk 2010). Über dem Südpol entdecken britische Forscher:innen ein riesiges Loch in der schützenden Ozonschicht. Die schiere Größe (so groß wie die gesamte Antarktis) sensibilisiert die Menschen für die Umweltfolgen gefährlicher Emissionen (Emission meint „Ausstoß“; im Allgemeinen die Aussendung/Austragung von Störfaktoren in die Umwelt). Dazu kommt das Wissen um eine zunehmende globale Vermüllung des Planeten Erde. Schlagworte wie „Wegwerfgesellschaft“ und „Umweltsünder“ befördern Entwürfe neuer Lebenskonzepte. 1981 ist das Jahr, in dem in der Bundesrepublik die Friedensbewegung wächst. Immer mehr Menschen fürchten sich vor einer Spirale des Rüstungswettlaufs. Die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl (Ukraine) im April 1986 zerstört das Vertrauen in die Zukunftstauglichkeit von Atomkraftwerken. Das Unglück sensibilisierte viele Menschen für die globalen Auswirkungen und Abhängigkeiten in der Welt (vgl. ebd.).
Veränderte Kindheit
Die Marburger Universität gibt den ersten „Jugendreport Natur“ (vgl. Natursoziologie.de o. A. a) in Auftrag. Er erscheint 1997. Die Autor:innen des Jugendreports stellen unter anderem eine weitverbreitete jugendliche Naturentfremdung fest, die mit einer Naturverklärung einhergeht. In der Befragung von jeweils 1.200 hessischen Schüler:innen der Klassen 6, 9 und 12 (2002) und 1.200 Schüler:innen der Klassen 6 und 9 aus Bayern, Hessen und NRW wurde festgestellt, dass die Befragten Folgendes nicht benennen konnten:
● 44 Prozent die Früchte von Buchen (häufigster Laubbaum in Deutschland)
● 62 Prozent die Früchte des Kakaobaums (Basis des Schokoriegels)
● Mehr als die Hälfte der Schüler:innen in Nordrhein-Westfalen weiß nicht, dass Rosinen getrocknete Trauben sind.
Im Gegensatz dazu haben die jungen Menschen ein überzogen idealisiertes Bild der Natur. 70 Prozent sehen in ihr die Harmonie schlechthin und bewerten alles, was natürlich ist, auch als gut. 80 Prozent bejahen Naturschutzgebiete und finden, dass das Wild seine Ruhe braucht. 90 Prozent geben an, ohne Natur nicht leben zu können. 80 Prozent der Jugendlichen glauben, dass Tiere eine Seele haben (Bäume: 40 Prozent) (vgl. ebd.).
Das rudimentäre Wissen über die Natur steht in einem gewissen Gegensatz zum Wunsch, sich für die Belange des Naturschutzes einsetzen zu wollen. Der Artenschutz wird befürwortet bei gleichzeitiger mangelhafter Artenkenntnis. Verdrängt wird das Thema Natur/Wald als Wirtschaftsfaktor. Nachfolgestudien des Jugendreports Natur belegen die Tendenz zur Naturentfremdung bei der heranwachsenden Generation (vgl. ebd.). Der 7. Jugendreport Natur (2016) titelt „Natur Nebensache?“ (Natursoziologie.de o. A. b). In der Grundauswertung (Schwerpunkt Wald) kommt man zu dem interessanten Ergebnis, dass die Wohnlage der Kinder keine große Rolle spielt. Naturentfremdung kann auch auf dem Lande stattfinden.
Die „Waldmoral“ ist geprägt durch eine einseitige, nach wie vor romantisierte Sichtweise. Man soll das Wild nicht jagen, nicht stören. Insbesondere häufige Waldbesucher:innen haben kein Verständnis für die Jagd. Daraus lässt sich ein Bedarf an Wissensvermittlung über den Wald als Nutzwald für Wald- und Naturkindergärten ableiten.
2005 greift der amerikanische Autor, Journalist und Aktivist Richard Louv das Thema jugendliche Naturentfremdung in den USA auf. Mit seinem Buch „Last Child in the Woods – Saving our Children from Nature-Deficit Disorder“ gelingt es Woods, breite Bevölkerungsschichten zu mobilisieren. Er löst eine Bewegung aus: „no child left inside“. Das Buch erscheint in Deutschland unter dem Titel: „Das letzte Kind im Wald? Geben wir unseren Kindern die Natur zurück“(Louv 2011). „Die Wälder waren mein Ritalin“, schreibt Richard Louv über sich selbst. Der Hirnforscher Gerald Hüther schreibt im Vorwort: „Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die Art und Weise, wie Kinder Natur sehen und erleben, grundlegend verändert. Die Polarität der Beziehung hat sich umgekehrt. Heute sind sich die Kinder der globalen Bedrohungen für unsere Umwelt bewusst – aber ihre körperliche Erfahrung, ihre Vertrautheit mit Natur, sind im Schwinden begriffen. […] Ein Kind heute kann wahrscheinlich einiges über den Regenwald am Amazonas erzählen – aber nicht darüber, wann es das letzte Mal allein im Wald herumgestreift oder in einer Wiese gelegen ist und dem Wind gelauscht und den Wolken hinterhergeschaut hat“ (ebd. S. 15 f.).
Im Jugendreport Natur 2006 titelt Rainer Brämer „Natur obskur – Naturentfremdung in der Hightechwelt“ (vgl. Natursoziologie.de o. A. a). Es wächst eine Jugend heran, für die (bei entsprechender medialer Ausstattung) Hausarrest seinen Schrecken verloren hat.
Kindheit heute findet mehr und mehr in Innenräumen statt. Kinder sind Jäger:innen, Sammler:innen und Hüttenbauer:innen. Dieses evolutionäre Erbe ist ein Schatz, den es zu bewahren gilt.
In den 1970er-Jahren hat Kompensatorische Erziehung den Ausgleich sozialer Benachteiligung zum Ziel. Medialisierung der Kinderzimmer, Bewegungsarmut, Zunahme von Ein-Kind-Familien, beengte Wohnverhältnisse, Verinselung, standardisierte Außenspielflächen, Verlust von Primärerfahrungen und Dominanz von Sekundärerfahrungen bereiteten den Boden für die Suche nach ausgleichenden pädagogischen Konzepten. Neue Erkenntnisse der Hirnforschung begründen zudem einen Bedeutungszuwachs der Frühen Bildung. Sportlehrer:innen und Mediziner:innen warnen warnen vor den Folgeerkrankungen zunehmender Bewegungsarmut: Kinder laufen Gefahr, elementare Bewegungsformen wie Springen, Balancieren, Rückwärtslaufen und Klettern nicht mehr zu erlernen. Junge Menschen werden immer dicker. Die Wege zwischen den Lebensinseln werden nur noch selten zu Fuß zurückgelegt. Das Sitzen vor Bildschirmen schirmt Kinder und Jugendliche auch von der Natur ab. Jugendforscher nennen es Cocooning (das „Eingesponnen-Sein“ in etwas).
1.3 Historische Entwicklung der Wald- und Naturkindergärten
Die Zeit ist reif für ein zunehmendes Interesse der Menschen am Naturraum als wertvollem Erlebens- und Erfahrungsraum für Kinder.
1952 gründet die Dänin Ella Flatau in Sollerod einen Kindergarten im Naturraum:
„Ausgangspunkt war eine Elterninitiative. Frau Flatau ging täglich mit ihren eigenen Kindern in den Wald. Die Nachbarn […] fanden Gefallen an der neuen Idee. Sie gaben ihre Kinder in die Obhut von Frau Flatau. Bald schlossen sich andere Eltern an. Aus dieser Elterngemeinschaft entstand der erste Waldkindergarten.“ (Miklitz 2000, S. 7)
Es ist nicht eindeutig belegt, ob es sich hierbei schwerpunktmäßig um einen Waldkindergarten (skovbornehaven) oder Wanderkindergarten (vandrebornehaven) handelte. Heute gibt es in Dänemark über 500 Naturkindergärten. Das entspricht einem Anteil von ca. zehn Prozent der dänischen Einrichtungen im Vorschulbereich.
Im Frühjahr 1968 gründet Ursula Sube in Wiesbaden den ersten deutschen Waldkindergarten. Sie hat keine Ausbildung als Erzieherin. So fließen keine öffentlichen Mittel. Die Finanzierung übernehmen Eltern. Die angehenden Erzieherinnen Kerstin Jebsen und Petra Jäger erfahren 1991 in einer Fachzeitschrift vom dänischen Modell eines Kindergartens im Naturraum. Sie gründen 1993 in Flensburg einen Waldkindergarten. Dieser erhält als erster deutscher Waldkindergarten eine staatliche Anerkennung (vgl. Miklitz 2000, S. 8). Es entsteht eine erste spezifische Konzeption eines solchen Kindergartens mit seiner besonderen pädagogischen Ausprägung.
Das Umweltbewusstsein führt Eltern zusammen, die das naturaffine Konzept des Waldkindergartens für ihre Kinder wollen. Von Pionier:innen muss viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Die meisten Vorschriften, die für Regelkindergärten gelten, lassen sich nicht auf den Waldkindergarten übertragen. Bestimmungen müssen ausgehandelt und adaptiert werden. Die ersten Gründungsinitiativen brauchen einen langen Atem. Fehlende Absprachen der Ämter untereinander erschweren/verzögern die Gründungen und die staatliche Anerkennung von Wald- und Naturkindergärten in Deutschland.
Die Sozialwissenschaftlerin und Erste Vorsitzende des Waldkindergartens Bad Liebenzell (BW) Ingrid Miklitz veröffentlicht 2000 im Luchterhand-Verlag das erste Grundlagenwerk zur Waldkindergartenpädagogik: „Der Waldkindergarten – Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes“. Das Buch hilft den immer zahlreicher werdenden Elterninitiativen bei der Gründung eines Waldkindergartens (vgl. Miklitz 2000).
Staatliche Entscheidungsträger:innen können sich seit 2000 an die ersten Landesverbände in Baden-Württemberg und in Bayern wenden. Eine Liste mit beispielhaften Entscheidungen (vor allem im Bereich der Hygiene) unterstützt die Pionier-Initiativen beim Bemühen um die Erlangung einer staatlichen Anerkennung. Kurze Zeit später wird der Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten gegründet. Bei Drucklegung existieren in Deutschland fünf Landesverbände: Baden-Württemberg (mitgliederstärkster LV mit 210 Einrichtungen), Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die Landesverbände haben sich zur BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft der Wald- und Naturkindergärten) zusammengeschlossen. Inzwischen gibt es Wald- und Naturkindergärten in vielen europäischen und außereuropäischen Ländern.
Begriffsklärung „Wald“ – die gesetzliche Definition:
„Nach § 2 Bundeswaldgesetz: (1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen.“ (§2 Abs.1 BWaldG)
Die ökologische Definition:
„Wald ist ein vernetztes Sozialgebilde und Wirkungsgefüge seiner sich gegenseitig beeinflussenden und oft voneinander abhängigen biologischen, physikalischen und chemischen Bestandteile, das praktisch von der obersten Krone bis hinunter zu den äußersten Wurzelspitzen reicht. Kennzeichnend ist die konkurrenzbedingte Vorherrschaft der Bäume. Dadurch entsteht auch ein Waldbinnenklima, das sich wesentlich von dem des Freilandes unterscheidet. Dieses kann sich nur bei einer Mindesthöhe, Mindestfläche und Mindestdichte der Bäume entwickeln.“ (Stiftung Unternehmen Wald, o .A.)
Laut der letzten Bundeswaldinventur (BWI) aus dem Jahr 2012 ist Deutschland eines der waldreichen Länder der Europäischen Union. Mit 11,4 Millionen Hektar ist knapp ein Drittel der Gesamtfläche mit Wald bedeckt. Im Zeitraum zwischen 2002 und 2012 hat die Waldfläche um 50.000 Hektar, um 0,4 Prozent, zugenommen.
Naturnahe Waldgebiete können nicht in einem nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewirtschafteten Waldgebiet entstehen. Das Erscheinungsbild und die ökologische Vielfalt eines Waldes hängen vor allem davon ab, welche Bäume in ihm dominieren und in welcher Art und Weise der Wald bewirtschaftet wird. Echte Urwälder gibt es bei uns nicht (außer in Gebieten im Bayerischen Wald, im Thüringer Wald, in Nordhessen und im UNESCO-Weltkulturerbe-Buchenwald Grumsin in Brandenburg). Fast alle Waldflächen wurden seit der Jungsteinzeit durch die Nutzung des Menschen verändert. Der Anteil des Nadelwalds ist gestiegen, heute macht er mehr als die Hälfte des deutschen Waldbestands aus. Die Zahl der Eichen und Buchen, einst die dominanten Baumarten bei uns, hat dagegen abgenommen (vgl. Kapitel 2.1 Begriffsbestimmung und Standards).
Wo ein Wald vorhanden und nutzbar ist, dient er als Aufenthaltsort der klassischen Waldkindergärten. Es gibt daneben auch Strand-, Park- und Bauernhofkindergärten.
1.4 Der klassische und der integrierte Naturkindergarten
Es können zwei verschiedenen Formen von Naturkindergärten unterschieden werden: der klassische und der integrierte Wald- und Naturkindergarten (vgl. Miklitz 2000, S. 9). Wenn im Nachfolgenden der Begriff „Naturkindergarten“ verwendet wird, sind immer auch Waldkindergärten gemeint.
1.4.1 Der klassische Kindergarten im Naturraum
Ein Naturkindergarten benötigt eine auf die besonderen Strukturen und Bedingungen im Naturraum abgestimmte naturpädagogische Konzeption. Die Kinder befinden sich täglich in der Natur. Da die Schutzunterkünfte von der Größe her in der Regel sehr beschränkt sind, sollten sie nur in Ausnahmefällen benutzt werden. In einem klassischen Naturkindergarten verbringen die Kinder grundsätzlich mindestens 75 Prozent der Kindergartenzeit im Naturraum. Eine Kindergartengruppe, die konzeptionell verankert einige Zeit des Tages in der Natur verbringt, ist somit noch keine Naturkindergartengruppe.