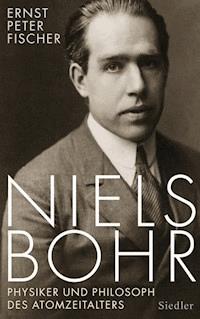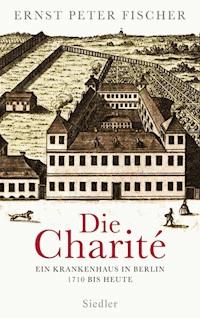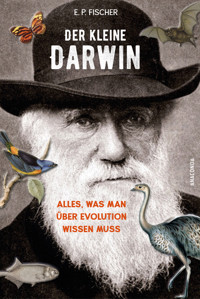2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch versammelt der renommierte Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer die besten Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft. Ob von Galileo Galilei, Marie Curie oder Albert Einstein – es sind Weisheiten, die die Neugier für die Forscher wecken und Lust machen auf noch mehr Wissenschaft. In gewohnt unterhaltsamer und tiefsinniger Weise bringt uns Ernst Peter Fischer seine Faszination für diese Welt näher, regt dazu an, weiterzudenken und sich sein Staunen zu bewahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ernst Peter Fischer zählt zu den renommiertesten Vermittlern von populärer Naturwissenschaft. Unter seinen zahlreichen Veröffentlichungen finden sich u. a. der Bestseller »Die andere Bildung« (2001), die kurzweilige Biografie »Der kleine Darwin« (2009) und »Durch die Nacht« (2015), eine faszinierende Reise durch die dunklen Gefilde unseres Lebens. Ernst Peter Fischer lebt in Heidelberg.
»Ernst Peter Fischer erklärt dem Volk alles, was es über Naturwissenschaft wissen muss.«
Die Zeit
Außerdem von Ernst Peter Fischer lieferbar:
Durch die Nacht. Eine Naturgeschichte der Dunkelheit (118/00838)
Niels Bohr. Physiker und Philosoph des Atomzeitalters (118/00996)
Der kleine Darwin. Alles, was man über Evolution wissen sollte (332/55087)
Die Verzauberung der Welt (332/55292)
Max Planck. Der Physiker (332/55116)
Schrödingers Katze auf dem Mandelbrotbaum. Durch die Hintertür zur Wissenschaft (332/50328)
Warum Spinat nur Popeye stark macht. Mythen und Legenden in der modernen Wissenschaft (332/55123)
Ernst Peter Fischer
»NOCH WICHTIGER ALS DAS WISSENIST DIE PHANTASIE«
Die 50 besten Erkenntnisse der Wissenschaftvon Galilei bis Einstein
INHALT
Zur Einführung
Erkenntnisse aus Astronomie und PhysiK
Galileo Galilei
Johannes Kepler
Isaac Newton
Michael Faraday
James Clerk Maxwell
Hermann von Helmholtz
Ludwig Boltzmann
Heinrich Hertz
Werner von Siemens
Max Planck
Albert Einstein
Lise Meitner
Marie Curie
Niels Bohr
Werner Heisenberg
Max Born
Wolfgang Pauli
Erwin Schrödinger
Victor Weisskopf
J. Robert Oppenheimer
Carl Friedrich von Weizsäcker
Richard P. Feynman
Erkenntnisse aus Mathematik und Informatik
Carl Friedrich Gauss
David Hilbert
Norbert Wiener
Alan Turing
Konrad Zuse
Erkenntnisse aus Naturforschung und Biologie
Francis Bacon
Benjamin Franklin
Alexander von Humboldt
Charles Darwin
Konrad Lorenz
Erkenntnisse aus Chemie und Medizin
Justus von Liebig
Robert Wilhelm Bunsen
Louis Pasteur
Robert Koch
Rudolf Virchow
Wilhelm Conrad Röntgen
Albert Schweitzer
Erkenntnisse aus Molekularbiologie und Genetik
Max Delbrück
Sidney Brenner
Barbara Mcclintock
James D. Watson
Francis Crick
Jacques Monod
François Jacob
Noch Mehrerkenntnisse
Georg Christoph Lichtenberg
Jean Piaget
Isaiah Berlin
Anton Tschechow
Quellen Der Erkenntnisse
ZUR EINFÜHRUNG
»Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt, und Phantasie umfasst die ganze Welt.« Eine schöne Erkenntnis, die dem überlebensgroßen Albert Einstein zugeschrieben wird und diesem Buch in abgewandelter Form den Titel gibt. Und auch wenn niemand genau sagen kann, wann und wo Einstein sie formuliert hat, so fällt es den meisten Menschen leicht, dem Gesagten zuzustimmen. In diesem Buch sollen denn auch Männer und Frauen zu Wort kommen, die als Forscher eine Fülle von Wissen angehäuft, dabei aber nicht vergessen haben, dass es Qualitäten gibt, die wichtiger sind. Die Phantasie gehört ebenso dazu wie ihre Weisheit, nach der sich viele Zeitgenossen sehnen.
Wenn ein neugieriges Mitglied der Art Homo sapiens, also ein von Biologen als »weiser Mensch« eingestuftes Lebewesen, in dem großen Nachschlagewerk namens Wikipedia nachschaut, was gelehrte Frauen und Männer unter der Weisheit verstehen, die ihm offenbar durch seine Geburt und seine Herkunft zukommt, dann verweist die enzyklopädische Auskunft zuerst auf die Weisheit alter Männer und danach auf Weisheiten aus dem alten China. Selbst einfältige Menschen dürfen jetzt fragen, warum die Frauen fehlen, wo der neue Osten und die Jungen bleiben und weshalb der Westen keine Rolle spielt. Wenn dasselbe Mitglied derselben Art mit demselben Computer jetzt bei Amazon nach Büchern schaut, die das Wort »Weisheit« im Titel führen, tauchen die Weisheit der Pferde, die Weisheit der Indianer, die Weisheit der Tuareg, die Weisheit der Buddhisten und viele andere Weisheiten vor seinem Auge auf, was abermals verwundert, weil in sämtlichen Titeln die Wissenschaft fehlt. Dafür bekommen hier sogar die Weisheitszähne ihren Auftritt, wobei diese Bezeichnung für die spät sich zeigenden Zähne von Menschen aus Persien stammt. Sie wurde dann mit dentes intellectus ins Lateinische übersetzt – wobei man diese intellektuellen Zähne wahrscheinlich öffnen muss, um die Löffel mit der Weisheit dazwischen zu bekommen, die viele Menschen meinen gefressen zu haben.
Weisheit hat offenbar bereits im Mund etwas mit dem Alter zu tun, und vielleicht sollte man erst gegen Ende eines oder seines Lebens versuchen, sich auf Weisheiten und ihre Qualitäten einzulassen, auch wenn man seit Jugendtagen damit beschäftigt ist. In meiner Schulzeit war solch eine Empfehlung zur geduldigen Gelassenheit zu hören, wobei es einen Philosophielehrer gab, der meinte, den Jungen – vor den Zeiten der Koedukation – beibringen zu können, was kluge Sätze von weisen unterscheidet. Als kluger Satz wurde die Bemerkung von Karl Marx eingestuft, in der es sinngemäß heißt, dass die Philosophen dauernd versucht hätten, die Welt zu interpretieren, während es in Wirklichkeit darauf ankomme, sie zu verändern. Als weise stufte der Lehrer zunächst mit einem ironischen Unterton die Feststellung ein, dass sich Marx da unnötig abmühe, denn die Welt habe nie etwas anderes getan, als sich zu verändern, und zwar vor allem, seit sich Menschen in ihr austoben. Für das Verändern benötige man auf keinen Fall besondere Gelehrte. Sie benötige man hingegen, um die Welt zu verstehen, und vielleicht – so der Lehrer – sei der- oder diejenige gut beraten und also auf dem Weg zur Weisheit, der diese Reihenfolge einhalten kann, also erst die Welt zu verstehen versucht, bevor er sich daranmacht, sie zu verändern (wobei sie auch Schaden nehmen und sogar zugrunde gerichtet werden kann).
Das mit dem Verstehen versuchte bekanntlich auch Albert Einstein, der dann – immer noch in der Schule – mit dem weisen Satz zitiert wurde, dass Weisheit nicht das Ergebnis von Bildung sei, sondern durch den lebenslangen Versuch zustande komme, sie zu erwerben – wobei sich die Knaben in ihren Sitzbänken in aller Ruhe überlegen konnten, wen Einstein mit dem »sie« meinte, die Bildung oder die Weisheit.
Auf jeden Fall wird mit dem klugen Zitat klar, dass Weisheit – oder auch Erkenntnis, um noch einmal auf den Titel dieses Buches zu verweisen – ihre Zeit braucht und man sich umfassend um sie bemühen kann, während Letztere vergeht. Merkwürdigerweise suchen viele Menschen in westlich ausgerichteten (europäisch-abendländischen) Kulturen nach Weisheiten im Osten, was sich unter anderem an den vielen Bänden zeigt, die Buchhandlungen dazu in eigenen Abteilungen vorrätig haben und die vom Tao der Physik ebenso künden wie vom Tao der Liebe. Wer in seine Suchmaschine »östliche Weisheit« eingibt, wird von der Titelfülle fast erschlagen, wobei besonders häufig auf die Schriften des Dalai Lama verwiesen wird, des tibetanischen Buddhisten und »ozeangleichen Lehrers«, wie es heißt. Wer es stattdessen mit »westlicher Weisheit« versucht, findet viel weniger Resonanz und eher so etwas wie die Weisheit der Urvölker für westliche Köpfe oder Fernöstliche Lehren für den westlichen Alltag.
Allmählich kommt man sich dabei als Europäer ratlos und ungerecht behandelt vor. Haben die klugen Köpfe im Osten wirklich mehr Weisheiten zu bieten als die westlichen Wettbewerber um die Wahrheit? Warum verkündet man es als eine Weisheit, wenn der Dalai Lama sagt: »Wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du schon weißt, wenn du aber zuhörst, kannst du unter Umständen etwas Neues erfahren«? Der Satz ist wahrscheinlich weder weise noch richtig, wie Kenner der europäischen Literatur wissen, die einen Heinrich von Kleist hervorgebracht hat. Kleist hat über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden nachgedacht und darauf hingewiesen, dass man am Anfang eines Satzes keineswegs weiß, was am Ende herauskommt. Man lernt sich selber kennen beim Sprechen, was zu der Frage führt, warum dies im Westen nicht als Weisheit angepriesen wird. Ist das zu schwer für die Menschen, die leichte Kost bevorzugen?
Man kann weiterfragen: Warum jubeln Bildungsbürger hierzulande dem Dalai Lama zu, wenn er verkündet, dass sich der Buddhismus bemühe, Leiden zu mindern und Freuden zu mehren, während das gleiche Publikum mit ausdruckslosem Gesicht gelangweilt auf den Hinweis reagiert, dass genau damit die Ziele westlicher Wissenschaft formuliert sind, nämlich die Freude an der Schönheit der Welt durch Wissen zu mehren und das Leiden der Menschen durch die Verbesserung ihrer Existenzbedingungen zu mindern?
Es gibt sie, die Erkenntnisse, die Weisheiten der westlichen Wissenschaft, die von Frauen und Männern geäußert worden sind, die das dazugehörige Wissen erworben und sich ihre Phantasie bewahrt haben. Dieses Buch stellt einige dieser Denkschätze und die dazugehörigen Forscher vor – wobei die jeweils zitierte Erkenntnis für sich stehen bleibt und nicht im Detail kommentiert wird. Witze und Weisheiten sollte man wirken lassen und nicht erklären. Sie werden durch solche Versuche nur verwässert und verdorben. Dafür wird der Leser aber neugierig auf die Menschen, von denen die Weisheiten stammen. Ihm kann mit den biografischen Anhängen zu den Schöpfern der zitierten Erkenntnisse geholfen werden. Womöglich machen diese Erläuterungen Lust auf noch mehr Wissenschaft – ob sie nun westlich oder östlich geprägt ist. Sie gehört zum Menschen und ist jede Mühe wert.
ERKENNTNISSE AUS ASTRONOMIE UND PHYSIK
»Ich fühle mich nicht zu dem Glaubenverpflichtet, dass derselbe Gott, der uns mit Sinnen, Verstand und Vernunftausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht zu benutzen.«
GALILEO GALILEI
(1564–1642)
Nur wenige Wissenschaftler verfügen über den Bekanntheitsgrad des Italieners Galileo Galilei, was vermutlich aber weniger an seinen fachlichen Qualifikationen und sachlichen Einsichten als an seinem polternden Auftreten und polemischen Engagement liegt. Beides war zudem mit einem unübersehbaren Geltungsbedürfnis gepaart. Galilei ging es vor allem um die Priorität von Ideen und Entdeckungen, und er wäre heute ein gefragter und gern gesehener Gast in televisionären Talkrunden, der sich lärmend und stets selbstsicher über Gott und die Welt auslassen und alles besser wissen würde.
Es sind wohl vor allem diese menschlichen Eigenschaften gewesen, die den Poeten Bertolt Brecht auf die Idee brachten, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Theaterstück über das Leben des Galilei zu schreiben. Brecht lässt seinen Galilei zum einen als leidenschaftlichen Wissenschaftler erscheinen, der »wie ein Liebender, wie ein Betrunkener« herausbrüllt, was er erfahren hat, und den eine große Sehnsucht auszeichnet: »Ich denke manchmal: ich ließe mich zehn Klafter unter der Erde in einen Kerker einsperren, zu dem kein Licht mehr dringt, wenn ich dafür erführe, was das ist: Licht«, lässt Brecht Galilei sagen.
Auf der anderen Seite führt der deutsche Dichter in seinem Theaterstück einen eher aggressiven Galilei vor, der gegen die unübersehbare öffentliche Dummheit kämpft und denjenigen in hoher Erregung »keine Gnade« gewähren will, »die nicht geforscht haben und doch reden«.
Der letzte Satz passte ganz vorzüglich auf die vielen Ethiker und anderen Philosophen, die in unseren Tagen etwa den biologischen und chemischen Wissenschaften unentwegt mit moralisch erhobenen Zeigefingern in die praktische Quere kommen wollen, ohne selbst auch nur das geringste Wissen erworben zu haben oder anbieten zu können, das den zahlreichen bedürftigen Personen unserer Tage die zitierte »Mühseligkeit der menschlichen Existenz« tatsächlich nehmen kann (statt sie unnötig zu vergrößern).
Wer den Namen Galileo Galilei hört, denkt vermutlich zuerst daran, dass der Forscher doch mit der katholischen Kirche in Konflikt geraten ist und dann sogar die hässlichen Hände der unnachgiebigen Inquisition zu spüren bekommen hat, die ihm schwer zugesetzt und zu einem unnötigen Widerruf gezwungen haben. Erst im Anschluss an dieses Trauerspiel fällt vielen Menschen bei dem Namen Galileo Galilei ein, dass dieser Physiker und Astronom Ansichten über die Bewegungen und das Aussehen von verschiedenen Himmelskörpern entwickelt hat. Dabei konnte Galilei als einer der ersten Astronomen seine Objekte nicht mehr nur mit bloßem Auge betrachten, sondern ihm ist dabei maßgeblich die damals neue Konstruktion eines Fernrohrs zu Hilfe gekommen, das der Wissenschaft im Besonderen und der Menschheit im Allgemeinen ab 1609 eine stark erweiterte Sicht des Universums erlaubte.
Bevor es das Fernrohr für den Himmel gab, war Galilei mehr mit irdischen Dingen und ihrer Physik beschäftigt, wie sie sich etwa in pendelnden Kronleuchtern oder den Bewegungen von fallenden oder schwimmenden Körpern zeigt. Er versuchte nach vielen Versuchen in zahlreichen Vorrichtungen, die fleißig beobachteten und gemessenen Zahlen mithilfe der dazugehörenden Sprache zu verstehen, also mit den Formeln und Gleichungen, die die Mathematik den Menschen zur Verfügung stellt. Galilei gewann dabei eine Überzeugung, die er in seinem Buch Il Saggiatore bis 1623 in einer Art Glaubensbekenntnis aufschrieb. Diesem Bekenntnis hängt die moderne Wissenschaft bis heute an, obwohl es in vielen Bereichen – etwa dem des Lebens – nicht unbedingt in der beschworenen Strenge haltbar ist und irgendwann einmal gründlich bedacht werden sollte:
»Das Buch der Natur kann man nur verstehen, wenn man vorher die Sprache und die Buchstaben der Mathematik gelernt hat, in denen es geschrieben ist. Es ist in mathematischer Sprache geschrieben, und die Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, und ohne diese Hilfsmittel ist es menschenunmöglich, auch nur ein Wort davon zu verstehen.«
Mit anderen Worten, Galilei verkündet als seine feste Überzeugung: »Gott ist ein Mathematiker.« Viele Zuhörer sind bis heute von dieser Botschaft so sehr angetan und begeistert, dass niemandem auffällt, wie gewaltig Galilei hier aufschneidet. Was er sagt, heißt nämlich in moderner Sprache, dass es mathematisch fassbare Naturgesetze für Bewegungen wie etwa die des freien Falls von Kugeln und anderen Gegenständen gibt, um die sich Galilei höchstpersönlich und höchst emsig bemüht hat – leider ohne jeden Erfolg. Galilei lag also keinerlei Beweis für seine oben zitierte starke Behauptung vor, die sich frühestens am Ende des 17. Jahrhunderts als relevant und akzeptabel herausstellen sollte.
Kurzum, was Galilei über die Mathematik schreibt, entspricht und entspringt vielleicht seinen Wünschen und verdient vielleicht unsere Bewunderung als eine kühne Vision, hat aber leider mit dem ihm und seiner Zeit verfügbaren Wissen nichts zu tun. Und dieser Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit brachte unseren Helden dann auch in den gefährlichen Konflikt mit der Kirche, den nur die Institution gewinnen konnte.
Galileis Konflikt mit der Kirche hatte um 1614 begonnen, als er sich in Briefen und Gesprächen dahingehend äußerte, dass es doch für Astronomen nicht um die Frage gehen könne, ob einzelne Bibelstellen in Einklang mit dem Kopernikanischen System stünden oder nicht. Es gehe in der Wissenschaft seiner Tage vielmehr um die Aufgabe, das ganze Denken über den Kosmos von der ihm überholt erscheinenden Philosophie des Aristoteles zu lösen und für eine Epoche neu zu entwerfen, in der ein Teleskop zur Verfügung stand, das den Himmel näher holte und genauer Beobachtung zugänglich machte.
»Erkennen heißt, das äußerlichWahrgenommene mit den innerenIdeen zusammenbringen und ihreÜbereinstimmung beurteilen, was (man)sehr schön ausgedrückt hat mit dem Wort›Erwachen‹ wie aus einem Schlaf.«
JOHANNES KEPLER
(1571–1630)
Vor dem Wissen steht das Glauben, woraus folgt, dass die ersten Männer der Wissenschaft über festes Vertrauen in einen Schöpfergott verfügten und unter dieser Vorgabe die Welt erkundeten. Zu ihnen gehört Johannes Kepler, der bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges lebte und sich zum Protestantismus bekannte. Für Kepler wirkte Gottes Gnade auf vielfältige Weise bis in den persönlichen Bereich hinein, etwa dadurch, dass der Schöpfer den kränklichen Astronomen auf der Erde lang genug am Leben hielt, um ihm ausreichend Gelegenheit zu geben, das Werk des allmächtigen Herrn des Himmels und der Erden in seiner Schönheit und Vollkommenheit zu erforschen.
Kepler zeigte sich zeitlebens davon überzeugt, dass »nichts in der Welt (…) von Gott planlos geschaffen« ist, wie er in seinem Hauptwerk Weltharmonik von 1619 geschrieben hat, und er sah seine Aufgabe darin, sich auf die dazugehörigen Gedanken Gottes einzulassen. Von den wissenschaftlichen Bemühungen Keplers, die den Gang von Licht durch Glas (Optik) ebenso ins Visier nahmen wie die sechseckige Form von Schneeflocken (Chemie), sollen nur die astronomischen Leistungen bedacht werden, die den Himmel zu erfassen versuchten.
Als Kepler sich an sein Werk machte, sah das christliche Denken die Erde mit dem Menschen im Zentrum der Welt, und um diese Mitte drehten sich die kugelförmigen Sphären, die ihrerseits außen Platz für das Göttliche ließen. Der aus dem Württembergischen stammende Astronom Kepler kannte nicht nur die antiken Himmelsmodelle in christlicher Ausschmückung, wie sie etwa in Dantes Göttlicher Komödie eine Rolle spielen. Er kannte darüber hinaus auch die Ideen von Nikolaus Kopernikus (1473–1543), der in seinem Sterbejahr die bis heute als umwälzend geltenden Ansichten über die Bewegungen am Himmel publiziert und dabei zwei dramatische Wendungen (Revolutionen) im Denken vorgenommen hatte. Zum Ersten empfahl Kopernikus, die Erde aus dem Zentrum der Welt zu nehmen und dort die Sonne unterzubringen. Und zum Zweiten stellte der polnische Domherr die Hypothese vor, dass sich die Erde zweimal drehe, nämlich nicht nur um die Sonne – in einem großen Umlauf, für den sie ein Jahr benötigt –, sondern zusätzlich in einem eher kleinen und kürzeren Rahmen um ihre eigene Achse, was den Wechsel von Tag und Nacht erklärt.
Allerdings gab es im frühen 17. Jahrhundert keinerlei empirische Evidenz für eine Drehung der Erde um die Sonne, was es vielen Astronomen dieser Zeit leicht machte, den heliozentrischen Gegenvorschlag zum geozentrischen Kosmos als belanglose Spielerei ohne wissenschaftlichen Wert abzutun. Es war offenbar mehr oder weniger allein Johannes Kepler, der von Anfang an fest von der zentralen Position einer wärmenden und leuchtenden Sonne überzeugt war.
Keplers Überzeugung beruhte auf einem Grund, der direkt zu Gott führt. Er steckte darin, dass Kepler durch das Kopernikanische System von »religiöser Leidenschaft« erfasst wurde. Tatsächlich sieht Kepler in der heliozentrischen Anordnung am Himmel »das körperliche Abbild« des »drei-einen Gottes« in der Welt, wobei er Gott den Vater im Zentrum, seinen Sohn in der Oberfläche der Kugel und den »Heiligen Geist im Gleichmaß der Bezogenheit zwischen Punkt und Zwischenraum« sieht, wie es bei ihm etwas kryptisch und für die Gegenwart nicht immer leicht nachvollziehbar heißt. Einfacher ausgedrückt: Kepler erkundet die Gestalt des Kosmos im heliozentrischen Glauben mithilfe der christlichen Trinität, und mit diesen Vorgaben macht er sich daran, nach den wahren Gesetzen der Proportionen der Planetenbewegung als dem wahren Ausdruck der Schönheit der Schöpfung zu suchen.
Bekanntlich findet Kepler im Laufe seines weiteren Lebens drei Gesetze dieser Art, wobei sich die genannte Zahl nicht nur in die christliche Harmonie fügt, sondern zu einem besonderen Erlebnis von Kepler führt. Tatsächlich findet er zunächst zwei Gesetze für die Bewegung der wandernden Himmelskörper, von denen das erste allgemein für die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens von größter Bedeutung ist. Es stellt den Abschied von kreisförmigen Planetenbahnen am Himmel dar und verkündet, dass zum Beispiel die Erde die Sonne auf einer Ellipse umläuft. Kepler erkennt die außerirdische Realität dieser geometrischen Figur mithilfe von langwierigen Beobachtungen der Marsbahn und sich nahezu ewig hinziehenden Berechnungen.
Diese quantitative Akribie zeigt, dass hier neben dem religiösen Eiferer auch ein streng der Empirie verpflichteter Wissenschaftler heutiger Prägung am Werk ist, sodass man Kepler als direkten Mittler zwischen der mittelalterlichen und der modernen Welt betrachten kann. Anders ausgedrückt: Er steht und wirkt wahrlich am Beginn der Neuzeit. Sein Beispiel weist zugleich auf etwas Weiteres hin: Seine große Entdeckung – dass Planeten auf Ellipsen unterwegs sind – ist nicht das Ende einer Untersuchung, sondern erzwingt im Gegenteil einen neuen Anfang, und zwar aus folgendem Grund:
Solange die Annahme galt, dass die Planeten kreisförmig von außerirdischen Himmelssphären bewegt werden, fragte niemand nach der dafür nötigen Kraft. Die Götter hatten es schlicht auf diese perfekte Weise eingerichtet, und mehr war da für Menschen nicht zu wissen und zu wollen. Indem Kepler die Kreise abschaffte und durch Ellipsen ersetzte, kam er zwar, wissenschaftlich gesehen, der Wahrheit am Himmel näher, aber er musste dafür einen Preis zahlen. Dieser bestand in der Verpflichtung, eine Antwort auf die Frage zu geben, wer oder was für die gefundene geometrische Form zuständig ist und die nötige Kraft dafür liefert. Kepler sah das Problem, kam aber nicht auf die Lösung, die noch ein knappes Jahrhundert auf sich warten lassen musste – und zwar so lange, bis Sir Isaac Newton in England die Bühne der Wissenschaftsgeschichte betrat und die Schwerkraft einführte. Mit seiner Mechanik konnte man Keplers Gesetze ableiten, und die moderne Physik hatte begonnen.
»In der Wissenschaft gleichen wir alle nur den Kindern, die am Rande des Wissens hie und da einen Kieselstein aufheben, während sich der weite Ozean des Unbekannten vor unseren Augen erstreckt.«
ISAAC NEWTON
(1642–1727)
Isaac Newtons Einfluss reicht ungeheuer weit. Seine Physik hat mit der Einführung einer universellen Schwerkraft (Gravitation) nicht nur zu der allgemeinen Idee eines Uhrwerks geführt, das am Himmel tickt, den Kosmos ausmacht und die Planeten auf ihren Bahnen hält. Newton hat mit seiner Mechanik auch starken Einfluss auf die Geschichte der Philosophie ausgeübt. Denn das Werk, in dem Immanuel Kant seine Kritik der reinen Vernunft vorstellt, müsste eigentlich den Titel »Kritik der Newtonschen Physik« tragen. Zwar versteht Kant nicht genau, was der Physiker Newton unter Trägheit versteht, aber der Philosoph meint, dass der Brite zum einen etwas gefunden hat, was a priori wahr ist, nämlich die euklidische Geometrie des Raumes (die Einstein als unzureichend identifizieren konnte), und Kant meint zum anderen, dass mit Newton die immanente Erklärung der Welt – ihre Mechanik – abgeschlossen ist und das kosmische Uhrwerk nun nach seinen ewigen Gesetzen berechenbar abläuft.
Newton selbst hingegen ist da gar nicht so sicher: Als tiefgläubiger Mensch gesteht er einem Gott Eingriffsmöglichkeiten zu und sieht in seinem Ansatz mehr offene Fragen als fertige Lösungen: So wundert er sich etwa, wie die Schwerkraft entsteht und sich im Raum ausbreitet. Aber darüber huscht Kant hinweg, denn jetzt versteht er, was Galilei gemeint hat, als er von dem Buch der Natur schrieb, das in der Sprache der Mathematik verfasst ist. Newton hat Gottes Sprache enthüllt, und sein Ruhm wächst ins Unermessliche, als er zum einen den Wechsel der Gezeiten erklären und vorhersagen kann und sich zum anderen im Laufe des 18. Jahrhunderts seine Behauptung bestätigt, die Erde sei keine perfekte Kugel, sondern an den Polen abgeflacht.
Während sich diese Einsichten nach 1800 verbreiten, gewinnen die Menschen endgültig den Eindruck, dass Newtons Mechanik und Uhrwerk nicht nur den von ihnen bewohnten Planeten, sondern sie selbst und ihr Leben in Form von Gesetzen erklären können und ihnen somit keine Freiheiten mehr bleiben. Alles scheint determiniert zu sein.
Gegen diese Einengung des Daseins wehren sich die Menschen, die von der Kulturgeschichte als Romantiker bezeichnet werden. E. T. A. Hoffmann zum Beispiel lässt in seinen Erzählungen Menschen auftreten, die alle möglichen Handlungen ausführen können, nur nicht solche, die vorhersagbar sind. Die romantische Literatur kommt als Antwort auf die Newtonsche Physik zustande, und so ahnt man, welche Ehrfurcht mit dem Namen des britischen Physikers einherging, und zwar schon zu seinen Lebzeiten.
Als Newton 1727 in London im Alter von 85 Jahren starb, setzten ihn seine Landsleute in der Westminster Abbey bei, und Voltaire, der Beobachter der englischen Kultur aus Frankreich, stellte fest, dass Newton »begraben wurde wie ein König, der beim Volk sehr beliebt war«. Der Dichter Alexander Pope verfasste bei dieser Gelegenheit ein Epitaph, das bis heute zitiert wird: »Nature and Nature’s laws lay hid in Night. God said, Let Newton be! and all was Light.«
Newtons Erfolge als mathematischer Physiker ließen die anderen Wissenschaften davon träumen, auch jemanden wie ihn hervorzubringen, die Biologie zum Beispiel einen »Newton des Grashalms«, wie Kant formulierte, was aber mindestens einem Zeitgenossen nicht unbedingt gefallen haben kann. Gemeint ist Johann Wolfgang von Goethe, der Newton in Hinblick auf die Erklärung der Farben als seinen Gegner einstufte und mit einer eigenen Farbenlehre versuchte, selbst wissenschaftliche Reputation zu erlangen. Heute deutet man die beiden großen Bemühungen um das mannigfaltige Bunte versöhnlich, indem man sagt, Newton habe mit seiner Zerlegung des Sonnenlichts in Spektralfarben als Physiker agiert, während Goethe mit seiner Beschreibung der Lichtwirkungen dasselbe Phänomen als Physiologe und Psychologe untersucht habe. Wer ein Fernrohr bauen wolle, kommt mit Goethe nicht weiter, und wer die Gefühle verstehen will, wie sie etwa beim Betrachten von Rot oder Magenta entstehen, kommt mit Newton nicht weiter.
Übrigens – wer den Menschen Newton verstehen will, kommt mit der Naturwissenschaft allein auch nicht weit. Denn wie die Historiker inzwischen finden und zeigen konnten, hat Newton mehr alchemistische als physikalische Texte hinterlassen. Er hat zum Beispiel das Buch des legendären Vaters der Alchemie, einer ins Reich der Fabel gehörenden Figur namens Hermes Trismegistos, herausgegeben, das den Titel Tabula smaragdina, also »Die smaragdene Tafel« trägt. In ihm heißt es explizit: »Die Dinge unten sind wie die Dinge oben«, und möglicherweise steckt hierin die Quelle für Newtons Überzeugung, dass ein Mond am Himmel denselben Gesetzen unterliegt wie ein Apfel auf der Erde. Beide fallen dank der Schwerkraft, und der Trabant muss sich schnell um seinen Planeten drehen, um seine Position zu halten.
Man sieht: Wer bei Newton eine ausschließlich auf Vernunft und Experiment gegründete Wissenschaft zu finden hofft, sollte sich auf Überraschungen gefasst machen. Selbst als er seine berühmte Behauptung aufstellte »Hypotheses non fingo« – »Ich mache keine Hypothesen«, da hat er keiner Logik das Wort geredet, sondern nur gesagt, was die »Natürlichen Magier« seiner Zeit gesagt haben, weshalb man Newton gerne als den letzten dieser Zunft bezeichnet. Magier versuchten, mit okkulten Prinzipien zu operieren, und die Schwerkraft gehörte für Newton zu diesem okkulten Reich. Schließlich konnte er keine Gründe für ihre Herkunft angeben. Er konnte nur hinnehmen, dass es sie gibt, und er konnte ihre Auswirkung beschreiben.
Newton kümmerte sich vor allem deshalb so sehr um die Schriften der Alchemisten, weil er vermutete, sie enthielten ein geheimes Wissen, das von Gott offenbart worden sei. Newton nahm an, dass es »Gottes große Alchemie« sei, die aus dem Urchaos die Ordnung der Welt geschaffen habe, die seine Gesetze erkennen lassen.
»Es hat Gott gefallen, seine materielleSchöpfung mit Hilfe von Gesetzen zustande zu bringen. Der Schöpfer beherrscht seine materiellenHervorbringungen durch definitive Gesetze, die durch die Kräfte zustandekommen, die auf die Materie einwirken.«
MICHAEL FARADAY
(1791–1867)
Michael Faraday stammt aus einem Slumvorort Londons, und er musste als Sohn eines Hufschmieds schon als 13-Jähriger die Schule verlassen, um durch Buchbinderei etwas Geld für die Familie verdienen zu können. Doch wie das Leben so spielt – der kleine Faraday liest die Bücher, die er herstellt, und besonders gefallen ihm solche, die sich mit Wissenschaft befassen. Das spannende Thema seiner Kindheitsjahre ist die Elektrizität. Der 20-jährige Michael lässt sich von dem entsprechenden Eintrag in der Encyklopædia Britannica derart faszinieren, dass er sich kleine Apparate anschafft, um eigene Versuche durchzuführen.
1812 setzt er alles daran, um die Vorlesungen zu hören, die der führende Elektrochemiker seiner Zeit, Sir Humphry Davis, anbietet. Faraday macht fleißig Notizen und stellt das Geschriebene zu einem Buch zusammen, das überraschend den Weg zu Davis findet. Der berühmte Mann ruft den unbekannten Autor zu sich, und als Folge des Treffens betritt der 22-jährige Faraday das Königliche Institut der Wissenschaft, das ihm wie ein Königreich erscheint und in dem sich seine ganze Karriere abspielen wird.
Ihn fasziniert die Wandelbarkeit der Stoffe und der Kräfte, und so beginnt Faraday sein eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten mit chemischen Versuchen wie der Destillation fetter Öle. Dabei fällt ihm eine Verbindung auf, die bald Benzol heißt und aus sechs Kohlenstoff- und sechs Wasserstoffatomen besteht, was den Chemikern lange Zeit viel Kopfzerbrechen bereitet. Sein eigenes Hauptaugenmerk richtet sich immer stärker auf die Elektrizität, die er zunächst für eine Flüssigkeit hält, da sie als Strom durch Leitungen fließen kann. Aber wie soll er dabei erklären, dass es zwei Formen von Elektrizität – Plus und Minus – gibt? Und wie kann man das Gewicht des Stroms messen?
Die Vorstellung von Flüssigkeiten erlebt damals ihren Höhepunkt, denn die Zeitgenossen deuten nicht nur die Elektrizität, sondern auch die Wärme auf diese Weise. Faraday will wissen, wie dabei Umformungen zustande kommen können. Während er dies untersucht, festigt sich in ihm der Gedanke an eine Einheit in der Natur, eine einheitliche Schöpfung der Dinge. Die Frage lautet: Wie kann man zeigen, dass die Kräfte der Natur in der Tiefe zusammenhängen? Eine mögliche Antwort darauf liefert eine Beobachtung, die dem dänischen Physiker Hans Christian Øersted 1820 gelingt. Øersted war aufgefallen, dass dann, wenn ein elektrischer Strom in einem Draht zu fließen beginnt, eine Magnetnadel in der Nähe ausschlägt, wobei der Effekt von der Richtung des Stroms und der Lage der Nadel abhängt.
Faraday wiederholt die Experimente sofort und bemerkt, was tatsächlich passiert: Die Elektrizität des Stromes wird in eine magnetische Kraft verwandelt, die an der Nadel dreht. Der Däne hatte herausgefunden, dass Elektrizität in Magnetismus verwandelt werden kann, und Faraday nimmt sich das symmetrische Gegenstück vor: »Verwandle Magnetismus in Elektrizität«, wie er sich selbst in seinem Tagebuch auffordert, und er hält an dieser Aufgabe hartnäckig fest, auch wenn er zehn Jahre braucht, um sie zu lösen. Im August 1831 umwickelt Faraday einen Eisenring mit zwei Kupferspulen. Eine dieser Spulen verbindet er mit einem Messgerät (einem Galvanometer), und die andere setzt er unter Strom. Er stellt sich vor, damit ein Magnetfeld aufzubauen, das dann in der ersten Spule einen weiteren Strom in Gang setzte – induzierte, wie man heute sagt. Zunächst stellt Faraday zwar fest, dass im stationären Fall nichts zu sehen ist. Doch dann bemerkt er, dass beim Ein- und Ausschalten des Stroms in der zweiten Spule das Galvanometer reagiert und einen Stromfluss anzeigt – und zwar dann und nur dann. Es war also nicht das Magnetfeld selbst, das einen elektrischen Strom induzierte. Es war dessen zeitliche Änderung.
Faraday hatte das Prinzip der elektrischen Induktion entdeckt, und bald konnte er konstruieren, was heute als Generator, Elektromotor und Transformator funktioniert. Die Grundlage der Elektrotechnik war verstanden und gelegt. Als er seine Einsicht der Gesellschaft vorstellte, fragte ihn jemand, wozu man all diese Spulen und anderen Gerätschaften eigentlich gebrauchen könne. Worauf Faraday ohne zu zögern antwortete: »Im Moment weiß ich es noch nicht, aber eines Tages wird man sie besteuern können.«
Zu dieser Zeit gab es viele Politiker, die Faradays Versuche als einen »gross humbug« einschätzten, was ihn aber nicht störte. Faraday hatte sich zudem schon vor seinem Durchbruch mit der Induktion vorgenommen, seine Erfahrungen allgemeinverständlich darzustellen. 1826 hat er eine »Weihnachtsvorlesung für Kinder« am Sitz der Royal Society in London ins Leben gerufen und damit eine Tradition begründet, die bis heute gepflegt wird. Seine eigene berühmt gewordene Darbietung behandelt »Die Naturgeschichte einer Kerze«, und das dazugehörige Original – The Chemical History of a Candle