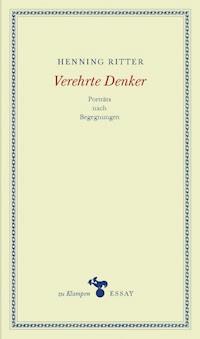14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Lieblingsepoche des Autors ist fraglos das 18. Jahrhundert der Rousseau und Montesquieu, gerade wegen der Geständnisfreude, mit der es seine Leidenschaften bekennt. Vor allem aber interessiert ihn die geistige Konkurrenz zwischen den Epochen und Traditionen, das Unerledigte der Vergangenheit, ihre Lektionen; und die Gegenwart, als zuletzt kommende, wird um ihre scheinbare Überlegenheit gebracht, alle Perioden erhalten die gleiche Chance. Und so entsteht ein Gespräch zwischen den unabhängigsten Köpfen von der Aufklärung bis heute, von Montaigne bis Nietzsche und Darwin, von Büchner bis Canetti, Jünger und vielen anderen - ein Füllhorn voller immer wieder überraschender Lesefrüchte, Entwürfe, Maximen und Reflexionen; mit wiederkehrenden Motiven und Themen, wie etwa (unter dem Stichwort Deutsche Dinge") die beständigen Eigenarten der Deutschen, die Rolle von Mitleid und Erinnerung in der heutigen Gesellschaft oder die Konkurrenz von Politik und Kultur in der deutschen Geschichte. Die Notizen bewegen sich zwischen der lakonischen Knappheit des Aphorismus und dem Kurzessay; Spontaneität und Zufall sind ihr Signum, und sie sind ungeplant, notiert in ein Heft, das jederzeit zur Hand war. Es sind, um mit einer seiner schönen Trouvaillen zu sprechen, Denksteine, die um und um gewendet werden müssen" (Goethe), Gedanken im Wartestand, die darauf warten, dass Autor und Leser sich ihnen zuwenden, um Gebrauch von ihnen zu machen. Henning Ritters Notizhefte sind ein sehr persönlicher Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Denken im Spiegel einer unvermutet aktuellen Vergangenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
HENNINGRITTER
NOTIZHEFTE
BERLIN VERLAG
VORBEMERKUNG
Dieser Band enthält Notizen aus den Jahren 1990 bis 2009. Es handelt sich um eine Auswahl, etwa ein Zehntel der Aufzeichnungen. Notiert wurden die Einfälle und Reflexionen in Notizhefte, von denen sich im Lauf der Jahre ein halbes Hundert ansammelte. An eine Veröffentlichung war lange nicht gedacht. Dann verlockten Stetigkeit und Abwechslungsreichtum der Notizen, sie Freunden zugänglich zu machen, die zu einer Veröffentlichung rieten.
Sich dazu zu entschließen wurde leichter gemacht durch eine Erfahrung, die jeder kennt, der über längere Zeit hin Notizhefte führt. Nach und nach übernimmt das Notizbuch die Regie, es bestimmt, was jeweils in die Folge der Aufzeichnungen aufgenommen wird. Es gibt also einen Türhüter, der eine subtile, für den Schreibenden kaum merkliche Zensur ausübt, die verhindert, daß man alles schreiben kann, was man will. Dieses muß zunächst die Schwelle des Notizheftes überschreiten. So ergibt sich eine Kontinuität von Motiven und Impulsen, die über lange Zeit Bestand haben kann und für den Schreibenden nicht unbedingt deutlicher faßbar ist als für den hinzukommenden Leser.
Diese hinter dem Rücken des Autors vollzogene Objektivierung hatte nun ihrerseits einen gewissen Sog. Neben der beruflichen Tätigkeit als Redakteur mit ihrem täglichen Lese- und Schreibpensum hatte die unreglementierte Lektüre eine wachsende Anziehungskraft. Ihre Freiheit und Spontaneität verlockten zu immer neuen Ausflügen zu Lieblingsautoren und in Lieblingsepochen.
Auch in den Lektüren zeigt sich eine gewisse Vorbestimmung. Es gibt Bücher, für die im Bewußtsein des Lesers ein Platz freigehalten ist. Jedenfalls wird diese Illusion rückblickend erzeugt. Andererseits gibt es freie Räume im Bewußtsein, von denen man zu wissen glaubt, durch welche Lektüren sie gefüllt sein wollen. Anhaltende Lektüre ermöglicht beide Arten geistiger Erfahrung. Einmal erschließt sie Leerräume des Bewußtseins, ein anderes Mal räumt sie im überfüllten Bewußtsein auf. Jedesmal erlebt der Leser eine andere Geschichte. Zu der einen wie der anderen Erfahrung möchten die vorliegenden Notizen anregen.
Frankfurt im Juni 2010
N O T I Z H E F T E
Was wiegt schwerer, moralisches oder intellektuelles Versagen? In »Doppelleben« berichtet Gottfried Benn über seinen Briefwechsel mit Klaus Mann, den er nach dem Krieg aus Anlaß seiner Rechenschaft wiederliest. Seine Darstellung zeigt, daß damals, 1950, die Kriterien des Versagens noch nicht festlagen. Und es ist noch nicht klar, welche Art von Versagen mehr Gewicht hat. Seit der Mitte der fünfziger Jahre herrscht dann Konsens darüber, daß das Versagen gegenüber dem Nationalsozialismus ein moralisches Versagen war. Auch der Begriff der Emigration hatte, wie Benn betont, erst allmählich eine moralische Färbung angenommen. 1933 habe es ihn in Deutschland nicht gegeben – »man kannte politische Flüchtlinge, aber den massiven, ethisch untermauerten Begriff der Emigration, wie er nach 1933 bei uns gang und gäbe wurde, kannte man nicht … Wenn nun also Angehörige meiner Generation und meines Gedankenkreises Deutschland verließen, emigrierten sie noch nicht in dem späteren polemischen Sinne, sondern sie zogen es vor, persönlichen Fährnissen aus dem Wege zu gehen, die Dauer und die Intensität des Fortgehens sah wohl keiner von ihnen genau voraus. Es war mehr eine Demonstration als eine Offensive, mehr ein Ausweichen als eine Emigration.«
Zu diesen Feststellungen kommt Benn beim Wiederlesen des Briefes von Klaus Mann: »Diesen Brief hatte ich seit 15 Jahren nicht wieder gelesen und als ich ihn heute wieder vornahm, war ich vollkommen verblüfft. Dieser 27-jährige hatte die Situation richtiger beurteilt, die Entwicklung der Dinge genau vorausgesehen, er war klarer denkend als ich, meine Antwort … war demgegenüber romantisch, überschwänglich, pathetisch, aber ich muß ihr zugutehalten, sie enthielt Probleme, Fragen, innere Schwierigkeiten, die auch heute noch für uns alle akut sind.« Die intellektuelle Überlegenheit ist es, nicht die moralische, die Benn beim Wiederlesen des Briefes Klaus Manns bewußt wird.
Während die Sprachfiguren der französischen Moralistik, die Nietzsche so sehr bewunderte, dazu dienen sollten, das Gewicht der Welt zu verringern, nutzt Nietzsche sie für das Gegenteil. Überall will er die Unerträglichkeit des Daseins steigern, die Wunde der Existenz fühlbarer machen: Das ist sein Perspektivismus auf das Leiden hin. Das soll einen höheren Pakt der Sprache mit dem Leben ergeben, jenseits von Leiden und Mitleiden.
Will man das Verhältnis meiner Generation zu Walter Benjamin beurteilen, so muß man in die Rechnung aufnehmen, wie viele mit Arbeiten über ihn, dem die Habilitation verweigert wurde, zu akademischen Titeln gelangten, gar habilitierten mit einer Arbeit über das Trauerspielbuch, das Benjamins Auszug aus der akademischen Welt besiegelte. Darin liegt zweifellos ein Mangel an Takt gegenüber dem verehrten Autor, obwohl die Betreffenden sich wohl eher einbildeten, sie würden ihn an der akademischen Institution rächen. Dabei ist es die Generation aber schuldig geblieben, die Gedanken Benjamins aufzuschließen, da sie sich diese eher mimetisch aneignete. Rolf Tiedemann bildete es zu einer eigenen Disziplin aus, Benjamin mit Benjamin darzustellen, ein Verfahren, das um so verstörender wirken muß, als Benjamin eine manische Empfindlichkeit gegenüber Anleihen bei seinem Denken hatte.
Von Blochs »Spuren« sagte er, es seien die Spuren, die sein Denken bei Bloch hinterlassen habe. Über Adorno – damals Theodor Wiesengrund – soll er, nach einer Überlieferung von Soma Morgenstern, gesagt haben: »Er folgt mir bis in meine Träume, und: Habe ich Ihnen schon einmal erzählt, daß Teddy Wiesengrund mit Hilfe eines Kapitels aus einem meiner Bücher sich bei einem Professor hier in Frankfurt habilitieren ließ, bei dem ich durchgefallen bin.«
Im Licht der Zeugnisse von Freundschaften und Enttäuschungen behauptet sich als integre Gestalt Gerhard Scholem, der Benjamin über alle Fährnisse hinweg die Treue bewahrte, auch gegen Benjamin selbst. Seine nüchterne Stimme fand bei meiner Generation der Benjamin-Verehrer das geringste Echo. Denn Scholem scheute sich nicht, Benjamins Irrtümer und Mißgriffe, etwa seine Annäherung an den Kommunismus oder seine unterwürfige Haltung gegenüber Brecht, beim Namen zu nennen, und verletzte damit den Konsens derer, die nur eines wollten: Benjamin in allem recht geben. Dafür zahlten sie den Preis der Unverständlichkeit.
Die Rezeption Benjamins ist ein Beispiel dafür, wie die Rezeption in das Innere des Rezipierten eindringt, es umformt und letztlich die Quellen der Rezeption verschüttet. Während die Benjamin-Verehrung am Verfehlten des deutsch-jüdischen Verhältnisses etwas gutmachen möchte, wird sie doch gerade zur Bestätigung dafür, daß dieses Verhältnis – nicht etwa nur die sogenannte deutsch-jüdische Symbiose – längst schon gescheitert war, bevor die Nationalsozialisten zur Macht kamen.
Montesquieu hat vor Moralisierung der Politik gewarnt: »Es ist nutzlos, der Staatskunst etwa vorzuwerfen, daß sie in Widerspruch zur Moral, Vernunft und Gerechtigkeit steht. Solche Predigten rufen allenfalls allgemeines Kopfnicken hervor, ändern aber niemanden.« Was die Moral untauglich macht für die Politik ist ihre allgemeine Zustimmungsfähigkeit. Sie greift einer Einheit vor, welche die Politik nur anstreben kann.
Kein menschlicher Gedanke, so Carl Schmitt, sei vor Umdeutungen sicher. Das gilt auch für die eigenen Gedanken, die grenzenloser Anpassung fähig sind. Man muß sie also vor den eigenen Umdeutungen schützen.
Ein Vorblick auf die Bundesrepublik: Da die Deutschen weder von einem Herrn regiert werden noch »demokratisch leben« wollen, sollen sie dem »Ideal einer wohlgeordneten, in genugsamer Freiheit vorwärts strebenden Bundesrepublik« nachkommen, erklärte Johannes von Müller im Jahre 1787.
Der Gedanke der versäumten Verwestlichung ist 1922 von Ernst Troeltsch ausgesprochen worden. Er plädierte für ein Nachholen der westlichen Aufklärung, ihrer Ideen des Naturrechts und der Menschheit. Gleichzeitig warb Hermann Hesse in einem Aufsatz über »Die Brüder Karamasow« und den Niedergang Europas für eine Rückwendung nach Asien, zum Ursprung und zu den faustischen Müttern – als Wiedergeburt.
Die Frage, die die Bundesrepublik seit ihren Anfängen wie keine zweite begleitete, war die nach ihrer Belastbarkeit. Solange sie ein Provisorium war, schien die Antwort einfach. Große Belastungen waren von ihr fernzuhalten oder betrafen ihre Entscheidungskompetenz nicht. Seit der Wiedervereinigung ist dieser Staat, dessen Wirtschaftskraft ansehnlich ist, von außerordentlichen Belastungen und politischen Entscheidungen nicht mehr auszunehmen. So wurde es als politisches Versagen der Bundesrepublik angesehen, daß sie sich im Golfkrieg einer politischen Entscheidung entzog, als sei sie noch das alte Provisorium, und Zuflucht nahm zu kompensatorischen Leistungen und einer Bekundung der Sehnsucht nach einem allgemeinen Weltfrieden. Die existentielle Dimension der Politik wurde verfehlt.
Das zeigt an, daß eine tiefgehende Veränderung des deutschen Nationalcharakters eingetreten ist. Während früher das Schreckbild der Deutschen die »Händlergesellschaft« war, ist diese heute die Wurzel ihrer Identität. Nach den Katastrophen im Gefolge der Verteufelung der Händlergesellschaft will man heute deren schützendes Gehäuse nicht verlassen. Zur Ironie der Inversion gehört, daß die Israelis den Deutschen ihre Händlermentalität vorwerfen, die sie vor weitergehenden Verpflichtungen zurückschrecken lassen, mit dem Ergebnis, daß die Bellizisten von einst, wie manche Israelis meinen, einen nicht weniger bedrohlichen Pazifismus praktizieren. Während die Israelis allseits von Feinden umgeben sind und sie auch als solche identifizieren, wollen die Deutschen überall nur Freunde sehen.
Nietzsche entdeckt, daß der Gedanke der Dekadenz nicht nur auf Spätzeiten, sondern auch auf Frühzeiten angewandt werden kann. Schon der Sündenfall drängt sich als Beispiel auf. Die Dekadenz wartet gleich neben dem Ursprung. Jeder Ursprung läßt sich als Abfall deuten, als abgeleitet aus einem anderen Ursprung. Das Leben selbst ist gegen Aufstieg und Niedergang gleichgültig, es geht durch beide hindurch.
»Menschen handeln in Wirklichkeit nur, um darüber reden zu können oder zu hören, daß darüber geredet wird«, schreibt Alexandre Kojève an Leo Strauss (19. September 1950). Das mache in den Augen der Menschen die Überlegenheit ihrer Welt gegenüber der Natur aus. Heute ist es das Höchste, sich zu verständigen und darüber zu reden.
Das Neue ist längst nicht mehr, was es zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war – ein Schock, der einen Zuwachs an Erkenntnis versprach. Der Gedanke, daß das Neue per se authentisch sei, hat an Glanz verloren. Die einstmals produktive Provokation der Sehgewohnheiten hat das Wegsehen zur Gewohnheit werden lassen, wo immer Neues verheißen wird. Das Neue wurde in dem Augenblick zur Wiederholung, als es eine künstlerische Konvention geworden war.
Ein Prospekt der Weißen Flotte Potsdam preist eine Fahrt über den Schwielowsee damit an, daß Theodor Fontane Caputh als »Chicago des Schwielowsees« beschrieben habe. Was immer dieser Vergleich zu seinen Zeiten bedeutet haben mochte, heute ist er kaum mehr erhellend. Aber es gibt andere transatlantische Beziehungen, auch wenn im Prospekt die Mitteilung: »Albert Schweitzer lebte in Caputh bis zu seiner Emigration«, eine groteske Verwechslung mit dem anderen, berühmteren Albert ist, nämlich Einstein, dessen Haus hier noch besichtigt werden kann. Von Chicago nach Lambarene und wieder zurück nach Princeton, so verlaufen die Koordinaten von Caputh.
In der Zeitung »Rotes Schwert«, dem Organ der Tscheka, hieß es am 18. August 1919: »Uns ist alles erlaubt.« Das hatten auch Robespierre und Saint-Just gesagt, als sie gegen die verborgenen Volksfeinde vorgingen, die sich als Revolutionäre ausgaben. Robespierre erklärte: »Recht ist, was der Revolution nützt«, und Saint-Just sagte, daß »alles denen erlaubt sein muß, die im Sinne der Revolution handeln«. Die Formulierung »Alles ist uns erlaubt« geht auf Paulus zurück, 1. Korinther 6, 12: »Alles ist mir erlaubt – aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen.« Paulus spricht vom Verhalten zu Speisevorschriften, die auch am besten deutlich machen, daß die Freiheit, alles zu tun, eingeschränkt werden kann einmal durch das, was schädlich ist, und zum anderen durch das, was den Willen ungewollt bindet.
Während eines sechsmonatigen Aufenthalts in Polen 1917 hatte Alexandre Kojève in der Warschauer Bibliothek beim Betrachten einer Büste von Descartes eine Erleuchtung. Descartes und Buddha erschienen ihm in einer einzigen Verkörperung. Seither suchte er nach dem Gemeinsamen der beiden Philosophien und fand es in der »auto-compréhension de la pensée«, im Sich-selbst-Begreifen des Denkens. Die Möglichkeit, das Denken zu denken, beweise, daß es notwendig sei, das Denken als Nichtsein zu begreifen. Der Buddhismus wurde für Kojèves Bemühungen um das Sich-selbst-Begreifen des Denkens auch deswegen bedeutsam, weil die Schwierigkeiten eines Europäers, das hinduistische Denken zu begreifen, den Schwierigkeiten glichen, die Begriffe zu finden, mit denen man das eigene Denken auszudrücken sucht. Das erklärt den Exotismus der philosophischen Sprache Kojèves, die sein »System« von allen bekannten Systemen unterscheiden sollte.
Carl Schmitts Überlegungen zum Ost-West-Gegensatz müssen nach dessen Ende noch einmal durchdacht werden. Eine der Fragen ist, ob mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion der globale Ost-West-Gegensatz verschwunden ist oder sich in eine neue dialektische Spannung von vergleichbarer Dimension übersetzen wird, ob der Westen überhaupt als Sieger anerkannt werden kann – oder ob er global an Bedeutung verlieren wird, wenn er nicht mehr der eine Pol eines globalen Gegensatzes ist. Gegensätze durchdringen ein homogenes Medium viel tiefer, als eine einseitige Kraft es vermöchte.
Georg Brandes, von dem Friedrich Sieburg gesagt hat: »Durch ihn hieß Dänemark damals Europa«, ist der Pionier der vergleichenden Literaturbetrachtung. In seinem Buch über die »Hauptströmungen der europäischen Literatur« hat er sie sehr glücklich charakterisiert durch die »doppelte Eigenschaft, uns das Fremde solchergestalt zu nähern, daß wir es uns aneignen können, und uns von dem Eigenen solchergestalt zu entfernen, daß wir es zu überschauen vermögen«. Die vergleichende Betrachtung ließ ganz neue Beobachtungen zu, etwa daß ein Land wie Dänemark von der europäischen Bewegung der Revolution erfaßt wurde, nicht aber von ihren Folgen, und daß es an der Reaktion teilnahm, ohne die Aktion erlebt zu haben. Durch diese Betrachtungsweise entstehen ganz neue literarische Realitätsbezüge. An Frankreich beobachtete Brandes, daß es alle äußeren Mächte umstürzte, ohne je die Autoritäten seiner Literatur anzutasten, daß es die Tradition mittels der Literatur auf den Kopf stellte, nicht aber die Traditionen der Literatur.
Zu seinen bemerkenswerten Einsichten gehört auch, was er über die Rolle der Emigrantenliteratur zu sagen hatte. Als um 1800 die Völker erstmals in »ununterbrochenen geistigen Verkehr« miteinander zu treten begannen, entwickelte sich eine Emigrantenliteratur, die unter dem Einfluß Rousseaus stand. Die typischen Romane der Emigrantenliteratur – »Adolphe«, »René«, »Oberman« – bewegten sich in den Spuren Rousseaus und im schärfsten Gegensatz zum Regime in Paris. Während dort »die Zahl und der Säbel«, der klassische Odenstil in der Literatur und die exakte Wissenschaft herrschten, handelte es sich hier um »Gefühle, Träume, Schwärmereien und Reflexionen«. Durch Rousseau hielt diese Literatur Verbindung zum achtzehnten Jahrhundert. In der nachrevolutionären Literatur insgesamt wechselte der Einfluß Rousseaus mit dem Voltaires ab, einmal war der eine stärker, einmal der andere, bis beide schließlich wirkungsgeschichtlich miteinander verschmolzen.
Das alles zeigt, eine wie starke Traditionsmacht die Literatur war, die allein die Revolution unangefochten überstand. Die für Brandes charakteristische Frage lautet: Was ist das Neue bei …? Und die Antwort besteht meist darin, daß er zeigt, wie etwas Altes hier zu Ende gebracht wird. Die Literatur entledigt sich schrittweise der starken Macht der Tradition, die sie gehütet hatte.
Man weiß nicht, was erschütternder ist, die Briefe des wahnsinnigen Nietzsche oder das Ausbleiben der Antworten – als handelte es sich bloß um ein Unwohlsein, dessen Vorübergehen abgewartet werden muß. Immerhin, es gibt die Antwort Strindbergs auf die »Nietzsche Caesar« unterzeichneten Zeilen vom 31. Dezember 1888. Nietzsche wollte ihm zu seiner Novelle etwas sagen – »sie klingt wie ein Flintenschuß« –, fuhr dann aber fort: »Ich habe einen Fürstentag nach Rom zusammenbefohlen, ich will den jungen Kaiser füsilieren lassen. Auf Wiedersehn! Denn wir werden uns wiedersehen … Une seule condition: Divorçons …« Strindbergs Antwort ist grandios. Er antwortet lateinisch, vom Datum bis zur Unterschrift – »Litteras tuas non sine perturbatione accepi et tibi gratias ago« [Deinen Brief habe ich nicht ohne Verwirrung erhalten und danke Dir] –, und griechisch [in griechischer Schrift]: »Thelo, thelo manenai!« [Ich will, ich will rasen!] Unübertrefflich aber ist, wie er unterzeichnet: »Strindberg (Deus optimus maximus).« Wie nah dem Wahnsinn muß man sich fühlen, um so einen Wahnsinnigen zu grüßen?
Der Roman »Adolphe« von Benjamin Constant ist die Beisetzung der Romantik durch sie selbst. Die romantische Einstellung scheitert an der Gesellschaft, die Gefühle sind ihr nicht gewachsen: »Die Gesellschaft ist zu mächtig, sie tritt in zu vielen Gestalten in Erscheinung. Die Gleichgültigen legen eine bewundernswerte Geschäftigkeit an den Tag, um sich im Namen der Moral als Störenfriede zu betätigen und als eifrige Verfechter der Tugend Schaden zu stiften.« Die Passion, die erotische Leidenschaft, die im achtzehnten Jahrhundert das Gewebe der Konvention und der Gleichgültigkeit zu zerreißen vermochte, streckt vor der neuen Gesellschaft die Waffen.
Günther Anders berichtet, daß er 1928 »Mein Kampf« las und dafür von seinen Freunden, die Hitler »idiotischerweise nur den Anstreicher nannten«, durch den Kakao gezogen wurde. Er war in seinen Kreisen der einzige, der dieses »gemeine, haßfreudige, zum Hassen aufreizende, achtelgebildete, feierliche, rhetorisch mitreißende, unbestreitbar höchst intelligente Buch« zur Kenntnis nahm. Später schrieb er über die Eindrücke dieser Lektüre: »Da wußte ich also, dieser Mann sagt, was er meint, und er meint, was er sagt. Und er sagt es so vulgär, daß er für das Vulgäre unwiderstehlich sein wird, und selbst Nicht-Vulgäre vulgär machen und mitreißen wird.«
Der Kerngedanke der Kulturmorphologie Spenglers ist die Idee der Pseudomorphose, der im zweiten Band der Abschnitt »Historische Pseudomorphosen« gewidmet ist. Der Gedanke besteht darin, daß alles, was aus älteren seelischen Schichten aufsteigt, in die »Hohlformen fremden Lebens« gegossen wird, »junge Gefühle erstarren in ältlichen Werken«, und die Unfähigkeit zu eigener Gestaltung läßt den »Haß gegen die ferne Gewalt zur Riesengröße« wachsen. Alles, was so lebt, ist also gefälscht und tritt uns unter einer Maske entgegen. Es gilt also, die »innere Form« zu erraten, »welche durch die äußere gefälscht wird«. Eines der Beispiele Spenglers ist in Alexandria und Beirut die Einwanderung all dessen, was magischen Ursprungs und Geistes ist, in die Formen griechischer Philosophie und römischer Rechtswissenschaft: »Es wird in antiken Sprachen niedergeschrieben, in fremde und längst erstarrte Literaturformen gepresst und durch die greisenhafte Denkweise einer ganz anders angelegten Zivilisation verfälscht.«
Das entscheidende Wort ist »verfälscht«. Man kann alle Überlieferung, indem sie auf Mißverständnissen und Umdeutungen beruht, als Verfälschung ansehen – wenn man die Dinge vom Ursprung her sieht. Als aktuelle Gestalt sieht Spengler das Petrinische Rußland »in eine künstliche und unechte Geschichte gezwängt, deren Geist vom Urrussentum gar nicht begriffen werden konnte«. Die Literatur mit ihren angelesenen Problemen und Konflikten oben und unten, das »entwurzelte Bauernvolk mit all der metaphysischen Trauer, Angst und dem Elend, das Dostojewski mit ihm erlebt hat«, Tolstoi mit seinem Haß gegen das Europa, »von dem er selbst sich nicht befreien kann, er haßt es in sich, haßt sich und wird damit der Vater des Bolschewismus«.
Der Gegensatz von Dostojewski und Tolstoi wird Spengler zum Schlüssel für die Pseudomorphose jenes Rußland, das von Peter dem Großen auf den europäischen Weg gezwungen worden war. Daß er die Bolschewiki in die Linie Tolstois und nicht Dostojewskis stellt, ist entscheidend für seine Prognose über die russische Revolution. Die Bolschewiki gehören für ihn zur besseren Gesellschaft, sind deren niedrigste, von ihr nicht anerkannte Schicht und deshalb erfüllt vom Haß der Niedrigen. Aber sie sind geistig nicht in der Lage, in Dostojewski »ihren eigentlichen Feind« zu erkennen. Ihre Durchschlagskraft erhielt die Revolution auch nicht durch diesen kraftlosen Haß der Intelligenz, sondern durch das »stadtlose Volk, das sich nach seiner eigenen Lebensform, seiner eigenen Religion, seiner eigenen künftigen Geschichte sehnt«.
Oswald Spengler will 1911 erfaßt haben, »daß ein politisches Problem nicht von der Politik selbst aus begriffen werden kann«. Das bringt ihn auf den Gedanken, ein Lebensgebiet jeweils aus der Sicht eines anderen zu sehen, beispielsweise die Formen der bildenden Künste mit denen des Krieges und der Staatsverwaltung in Zusammenhang zu bringen, um so »die tiefe Verwandtschaft zwischen politischen und mathematischen Gebilden derselben Kultur, zwischen religiösen und technischen Anschauungen, zwischen wirtschaftlichen und Erkenntnisformen« festzustellen. Aber dann erledigt sich diese Vision, indem Spengler die »Abhängigkeit der modernsten physikalischen und chemischen Theorien von den mythologischen Vorstellungen unserer germanischen Ahnen« nachweisen will. Pardauz.
Seine morphologische Idee hängt mit dem Zerfall der Stileinheit der Künste zusammen, die fortan nur noch als eine tiefer liegende strukturelle Einheit zu fassen war. Dieser Befund wurde auf die Geschichte übertragen, die als heterogenes Kontinuum allerdings strukturlos ist. Sie wird deswegen auf ihren Stil hin befragt, und das primäre Phänomen der Geschichte ist die Umformung und Überformung des Fremden durch die Zivilisation. Das Fremde wird zum Urphänomen. Spenglers Kulturmorphologie ist Gnosis.
Die Neigung zu Prognosen hängt mit einer Wahrnehmungsschwäche gegenüber der Wirklichkeit zusammen. Man braucht die Vereinfachung der Zukunftsprojektion, um überhaupt etwas sehen zu können. Schon Spengler hatte sich den prognostischen Gestus angeeignet, um der Gegenwart Kontur zu geben. Dafür mußte er einen großen Abstand zu ihr nehmen, er betrachtete sie »wie etwas unendlich Fernes und Fremdes«.
Die Verwechslung von Kunst und Politik, die politische Optik auf die Kunst und die künstlerische auf die Politik, ist ein Grundzug des deutschen Kulturpessimismus der neunziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts. Damals trat mit den »Blättern für die Kunst« und mit dem Rembrandtdeutschen eine Bewegung auf, die sich als Antipolitik, als Gegenbewegung zur Realpolitik verstand und zwischen geistigen und historisch-politischen Tatsachen nicht unterschied. Es war eine Art Schattenpolitik. Sie wollte die Politik von der Kunst her auflösen. Es war die Politik von Männern, die sich plötzlich und fast gegen ihren Willen in die Politik hineingezogen sahen. So hat auch Spengler im Augenblick seiner Agadir-Panik reagiert, als er von der Kunstphilosophie unmittelbar in politische Prognostik und in eine Stilkritik der Politik übersprang.
In die Zwischenlage zwischen Original und Abklatsch ist Nietzsche durch die Philologen geraten, die ihn mit philologischem Biedersinn aus dem Zusammenhang mit dem Faschismus lösen wollten, indem sie ein Textgewebe konstruierten, das keine über seine immanenten Verflechtungen hinausweisende Botschaft hat. Als unbeabsichtigte Nebenfolge dieses philologischen Verfahrens hat sich Nietzsches Originalität in etwas höchst Vermitteltes verwandelt. Dabei ist unzweifelhaft, daß er es auf nichts so sehr abgesehen hatte wie auf die Möglichkeit, dieses Spiel zu durchbrechen und zu einer originären Botschaft zu finden. Will man dies nicht als ein monströses Selbstmißverständnis abtun, so muß man seine Originalität in seinen philosophischen Absichten, seinem sokratischen Ehrgeiz, suchen. Die Nietzsche-Philologie nötigt also dazu, die Frage, die sie liquidieren wollte, zu erneuern.
Nietzsche selbst hat sich über diese Frage deutlich genug ausgesprochen: »Man wird immer vorsichtiger im Erteilen von Prioritätsansprüchen. Es ist gewiß ein großes Verdienst, eine total neue Weltanschauung zu fassen; aber das größere ist, auf sie so zu schlagen, daß sie nach allen Seiten Funken gibt. Die Weisheit des stillen Denkens, die in der Studierstube verschlossen bleibt, hat in der Geschichtswissenschaft wenig Anrecht auf Wertschätzung.« Er weiß wohl selbst noch nicht, wofür er sich entscheiden wird. Am Ende versucht er, beides auf einmal zu tun: eine Weltanschauung als Hammerschlag zu verkünden – die sogenannte Lehre vom Willen zur Macht. Nietzsche glaubte, unter den Hammerschlägen verberge sich eine Weltanschauung. Der »Wille zur Macht« ist das Gerücht einer Philosophie und hat sich deswegen als wirksamer erwiesen als jede Weltanschauung.
»Die Geschichte der Philologie hat keinen Ort für Nietzsche«, heißt es schon in Karl Reinhardts 1941 gehaltenem Vortrag »Die klassische Philologie und das Klassische«. Er begründet es damit, daß es dazu bei Nietzsche zu sehr an positiven Leistungen fehle. Selbst das Dionysische – »soweit es für die Philologie vorhanden ist« – sei keine Entdeckung Nietzsches gewesen, Sachkenner, vor allem Archäologen, hätten »längst davon viel mehr als Nietzsche selbst« gewußt. Sogar Rohdes »Psyche« hätte ohne ihn geschrieben werden können. Statt dessen gebühre ihm »ein umso höherer Rang im deutschen Humanismus, wenn dessen Geschichte je geschrieben werden sollte«. Seine Vertrautheit mit den Alten war von einer Art wie die Goethes, Montaignes, Winckelmanns und schloß die Befähigung zum »genialen Mißverständnis« ein, das sicherste Zeichen dafür, daß aus dem Verkehr mit den Alten wirklich gelebt wird. Daß Nietzsche von der Gelehrsamkeit der Zeit nicht berührt wurde, ist für Reinhardt die größte Leistung seines Humanismus und die Bedingung für die »freie Art seiner Bemerkungen«. Er gibt dafür ein Beispiel: Die »leichtlebenden Götter« – das sei »die höchste Verschönerung, die der Welt zuteil geworden ist, im Gefühl, wie schwer es sich lebt«.
Nietzsche übersetzt den Gegensatz von Christlich und Heidnisch in den Gegensatz von Optimistisch und Pessimistisch. Von der Unterscheidung Christlich-Heidnisch sagt er, daß sie »keine eigentliche Scheidung« sei. Die »Urfrage« sei vielmehr: »pessimistisch oder optimistisch gegen das Dasein«. In dieser Urfrage klingt bei Nietzsche das Echo der von ihm uneigentlich genannten Unterscheidung nach. So ist aus seinem Gegensatz des Dionysischen und des Apollinischen der Gegensatz von Heidentum und Christentum herauszuhören, das Skandalon der christlichen Verneinung des Daseins.
Daß die Griechen zum Problem wurden, war der große Schritt, den Nietzsche getan hat. Die Griechen waren nicht mehr die tiefste Rechtfertigung des Lebens, sondern bedurften selbst der Rechtfertigung.
Bevor die Neurose als Krankheit faßbar ist, fragt Nietzsche schon, ob es vielleicht »Neurosen der Gesundheit« gebe, durch die sich die nach Freiheit vom Schmerz strebende Moderne von den Griechen unterscheidet.
Nietzsches »Versuch einer Selbstkritik« ist wichtig, weil hier festgelegt wird, wie über Nietzsche nach Nietzsche zu schreiben sei. Das Vorbild dieses Textes bleibt lange spürbar, etwa bei Thomas Mann oder Gottfried Benn, die gleichsam der Autorschaft Nietzsches treu bleiben und mit Nietzsche über Nietzsche sprechen wollen. Nietzsche bedient sich hier der Strategie Rousseaus, die Nachwelt in die eigene Regie zu nehmen und ihre Lesart festzulegen durch eine Selbstdeutung, die die geläufige Lesart untergräbt.
In den Vorarbeiten zur »Geburt der Tragödie« finden sich großartige Bemerkungen über Erkennen und Handeln. Erkenntnis tötet: »Die vollkommene Erkenntnis tötet das Handeln: ja, wenn sie sich auf das Erkennen selbst bezieht, so tötet sie sich selbst.« Das beweist, daß sie nicht lebensdienlich ist. Erkenntnis ist unendlich: »Die Erkenntnis ist eine Schraube ohne Ende: in jedem Moment, wo sie eingesetzt wird, beginnt eine Unendlichkeit: deshalb kann es nie zum Handeln kommen.« Die Wissenschaft täuscht über ihren Zweck: »Der Zweck der Wissenschaft ist Weltvernichtung. Dabei geschieht es allerdings, daß die nächste Wirkung die von kleinen Dosen Opium ist: Steigerung der Weltbejahung. So stehen wir jetzt in der Politik in diesem Stadium.« Was die Kunst dem Staate antut, tut die Wissenschaft der Kunst: »Die Kunst hat die Aufgabe, den Staat zu vernichten. Auch das ist in Griechenland geschehen. Die Wissenschaft löst nachher auch die Kunst auf.«
Raffaels Gemälde »La Muta« (Die Stumme) in Urbino gehört in den magischen Umkreis von Leonardos »Mona Lisa«. Benennung des Bildes, Gesichtsausdruck und Haltung der Hände legen den Vergleich nahe. Bei Leonardo ist es ein psychologisches Rätsel, dessen Auflösung das Gemälde zu verlangen und dessen Unlösbarkeit es zu behaupten scheint. Damit hängt die Wut zusammen, die das Bild immer wieder ausgelöst hat. Es stellt etwas dar, was es nur durch seine Darstellung gibt und was in diese Darstellung gebannt bleibt. Der Betrachter steht vor etwas Verschlossenem, zu dem der Schlüssel weggeworfen wurde. Raffaels »Stumme« entspricht diesem Eindruck, wobei, im Unterschied zur »Mona Lisa«, die Stummheit die Lösung des Rätsels ist. So könnten wir sagen: Wie es sich bei der »Stummen« verhält, so auch bei der »Mona Lisa«, nur ist das Rätsel, das dargestellt wird, nicht ein äußeres, dessen Auflösung die Stummheit ist, sondern ein unbekanntes inneres, für das es keine Auflösung gibt.
Jedes der großen totalitären Systeme hat einen Humanismus hervorgebracht: das sowjetische nicht nur seine humanistische Propaganda und im Zerfall den »Sozialismus mit menschlichem Antlitz«, der Faschismus den »Dritten Humanismus« und den deutsch-italienischen Achsenhumanismus. Wie nach Tocqueville jeder Tyrann und Diktator den Rechtsgelehrten findet, der ihm den Legitimitätserweis bringt, so findet jedes totalitäre System seine humanistischen Interpreten. Seine Schreiber findet es ohnehin.
Über Freuds Moses bemerkt Carl Schmitt im »Glossarium« (30. September 1950): »ein soziologischer Film voll atemloser Spannung; schwer zu sagen, was soziologisch spannender ist. Dieser Moses, diese Jahwe-Religion, diese Mythik des Vaterfraßes, diese Deutung des Urchristentums oder dieser Autor selbst.« Diese Bemerkung ist um so erstaunlicher, als Freud oder die Psychoanalyse sonst nicht anders als voller Vorbehalte erwähnt werden, als handele es sich um nichts weiter als um eine moderne Form von Magie oder Astrologie. So heißt es am 20. Juli 1951, daß die Raum-Neurosen der Termiten bei Benn »das Gefühl und die Angst vor der Verwandlung in Termiten« anzeigen, während »die Methoden der Freud-indizierten Neurosentherapie« den Sinn hätten, »diese Termitisierung zu vollenden«.
An anderer Stelle (6. August 1949) wird Freud in eine Reihe gestellt mit Salomon Reinach, Émile Durkheim und anderen emanzipierten Juden. Auf unheimliche Weise treffe deren Definition der Religion auf sie selber zu, sie falle auf sie selber zurück: »Religion ist für sie ein System von Skrupeln, von dem man sich freizumachen hat. Definition der arrivierenden Freigelassenen, die sich der Erinnerung des Ghettos zu entledigen suchen und dafür die heilige Katze der Wissenschaftlichkeit stehlen. Ebenso Marx und Freud.« Seine Betrachtungsweise, die zu solchen »Linien« führt, erläutert Carl Schmitt am Beispiel von Darwin und Freud: Er sehe immer nur den Autor und dessen geschichtliche Lage: »Aus Darwins Entstehung der Arten ergibt sich nichts als ein Bild Darwins, seiner psychologischen Art und seiner soziologischen Situation. Aus allen Büchern und Schriften Sigmund Freuds dasselbe … die Wiener Psychoanalyse: Eine bestimmte Schicht streift aus früheren Situationen überkommene Hemmungen und Störungen ab und richtet sich auf ein größeres Sicherheitsgefühle ein. Auch das erlaubte die Situation nach 1848 der zweiten und dritten Generation. – Entgettoisierungsriten. Der Mythos ist die Exegese des Symbols. Wo steckt hier das Symbol? Eine Menschengestalt!«
Der Hinweis auf das Sicherheitsgefühl entspricht genau der Erfahrung Freuds. In der liberalen Ära Wiens um die Jahrhundertmitte kam es zu einer beispiellosen Zunahme der Lebenssicherheit und der Lebenschancen der Juden – jeder Jude, sagte man, konnte sich ausrechnen, Minister zu werden –, aber in Freuds Studentenzeit kam es zu einem Stillstand und Rückgang dieser Entwicklung. Freud zog aus dieser Erfahrung die Konsequenzen mit seiner pessimistischen Anthropologie. Das Thema der Entthronung des Vaters gehört in die gleiche Zeit nach der Jahrhundertmitte. Carl Schmitt sieht es im Gefolge des Positivismus von Comte aufkommen (17. Februar 1948): »Entthronung des Vaters durch das positivistisch veränderte, nicht mehr trinitarische Kreuzzeichen von Auguste Comte, aber Beibehaltung des Kreuzzeichens. Was tritt an die Stelle des Vaters: die Ordnung, sagt Comte. La loi, sagt Michelet. Das Kreuzzeichen in einem anderen Namen als dem von Vater, Sohn und Geist. Freud im Zuge dieser Entthronung des Vaters.«
Zu den auffallenden Zügen einiger Angehöriger meiner Generation gehört das sammlerische, das antiquarische Interesse im wissenschaftlichen. So als wollten sie etwas nachholen, was zu erleben ihnen verwehrt war, wurden sie zu Bibliographen und Antiquaren. Während sie den Vätern das Wort abschnitten, gaben sie es den Großvätern zurück, vorzugsweise den Exilierten unter ihnen. Das begann mit Walter Benjamin. Aber bald wurde die Restaurierung verlorener Lebenswerke auf andere übertragen, weit bis in Abgelegenes. Warburg und Panofsky wurden späte Nutznießer dieser Suche nach integren Werken und Lehrern. Ob diejenigen, die diesen so hingebungsvoll nachforschten, dieselben Lehren geschätzt hätten, wenn sie ihnen unmittelbar begegnet wären? Der lebhaften antiquarischen Befassung kontrastiert eine merkwürdige Mutlosigkeit, selbst etwas in der durch diese Namen bezeichneten Richtung zu unternehmen. Die Verehrung sucht nicht die Auseinandersetzung über Sachen, sondern bescheidet sich beim Sammeln. Sie ist fixiert auf das Detail und will vor allem die institutionellen Voraussetzungen einer so ungewöhnlichen geistigen Produktivität nicht wiederbeleben, sie bescheidet sich im Wiederholen. So bleibt man auf den Buchstaben fixiert. Diejenigen, die ihre eigene Bildung und deren Institutionen gering achteten, beschwören sie in den »minuscula« und »petites perceptions« einer vergangenen Geistigkeit. Richtig daran ist die Einsicht, daß sich das Schicksal des Geistigen an Unwägbarkeiten entscheidet. Vergessen ist allerdings die ebenso wichtige Voraussetzung der Originalität, des Neuen als Signum des Geistes.
Luthers siebzehnte These gegen die scholastische Theologie: »Non potest homo naturaliter velle deum esse deum. Immo vellet se esse deum et deum non esse deum« (Von Natur kann der Mensch nicht wollen, daß Gott Gott sei. Vielmehr wird er wollen, daß er Gott sei und nicht Gott). Noch Nietzsches »Gott ist tot« entspringt dieser von Luther illusionslos anerkannten anthropologischen Wurzel, fügt den Fundamenten protestantischen Glaubens also nichts hinzu.
»Es gibt wenige Menschen, die sich mit dem Nächstvergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige hält uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Vergangenheit und suchen das völlig Verlorene wieder hervorzurufen« (Goethe, »Die Wahlverwandtschaften«).
Die sogenannte Wende hat gelehrt, daß Deutschland einerseits weniger geteilt war, als man während der Zeit der Teilung annahm, andererseits aber tiefer getrennt, als man bis heute glaubt. Zwei Teilungen überlagern einander.
In Paris hatte es im Jahr nach der Revolution von 1848 einen politischen Neuanfang gegeben. Männer fanden den Weg in die Politik, die sich bis dahin abseits gehalten hatten. So kam auch Alexis de Tocqueville, der ein unauffälliger Abgeordneter der Nationalversammlung war, in ein politisches Amt. Er wurde 1849 Außenminister. Die wenig glanzvolle politische Laufbahn des liberalen Aristokraten hielt sich nur kurz auf dieser Höhe. Bedeutender als seine politische Laufbahn ist seine Schilderung der Tage der Pariser Revolution in seinen »Erinnerungen«. Alexander Herzen dagegen, ein russischer Revolutionär von der umgänglichsten Art, fühlte sich von dem magisch angezogen, was sich damals in Paris abspielte. In seinen Memoiren »Erlebtes und Gedachtes« hat er einen merkwürdigen Vorfall geschildert. Kaum war er zu einer politischen Versammlung nach Paris geeilt, wurde er von der Polizei verhaftet. Auf dem Weg zum Polizeirevier kam ihm Tocqueville entgegen, der Außenminister. Herzen kannte ihn aus früheren Tagen und bat ihn, daß er ihn doch identifizieren und befreien möge. Tocqueville soll daraufhin erwidert haben, es gebe zwischen Judikative und Exekutive leider keine Verbindung, es seien dies zwei getrennte Gewalten, so daß er nichts für Herzen tun könne. Eine unerfreuliche Begegnung also, bei der der von Ängsten geplagte Tocqueville keine gute Figur machte. Aber hatte er nicht recht, wenn er darauf hinwies, daß sich die liberale Ordnung nicht aus persönlichen Gefühlen gefügig machen solle? Statt eine Entscheidung zu treffen, reagierte Tocqueville als guter Liberaler mit einem Antrag auf Nichtbefassung.
Was Carl Schmitt 1933 an Franz Blei über Berlin schrieb, hätte ebensogut nach 1945 gesagt werden können, hätte dann aber weniger originell gewirkt: »Dieses Berlin ist ein Vakuum zwischen Osten und Westen, eine Passage, in der es scheußlich zieht. Die Berliner selbst halten diesen Luftzug für den Atem des Weltgeistes und fühlen sich in einer historischen Rolle.«
Es sind Aufzeichnungen von Carl Schmitt (Berlin 1907) aufgetaucht, die frühesten schriftstellerischen Zeugnisse, die von ihm erhalten sind, und es klingt darin ein Thema an, das ihn bis ins Alter nicht losgelassen hat, das der irrealen Bedingungssätze: »Fangen wir nicht mit ›Wenn‹ und ›Hätte‹ an. Die Menschen bedienen sich gedankenlos des sprachlichen Vehikels irrealer Bedingungssätze für ihre Phantasien und Wünsche. Die Geschichtsphilosophen mögen sich ausmalen, was geschehen wäre, wenn Antonius bei Actium gesiegt hätte oder Napoleon bei Leipzig. Das sind sogenannte Uchronien, die noch weniger Konsistenz haben als Utopien. Sich im Ernst als wirklich gewesen vorstellen, was nicht wirklich gewesen ist, um einen völlig anderen Verlauf der Dinge zu konstruieren, ist ein gefährliches Spiel. Nur in einem kleinen Spielraum hat es einen gewissen Sinn und als heuristische Methode. Wir sollen unsere Sünden bereuen, aber wir können nicht ein Stück aus dem unteilbaren Geschehen herausnehmen und es durch ein anderes erdachtes Stück ersetzen. Es hat etwas Vorlautes, sagen zu wollen, was geschehen wäre, und es scheint mir unfromm, etwas wissen zu wollen, was nicht wirklich geschehen ist. Gott hat zugelassen, was geschehen ist, und nicht zugelassen, was nicht geschehen ist. Tout ce qui arrive est adorable. Wer nicht mehr imstande ist, die Allmacht Gottes zu lobpreisen, sollte wenigstens vor ihr verstummen.«
Nietzsche glaubte, Voltaire zu sein, und nahm seine Abneigung gegen Rousseau als Indiz dafür. Tatsächlich war seine Ähnlichkeit mit Rousseau viel größer als die mit Voltaire. Mit Rousseau gehört Nietzsche in die Reihe der protestierenden Denker, beide sind Umdenker, fühlen sich als absolute Ausnahmeerscheinungen und machen sich selbst zum Maßstab für ihre Wahrheiten. Karl Löwith hat diese Zusammengehörigkeit gesehen: »Als Kritiker der bestehenden Welt bedeutet Nietzsche für das neunzehnte Jahrhundert, was Rousseau im achtzehnten war. Er ist ein umgekehrter Rousseau: ein Rousseau durch seine ebenso eindringliche Kritik der europäischen Zivilisation und ein umgekehrter, weil seine kritischen Maßstäbe genau entgegengesetzt zu Rousseaus Idee vom Menschen sind. Im Bewußtsein dieses Zusammenhanges erkannte Nietzsche in Rousseaus Bild vom Menschen ›die größte revolutionierende Kraft der Neuzeit‹ an, die auch den deutschen Geist in Kant, Fichte und Schiller in entscheidender Weise geprägt hat, zugleich bezeichnete er ihn aber auch als eine ›Mißgeburt an der Schwelle der neuen Zeit‹, als ›Idealist und Kanaille‹ in einer Person. Sein Begriff von Gleichheit habe Ungleiches gleichgemacht und eine Sklavenmoral zur Herrschaft gebracht. Seine demokratisch-humanitären Ideen verfälschten die wahre Natur des Menschen, die nicht human, sondern ein ›Wille zur Macht‹ sei.«
Der späte Nietzsche versicherte sich im Oktober 1888, daß seine Bücher »Zeile für Zeile erlebte Bücher« seien und »aus einem Willen zum Leben« kämen. Genau dies war auch das Kriterium Rousseaus, der von sich das gleiche sagen konnte. Beide verbindet ein Denken, das ein zum Äußersten getriebenes Persönliches zum Siegel hat und für das die biographische Wahrheit die höchste Wahrheit ist: »Und so erzähle ich mir mein Leben.« Am Ende erzählt man sich sein Leben als eine eigene Schöpfung. Für Nietzsche ist dies die höchste Form der Einsamkeit: »Aber das erst ist die Bedingung für jenen äußersten Grad von Selbstigkeit, von Selbsterlösung, der in mir Mensch wurde: ich bin die Einsamkeit als Mensch … Daß mich nie ein Wort erreicht hat, das zwang mich, mich selber zu erreichen« (Dezember 1888 bis Anfang Januar 1889). Dieses Bekenntnis ist eine Überbietung der »Träumereien« Rousseaus, die auch ein ganzes Leben in sich aufheben und neu schaffen. Einer der spätesten Titelentwürfe Nietzsches scheint an die »Träumereien eines einsamen Spaziergängers« anzuschließen in dem, was er »Müßiggang eines Psychologen« nennt. Rousseau und Nietzsche verbindet auch, daß sie Musiker waren.
Chamfort verbindet die Geringschätzung des Volkes mit der Überzeugung, alles nur für das Volk zu tun. Die Verachtung des Volkes und der Dienst am Volk bedingen einander. Chamfort hatte davon ein deutliches Bewußtsein: »Der Vorzug des Volkes in der Revolution liegt darin, daß es keine Moral hat. Mirabeau hat recht: Nicht eine unserer alten Tugenden kann uns jetzt dienen. Das Volk braucht keine Tugenden, oder es braucht Tugenden einer anderen Art.«
Stifter ist der erste Schriftsteller, der vom Verschwinden des Menschen handelt. Seine Prosa holt die Natur ganz nah an den Menschen heran, nicht um sie zu vermenschlichen, sondern um sie vom Menschen zu emanzipieren – eine radikale Umkehrung der nach 1848 herrschenden Wertungen. Stifter ist ein gewendeter Achtundvierziger. Wenn diese Absicht nicht gesehen wird, verwandelt sich seine Prosa in Kunstgewerbe. In Wahrheit stimmen seine Idyllen auf die Katastrophe ein. Die Naturnähe seiner Prosa bezeugt die Überflüssigkeit des Menschen, nicht die Feindlichkeit zweier Ordnungen – der des Menschen und der Natur –, sondern ihre wechselseitige Fremdheit.
Am hundertsten Geburtstag von Erwin Panofsky sieht es so aus, als habe er sich vom Kunstgelehrten, als der er Weltruhm und Einfluß errang, in das Haupt einer Gegenbewegung gegen die moderne Kunst überhaupt verwandelt. Er erscheint als ein Schriftsteller, der mit gelehrten Requisiten operiert wie ein Romancier mit seinen Figuren. Befördert durch die Erfahrung der Emigration hat der Kunsthistoriker eine erstaunliche Entwicklung seines intellektuellen Stils durchlaufen, von einer höchst esoterischen, oft gekünstelten, alles Populäre abweisenden deutschen Gelehrtenprosa zu einer nicht weniger anspruchsvollen, aber leicht verständlichen Sprache gefunden. Das Mittel der Ironie hat dazu am kräftigsten beigetragen und die größte Distanz zu der Sprache seiner Anfänge geschaffen.
Wenn man sich Panofsky von seiner Sprache her nähert, folgt man nur einem Verfahren, das er selbst als höchste Form der Eloge in der Würdigung seines Lehrers Wilhelm Vöge gewählt hat. In seinem ersten nach dem Krieg auf deutsch geschriebenen Text schilderte Panofsky die Eigenart des literarischen Stils dieses Kunsthistorikers, als handelte es sich vor allem um einen Meister der deutschen Sprache. Wie Mörike, Fontane und Stifter gehöre Vöge zu den »Unübersetzbaren«, schreibt Panofsky, »und gerade diejenigen seiner Formulierungen, die seinen Hörern und Lesern bis an ihr Lebensende gegenwärtig bleiben werden, versagen sich der Übertragung wie Daphne der Umarmung Apolls«. Panofsky wählt hier ein Bild, das vor ihm wohl noch niemand als Bild für das Übersetzen gebraucht hatte, ein Gegenbild zur »belle infidèle«. So kann nur sprechen, wer das Unübersetzbare liebt. Das Sprachideal, das solche Beobachtungen trägt, ist das der Verbindung von Prägnanz und Natürlichkeit – »zugleich poetisch und präzis, gefühlvoll und geistreich«. Die sprachschöpferische Phantasie verbinde den Gedanken mit der Anschauung und die Anschauung mit dem Klang. Über Vöge sagt Panofsky, daß er »hörte, was er schrieb, ebenso wie er sah, was er dachte«. Dabei spielt auch die regionale Aussprache eine Rolle, und der Hannoveraner Panofsky spricht mit Blick auf den Bremer Vöge, der in Hannover seine Gymnasialbildung erhielt, von der »sorgfältigen, sozusagen gut angezogenen Aussprache, die der Provinz Hannover und den Hansestädten eigen ist«.
Dieses Verhältnis zur Sprache hängt mit Vöges wie Panofskys Kunstwahrnehmung zusammen. Sie suchten Bedeutsames im kleinen zu erfassen. So entdeckte Vöge, daß die gotische Gewändestatue weniger steht als schwebt: »in ihrer ganzen Länge mit dem Säulenschafte verwachsen, schweben diese Figuren, auf gebrechlichen Konsolen fußend, zwischen Erde und Himmel«, sie seien »keineswegs in den Dienst der Architektur getreten«, sondern »nur in ihren Schutz geflüchtet«. Über das Knospenkapitell sagt er, es sei »zart zugleich und fest, wie die junge Gotik selbst«, und fuhr im Gespräch etwa folgendermaßen fort: »Bald aber sollte die Knospe sich öffnen und die Einförmigkeit einer unendlichen Vielfalt weichen. Efeu, Weinlaub, Huflattich, Kresse – haben Sie einmal in Paris kalten Hahn mit Cresson gegessen? – all den bescheidenen Gewächsen des Küchengartens war es erlaubt, an dem majestätischen System von Reims sich auszubreiten.« Vöge ist für Panofsky der Kenner der »Süßigkeit des Individuellen«. In dem Porträt seines Lehrers hat Erwin Panofsky seine eigene intellektuelle Biographie verschlüsselt. In diesem Spiegel gibt er sich so deutlich zu erkennen wie sonst kaum einmal.
Massenmensch ist für Ortega y Gasset derjenige, der nicht erschauert, wenn er merkt, daß er ist wie alle.
Die Unbefangenheit des Massenmenschen gegenüber sich selbst bewirkt, daß die Masse den direkten Ausdruck ihrer Wünsche, ihrer Geschmacksrichtungen und Phantasien sucht, sie operiert ohne Umwege, sie sucht die »action directe«.
Im Jahre 1930 stellt Ortega y Gasset fest, es geschehe nichts, was nicht schon hundert Jahre zuvor prophezeit worden wäre. Ob er das einige Jahre später auch noch behauptet hätte? Seine These, daß die Massen in jeder Hinsicht unlenkbar seien, führte ihn zu der Prognose, daß sie wünschen werden, einem Führer zu folgen, daß sie es aber nicht können werden. Kurze Zeit nach dieser Feststellung bewiesen die Massen, daß sie es konnten.
Niedergangsprognosen sind schwache Prognosen, mit geringem Risiko, denn sie beschreiben nur die Abschwächung dessen, was ist. Sie sind nicht mehr als Umzeichnungen des Vorhandenen. Niedergang gehört zum Erwartbaren. Als Prognose wirkt die Voraussage eines Niedergangs nur, weil sie die Eitelkeit der Lebenden verletzt. Ortega y Gasset dagegen sagte einen Aufstieg voraus, einen Zuwachs an Vitalität. Seine Prognose verbündete sich mit neuen Kräften, wirkte daher optimistisch. Der Aufstand der Massen bedeutet einen »unermeßlichen Zuwachs an Lebenskraft«, an Lebensmöglichkeiten, »gerade das Gegenteil also von dem, was wir so oft über den Niedergang Europas hören«. Diese Sicht der Dinge war aber im gleichen Atemzug pessimistisch, da ein Zuwachs an Lebenskraft die historische Substanz aufzehren konnte. Walter Rathenau sprach vom »vertikalen Einbruch der Barbarei«. Ortega y Gasset teilt die Eigenart der modernen Prognosen, sowohl pessimistisch wie optimistisch gelesen werden zu können.
Der Blick auf die Vergangenheit zeigt, daß sie zu klein wäre, um die Gegenwart aufzunehmen. Es gibt keine Vergangenheit mehr, die als Gehäuse für die Gegenwart ausreichen würde. Dadurch verändert sich das Verhältnis zu ihr. Keine Vergangenheit, nicht Athen, nicht Rom, nicht Florenz, ist groß genug. Also sind die Rückwege abgeschnitten. Das treibt die Gegenwart zusätzlich an, auf ihrem Weg weiterzugehen. So entsteht zum ersten Mal eine Epoche, die mit keiner Renaissance mehr rechnet, die mit aller rückwärtsgewandten Verehrung, mit allem Klassizismus gründlich aufräumt, »die nichts Vergangenes als mögliches Vorbild oder Norm anerkennt«, wie Ortega y Gasset feststellte. Das Prestige der Vergangenheit verliert sich. Der Anzug ist zu klein geworden. Die Gegenwart entwertet durch ihre bloße Existenz alle Vergangenheit – »die berühmte Renaissance kommt uns muffig, krähwinklig, sagen wir es getrost: reichlich aufgedonnert vor«. Der Preis dafür ist, daß die gegenwärtige Menschheit das Gefühl haben muß, allein auf der Welt zu sein.
Indem die Vergangenheit und die Gegenwart so entschieden auseinandertreten, wird alles und sein Gegenteil möglich. So muß es scheinen, »als könnte auch das Schlimmste möglich sein, auch Rückschritte, Barbarei, Niedergang«. Und es gibt keinen Grund, nicht zu akzeptieren, was geschieht. In dem Maße, wie die Menschheit rein in der Gegenwart lebt, weiß sie sich dessen nicht zu erwehren, was diese Gegenwart bringt und fordert. Die Menschen trachten allenfalls danach, sich in Sicherheit zu bringen, sich »unempfindlich zu machen für die tiefen Spannungen unseres Schicksals«, indem sie »Gewohnheiten, Sitten, Redensarten – alle Arten von Chloroform – darüber schütten«. So kommt es, wie Ortega y Gasset sieht, zu der merkwürdigen Lage, daß man am Ende so vieler Jahrhunderte einer ununterbrochenen Entwicklung auftrete und doch ein Anfang, eine Morgenröte, eine Kindheit zu sein scheine. Daß dies eine falsche, eine unechte Jugend ist, liegt auf der Hand.
Auch Ortega y Gasset prophezeite den Untergang des Abendlandes, allerdings nicht aufgrund seines Versagens, sondern wegen seines beispiellosen Erfolgs. Das gab seiner Prognose eine größere Kraft als der Spenglers. Die Zivilisation, meinte er, werde an Umfang und Präzision so sehr zunehmen, daß sie das Fassungsvermögen der Menschen übersteigen werde. Der Durchschnittsmensch wird damit zunächst fertig, indem er sich in einer Welt des Überflusses einrichtet, über deren Voraussetzungen und Organisation er sich keine Gedanken macht. Das Leben erscheint ihm leicht, reich und ohne schicksalhafte Grenzen, es gibt ihm die Möglichkeit, seine banalen Überzeugungen durchzusetzen: »Die Grundtatsache im Dasein des Massenmenschen ist der Unernst, das ›im Scherz‹.«
Alfred Jarry parodiert die Denkweise des Nationalismus: »Wenn es Polen nicht gäbe, gäbe es keine Polen.« Dabei hat es Polen ja oft genug nicht gegeben, und die Polen wurden dadurch erst recht Polen.
Daß die Politik alles ist, entdeckte auch Kierkegaard. In seinem Tagebuch schreibt er: »Heute, im Jahr 1848, scheint die Politik die alles beherrschende Macht zu sein; aber man wird sehen, daß die Katastrophe die Kehrseite der Revolution bedeutet. Damals sah alles nach einer religiösen Bewegung aus, und sie entpuppte sich als eine politische; heute sieht alles nach einer politischen Bewegung aus, aber sie wird sich als religiöse entpuppen.« Die Französische Revolution als eine religiöse Bewegung zu charakterisieren kann verwundern. Das Umschlagen von Religiösem in Politisches und von Politischem in Religiöses, das Kierkegaard feststellt, erinnert an Charles Péguys Aussage, daß die Mystik des Anfangs in Politik umschlage. Aber Péguy kannte nur eine einzige nicht umkehrbare Richtung der Verwandlung von Mystik in Politik.
Kierkegaard hat richtig gesehen, daß »der mörderischste Kampf nicht zwischen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten stattfindet, sondern zwischen Leuten, die dasselbe sagen und sich wegen der Interpretation in die Haare geraten, denn dort liegen die qualitativen Unterschiede«. Es dürfte die Erfahrung der religiösen Feindseligkeiten gewesen sein, die Kierkegaard auf die Feindschaft durch Interpretation ein und desselben aufmerksam machte. Deswegen nahm er an der Politik im neunzehnten Jahrhundert religiöse Züge wahr.
»Der Literat ist schutzlos. Er gleicht den fliegenden Fischen. Wenn er sich ein wenig erhebt, verschlingen ihn die Vögel, wenn er taucht, fressen ihn die Fische« (Voltaire, »Idées républicaines«).
»Eine richtige Idee, die schwierig ist, hat stets weniger Erfolg als eine falsche, die einfach ist.« Tocqueville hat durch die Wahrnehmung der amerikanischen Gesellschaft die Rolle des Erfolgs als Kriterium entdeckt. Die Wahrheit steht in der künftigen demokratischen Gesellschaft nicht mehr im Kampf mit der Unwahrheit, sondern mit dem Erfolg.
Lessing war der Ansicht, daß der der beste Mensch sei, »der die größte Fertigkeit im Mitleiden hat«. Aber gibt es beim Mitleid überhaupt einen Komparativ oder einen Superlativ? Man kann sich nicht gegenseitig im Mitleid überbieten, weil der Impuls zum Wettbewerb den des Mitleids ersticken würde. Mitleid kann durch Eigenliebe nicht gesteigert werden. Aber das Mitleid wird pervertiert, wenn es sich nicht auf das Individuum, sondern auf die Menschheit richtet. Eine Pariser Sektion während der Revolution verkündete: »Seid unmenschlich aus Mitleid, aus Liebe zur Menschheit.« Das Mitleid ist echt nur, wenn es spontan ist und von einem Wesen für seinesgleichen empfunden wird. Das ist die nicht zu überholende Einsicht Rousseaus.
Paul Valéry war von Montaigne gelangweilt: »Ich habe einen Band Montaigne aufgeschlagen. Nach wenigen Minuten habe ich ihn zurückgestellt. Er hat mich zu Tode gelangweilt. Solche Sachen kann jeder schreiben.« Und schon Ranke wunderte sich über die Ansteckung, die von Montaigne ausging: »Wie viele bemerkt man, die von seiner Manier ergriffen sind, wenn sie nur von ihm reden.« Nietzsche wiederum bewunderte seine Redlichkeit und Heiterkeit und glaubte, »etwas von Montaignes Mutwillen im Geiste, wer weiß, vielleicht auch im Leibe zu haben. Montaigne macht sich so normal, daß er unnachahmlich wird. Das Individuum erreicht seine Unverwechselbarkeit nicht in der Abweichung, sondern in der Aneignung und Nuancierung dessen, was ihm mit allen gemeinsam ist.«
Nietzsche, der sich Montaigne so nah fühlte, tat gerade das Gegenteil von dem, was dieser empfahl. Er entfesselte die Kräfte, die sich zu Irrtum, Verblendung steigerten, anstatt sie zu mäßigen wie Montaigne, der lieber bewahren und erhalten wollte. Denn er lebte in einer Zeit bedrohlicher Neuerungen: »Ich hatte nur zu bewahren und zu erhalten, und das ist ein stilles und unscheinbares Werk. Die Neuerung ist ein ruhmvolles Tun; doch sie ist uns in einer Zeit untersagt, in der wir von Neuerungen zu Boden gedrückt sind und kaum wissen, wie wir uns ihrer erwehren sollen.«
Die Zweischneidigkeit von Montaignes Konservativismus besteht darin, daß er die bestehende Ordnung akzeptiert – weil sie Ordnung ist und die Stelle der Unordnung einnimmt – und ihr zugleich jede übermenschliche Autorität, jede geheiligte Grundlage entzieht. So schließt die konservative bejahende Haltung Montaignes keine positive Begründung der politischen Institutionen ein. Sie sollen es nur ermöglichen, in Gewohnheiten zu leben: »Die Gewohnheit ist eine zweite Natur und nicht minder mächtig. Was mir an dem mangelt, woran ich gewohnt bin, das deucht mich, mangelt mir wirklich.« Das Gewohnte und die Gewohnheiten sind wirklicher als das, was durch sie beglaubigt wird.
Montaignes Skepsis ist nicht Zweifel schlechthin, sondern sie hat, wie Hugo Friedrich sagt, »wieder den alten Sinn des Wortes: sie ist ein Spähen, vor dem Welt und Mensch nicht ärmer werden, sondern reicher, eine erschließende Skepsis mit der Ehrfurcht vor der Überlegenheit der reinen Erscheinung einer Sache über die immer nur unvollkommene Deutung der Sache«. Befreit von den Vorurteilen des Herkommens, will er den »wahren Gesichtspunkt der Sachen« enträtseln, die uns »die tägliche Gewohnheit verbirgt«. Ein anderes Wort für Montaignes Skepsis wäre Sachlichkeit. Wenn der Mensch erst einmal »diese Larve abgerissen und die Sache auf Wahrheit und Vernunft zurückgeführt hat«, wird er sein Urteil wie auf den Kopf gestellt und dennoch viel fester begründet finden. Dennoch sagt Montaigne: »Ich zeige nicht das Sein, ich zeige den Übergang.« Was er zeigt, ist keine Hinterwelt, sondern das, was im Wegsehen von den Vorurteilen sichtbar wird – und sei es nur momentan. Er schiebt der Versuchung, auf ein immer Gültiges zu treffen, einen Riegel vor: »Nein, nein! Wir fühlen nichts, wir sehen nichts. Alle Dinge sind für uns verborgen; es gibt keines, von dem wir sagen können: es ist dies, es ist das! … Wir haben keinerlei Beziehung zum Sein.«
Es ist eine Anmaßung unserer Zeit, daß sie sich einen historischen Sinn zuspricht, der den früherer Epochen nicht nur an Stärke, sondern auch in seiner Qualität übertreffe – als würden wir den Sinn vergangenen Geschehens ausschöpfen können. Montaigne dagegen glaubte, daß die Erinnerung bestimmten Orten innewohne und man an der Geschichte teilhabe, wenn man den Fuß auf das Pflaster Roms setzt. Die Macht der Erinnerung wird wie etwas von außen Kommendes erlebt, wie etwas Fremdes. Auf seiner italienischen Reise suchte Montaigne so viele Inschriften und Überreste wie möglich auf, weil noch die unbedeutendsten Teile Bewunderung verdienten. Für den Historismus ist solche direkte naive Teilhabe an Bewunderungswürdigem bedeutungslos. Für ihn wohnt die Bedeutung in Rekonstruktionen. Für Montaigne sind die geschundenen Überreste in Rom unendlich viel bedeutsamer als alle sonstige Kunde über die Vergangenheit.
Montaignes Tagebuch seiner Reise durch Deutschland und Italien ist ein einzigartiges Dokument seines Verhältnisses zu geschichtlichen Zeugnissen, denen er sich, ungefiltert durch ästhetische Wertschätzung, in ihrer Dinglichkeit zuwendet. Er achtet auf die Größe und technische Beschaffenheit der Kirchen und der antiken Bauten, er betastet sie eher, als daß er sie betrachtet, er sucht an ihnen nach Inschriften, die ihren Charakter als Zeugnisse bekräftigen. Wie Zbigniew Herbert in seinem schönen Aufsatz über »Monsieur de Montaignes Reise nach Italien« bemerkt, ist dieser »empfänglicher für das Seltsame, Sinnreiche, technisch Neue als für das Schöne«. Er interessiert sich für allerlei kunstreiche Vorrichtungen, für Mühlen, Wasserkünste, raffinierte Brunnen, über die Verteidigungsanlagen von Augsburg verbreitet er sich auf mehreren Seiten. Seine »grenzenlose Bewunderung«, notiert Zbigniew Herbert, »erregt Pratolino, eine Besitzung des Großherzogs von Toskana, mit ihrer künstlichen Grotte, der hydraulischen Orgel, den sich bewegenden Statuen, den Kanonenschlägen und dem Vogelgezwitscher. Dieses etwas jahrmarkthafte Spektakulum versieht Montaigne mit dem Kommentar: ›Das übertraf alles, was wir je gesehn.‹«
Montaigne, der sich von der Zukunft völlig freihält, empfindet es als Erleichterung, daß er der Letzte seines Geschlechts sein wird und daß er für keine Zukunft einstehen muß. Er ordnet seine Dinge nur so weit, daß er sie einer ungewissen Zukunft überlassen kann. Er wirkt glaubwürdig, wenn er sagt: »Ich schreibe mein Buch für wenige Menschen und für wenige Jahre.« Denn hätte er sich ein längeres Nachleben sichern wollen, so hätte er es, nach allem, was er über die Zukunft wissen konnte, einer dauerhafteren Sprache anvertrauen müssen – dem Lateinischen. Daß das gewöhnliche Französische, dessen er sich bediente, das Tor zur Zukunft aufschließen würde, konnte er nicht wissen. Durch Zufall gelangte er in die Zukunft, die ihn nicht interessierte.
Immer wieder überrascht Montaigne. So möchte man von einem Essai über Eitelkeit erwarten, daß sein Autor einen Bereich bezeichnet, in dem er gegen den Vorwurf der Eitelkeit gewappnet wäre. Montaignes Strategie ist eine andere. Er beginnt seinen Essai mit dem Eingeständnis, es müsse das Eitelste sein, über die Eitelkeit zu schreiben. Er läßt sie als so allgegenwärtig erscheinen, daß sie als Vorwurf an Gewicht verliert. Er schildert seine Eitelkeit sogar dort, wo man sie am wenigsten vermutet hätte – doch nicht, um sie als berechtigt erscheinen zu lassen, sondern um die Kritik an ihr zu erschöpfen. Ein Laster, dem man sich so wenig entziehen kann, läßt den moralisierenden Angriff von sich abprallen. Nicht die Eitelkeit könne man vermeiden, sondern daß man ihr erliegt, ohne es zu bemerken und ohne sie zu erkennen. Wir seien ganz durchtränkt von ihr, so daß allenfalls jene, die es wissen, dabei etwas besser wegkämen. »Und auch dessen bin ich nicht sicher«, lautet der charakteristische Nachsatz Montaignes.
Der Vorwurf der Eitelkeit zielt freilich ins Zentrum des Montaigneschen Unternehmens eines aufrichtigen Selbstporträts. Ein eitles Unterfangen wird Pascal dieses Vorhaben Montaignes, sich selbst zu schildern, nennen – ein Versagen des Sündenbewußtseins. Montaigne hat diesen Einwurf, wenn auch nicht in einer theologischen Sprache, vorweggenommen. Es sei eine Abweichung von den Anordnungen der Natur, die unsere Augen mit Bedacht nach außen gerichtet habe. »Wir lassen uns mit der Strömung treiben; aber gegen den Strom zu uns zurückzufinden, ist ein mühseliges Unternehmen: das Meer tobt und verlegt sich selber den Weg, wenn es in seine Grenzen zurückgetrieben wird.« Wie eine höchste Steigerung der allpräsenten Eitelkeit muß es da wirken, wenn man sich auf sich selbst zurückwendet.
Sogar das delphische Gebot »Erkenne dich selbst!« zieht er in diesen Universalverdacht hinein. Aber nachdem alles unter das Verdikt der Eitelkeit gefallen ist, wird die rettende Formel gefunden, um das eigene Buch diesem Verdacht zu entziehen: »Alles ist Eitelkeit für dich, in dir und außer dir; doch sie ist weniger eitel, wenn sie weniger umfängt.« Die Selbstverkleinerung des Menschen, die Montaigne überall in seinen »Essais« mit List und Nachdruck betreibt, wird auch hier zum Rettungsmittel. Nur wer sich seiner wahren Kleinheit bewußt wird, wird dem delphischen Gebot gerecht. Selbsterkenntnis ist die Erkenntnis der wahren Größe und also der Kleinheit des Menschen. Der Mensch, der nur sich selbst in den Blick nimmt, mag eitel sein, aber er schränkt seine Eitelkeit auf den kleinsten möglichen Umfang ein.
In einem Brief an Boisserée vom 24. Juni 1816 spricht Goethe von Denksteinen – sie müssen um und um gewendet werden.
Gesunkenes Kulturgut ist nicht nur unten anzutreffen, oft schwimmt es oben.
Eine Fehlprognose in unserer Zeit ist, daß das Zeitalter des Nationalismus zu Ende gegangen sei oder zu Ende gehe. Richtiger wäre es zu sagen, daß die nationalen oder nationalistischen Motive sich in den Hintergrund, hinter einen Schleier von universalistischer und menschenrechtlicher Rhetorik zurückgezogen haben. Auch die Phase der Indienstnahme des Nationalismus durch revolutionäre Programme und Rhetorik ist vorübergegangen, ohne daß sich an diesem Befund etwas änderte.
Der große kulturrelativistische Schub, der vom achtzehnten Jahrhundert ausging und Europa aus dem Mittelpunkt des kulturellen Universums zu rücken schien, hat gegen die Absichten seiner Urheber die Dynamik des Eurozentrismus erst freigesetzt. Die kritische Infragestellung des eurozentrischen Weltbildes wurde zur Grundlage der weltbeherrschenden Rolle der europäischen Kultur. Der Selbstzweifel und die Relativierung der eigenen Position schufen die Überlegenheit, die sie untergraben wollten.
Ist es den Lesern von Georg Büchner geläufig, daß »Friede den Hütten! Krieg den Palästen!« im »Hessischen Landboten« ein Chamfort-Zitat ist? Mit seiner Freundin, der englischen Dichterin Helena-Maria Williams, ging Chamfort 1792, zur Zeit der Schlacht von Valmy, zu einem Pariser Essen und improvisierte bei dieser Gelegenheit ein Kampflied für die Armee: »Troupes guerrières/Sur vos drapeaux/Placez ces couplets:/Paix aux chaumières/Guerre aux châteaux« (Kriegstruppen, heftet an eure Fahnen dieses Liedchen: Friede den Hütten, Krieg den Schlössern).
Chamfort entdeckt den Widerspruch als den Universalschlüssel zur Realität: »Da bei uns alles eine Folge von Widersprüchen ist, so genügt schon die geringste Aufmerksamkeit, um sie zu bemerken und miteinander zu verbinden. So kommt es ganz ungezwungen zu Kontrastwirkungen, und wer sie aufdeckt, scheint ein höchst geistreicher Mann zu sein.« Der geistreiche Chamfort ist der Herr der Salons. Doch in einer widersprüchlichen Gesellschaft ist es nicht schwer, geistreich zu sein. Sie trägt ihm alles zu, was er in seine Wahrnehmung aufnimmt. Wenn man also ohne große Anstrengung geistreich sein kann, so kann man sich dies nicht als Verdienst zurechnen. So ist, was Chamfort entdeckt, ein vernichtendes Urteil über die Gesellschaft.
Die scheinbar absichtslose Freilegung von Kontrastwirkungen und Widersprüchen ist die literarische Technik Chamforts. Es ist das, was er aus dem Salon mitbringt. Indem er dieser Technik aber das Gekünstelte nimmt und sie als eine Selbstenthüllung der Wirklichkeit ausgibt, macht er etwas Neues aus ihr. Indem er einfach erzählt, wird er, ohne daß er sich dessen versieht, zum Satiriker und Humoristen. Der Wechsel der Gattungen geschieht gleichsam spontan: »Erzählen heißt bei uns Grotesken vorbringen. Ein einfacher Berichterstatter wird zum Humoristen, und unsere Historiker werden einst als satirische Schriftsteller gelten.« Auf den Gedanken, daß er der Suggestion seiner Pointen erliegen könnte, kommt Chamfort nicht.
Den Übergang vom Verhalten in Nahhorizonten zu dem in Fernhorizonten hielt Charles Darwin mühelos für vollziehbar. In »Die Abstammung des Menschen« schreibt er: »Wenn der Mensch in der Kultur fortschreitet und kleine Stämme zu größeren Gemeinwesen sich vereinigen, so führt die einfachste Überlegung jeden Einzelnen schließlich zu der Überzeugung, daß er seine sozialen Instinkte und Sympathien auf alle, also auch auf die ihm persönlich unbekannten Glieder desselben Volkes auszudehnen habe. Wenn er einmal an diesem Punkte angekommen ist, kann ihn nur noch eine künstliche Schranke hindern, seine Sympathien auf die Menschen aller Nationen und aller Rassen auszudehnen.« Diejenigen, die das Verhalten im Nah- und Fernhorizont gegeneinander absetzen und meinen, daß es zwischen beiden keine Kontinuität gebe, verkennen die Rolle der Gewohnheit, die in beiden Fällen Orientierung gibt. Verwirrung tritt nur ein, wenn man das Verhalten in Fernhorizonten vom Verhalten in Nahhorizonten und von der dort eingeübten Gewohnheit her denkt und verstehen will. Das ist so, als wenn Autobahnen mit Wanderwegzeichen versehen würden.