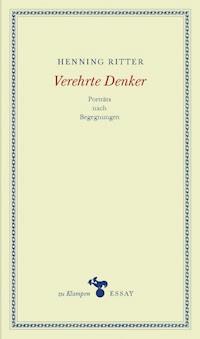
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: zu Klampen Essays
- Sprache: Deutsch
Blitzartig können persönliche Begegnungen das Denken des Gegenübers erhellen. Die in diesem Band versammelten Porträts einiger der bedeutendsten Gelehrten unserer Zeit wollen deren Werk aus einer persönlichen Sicht und in Momentaufnahmen beleuchten. Dass die Biographie einen privilegierten Zugang zur Welt der Ideen zu bieten vermag – diese Einsicht verdankt Henning Ritter dem Philosophen Isaiah Berlin. Er bezeichnet die Auseinandersetzung mit dessen Schriften als 'rettend', riss sie ihn doch aus seiner 'ans Theoretisieren verlorenen Haltung'. Die persönliche Begegnung mit dem herausragenden Ideengeschichtler gehört zu jenen Erfahrungen, die in Henning Ritters Leben und Denken einen tiefen Abdruck hinterlassen haben. So verschieden die Porträtierten – Carl Schmitt, Jacob Taubes, Klaus Heinrich, Isaiah Berlin und Hans Blumenberg – auch sein mögen, gemeinsam ist ihnen, dass Denken und Person in einer großartigen Spannung zueinander stehen. Henning Ritter gelingt es, diese Spannung sichtbar zu machen, indem er in geraffter Form und in betont subjektiver Sicht Person und Werk ineinander spiegelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 98
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reihe zu Klampen Essay Herausgegeben von Anne Hamilton
Henning Ritter, Jahrgang 1943, lebt in Berlin. Er war von 1985 bis 2008 bei der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« verantwortlicher Redakteur für das Ressort »Geisteswissenschaften«. Die Universität Hamburg verlieh ihm im Jahr 2000 die Ehrendoktorwürde. 2005 erhielt er den Ludwig-Börne-Preis und 2011 den Preis der Leipziger Buchmesse. Zuletzt sind von ihm erschienen »Die Eroberer« (2008)
Henning Ritter
Verehrte Denker
Inhalt
Cover
Informationen zum Autor
Titelseite
Carl Schmitt
Besuch in Plettenberg
Jacob Taubes
Verstehen, was da los ist
Klaus Heinrich
Die lange Lehre zum kurzen Protest
Isaiah Berlin
Das Treffen in Frankfurt
Hans Blumenberg
Imaginäre Bibliotheken
Impressum
Carl Schmitt
Besuch in Plettenberg
Es klingelte, und ich lief zur Tür. Ein wichtiger Besucher war angekündigt. Ich sollte meinen Diener machen und den kleinen älteren Herrn, gewiß weit über sechzig, hereinlassen – »Legen Sie bitte ab«. Daß uns Kindern das Empfangsritual übertragen war, daran waren meine Schwester und ich schon lange gewöhnt. Vaters Amtsgeschäfte – er war seit 1947 Professor für Philosophie an der Universität Münster – wurden in den ersten Jahren zu Hause abgewickelt, da das Seminargebäude noch nicht wieder aufgebaut war. Es war unsere Aufgabe, die Studenten, die zur Sprechstunde kamen, zu empfangen und zu Vaters Arbeitszimmer zu bringen. Wenn sie warten mußten, pflegten wir sie mit allerlei »Döntjes« zu unterhalten. Beim Mittagessen gaben wir zum Besten, was wir aufgeschnappt hatten, aber auch unsere oft grausamen Urteile über die Studenten. Unser Examen bestanden nur wenige.
Seltener kamen namhafte Besucher, abends bekamen wir sie nicht zu Gesicht. Den Gast, der sich als Carl Schmitt vorstellte, hatte mein Vater als einen bedeutenden Mann angekündigt. Als er bei uns erschien, es war 1957, war ich noch nicht vierzehn Jahre alt. Von den näheren Umständen seines Besuchs wußte ich nichts. Er sollte im Collegium Philosophicum, dem Diskussionskreis der fortgeschrittenen Studenten, einen Vortrag halten. Das war nicht selbstverständlich. Carl Schmitt war wegen seiner Rolle im Nationalsozialismus nach 1945 kaltgestellt und ohne Aussicht, in die akademische Welt zurückkehren zu können.
Daß er in Münster auftreten konnte, ohne daß es seitens der Universität zu einem Einspruch kam, erklärt sich dadurch, daß diese Veranstaltung als private Begegnung deklariert wurde. Die Teilnahme war sogar für die Mitglieder des Collegiums freiwillig, und die Zuhörer brachten die gesamten Kosten des Besuchs von Carl Schmitt in Münster aus der eigenen Tasche auf. Ernst Wolfgang Böckenförde, der zum engeren Kreis um Carl Schmitt gehörte, hatte das Treffen angeregt, und mein Vater meinte, daß ein Mann vom Range Carl Schmitts, trotz seiner nationalsozialistischen »Belastung«, als bedeutender Kopf und Gesprächspartner nicht ignoriert werden dürfe.
Carl Schmitt war der erste, der wie mit einem Erwachsenen mit mir redete. Er setzte voraus, daß ich wußte, mit wem ich es zu tun hatte, und als wollte er zeigen, daß er ein umgänglicher Mensch war, stellte er sich mir von einer unerwarteten Seite vor – als Erzähler. Er holte ein schmales Büchlein hervor, ein in grünes Leinen gebundenes Reclamheftchen. Darin würde ich, meinte er, spannende Geschichten über Piraten und Abenteurer finden. »Land und Meer« lautete der Titel. Darunter stand: »Eine weltgeschichtliche Betrachtung«. Daß der Verfasser damit auf einen großen Historiker des neunzehnten Jahrhunderts anspielte, auf Jacob Burckhardts »Weltgeschichtliche Betrachtungen«, konnte ich damals nicht wissen.
Als ich das Heft aufschlug, fand ich darin eine handschriftliche Widmung: »Für Hanns Henning Ritter zur Erinnerung an den Besuch von Carl Schmitt, Münster im März 1957«. Und unter der Widmung standen in der schönen, aber für mich nicht gleich lesbaren Handschrift noch ein paar Zeilen: »Ich denke, lieber Hanns Henning, daß dich die Sache mit dem Wal (Seite 15 ff.) und die Geschichte der Lady Killigrew (Seite 27 ff.) besonders interessieren könnte. C. S.« Auf der Rückseite des Titelblatts fand ich später eine gedruckte Widmung: »Meiner Tochter Anima erzählt.« In gewisser Weise sollte ich mich durch die handschriftliche Widmung einbezogen fühlen in die Intimität dieser väterlichen Erzählung.
Das Gewand, in das er seine Gedanken über die europäischen Raumrevolutionen gehüllt hatte, war dazu angetan, Leser irrezuführen. Ja, offenbar war es die Absicht dieses schmalen Büchleins, seine Leser nicht merken zu lassen, daß der Verfasser in dieser Erzählung dieselben Ansichten darlegte, die er in gelehrten und umstrittenen Abhandlungen und Büchern vertreten hatte. Auf diese Weise hatte Carl Schmitt sich ein Schlupfloch geöffnet, durch das er aus dem Gehege der öffentlichen Ächtung auszubrechen vermochte.
»Land und Meer« ist eine Geschichtsphilosophie in nuce, zweifellos ein Wunderwerk doppelter Lesbarkeit. Die Geschichten über die Walfänger, die bei ihrer Jagd nach dem Wal als erste die Weltmeere in allen Richtungen durchpflügten, und über die räuberische Lady Killigrew, die zur Zeit der Königin Elisabeth mit ihrer Piratensippschaft die Schiffe, die der Küste zu nahe gekommen waren, unbehelligt ausraubte und niemanden mit dem Leben davonkommen ließ, lasen sich wie spannende Abenteuer und waren doch zugleich Wegmarken in der ungeheuren Geschichte der Verwandlung Englands in ein Seereich.
Während der Leser sich als Zuschauer der Abenteuer der europäischen Welteroberung in der Sicherheit eines lange zurückliegenden Geschehens weiß, wird ihm von den Umwälzungen des Raumbewußtseins buchstäblich der Boden unter den Füßen weggezogen. An der Schwelle zur Gegenwart folgt auf die maritime Expansion die Eroberung des Luftraums, die die herkömmlichen Unterscheidungen von Land und Meer obsolet macht. Der Märchenton, in den die Vergangenheit getaucht war, ließ die Zukunft eher noch beunruhigender erscheinen.
Mich hat der Hinweis auf »die Sache mit dem Wal« und die Geschichte der Lady Killigrew lange davon abgehalten, die andere Geschichte, die Carl Schmitt erzählte, zu bemerken und den Hintersinn dieser kleinen Weltgeschichte der europäischen Expansion zu erfassen. Seinen literarischen Rang offenbart das sechzigseitige Buch aber erst dann, wenn man einer solchen jugendlichen Lektüre in späteren Jahren eine andere folgen läßt, die ein Gespür für die untergründigen Beängstigungen hat, die tiefer gehen als die von den Abenteuern der Piraten geweckte Spannung.
Die Geste Carl Schmitts hat mich dauerhaft für ihn eingenommen. Damals konnte ich nicht durchschauen, welch geniale Menschenfängerei eines alten Mannes darin lag. Der Eindruck dieser ersten Begegnung war so stark, daß ich noch während meiner Schulzeit auf Bücher von Carl Schmitt zu achten begann. Eine Nachwirkung jener ersten Begegnung war auch, daß ich während meines vierten Semesters – ich war inzwischen von Marburg nach Berlin gewechselt und hatte dort Philosophie zu studieren begonnen – eine Einladung von Carl Schmitt erhielt, ihn in Plettenberg zu besuchen. Für die Übernachtung in einem Dorfgasthaus hatte er gesorgt. Ich sollte ihn nachmittags und abends in seinem Haus aufsuchen, mit Abendessen und Wein, und am nächsten Vormittag noch einmal vorbeikommen. Er wollte mich dann zum Bahnhof fahren lassen. Das tat er auch und begleitete mich.
Carl Schmitt war ein großzügiger, unkomplizierter Gastgeber und widmete mir die ganze Zeit meines Besuchs in Plettenberg. Ich wußte mittlerweile eine Menge über den Staats- und Verfassungsrechtler, der schon in den zwanziger Jahren einen großen Ruf hatte und nach 1933 dem nationalsozialistischen Regime diente. Nach einem Angriff im »Schwarzen Korps« im Jahre 1936 verlor er seine Parteiämter. Er zog sich vom Staatsrecht zurück und lehrte und publizierte auf dem Gebiet des Völkerrechts. Sein Buch »Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum«, das 1950 erschien, war aus Vorlesungen und Seminaren zu Beginn der vierziger Jahre hervorgegangen, und auch »Land und Meer« war 1942 zuerst veröffentlicht worden.
Ich wäre damals nicht nach Plettenberg gefahren, wenn ich erwartet hätte, mit nationalsozialistischen Apologien konfrontiert zu werden. Es gehört zu den irrigen Ansichten über jene Jahre, daß man damals in dieser Hinsicht weniger wach gewesen sei als später, besonders nach 1968. Das Gegenteil trifft wahrscheinlich zu. Wer zwischen Ruinen aufgewachsen war, mit vier Jahren den Vater zum ersten Mal gesehen hatte, als er aus der englischen Kriegsgefangenschaft zurückkehrte – »Da bist du ja endlich!« –, wer den Bemerkungen über Unbelehrbare gelauscht hatte, konnte als Zwanzigjähriger sich zutrauen, daß er Nostalgie für das untergegangene Reich sofort bemerken würde. Die Gewißheit, daß Carl Schmitt seinem nationalsozialistischen Engagement keineswegs nachhing, ist mir seit dieser Begegnung geblieben. Mehr noch, daß er von seiner geistigen Herkunft und seinen intellektuellen Loyalitäten her keine substantiellen Beziehungen zum Nationalsozialismus hatte. Seine Affinität zum reaktionären Denken hatte ihre Wurzeln im neunzehnten Jahrhundert, im Kulturkampf und im Frankreich der Dreyfuskrise. Léon Bloy war der Kopf, zu dem er über die Jahre immer wieder eine besondere Affinität bekundete.
In seiner mit Büchern vollgestopften Bibliothek ließ er sich von einem vielleicht zufälligen, aber traumwandlerisch sicheren Griff zu Büchern leiten, von denen er annahm, daß sie mich in ein Gespräch ziehen könnten. Wie konnte er, als er Lucien Goldmanns Buch über Racine, »Le Dieu caché« herauszog, wissen, daß der französische Literatursoziologe, ein führender Kopf der Linken, mir nicht unbekannt war? Woher wußte Schmitt, daß der Kunsthistoriker Erwin Panofsky einer meiner Lieblingsautoren war? Auf wundersame Weise zog er dessen jüngste Publikation, »Pandora’s Box«, aus einem Bücherstapel hervor. Panofsky, der von seinen Freunden »Pan« genannt wurde, hatte es zusammen mit seiner Frau Dora geschrieben, nicht zuletzt um des Effekts willen, der sich aus der Verbindung ihrer beiden Namen in dem mythischen Namen »Pandora« ergab. Carl Schmitt erledigte nun dieses so gelehrt wirkende Buch als ein oberflächliches Spiel mit einem großen mythischen Thema. Mit wenigen Sätzen hatte er einen meiner akademischen Heroen demontiert.
Woher schließlich konnte Carl Schmitt von meiner intensiven Beschäftigung mit Walter Benjamin wissen? Durch den Band »Illuminationen« hatte ich ihn zuerst kennengelernt, und die beiden von Friedrich Podzus herausgegebenen Bände der »Schriften« hatte ich mir damals aus der Universitätsbibliothek entliehen und Aufsatz für Aufsatz studiert. Nun trat ein anderer Benjamin hervor. Carl Schmitt erwähnte den Brief, den Benjamin ihm 1930 über seine Abhandlung »Politische Theologie« geschrieben hatte und der heute in der Ausgabe der Briefe Benjamins nachzulesen ist, nachdem er von deren Herausgebern zunächst unterschlagen worden war. Für mich war die Erwähnung des Kontaktes zwischen Benjamin und Carl Schmitt eine aufregende Neuigkeit. Carl Schmitt sprach mit großer Hochachtung von Benjamins ästhetischen Forschungen. In seinen Augen war Benjamin weder Marxist noch Materialist, vielmehr stand seine intensive Beziehung zur Romantik und zum Mythos im Vordergrund.
Was mich bei dem Besuch bei Carl Schmitt am meisten beeindruckte, mindestens ebenso stark wie die instinktive Sicherheit, mit der der alte Herr das Gespräch auf Themen brachte, die auf mich wirkten, als hätte er meine geheimen Vorlieben erraten, war seine Fähigkeit zuzuhören. Er wußte sicher, daß junge Menschen am leichtesten zu fassen sind, wenn man sie für voll nimmt, also genau darauf hört, was sie sagen, und darauf antwortet. Da war, wie mir nicht verborgen bleiben konnte und sich wenige Jahre später weltweit zeigen sollte, ein Mann, dessen Ruhm noch längst nicht ausgeschöpft war, der darauf wartete, daß die Dinge sich zurechtrückten und er den Platz einnehmen würde, der ihm zustand. Diese Erwartung, die den ungeheuer ehrgeizigen Mann bis in alle Fasern durchdrungen haben mochte, war es wohl auch, die ihn auf so einzigartige Weise aufmerksam sein ließ und zu einem Zuhörer machte, wie ich noch keinen erlebt hatte und auch später nicht erlebte. Denn der junge Mann, dem er aufmerksam zuhörte, war ein Gefäß jenes Nachruhms, auf den er zuversichtlich hoffte.
Aus den Notizen, die ich mir nach meinem Besuch bei Carl Schmitt machte – sie beginnen am 2. Januar 1964 –, ist nicht viel zu gewinnen. Es fiel mir nicht leicht, meine Eindrücke zu fixieren. Aber ich fühlte mich magisch berührt von Schmitts Art zu sehen, zu denken, fasziniert von der Spannung, die er zu erzeugen vermochte. So gewann das Gespräch eine lange nachwirkende Intensität. Einer seiner Sätze, der sich mir besonders einprägte, lautete: »Entfesselung ist nicht schwer.« Er könne sich die Kleider vom Leib reißen, sagte er mit einer heftigen Geste: »Dann bin ich nackt, das ist eher komisch: Der Mensch ist nicht nackt.«
Jacob Taubes
Verstehen, was da los ist
DER amerikanische Professor, der unlängst umherreiste und alle erreichbaren Leute interviewte, die mit Jacob Taubes zu tun gehabt hatten, ist ein ausgewiesener Kenner der deutschen Geistesgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Er hat ein Buch über Hans Freyer geschrieben, um sich über die Gründe für die Anfälligkeit junger deutscher Akademiker für den Nationalsozialismus Klarheit zu verschaffen. Sein Interesse für deutsche Universitätsverhältnisse scheint echt zu sein. Der rundköpfige Brillenträger führt das Gespräch wie ein Protokollant, der alles im Kästchen haben will. Er scheint meine Antworten in eine vorbereitete Liste einzutragen, um sie mit den schon gesammelten Antworten abgleichen zu können. Offenbar hat er das eine oder andere schon von anderer Seite gehört und macht deswegen bei manchen Mitteilungen von mir nur einen Haken. Für Jacob Taubes interessiert sich der Professor vor allem deswegen, weil andere sich für ihn interessiert haben und interessieren.
Gelegentlich korrigiert er meine ungenauen Erinnerungen. So bei der Anekdote darüber, wie Jacob Taubes von Kollegen, denen sein umfassendes Bescheidwissen auf die Nerven ging, hereingelegt wurde. Sie verabredeten sich, ein Gespräch über einen mittelalterlichen Gelehrten zu führen, den sie sich ausgedacht hatten, in der Erwartung, daß Taubes, wenn er unvorbereitet zu diesem Gespräch hinzukäme, sich, wie er es gewöhnlich tat, sofort einmischen würde, um seine unerschöpflichen Kenntnisse zu demonstrieren. So geschah es: Nicht nur kannte Taubes jene obskure Gestalt, er teilte sogar, als wäre er ein intimer Kenner dieser Figur, eine Fülle von Details aus seinem Leben und seinen Schriften mit – bis seine Kollegen ihn schließlich darüber aufklärten, daß sie sich diese Figur ausgedacht hatten, um ihn in die Falle laufen zu lassen. Diese Blamage, die sich meiner Ansicht nach an der Columbia University zugetragen hatte und die, wie ich meinte, der Anstoß gewesen war für Taubes’ Entschluß, Amerika zu verlassen und nach Berlin an die Freie Universität zu gehen, hatte sich allerdings schon einige Jahre zuvor an der Harvard University ereignet, ohne die von mir angenommenen dramatischen Folgen zu haben. Ein Scherz ohne Bedeutung.
Auch das meiste von dem, was ich aus eigener Erinnerung beitrug, hatte der Professor schon von anderen eingesammelt. Diese Tatsache, die auf mich ernüchternd wirkte, beflügelte ihn. Während seine Kenntnisse der Person, der er selbst nie begegnet war, immer mehr zunahmen, wurden meine persönlichen Eindrücke, die ich wie ein Vermächtnis hütete, immer gewichtsloser. Zusehends erwies sich der Interviewer als Herr auch über meine Erinnerungen. Und je mehr Überschneidungen mit den Aussagen seiner sonstigen Informanten er registrieren konnte, desto mehr gewann sein Vorhaben an Substanz, aus einer Vielzahl von Aussagen anderer das Bild der Person von Jacob Taubes erstehen zu lassen.
Am Ende wußte ich nicht mehr, warum ich viele Jahre lang mit Jacob Taubes befreundet gewesen war und was mich damals an ihm gefesselt hatte. Ich konnte mich damit trösten, daß meine ersten Eindrücke von Jacob Taubes fast vierzig Jahre zurücklagen, so daß sich Erinnerungsschwächen leicht erklären ließen. Dennoch war die Enttäuschung über meine dürftige Gedächtnisleistung groß, sie wirkte wie ein persönliches Versagen gegenüber einem Lehrer und Freund. Ich stellte mir vor, daß es nach der Niederlage deutschen Kriegsgefangenen ähnlich erging, wenn sie über eine erledigte Vergangenheit befragt wurden. Allein dadurch, daß der Befragte keine Verbindung zur Vergangenheit herstellen kann, entsteht ein Schuldgefühl. So lieferte ich einen Teil meiner Geschichte ab, ohne innere Beteiligung.
Der amerikanische Professor hat das Thema des Buches, das er über Jacob Taubes zu schreiben gedenkt, in Vorträgen und Zeitungsartikeln erläutert. Er wolle, hat er erklärt, die Frage beantworten: »Wer war dieser Mann, und warum haben sich so unterschiedliche Intellektuelle auf drei Kontinenten und quer durchs politische Spektrum für ihn interessiert?« Das Etikett, das er für ihn gefunden hat, lautet: »Ideenhändler«. Dieser Mann, um den sich so viele Anekdoten rankten und der sich in so vielen verschiedenen Welten bewegt hat, sollte demnach wohl jemand sein, der nicht einer Idee sich ergeben hat, sondern der es mit vielen Ideen aufgenommen und aus der Not dieses Zuviel an intellektuellen Loyalitäten eine Tugend gemacht hat, indem er mit dem, was er im Überfluß besaß, lebhaften Handel trieb.
Schon früh hatte Jacob Taubes in dem Ruf gestanden, »charismatisch« oder »dämonisch« zu sein. Das bezeugten seit den frühen sechziger Jahren, wie der amerikanische Professor weiß, Intellektuelle aus dem konservativen wie aus dem linken Lager. Und in seinen Interviews, die er später mit einer Vielzahl von Leuten führte, die Jacob Taubes begegnet waren, ergab sich bald die merkwürdigste Zusammensetzung von Facetten einer Persönlichkeit, die nur schwer auf einen Nenner zu bringen war.
Der Sproß einer rabbinischen Gelehrtenfamilie, der selbst noch zum Rabbiner ausgebildet worden war und sowohl bei protestantischen wie katholischen Theologen – Hans Urs von Balthasar und Karl Barth – studiert hatte, kam in den späten vierziger Jahren nach New York, wo er am Jewish Theological Seminar lehrte, Privatunterricht bei Leo Strauss genoß und mit aus Deutschland emigrierten Intellektuellen, wie Hannah Arendt und Paul Tillich, in Berührung kam. In Jerusalem wurde er enger Schüler Gershom Scholems, bis es zwischen ihm und seinem Lehrer zu einem unheilbaren Bruch kam, der ihn zur Rückkehr in die Vereinigten Staaten veranlaßte, wo er in Harvard eine eigenwillige Variante europäischer Geistesgeschichte lehrte. Damals wurden Herbert Marcuse und Taubes Freunde. Es war der Anfang seiner »linken« Biographie, die in der Mitte der sechziger Jahre in Berlin zu voller Blüte gelangte.
Das Interview mit dem amerikanischen Professor rief mir, ohne daß es mir gleich klar wurde, ein Gespräch mit Jacob Taubes in den ersten Jahren unserer Bekanntschaft in Erinnerung. Taubes erwähnte bei dieser Gelegenheit den Roman »Der Letzte der Gerechten« von André Schwarz-Bart, der Anfang der sechziger Jahre auch auf Deutsch erschienen war, aber nach einem beachtlichen Anfangserfolg hierzulande bald wieder in Vergessenheit geriet. Der Autor erzählt in einer altmodisch chronikalischen Weise die Geschichte einer jüdischen Familie von den ersten Kreuzzügen bis Auschwitz. Die Erzählweise gibt dem Weg dieser Familie eine merkwürdige Finalität: Im Lichte von Auschwitz wird alles im Rückblick bedeutsam, die Vergangenheit ist gleichsam verstrahlt. Der Autor hat als Überlebender einer Familie von Deportierten eine eigentümlich unwirkliche Stellung zu dieser Geschichte. Er wurde aus ihr herausgeschleudert. Dies gab für Jacob Taubes den Anstoß, mir Wort und Begriff der »Überlebensschuld« zu erklären: Die Überlebenden fühlen sich schuldig, weil sie von dem Schicksal der anderen nicht erfaßt wurden. Sie können angesichts der Würde der Opfer das Gefühl entwickeln, daß sie nicht würdig waren, deren Schicksal zu teilen.
Nirgends sonst scheint mir, ist die Distanz von Tätern und Opfern größer als in der Bekundung dieses letztlich doch fiktiven Schuldgefühls. Eben-so verständlich ist aber, daß dieses Schuldgefühl am wenigsten eine Rolle im öffentlichen Diskurs über Auschwitz und den Holocaust spielen konnte, nicht allein wegen seines gleichsam privaten, innerlichen Charakters, sondern auch, weil es eine Art Einverständnis mit dem Geschehenen bekundet, indem es dieses nur als passiv hinzunehmendes auffaßt, nicht als ein solches, gegen das aufbegehrt werden kann.
Damals hat mir Jacob Taubes den Sinn für die humane Bedeutung des Gefühls der Überlebensschuld sehr eindringlich vermittelt. Ich dachte, daß dies nun der Schlüssel zu allem Reden über Auschwitz werden würde, daß es sich sogar bei denen verbreiten könnte, die als Opfer nicht ausersehen waren. Es ist mit diesem Gefühl aber anders gewesen als mit vielem, wofür die Holocaust-Literatur sensibilisieren konnte: Es hat seinen exklusiven Charakter behalten, wobei ich annehmen durfte, daß wie Jacob Taubes auch viele andere ein lebhaftes Sensorium für diese Art von unschuldiger Schuld besaßen, ohne es zu erkennen zu geben. Tatsächlich bedarf es wohl einer starken religiösen oder gar theologischen Vorprägung, um mit dem Gefühl der Überlebensschuld etwas anfangen zu können. Es ist die Schuld nach der Katastrophe, von ähnlicher Intensität wie jene Emotionen, die der Erwartung einer nahen Katastrophe vorausgehen, wie wir sie aus dem Umfeld des Neuen Testaments kennen. Es handelt sich um ein religiöses, ein apokalyptisches Gefühl.
Wenn ich mich frage, wodurch Jacob Taubes auf mich als Lehrer eingewirkt hat, dann waren es Mitteilungen wie die eben geschilderte: Der Lehrer ist ohne jede Scheu, dem Schüler Probleme zuzumuten, für deren Wahrnehmung, geschweige denn Lösung dieser keine Voraussetzungen mitbringt. Hierin liegt eine gewisse Phantastik: Man erfährt von Dingen, von denen einen verständigen Gebrauch zu machen einem gleichwohl verwehrt ist, weil es sich um Erfahrungen handelt, an deren Voraussetzungen man nicht teilhat. Dezent ins Vertrauen gezogen und mit exklusiven religiösen und theologischen Erfahrungen bekannt gemacht – man lebt nicht in der Welt des Apokalyptikers – erfährt man zweifellos so etwas wie Erhabenheit, da der Gegenstand des Nachdenkens der Erfahrung inkommensurabel ist. Für Taubes, so lernte ich verstehen, ging es auch in der Philosophie um nichts anderes, als sich zur Wahrnehmung dieses Inkommensurablen fähig zu machen. Auch wenn er von Schelling, Hegel, Marx sprach, war er nur daran interessiert, das Exorbitante ausfindig zu machen, das auch ihren verständlichsten Sätzen noch zugrunde lag. Das hatte in den Jahren, in denen man sich, schon unter dem Eindruck der analytischen Philosophie, alles philosophischen Überschwangs enthielt, vielmehr rational rekonstruierte und die Erfahrung, von der die Philosophie handelte, für eine restlos allgemein zugängliche hielt, nachgerade etwas Skurriles und Rückständiges. Es roch nach Theologie.
Versuche ich, mir die »Lehre« von Jacob Taubes, zumal um die Mitte der sechziger Jahre, als er noch nicht der allgegenwärtige linke Philosoph der Freien Universität war, sondern Judaistik und Religionssoziologie lehrte und durch stupende Kenntnisse gleichermaßen über Judentum wie Christentum beeindruckte, zu vergegenwärtigen, so stoße ich auf Namen und Bücher, deren Lektüre er denen dringend empfahl, die er als seine Schüler ansah. Missionierung war dafür der zutreffendere Ausdruck als Lehre: Es war der Gestus eines ebenso verführerischen wie autoritativen »Nimm und lies«, mit dem er einem Autoren und Bücher aufdrängte. Da waren einmal die Namen jenes intellektuellen Milieus, in dem er in New York gelebt hatte und dessen Protagonisten er mit Anekdoten und persönlich gefärbten Schilderungen vorstellte. Über Lionel Trilling, den jüdischen Literaturkritiker und Ideenhistoriker des protestantischen Amerika, erzählte er, daß man ihn wegen seiner restlosen Anpassung an seine geistige Umgebung durch den Kalauer »Incognito, ergo sum« charakterisierte. Die junge Susan Sontag hatte – sie erinnerte sich dessen dankbar bis zuletzt – ein Seminar von Taubes besucht, in dem sie über Hölderlin referierte und dafür Deutsch gelernt hatte.
Das bunte Personal der New Yorker Intellektuellenszene trat in Taubes’ Erzählungen auf, jeder nach Möglichkeit in einer charakteristischen Anekdote. Immer wieder erwähnte Taubes mit dem größten Respekt seinen Lehrer Leo Strauss. War er in Deutschland gerade einmal durch sein Buch »Naturrecht und Geschichte« präsent, so schilderte Taubes ihn als eine Art philosophischen Magier, der alles anders machte, als es üblich war. In seinem Seminar habe er, wann immer ein Vorschlag zur Interpretation des behandelten klassischen Autors gemacht wurde, bis zum Überdruß den Satz wiederholt: »Klug sind wir alle.« Das sollte so viel sagen wie: Klugheit ist nicht genug, es kommt darauf an, einen privilegierten Zugang zu einem Text zu finden, sei es durch ein Schlüsselwort oder einen Schlüsselsatz, der sich an irgendeiner Stelle verbarg. Es kam darauf an, den Zugang zur Philosophie auf einer anderen, tiefer liegenden Ebene zu suchen, und zwar so, daß dadurch ein nicht naheliegendes Gesamtverständnis ermöglicht wurde. Die Werke der philosophischen Tradition bargen jedesmal ein Geheimnis, das es aufzuschließen galt und das allein ihre raison d’être ausmachte. Die These, daß diese Werke verschlüsselt auf uns gekommen seien, weil sie in einem unausweichlichen Konflikt zu den politischen Doktrinen der Gemeinschaft, ihren Sprachverboten und Sprachregelungen standen, klang wie eine sehr aktuelle Lehre.
So wenig bei Jacob Taubes von philosophischer Lehre im geläufigen Sinne die Rede sein konnte, so trat sein Gestus des Lehrens umso deutlicher hervor. Er hielt sein Philosophieren für alles andere als Privatsache. Er lehrte durch nachdrückliches Hinzeigen auf die Philosophen, die seiner Ansicht nach diesen Namen verdienten. Der große Ruf, den Martin Heidegger bei den jüdischen Schülern seiner Marburger und Freiburger Jahre genoß, war bei Taubes, auch in den Zeiten, in denen er sich öffentlich als Linker bekannte, nicht verblaßt. Man braucht nur seinen Aufsatz über die ersten Seiten von Heideggers »Einführung in die Metaphysik«, einer der wenigen philosophischen Aufsätze, die er publiziert hat, zu lesen, um zu erkennen, daß es sich um den Versuch der Rekonstruktion einer authentischen Erfahrung handelt, sei sie nun metaphysisch oder die Analyse einer psychischen Grenzerfahrung.
Aber nicht das Dozieren über philosophische Probleme war Jacob Taubes’ Stärke. Daß er von der Begriffsartistik, zum Beispiel des Philosophen Dieter Henrich, wirklich beeindruckt gewesen wäre, scheint mir zweifelhaft. Seine Bewunderung für dessen souveräne Beherrschung der Philosophie des deutschen Idealismus konnte er zwar nicht unterdrücken, aber er mochte sich diesem Denkstil auch nicht unterwerfen, er versuchte, wo es nur ging, sich einen Ausweg daraus zu eröffnen. Und dieser Ausweg bestand meist in einer Theologisierung der Philosophie, die ihm nur erträglich war, wenn er ihr diese Wendung geben konnte. Philosophische Sätze, wie Wittgensteins: »Die Welt ist alles, was der Fall ist«, interessierten ihn nur dann, wenn es ihm gelang, ihnen einen theologischen Sinn zu unterlegen: Die Welt ist alles, was der Sündenfall ist. Diesen Kalauer hat er sich nicht gescheut, in einem seiner Aufsätze zu drucken. Es war ihm ernst damit, ein ernster Scherz. Darin glich er einem Kleriker, der aus allem nur die für ihn bestimmte Botschaft heraushört. Alle säkulare Philosophie hatte für ihn eine antitheologische Spitze, die es abzubrechen galt: Denn sie wollte den Menschen als von Natur gutes Wesen hinstellen, sie war, selbst wenn sie vom radikal Bösen sprach, eine Leugnung des Bösen.
Und in unmittelbarer Nachbarschaft lauerte für Taubes die Banalität, die eigentliche Gefahr für geistige Tätigkeit war: Der Absturz in die Banalität war der Sündenfall des Denkens. Sie konnte ihm sogar als das Böse schlechthin erscheinen. Alles war also zu tun, um sich nicht in Banalitäten zu verlieren. Deswegen waren geistreiche Bücher, originelle Entwürfe, so verfehlt sie am Ende auch sein mochten, ein Mittel, um das Böse zu exorzisieren. Daraus erklärt sich sein Fetischismus der großen Namen und der großen geistigen Entdeckungen. Ein Philosoph wie Leo Schestow, den er mir schon in der ersten Zeit unserer Bekanntschaft ans Herz legte, mußte nicht Recht haben, aber ich sollte seine große einzelgängerische Leistung erkennen, sich gegen die ganze Tradition der abendländischen Philosophie zu stellen und sie in der Spannung von »Athen und Jerusalem« zu sehen, die für immer unlösbar sein würde. Schestow, das war aus Jacob Taubes’ emphatischen Exkursen über ihn zu entnehmen, hatte die Aufgabe eines freien Philosophierens jenseits der philosophischen Systeme entdeckt und das Recht der Religion gegen ihre angebliche Überwindung durch die Aufklärung verteidigt.
Damit hatte Schestow nach Taubes’ Ansicht etwas erkannt, was weder bewiesen noch widerlegt werden konnte: eine ursprüngliche Sicht auf die Philosophie und ihre Geschichte, die ihn freilich nicht in den Besitz gesicherter Erkenntnis brachte.
Hierher gehört die Geschichte, die Jacob Taubes mir bei anderer Gelegenheit erzählte, über den Rabbi einer galizischen Kleinstadt, der eines Tages unter Wehklagen auf die Straße läuft und den herbeieilenden Einwohnern von einem schrecklichen Pogrom berichtet, das sich in der eine Tagesreise entfernten Hauptstadt zugetragen habe: Die Synagoge stehe in Flammen und die frommen Juden würden gejagt. Am folgenden Tag laufen die verängstigten Einwohner den ersten Ankömmlingen entgegen, die Zeuge des Verhängnisses gewesen sein können. Auf Befragen erklären diese jedoch, sie hätten nichts gesehen. Nachdenklich gehen die immer noch verängstigen Bewohner zurück in das Schtetl und sprechen auf dem Weg über ihren Rabbi, der sich geirrt hat: »Aber den Kück«, sagen sie einhellig, »hat er gehabt.«
Um diesen »Kück« ging es Jacob Taubes, auch er scheute sich nicht, ihn gegen Empirie und allerlei Wahrheitskriterien zu verteidigen. Ich behaupte nicht, daß das alles richtig ist«, sagt er einmal mit Blick auf Karl Barth, »aber es gibt nie etwas ganz Falsches.« Herauszufinden, wo der »Kück« in allen Sachen lag, war sein Beruf. Dies brachte ihn zu einer rastlosen Suche nach geistiger Spannung, der er bis in die entlegensten Gebiete nachging. Émile Cioran, den Taubes regelmäßig bei seinen Parisreisen besuchte, hat diesen Zug an ihm richtig erfaßt. Ihn habe der »Abscheu vor jeder öden Wissenschaft« beherrscht. Cioran erzählt, daß jeder Besuch seines Freundes in Paris zu langen Monologen über »unsagbar lebenssprühende Sujets« Anlaß gegeben habe. Und solche lebenssprühenden Sujets konnten die entlegensten Themen hergeben, berichtet Cioran, auch Mesopotamien oder andere meist religionsgeschichtliche Gegenstände. Taubes wußte, wie er seinen Zuhörer fesseln konnte, so daß dieser das Gefühl hatte, als wäre er schon immer von Mesopotamien fasziniert gewesen.
Tatsächlich aber entstand diese Faszination des Entlegenen durch Bezüge zur Gegenwart, die Taubes ihm abzugewinnen wußte. Wie Cioran versichert, fand er in ihren Gesprächen immer Mittel und Wege, »um einen Streifzug durch die Gegenwart zu machen«. Solche Gegenwartsbedeutung war geradezu die Voraussetzung des Studiums des Entlegenen. Auf diese Weise, bemerkt Cioran, habe Taubes ihm erspart, »einen Haufen neu erschienener Bücher zu lesen«.
Der allgemeine Gegenwartsbezug war freilich nur vorgeschoben. Denn wirklich interessant wurden die Dinge für Taubes erst dann, wenn sie einen Bezug zum Judentum hatten. Dies war es, was Jacob Taubes interessierte: alles aufs Judentum zu beziehen. Er pflegte sich als »Erzjuden« zu bezeichnen, weil das Judentum für ihn alles war. Das ließ er freilich nicht immer merken. Denn alles hatte für ihn eine exoterische und eine esoterische Seite. Diese war das Judentum. Die Philosophie war für ihn deswegen auch nur von begrenztem Interesse. Denn wo sie ihn fesselte, sprach sie Dinge aus, die im Judentum schon auf andere Weise gewußt waren.
Um die besondere Fähigkeit von Jacob Taubes, eine Fülle von wichtigen Büchern ausfindig zu machen, und um seine unerschöpfliche Gabe, ihre Erträge weiterzugeben, rankte sich bald so etwas wie eine Legende: Taubes lese, so hieß es, die Bücher nicht, sondern eigne sich durch Handauflegen an, was ihm an ihnen wichtig sei. Gewiß hat er dies getan, aber nicht, weil er diese Bücher nicht las, sondern weil er sie tatsächlich las – auf seine Weise. Seine Art, die für ihn wichtigen Bücher zu lesen, bestand darin, den einen Satz oder das eine Wort zu finden, in dem das Wesentliche eines Buches kondensiert war.
Tatsächlich fragte er gelegentlich nach diesem Schlüsselsatz, nach dem Schlüsselwort, in dem alles liegen sollte. Er ließ die Bücher auf sich wirken, als wollte er sie selber schreiben und maß sie an dem Buch, das sie hätten sein können. Deshalb konnte er auch selbst keine Bücher schreiben. Zu leicht war abzusehen, daß alles, was er schrieb, seiner Art der »Lektüre« nicht standhalten würde. Nach seiner wie in Trance von einem Hochbegabten verfaßten Dissertation blieb es bei Aufsätzen, bei Gelegenheitsarbeiten, bei denen man sich manchmal fragt, ob sie alle von demselben Autor verfaßt sind.
Sein authentisches Ausdrucksmittel war das Gespräch und jenseits dessen allenfalls der Brief. In den erhitzten Jahren der Studentenbewegung schrieb Taubes ständig Briefe wie Eingaben – an den Wissenschaftssenator, an Mitarbeiter in dessen Behörde, an den »Tagesspiegel« und an die »Frankfurter Rundschau« – man konnte den Eindruck gewinnen, daß kein Tag ohne einen Leserbrief in Sachen Universitätsreform vorübergehen sollte. Er arbeitete an diesen Briefen wie an Depeschen, und viele ungeöffnete Briefe häuften sich auf seinem Schreibtisch. »Machen Sie den Brief mal auf und sagen Sie mir, was drinsteht.« Wenn es nicht das erwartete Unangenehme war, durfte er wieder auf den Haufen unerledigter Post zurückgelegt werden.
Aber es waren nicht nur diese Briefe, die ihn beschäftigten. Mit einem Brief hatte Gershom Scholem 1951 das Band zwischen Lehrer und Schüler zerschnitten, ihn wegen eines Vertrauensbruchs für immer aus seiner Umgebung verbannt und ihm damit für viele Jahre den Aufenthalt in Jerusalem verwehrt. Dieser Brief hat den intellektuellen Weg von Jacob Taubes bis zum Ende bestimmt. Man kann den Eindruck gewinnen, daß alles, was er geistig unternahm, der Entwurf einer Antwort an Scholem war.
Wenn er sich zuletzt mit Paulus auseinandersetzte, sich selbst als »Pauliner« bekannte, so lag auch darin noch eine Antwort an Scholem. Denn über Paulus, den Scholem abstoßend fand, war er mit ihm schon in der Zeit ihrer Freundschaft uneins gewesen. Und natürlich standen seine Thesen zum Messianismus ganz im Zeichen des Gegensatzes zu Scholem. Er wollte Scholem auf dessen eigenem Gebiet bezwingen, indem er beispielsweise die Karte der Innerlichkeit spielte, die Scholem theologisch mit einem Bann belegt hatte. Und sogar in Scholems Freundschaft mit Benjamin drängte Taubes sich ein, sobald sich die erste Gelegenheit dazu bot. Wiederum war es ein Brief, der es erlaubte, die Karten neu zu mischen.
Als Taubes einen Brief Walter Benjamins an Carl Schmitt in die Hände bekam, den Benjamin im Dezember 1930 an Carl Schmitt geschrieben hatte, bemerkte er sofort den Sprengstoff, den er enthielt – nicht zuletzt deswegen, weil er in der soeben erschienenen zweibändigen Ausgabe der Briefe Benjamins nicht enthalten war. Die Sache mit Benjamins Brief an Carl Schmitt ist vertrackt. In dem Brief vom 9. Dezember 1930 schreibt Benjamin, daß sein Buch »Ursprung des deutschen Trauerspiels« Carl Schmitt vom Verlag zugehen werde. Neben dieser Ankündigung spricht er seine Freude darüber aus, daß er ihm das Buch »auf Veranlassung von Herrn Albert Salomon« zusenden dürfe, offenbar einem gemeinsamen Bekannten.
Es kann so aussehen, als ginge es nur darum, Carl Schmitts Aufmerksamkeit auf das Buch zu lenken, das der Postbote in den nächsten Tagen bringen wird. Dem scheint auch Benjamins Hinweis zu dienen, wieviel sein Buch Carl Schmitts »Darstellung der Lehre von der Souveränität im 17. Jahrhundert« verdanke.
Benjamin weist auch auf seine Zitate aus Carl Schmitts 1922 erschienenem Traktat »Politische Theologie« im ersten Kapitel des Trauerspielbuches hin, die in den Anmerkungen nachgewiesen sind. In der ersten Neuausgabe des Buches fehlten diese Hinweise auf Carl Schmitt, für Taubes kein technisches Versehen, sondern ein weiterer Beweis für die Absicht, die geistige Verbindung zwischen Carl Schmitt und Walter Benjamin zu verschweigen.
Die erste der drei Anmerkungen verweist pauschal auf die erste Seite der »Politischen Theologie«, die mit einem Donnerschlag beginnt: »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.« Allein diese Definition, heißt es dort weiter, könne dem Begriff der Souveränität gerecht werden. Dieser sei ein »Grenzbegriff«, ein »Begriff der äußersten Sphäre«. Seine Definition könne nicht an den Normalfall, sondern nur an einen Grenzfall anknüpfen. Der Begriff des Ausnahmezustandes, fährt Carl Schmitt fort, sei ein allgemeiner Begriff der Staatslehre, »nicht irgendeine Notverordnung oder jeder Belagerungszustand«. Durch diesen allgemeinen Charakter eigne sich der Begriff des Ausnahmezustandes »im eminenten Sinne für die juristische Definition der Souveränität«. Und dann folgt der zentrale Satz: »Die Entscheidung über die Ausnahme ist nämlich im eminenten Sinne Entscheidung.«
In Benjamins Trauerspielbuch kommt von diesen rechtslogischen Erwägungen nichts vor. Im weiteren macht er lediglich, mit Hinweis auf Carl Schmitt, eine allgemeine Bemerkung über den modernen Souveränitätsbegriff, der auf eine »höchste, fürstliche Exekutivgewalt« hinauslaufe, und setzt davon eine barocke Auffassung der Souveränität ab, wonach deren Begriff sich aus einer Diskussion des Ausnahmezustandes entwickelt und es zur wichtigsten Funktion des Fürsten macht, den Ausnahmezustand auszuschließen.
Diese Darstellung läuft freilich auf eine Entschärfung der Schmittschen Definition hinaus, indem dem Fürsten die Funktion der Vermeidung des Ausnahmezustandes zugeschrieben wird, so daß es zur Entscheidung gar nicht kommt. An die Stelle von Ausnahme und Entscheidung treten Ausnahme und Diskussion. Die Bezugnahme auf »Politische Theologie« ist unnötig, das Spezifische der These Carl Schmitts über Souveränität wird unterschlagen. Auch die beiden folgenden Schmittzitate übernehmen geistesgeschichtliche Aussagen Carl Schmitts, die sich dem Thema des barocken Trauerspiels gut einfügen.
Dagegen beginnt der erste Teil des Trauerspielbuches mit einer Feststellung, die an Carl Schmitt denken läßt, wenn von der »notwendigen Richtung aufs Extrem« die Rede ist. Zweifellos ist dies dem Geist von Schmitts Erörterung des Souveränitätsbegriffs näher als die ausdrücklichen Bezugnahmen Benjamins auf die »Politische Theologie« im weiteren Verlauf der Abhandlung.
Hugo Ball hatte in seinem bedeutenden, 1924 / 25 in der Zeitschrift »Hochland« erschienenen Aufsatz »Carl Schmitts Politische Theologie«, einem eindringlichen intellektuellen Porträt Carl Schmitts, dessen Erkenntnismethode durch Extreme in den Vordergrund gerückt. Er hatte dies mit Sätzen von Chesterton erläutert: »Ein Praktiker, das ist ein Mensch, eingewohnt in die Alltagspraxis, in die Art, wie die Dinge gemeinhin funktionieren. Es ist unrecht, zu geigen, während Rom brennt, aber es ist ganz in der Ordnung, die Theorie der Hydraulik zu studieren, während Rom brennt.« Ball hatte dieses eindrucksvolle Bild auf Carl Schmitt angewandt: Er gehöre zu denen, die die Theorie der Hydraulik studieren; er sei »mit seltener Überzeugung Ideologe – ja man kann sagen, daß er diesem Wort, das unter Deutschen seit Bismarck eine üble Bedeutung hat, wieder zu Ansehen verhelfen wird«. Die letzte Bemerkung war eine Prognose.
Die Methode der Extreme war in den zwanziger Jahren, bei Ernst Bloch und anderen, ein Denken gegen den Normalzustand und gehörte zum utopischen Denken der Zeit. Wo der Normalzustand sich radikalisiert und in Extreme auflöst, wird die Erkenntnis durchs Extrem zum Denken für den Normalzustand. Diese Methode der Erkenntnis durch Extreme war es offenbar, die Benjamin zu Carl Schmitt hinzog und an die sich der wichtigste Satz seines Briefes anschloß: »Vielleicht darf ich Ihnen darüber hinausgehend sagen, daß ich auch Ihren späteren Werken, vor allem der ›Diktatur‹ eine Bestätigung meiner kunstphilosophischen Forschungsweisen durch Ihre staatsphilosophischen entnommen habe.« Über die These von der »notwendigen Richtung aufs Extrem« als Norm für die Begriffsbildung womöglich noch hinausgehend, ist hier von einer Konvergenz von Benjamins kunstphilosophischen und Schmitts staatsphilosophischen Forschungsweisen die Rede.
Merkwürdig ist, daß der versierte Bibliograph Benjamin von Carl Schmitts Buch »Die Diktatur« als einem von dessen »späteren Werken« spricht. Zwar war dieses Buch 1928 in zweiter Auflage erschienen (erweitert um einen Anhang über den Paragraphen 48 der Weimarer Verfassung), aber die erste Auflage von 1921 war älter als der Traktat »Politische Theologie«. Benjamins Unterscheidung von späteren und früheren Werken beruhte also auf einem Irrtum. Benjamins Hinweis auf Carl Schmitts Buch über die Diktatur ist allerdings viel brisanter, wenn man ihn, und sei es durch eine Fehldatierung, an die aktuelle Entwicklung heranzieht. Tatsächlich hat Benjamins Betonung der »späteren Werke« wesentlich dazu beigetragen, seinem Brief eine hochdramatische Wirkungsgeschichte zu geben, zu deren Voraussetzungen die Nähe zum Jahr 1933 gehört, das Carl Schmitt dann auf der Seite der Nationalsozialisten sieht, während Benjamin nach Paris emigriert.
Aus Benjamins Briefen wissen wir mittlerweile, daß er Carl Schmitts »Politische Theologie« bald nach ihrem Erscheinen im Jahr 1922 kannte und damals offenbar mit sich herumzutragen pflegte, denn er weist einen Freund darauf hin, daß er das Buch bei ihm vergessen habe. In einem Brief vom 23. März 1923 an Richard Weißbach heißt es: »Bei meinem letzten Besuch habe ich die ›Politische Theologie‹ von Schmitt bei Ihnen vergessen. Wollen Sie bitte so freundlich sein, sie mir zu schicken. Zu meiner gegenwärtigen Trauerspielarbeit ist sie mir wichtig.« Man kann also annehmen, daß Carl Schmitts »Politische Theologie« Benjamin während der ganzen Zeit der Arbeit an seinem Trauerspielbuch begleitet hat.
Ohne den aus seiner Sicht wohl nicht zu verkennenden reaktionären Charakter von Carl Schmitts »Politischer Theologie« und ohne auch die nicht weniger reaktionären eigenen Intentionen Benjamins zu verschleiern, ist gleichwohl die Feststellung zutreffend, daß die Beziehung Benjamin – Schmitt erst ex post, im Rückblick auf das Jahr 1933 und auf Schmitts nationalsozialistisches Engagement, jene Brisanz gewinnt, die für die Unterdrückung des Briefes und für seine spektakuläre Bekanntmachung durch Jacob Taubes ausschlaggebend wurde. Für die Philologie dieses Briefes hat sich Jacob Taubes nie interessiert. Denn dann hätte ihn auch Carl Schmitts Antwort an Benjamin interessieren müssen, die in einem Exkurs der kleinen Schrift »Hamlet oder Hekuba?« enthalten ist.
Bevor sich noch die Benjaminrenaissance abzuzeichnen begann, hat Carl Schmitt mit einer guten Witterung für das Kommende Benjamins Brief an ihn 1956 in seiner kleinen Schrift »Hamlet oder Hekuba« in einem Exkurs erwähnt, unter der Überschrift: »Über den barbarischen Charakter des Shakespeareschen Dramas; zu Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Ernst Rowohlt Verlag, Berlin 1928.« Das war offenbar die Reaktion auf die seinerzeit ohne Antwort gebliebene Zusendung des Buches. Noch an anderer Stelle in demselben schmalen Buch wird Walter Benjamin in einer Anmerkung genannt, die, wie Schmitt schreibt, auf ein großes Thema aufmerksam mache: auf die »politischen Symbole und Allegorien in Shakespeares Dramen«.
Carl Schmitt erklärt, daß Benjamin das »geistesgeschichtliche Problem ›Allegorie und Trauerspiel‹« in seinem Trauerspielbuch an zwei Stellen behandelt habe und daß es jetzt die Aufgabe sei, die Thesen und das Material der englischen Shakespeare-Forscherin L. Winstanley, an die Carl Schmitt sich anschloß, »mit den Gedanken von Walter Benjamin zu verbinden und das Problem der Allegorie zu vertiefen«. Er fügte hinzu: »Diese Aufgabe kann ich hier nur erwähnen. Ich würde mir ihre Behandlung vorbehalten, wenn nicht Gründe, die in meiner Person liegen, mich davon abhielten, noch Pläne zu machen und Veröffentlichungen in Aussicht zu stellen.« Damit war die Beziehung zum Jahr 1933 und seinen Folgen hergestellt.
Auch der erwähnte Exkurs konnte nicht den Anspruch erheben, die erwünschte Auseinandersetzung mit Benjamins Thesen zu Allegorie und Trauerspiel nachzuholen. Er begann mit einer Erörterung der Frage, ob Shakespeares Drama christlich sei, wie Benjamin meinte, oder nicht mehr christlich, wie Schmitt behauptete. Diese Frage verband er dann mit der Feststellung, daß Benjamin – auch in seinen Bezugnahmen auf die »Politische Theologie« – die »Verschiedenheit der englisch-insularen mit der europäisch-kontinentalen Gesamtlage und damit auch die Verschiedenheit des englischen Dramas gegenüber dem barocken Trauerspiel des deutschen 17. Jahrhunderts zu gering einschätzt«. Diese nachdrückliche Betonung des Unterschieds der insularen und der kontinentalen geistigen Situation schließt unmittelbar an eine Erwähnung von Benjamins Bezugnahme auf Schmitts Definition der Souveränität an. An dieser Stelle erwähnt Carl Schmitt den Brief Benjamins: »Er hat mir 1930 seinen Dank in einem persönlichen Brief ausgesprochen.«
Der Hinweis auf Benjamins Brief ist also eingeflochten in die Erörterung der englischen und der kontinentalen geistigen Situation. Shakespeares Drama gehört für Schmitt in die englische Revolution von 1588 bis 1688, die mit der Vertreibung der Stuarts endet und der auf dem Kontinent die Entwicklung des souveränen Staates gegenüberstand. Sie war die politische Antwort auf den von Theologen geschürten konfessionellen Bürgerkrieg. Hier kommt Schmitt auf das in der Überschrift des Exkurses genannte Thema zu sprechen: »In dieser Situation nimmt das Wort ›politisch‹ den polemischen und infolgedessen überaus konkreten Sinn eines Gegensatzes gegen das Wort ›barbarisch‹ an.« In der modernen Begrifflichkeit von Hans Freyer erläutert Schmitt dies dadurch, daß dabei ein sekundäres System elementare und primäre Ordnungen, »die schlecht funktionieren«, verdränge: »Politik, Polizei und Politesse werden auf diese Weise zu einem merkwürdigen Dreigespann des modernen Fortschritts gegenüber kirchlichem Fanatismus und feudaler Anarchie, kurz gegenüber mittelalterlicher Barbarei.«
Aus der Sicht dieser neuen Ordnung, in der das klassische Theater von Corneille und Racine entstanden sei, habe Voltaire in Shakespeare einen »betrunkenen Wilden« sehen können, während sich der deutsche Sturm und Drang vorbehaltlos auf Shakespeare berief. Dies sei möglich gewesen, weil die Zustände im damaligen Deutschland zum Teil noch vorstaatliche waren, »wenn auch – dank der Auswirkungen der Staatlichkeit – nicht mehr so barbarisch wie im England der Tudor-Zeit«, wo man in vielen Dingen auf dem Weg zum Staat gewesen sei. Gleichzeitig aber hatte sich in den hundert Jahren die Insel England vom Kontinent abgesetzt und den Schritt zu einer »maritimen Existenz« getan. So sei England das »Ursprungsland der industriellen Revolution« geworden, »ohne durch den Engpaß der kontinentalen Staatlichkeit hindurchzugehen«. Shakespeare aber gehöre in Verhältnisse, die, gemessen am zivilisatorischen Fortschritt des Kontinents, noch als barbarisch im Sinne von vor-staatlich, gelten müßten. Es war das Schicksal Jakobs I. und der Stuarts, daß sie weder den kontinentalen Staat noch den Übergang Englands zur maritimen Existenz, der sich in ihrer Regierungszeit vollzog, begriffen.
Inwiefern waren diese Bemerkungen zum Gegensatz von »politisch« und »barbarisch« eine Antwort auf Benjamins Trauerspielbuch, das Carl Schmitt in einem Atemzug damit nennt? Er wollte, wie er ausdrücklich sagt, Benjamins Fehleinschätzung der Christlichkeit des Shakespeareschen Dramas und seine im Trauerspielbuch formulierte Auffassung vom souveränen Staat korrigieren. Aber die Schicksale beider Autoren legen es nahe, den Gegensatz von »barbarisch« und »politisch« auch in einem aktuellen Sinne zu bedenken. Carl Schmitts Erklärungen zu diesem Gegensatz können als ein Versuch angesehen werden, die Barbarei am Ende der Epoche der Staatlichkeit auf die Barbarei an ihrem Anfang zu beziehen und das Ende der Staatlichkeit durch den Einbruch der Barbarei in die Politik kenntlich zu machen – als ein unausweichliches historisches Geschick.
Dieses Beziehungsgeflecht hat Jacob Taubes, trotz seines intensiven Interesses an dem Gespräch zwischen Benjamin und Schmitt, nicht aufzulösen versucht. Für ihn war die Tatsache des brieflichen Kontakts allein schon ein Schlüssel zur deutsch-jüdischen Geistesgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, kein Unfall und auch kein Mißverständnis. Als Schlüsseldokument spielt dieser Brief eine entscheidende Rolle nicht nur in seinem bei Merve erschienenen Bändchen »Carl Schmitt – Gegenstrebige Fügung«, sondern auch noch in den spätesten Äußerungen von Jacob Taubes, in seinen Paulusvorlesungen.
Dort zeigt sich in einem Exkurs, in welchem Maße es auch bei der Auseinandersetzung mit Paulus um ein Verständnis der Gegenwart geht: um die Voraussetzungen des ersten Weltkriegs, um die Zwischenkriegszeit, um die Situation von 1933. Die Fragestellung, die Jacob Taubes den Zuhörern seiner Vorlesung zumutet, wird mit einem Schlag deutlich, wenn man, wie er es tut, die Formel der »geistigen Situation« auf das Jahr 1933 anwendet. Gab es eine »geistige Situation von 1933«? Diese Frage hat Taubes im Gespräch immer wieder ernsthaft aufgeworfen und erklärt, daß diejenigen, die in dem Geschehen keinen »Exzeß« sehen wollten, sich der Möglichkeit zu verstehen von vornherein beraubt hätten.
Mit Blick auf dieses Datum war für Taubes die Tatsache, daß es Benjamins Brief an Carl Schmitt gab, wichtiger als was darin stand. Die entscheidende Aussage lag für ihn im Datum 1930, also unmittelbar an der Schwelle jener Ereignisse, die den Briefschreiber wie den Adressaten eindeutig in einer Konstellation der Feindschaft verorten würden. Vor allem aber war es eine Begegnung außerhalb jenes kulturprotestantischen Konsenses, von dem Taubes wiederholt spricht und der ihm zufolge die geistige Situation der zwanziger Jahre noch weitgehend bestimmt hatte.
Das Treffen von Heidegger und Cassirer in Davos 1929 war noch ein Symbol dieses Konsenses gewesen, auch wenn hier die ersten Anzeichen des Bruches sichtbar wurden: Heidegger, so jedenfalls weiß Taubes zu berichten, verweigerte Cassirer den Handschlag, und als ein weiteres Symptom des brüchig gewordenen Konsenses schildert er die abendlichen Veranstaltungen der Schülergeneration, bei denen der junge Emanuel Levinas auf der Bühne auf und ab gegangen sei und, wie bei einer dadaistischen Session, immer wieder die Worte »Humboldt – Kultur« ausgestoßen habe.
Mit der ihm eigenen Vorliebe für elementare Feststellungen erklärte Taubes: »Die deutsche Kultur der Weimarer Republik und der wilhelminischen Zeit war protestantisch und ein wenig jüdisch gefärbt. Das ist ein factum brutum. Die Universitäten waren protestantisch.« Diese anscheinende Selbstverständlichkeit erhielt ihr für Taubes unentbehrliches Spannungsmoment, wenn er in geradezu brutaler Direktheit nach dem »Gemeinsamen zwischen Carl Schmitt, Heidegger und Hitler« fragte und die Antwort in der saloppen Feststellung gab: »Alle drei sind abgestandene Katholiken.«
Carl Schmitt wie Heidegger hätten sich gegen dieses kulturprotestantische Selbstverständnis einen Platz in der Universität erobert, und dies sei ihnen gelungen in einem Gestus der Zerstörung und Vernichtung des protestantisch-jüdischen liberalen Konsenses, »der etwa durch den Namen Ernst Cassirer einen eleganten, parfümierten Vertreter gehabt« habe. Jetzt bekommt das Gemurmel von Emanuel Levinas’ »Humboldt – Kultur« einen drohenden Unterton. So wird die Totenglocke einer etablierten Kultur geläutet. In diesem Endspiel wies Taubes dem »legitimen katholischen Antisemiten« Carl Schmitt die Rolle des »Aufstrebers der geächteten Minderheit der Katholiken« zu.
Es ist nicht zu übersehen, daß diese Situation an der Schwelle zu 1933 Rechtfertigungen für Taubes’ Briefwechsel mit Carl Schmitt und seinen Besuch in Plettenberg enthält. Seine Formel lautete: »Ich will verstehen, was da los ist.« Das verlangte zu verstehen, wie es dazu kam, daß die bedeutendsten Köpfe der Zeit, Martin Heidegger und Carl Schmitt, auf die Seite des Nationalsozialismus drängten – übrigens beide, ohne daß sie ein ernstzunehmendes geistiges Echo bei den neuen Verbündeten fanden. Vielleicht als einziger hat Taubes bemerkt, daß die Voraussetzungen für ein Verständnis dieses ungeheuren Vorgangs immer noch fehlen. Er erklärte dies damit, daß eine Philosophiegeschichte der ersten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts fehlte, die über die Verflechtung der späteren Akteure untereinander Aufschluß zu geben vermochte.
Ein entscheidendes Element dieser Philosophie- und Universitätsgeschichte hat Taubes zu recht ins Licht gerückt: die Marginalität der katholischen Akademiker, die in den liberalen Konsens der Zeit nicht aufgenommen waren und in ihn auch nicht mehr eintreten wollten, sich allenfalls auf eigene Faust mit dem Protestantismus auseinandersetzten, beispielhaft Heidegger, der das Studium von Luther und Calvin auf eigene Rechnung und als antiliberale Strategie unternimmt, aber auch Carl Schmitt, zu dessen prägendsten geistigen Erfahrungen, nach Ausweis seiner Tagebücher, Kierkegaard gehörte, dessen Theologie der Entscheidung seinen Dezisionismus beeinflussen wird.
Daß auch der antiliberale Impuls von Carl Schmitt mit der Verabschiedung des kulturprotestantischen Konsenses einhergeht, konnte Taubes nur vermuten. Inzwischen sind Aufzeichnungen unter dem Titel »Berlin 1907« aufgetaucht, die ursprünglich wohl für »Ex captivitate salus« bestimmt waren. »Warum bin ich nach Berlin gegangen?« fragt Carl Schmitt in einem 1947 geschriebenen Rückblick auf das Jahr 1907. Er antwortet: »Ich rannte 1907, von einem humanistischen Gymnasium in der Provinz gleich nach Berlin, wie ein hungriges Füllen auf die Weide.« Etwas später sagt er etwas Erstaunliches: »In Berlin sah ich eine neue Welt.« Es ist der Satz, mit dem Rousseau seinen Aufbruch in die Welt der Literaten beginnt. Er sah eine neue Welt, und unversehens fand er sich als Autor wieder in einer Welt, die sich als das genaue Gegenteil seiner Vision erweisen sollte.
Carl Schmitt berichtet über seinen Aufbruch in die Welt der Universität: »Ehrfürchtig betrat ich die Universität; ich dachte, sie wäre der Tempel einer höheren Geistigkeit. Aber der Kult, den ich dort sah, war ganz wirr und konnte mich nicht zur Teilnahme bewegen. Seine Priester waren auf eigentümliche Weise Ich-bezogen. Sie waren Ich-verpanzert und Ich-entfesselt zugleich. In dem inneren Widerspruch ihrer verpanzerten Entfesselung verwandelte sich der Boden, auf dem sie standen und wurde zu einer Bühne, auf der sie sich produzierten. Das ganze Zeitalter war histrionenhaft, und der Tempel erwies sich dementsprechend als ein Bühnenhaus … Alles wurde im Rahmen und auf dem Boden dieses Berlin zu einer Schauvorstellung. Die ethisch vibrierende Rhetorik beschleunigte nur den Prozeß der Verbühnung. Der einzige Raum, den diese Geistigkeit kannte, war der Bühnenraum … Die Kanzel wurde zum Katheder für philosophische und moralische Vorlesungen. Dann wandelte sich das Katheder zur Bühne, indem die Bühne zur moralischen Anstalt und die moralische Anstalt zur Bühne wurden. Der Wandel des Podiums wurde in der Physiognomie der Zeit sichtbar. In dem Gesicht des geistigen Typus dieser Jahre trafen drei bürgerliche Gesichter zusammen, das eines Predigers, eines Professors und eines Schauspielers. Der Generalnenner, die Generallinie, die Synthese kam durch ästhetische Harmonisierung zustande. Daraus ergab sich eine Gesamttendenz zur Goethe-Maske. Die Goethe-Maske war das tiefste Unheil der Zeit. Mit ihr wurde Tausenden von begeisterungsfähigen Jünglingen das Scheinbild einer potestas spiritualis in die Seele gelegt. Nur weil die Erinnerung an eine echte potestas spiritualis in mir noch nicht verloren gegangen war, blieb ich davor bewahrt, dem Scheinbild zu verfallen.«
Die geistige Sphäre, so meint Carl Schmitt, sei dem histrionischen Habitus der Epoche unterlegen, und exemplarisch dafür seien die Professoren Josef Kohler und Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf gewesen, mit ihrer Goethe-Bildung und der Goethe-Maske. Um seine persönliche Erfahrung in diesem Milieu zu benennen, bedient sich Carl Schmitt des Wortes »Repulsion«. Wodurch wurde er zurückgestoßen, abgestoßen? Durch einen pantheistischen Optimismus, »ein stolzes Bewußtsein des ungeheuren Fortschritts« sowie eine »staunende Begeisterung über den wachsenden Wohlstand und den ebenso wachsenden wissenschaftlichen Betrieb«. Man sah sich auf der Bühne, sie war der einzige Raum, den diese Art Gewißheit kannte – als bestätigte sich hier die ursprüngliche Raumbezogenheit des Geistes noch einmal in einer parodistischen Form. Seine Begegnung mit dieser Welt, erläutert Carl Schmitt, sei eine Erfahrung in dem »Bereich jenseits der Freundschaftslinie« gewesen.
Merkwürdig, daß Carl Schmitt in diesem autobiographischen Zusammenhang den Begriff der »Freundschaftslinie« verwendet. Offenbar konnte er seine Nichtzugehörigkeit zu dieser Welt nicht drastischer ausdrücken. Wollte er aber auch andeuten, daß er selbst eine Art Freibeuter war? Subjektiv hatte die Repulsion die Bedeutung, daß keiner von diesen Professoren den jungen Studenten »innerlich gewonnen« hatte. Das war damals das Entscheidende: daß er nicht verführt wurde mitzumachen bei dieser »norddeutsch-protestantischen, ethizistischen Ich-Verpanzerung«. Er erklärt diese Unverführbarkeit durch ein paar einfache und einsichtige Sätze: »Ich war ein obskurer junger Mann bescheidener Herkunft.« Auch hier kommt noch einmal die Rousseauparallele zum Vorschein, die »obscurité«, die am Anfang des intellektuellen Weges und an seinem Ende steht. »Weder die herrschende Schicht«, fährt er fort, »noch eine oppositionelle Richtung hatte mich erfaßt. Ich schloß mich keiner Verbindung, keiner Partei und keinem Kreise an und wurde auch von niemand umworben … Armut und Bescheidenheit waren die Schutzengel, die mich im Dunkel hielten.«
Offenbar waren diese Schutzengel ein Vierteljahrhundert später nicht da, als der Jurist aus der Obskurität heraustrat wie Rousseau. Bei Carl Schmitt spielte für seinen Abstand zur »neuen Welt« auch der Kulturkampf eine Rolle, denn er erklärt, der Konflikt sei scharf genug gewesen, »um einen jungen Katholiken gegenüber der herrschenden Schicht zu distanzieren«. In seiner Jugend habe es »soviel religiöse Substanz und Bindung« gegeben, »daß die verschiedenen Erscheinungsformen des Ich-Glaubens wie fremde Masken an mir vorüberzogen«. Stattdessen stellte ein »Gefühl der Traurigkeit« sich ein.
Eine eindringlichere Bestätigung für eine Geistesgeschichte der konfessionellen Spannungen am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts und für den Zerfall des liberalen Konsenses, der wesentlich protestantisch und, wie Taubes hinzufügt, zu einem gewissen Teil auch jüdisch geprägt war – »der Kulturprotestantismus war eine gemeinsame Firma von Juden und Protestanten« – dürfte sich kaum finden lassen. Die noch heute bedeutsamen Gestalten der Geistesgeschichte der zwanziger Jahre, wie Heidegger, Schmitt und Benjamin, standen denn auch außerhalb dieses Konsenses.
Was Benjamin betrifft, so hat schon er selbst eine andere, mehr oder weniger irreführende Fährte gelegt, als er mit dem Marxismus zu liebäugeln begann. Als die studentische Linke Benjamin seit der Mitte der sechziger Jahre als Linken und zwar, wie man damals gerne sagte, als einen undogmatischen Linken entdeckte, war auch Taubes der Selbstdeutung Benjamins und ihrer Übernahme durch die Linke zunächst auf den Leim gegangen. Gershom Scholem, der dem Marxismus seines Freundes immer mißtraut hatte, versuchte vergeblich, Benjamins Judentum zumindest als eine beständige Frage dagegen auszuspielen – ohne Erfolg.
Erst die Konstellation Benjamin – Schmitt hat durch die bloße Tatsache ihres Bestehens einen Wandel des Benjaminbildes herbeigeführt. Denn sie führt in das Zentrum jener von Jacob Taubes angemahnten Geistesgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, für die das Jahr 1933 zwar ein nicht weniger brutaler Einschnitt ist, gleichwohl aber in der Kontinuität der geistigen Konstellationen der zwanziger Jahre steht. Die Forderung einer solchen Geistesgeschichte ist ein bedeutendes Vermächtnis von Jacob Taubes, der seine Vorlesungen über Paulus nutzte, sie einzuklagen. Wie er von der »Hemmungslosigkeit« Carl Schmitts gesprochen hat, so von Heidegger als »Taktiker, Stratege ersten Grades«. Beides, Hemmungslosigkeit und strategisches Genie waren ihm selbst gegeben. Das eine setzt bei ihm das andere voraus: Er hat die nötige Hemmungslosigkeit gehabt, um seine strategische Begabung zum Zuge kommen zu lassen.
Dazu gehörte auch das Geschick, mit dem er die geistige Situation der Nachkriegszeit an seine Diagnose des Weimarer Jahrzehnts anschloß. »Es scheint«, schreibt er im zweiten Teil seiner Paulusvorlesung, »daß um 1950 / 60 herum die Neuzeit in Bedrängnis geriet. Man sah das Ende der Neuzeit, Beginn des Mittelalters, Guardini, Sedlmayr, Verlust der Mitte, Sie können die Karten mischen, wie Sie wollen.« Wiederum sind die entscheidenden Namen katholische, die man seinerzeit glaubte vernachlässigen zu können, weil sie nicht dem Glauben an die Moderne huldigten.
In der Mitte der fünfziger Jahre vollzieht sich die Wiederentdeckung von Walter Benjamin zunächst in einem luftleeren Raum, als eines Einzelgängers, der von den geistigen Spannungen der zwanziger Jahre ganz und gar unberührt geblieben zu sein schien. Der Benjamin der Ausgabe der Schriften von 1955 ist die Wiederauferstehung eines Übersehenen und Vergessenen. Sogar sein Tod durch die Verfolgung der deutschen Schergen wird von Adorno erwähnt wie das irdische Schicksal eines Heiligen.
Um dieses Bild nicht zu zerstören, mußte der Name Carl Schmitts aus Benjamins Vita und aus seinem Werk gestrichen werden. Keinesfalls durfte die geistige Situation vor 1933 wiederbelebt werden. Dieses Bild ließ sich jedoch nicht aufrechterhalten, nachdem die Studentenbewegung eine totale Politisierung Benjamins vorgenommen hatte. Jacob Taubes, der an diesen Vorgängen engagierten Anteil genommen hatte, war durch Benjamins Brief an Carl Schmitt ein strategisches Licht aufgegangen: Mit seiner Hilfe konnte er Benjamin von seinem angeblichen Marxismus befreien und ihn in das vieldeutige Geflecht der Positionen der zwanziger Jahre wieder einführen.
Auch nach der Seite Carl Schmitts war dies ein folgenreicher Schachzug. Denn in gewisser Weise setzte die Renaissance seines Werkes in Deutschland erst richtig ein, nachdem Benjamins Brief den Bann gebrochen hatte. Carl Schmitt selbst, ein gewiefter Werk- und Nachlebensstratege, hat diese Schlüsselrolle Benjamins für ihn frühzeitig geahnt, als er jenen Brief in »Hamlet oder Hekuba?« erwähnte, auf Benjamin einging und den Brief schließlich Hans Dietrich Sander zuspielte, durch den Jacob Taubes zuerst Kenntnis von ihm erhielt.
Eine fast fünfundzwanzig Jahre währende Beziehung zu einem Menschen kann nicht auf ein Erlebnis gegründet sein. Aber es sind doch einzelne Züge, die im Rückblick die Anziehungskraft, die er auf mich ausübte, erklären. Es war eine ungewöhnliche intellektuelle Mitteilsamkeit, die ihn auszeichnete. Er kannte mich kaum, da begann er schon, über die seiner Ansicht nach unumgänglichen Lektüren zu sprechen, über Leo Strauss, Kojève oder Leo Schestow, von deren Büchern er ausführlich zu erzählen begann. Später kamen andere Namen hinzu. Auch hier zeigte sich eine merkwürdige Unempfindlichkeit für Unterschiede.
Die Frage kam nie auf, wie das Buch des einen sich mit dem des anderen vertrug. Im Gegenteil, daß sie jeweils etwas völlig anderes anstrebten, sicherte ihnen einen Platz in dem intellektuellen Kosmos meines damaligen Lehrers. So war von Paul Goodman die Rede und von Lionel Trilling, von Gershom Scholem und Walter Benjamin und in Verbindung mit diesem später auch von Carl Schmitt. Und darüber hinaus: Wen kannte er nicht, wem war er nicht in New York, Paris oder Jerusalem begegnet? Er schien ein Sammler extremer Denker zu sein. Und jeder dieser Namen war ein Entreebillett für das Gespräch mit ihm.
Man brauchte sein Urteil nicht zu teilen, aber man mußte ein Gespür für den Grad der Spannung des Denkens haben. Eine der unumgänglichen Lektüren dieser Art war eine autobiographische Skizze, die Friedrich Overbeck hinterlassen hat. Taubes hatte das Vorwort zu einer Neuausgabe in einer neuen Reihe des Insel-Verlages geschrieben. Es war das Selbstporträt eines Theologen, der unwiderruflich seinen Glauben verloren hatte, ein in seiner Endgültigkeit und Nüchternheit erschreckendes Dokument. Es war ein prägnanter Ausdruck dessen, was Taubes unter »existentiell« verstand, das ohne religiöse Erfahrung nicht denkbar war.
Dies alles war so selbstverständlich, daß man gar nicht bemerkte, daß man einen Mann wie Jacob Taubes zuvor noch nie getroffen hatte. Ihn schien in alldem, fast obsessiv, die Frage umzutreiben, was echt und was unecht war – nicht was wahr war und was falsch. Wie immer die Antwort lautete, der Geist konnte keinesfalls echt sein, der ohne Erregtheit war. Das wäre nur Notenschrift, wie die philosophischen Systeme, die wir im Seminar studierten. Geist sollte beleben, sonst nichts, und so wurde es die Mission von Jacob Taubes, solche geistige Erregtheit zu übermitteln.
Für diese Lektion bin ich immer dankbar geblieben, für ihren Ernst nicht weniger als für die Komik, die in diesem Kult der Geistigkeit auch steckte. Waren diese Ergriffenheit und Erregtheit echt oder unecht? Jedenfalls konnte man darin ein jüdisches Erbe erkennen, nämlich die bis zur Kindlichkeit getriebene Anbetung der Geistesgabe.
Die hier versammelten Porträts sind in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« zuerst erschienen und wurden für diesen Band überarbeitet und erweitert.
2012
zu Klampen Verlag
Röse 21 · D-31832 Springe
[email protected] · www.zuklampen.de
Reihenentwurf: Martin Z. Schröder, Berlin
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2013
ISBN 9783866742154
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet abrufbar:http://dnb.d-nb.de





























