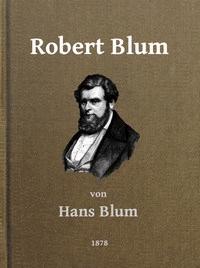0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Ähnliche
Novellen
von
Hans Arnold.
Hausgenossen. — Und doch!Der tolle Junker.Finderlohn. — Glück muß man haben!
Berlin.
Verlag von Gebrüder Paetel.
1881.
Alle Rechte vorbehalten.
HerrnTheodor Hermann Pantenius in dankbarster Verehrung
zugeeignet.
Hausgenossen.
In dem sonnenhellen, saubern Stübchen, das sie nun schon seit zwanzig Jahren bewohnte, saß Fräulein Sabine Krauthoff und strickte, während sie, mit einer Hornbrille auf der Nase, in einem abgegriffenen Buche las, welches sehr weit ab von ihr auf dem Tische lag.
Am Fenster blühten, trotz des Winters, Nelken und Balsaminen, und an den Wänden hingen allerlei Photographien in jeder Größe und Stellung. Aber nur Bilder von jungen Mädchen — Fräulein Sabine war Lehrerin gewesen. Mitten über dem Sofa prangte ein nach Fröbelscher Methode kunstvoll gefertigtes Flechtblatt unter Glas und Rahmen — das hatte die Lieblingsschülerin des Fräuleins, Käthchen Lang, geflochten, bei deren Eltern die alte Dame im Hause wohnte, und die inzwischen zu einem großen Mädchen herangewachsen war.
Aus dem Schüler- und Lehrerinnenverhältniß hatte sich mit der Zeit eine herzliche Freundschaft zwischen dem alten und dem jungen Mädchen gestaltet. Käthe, die sonst leicht ein wenig hochfahrend sein konnte, ja die in ihren Bekanntenkreisen sogar wegen ihrer kurzen Antworten und ihres gelegentlichen Uebermuthes als „sehr schnippisch“ bezeichnet wurde, legte in der stillen Stube von Fräulein Sabine all ihre kleinen Airs ab, und wurde immer wieder zum Kinde, das seine Thorheiten beichtete und sich liebevoll absolviren ließ.
Nie verging ein Tag, ohne daß Käthe die drei Treppen erstieg und an Fräulein Sabines Thür pochte — und so sehr hatte sich die letztere an diese täglichen Besuche gewöhnt, daß sie es recht schmerzlich empfand, als Käthe vor einiger Zeit zu einer verheiratheten Freundin nach auswärts ging und fast drei Wochen abwesend blieb.
Doch nun war das vorbei — gestern hatte die Frau Doktor Lang sich ihr Töchterchen von der Eisenbahn geholt, und Fräulein Sabine erwartete nun ungeduldig den Besuch des allgemeinen Lieblings. Ihr Harren sollte belohnt werden. Nicht lange, so klopfte es; auf das „herein“ kam ein junges Mädchen in die Thüre, schlank und groß gewachsen, mit einem übermüthigen Zug um den kleinen Mund, und einem sonnigen Lächeln in den dunkeln Augen. Sie begrüßte ihre alte Freundin mit der ihr eigenen ungestümen Herzlichkeit und setzte sich zu ihr — nicht auf den Stuhl, sondern aufs Fensterbrett.
„Und wie hast du dich bei Laura amüsirt?“ fragte die alte Dame, nachdem sie den „mitgebrachten“ warmen Shawl zur Genüge betrachtet und bewundert hatte.
„O sehr gut, Sabinchen, es war eine nette Zeit! aber“ —
„Nun, was „aber?“ fragte Fräulein Sabine erwartungsvoll, und schob die Brille auf die Stirn zurück.
„Ach — ich habe wieder einmal eine meiner gewöhnlichen Dummheiten gemacht! Soll ich sie dir erzählen? aber du mußt nicht schelten?“
„Das kann ich nicht so gewiß versprechen,“ sagte die Alte, indem sie ihren reizenden Liebling mit strahlenden Augen betrachtete, „indessen fang nur an — es läßt dir ja doch keine Ruhe, ehe du gebeichtet hast.“
Käthe rückte sich auf dem Fensterbrett zurecht, und pflückte eine von den rothen Nelken von Sabinens Blumenstock.
„Nun also,“ begann sie, „ich reiste allein von Laura zurück, und auf einer kleinen Station — Siegersdorff — wo der Zug hielt, sah ich zum Coupéfenster hinaus. An der Wand des Bahnhofsgebäudes mir gegenüber steht ein Herr und sieht mich an — nicht gerade unbescheiden, aber er fixirt mich doch unverwandt. Du weißt ja, Sabine, so etwas kann ich nicht leiden, ich denke also: „sollst ihm mal die Zunge herausstecken — der Zug fährt ja sofort ab, und du siehst ihn nie wieder.“
„Aber Käthe!“ rief das Fräulein erschrocken.
„Siehst du, siehst du, daß du schiltst!“ rief Käthe, und fiel ihrer alten Freundin ungestüm um den Hals, „sei ganz still, sonst erzähle ich nicht weiter, und du hast dein Leben lang die Angst mit dir herumzutragen, daß ich etwas noch viel Schrecklicheres gethan habe, was du nicht weißt!“
Die Alte machte sich lachend los.
„Laß mich nur — ich bin ja schon still! Also —“
„Also — in dem Augenblick, wo der Zug sich in Bewegung setzt, führe ich mein Vorhaben aus! Nur ein ganz kleines bißchen, Sabine — ich dachte schon, er hätte es nicht gesehen! — aber er lächelte spöttisch und nahm den Hut ab. Da fuhren wir hin.“
Fräulein Sabine schüttelte den Kopf.
„Wirst du nie deinen Uebermuth ablegen, Kind!“
Käthe zerpflückte die rothe Nelke unbarmherzig in Stücke.
„O ja, Sabine“, sagte sie dann verlegen, „aber —“
„Was aber? noch mehr solcher schöne Streiche?“
„Ach, Sabine — die Geschichte ist ja noch gar nicht zu Ende, das Schlimmste kommt nach. Also wir fuhren, aber kaum hundert Schritte weit — der Zug wurde zu meinem Entsetzen nur rangirt und rutschte nach fünf Minuten wieder in denselben Bahnhof ein. Da stand auch noch der Herr — und hatte er vorhin gelacht, so lachte er nun erst recht!“
„Angenehm!“ sagte Fräulein Sabine. „Und wie benahm er sich?“
„Er benahm sich gar nicht, sondern warf die Cigarre weg und stieg in dasselbe Coupé mit mir. Und wir fuhren mit einander bis hierher, wo er auch ausstieg!“
Käthe sprang vom Fensterbrett. „Und was sagst du jetzt?“
„Herzchen,“ erwiderte die alte Dame und lächelte gutmüthig, „was soll ich sagen? Zu geschehenen Dingen schweigt man am besten — das einzig Angenehme ist, daß du den Mann wahrscheinlich nicht wieder sehen wirst.“
Käthe sah nicht so entzückt aus, als man hätte vermuthen sollen, und streute ihre Nelkenblättchen in die Luft. „Meinst du?“
Die Alte warf ihr einen schnellen Seitenblick zu, und zog die Augenbrauen etwas in die Höhe, als wollte sie sagen: „aha!“ Sie schwieg aber.
„Weißt du, Sabine,“ begann Käthe nach einer Weile von Neuem, „er — der Mitreisende — benahm sich übrigens sehr taktvoll. Da er merkte, in welch tödtlicher Verlegenheit ich war, that er, als ob gar nichts vorgefallen sei, und unterhielt mich von allen möglichen Dingen — ganz ernsthaft und sehr nett. Nur einmal, als eine alte Dame, die mitfuhr, von der Gegend sprach, und ihn fragte, ob er nicht auch während der Reise auf die hübsche Aussicht geachtet habe? sagte er ruhig: „o ja — besonders in Siegersdorff!“ und dann sahen wir uns an und lachten beide — ich auch, Sabine — das konnte ich nicht ändern! Sonst war ich sehr würdevoll — nein, wirklich!“
„Davon bin ich überzeugt,“ sagte die Alte ernsthaft, „wie sah denn dein Freund oder Feind aus?“
„Sehr gut — groß, dunkelblond und humoristisch — und er war sehr hübsch angezogen.“
Die alte Dame lachte.
„Wenn’s nur kein Weinreisender war!“
„Aber, Sabine, schäme dich! als ob man das nicht merkte!“ In dem Augenblicke klopfte es.
„Fräulein Käthchen möchten gleich herunter kommen, Frau Majorin Scharff wäre da, und wollte etwas aus dem Eckschrank, und Fräulein Käthchen hätten die Schlüssel mit.“
„Unausstehlich!“ sagte Käthe verdrießlich, „Scharffs erwarten in den Tagen den gräßlichen Sohn, und borgen sich wieder einmal die ganze Wirthschaft zusammen. Ich komme,“ rief sie dem Mädchen zu.
„Ist der junge Scharff so „gräßlich,“ wie du sagst?“ fragte Sabine.
„Ich habe ihn nie gesehen — aber wenn von einem Menschen schon so viel gesprochen wird, hat man genug. „Kurt sagt, Kurt schreibt, Kurt meint“ — so geht es immerfort, als ob ich mich darum kümmerte, was ihr Kurt für Ansichten hat.“
Fräulein Sabine war auch aufgestanden.
„Weißt du, was ich glaube, Herzchen? Frau Scharff möchte dich sehr gern für den „gräßlichen Sohn“ haben.“
„Ach, das weiß ich ja schon lange! Aber ich danke, Sabine — ich danke — ich will gar nicht heirathen — oder“
„Hör einmal, Käthe, du kommst mir sonderbar vor! Deine Beichte war unvollständig! „Oder“ heißt das etwa: „oder die Bekanntschaft müßte damit anfangen, daß ich ihm die Zunge heraussteckte?“
„Sabine,“ sagte das junge Mädchen würdevoll, „ich begreife gar nicht, wie du mich so lange aufhalten kannst, wenn du hörst, daß Mama auf die Schlüssel wartet!“
Und fort war sie.
***
Während diese Unterhaltung stattfand, herrschte bei Käthens Eltern große Unruhe. An der Hausthüre war schon seit längerer Zeit eine Wohnung ausgeboten worden, und der Hausherr hatte sich bereits stummer Verzweiflung überlassen, weil noch keine Nachfrage stattgefunden hatte.
Jeder Mensch hat bekanntlich seinen Tollpunkt — die Vermiethungsfrage war der Tollpunkt des Doktors!
So lange der unheilvolle, weiße Zettel über seiner Thüre prangte, war er melancholisch — seine Gedanken irrten mit beängstigender Beharrlichkeit, aufgescheuchten Vögeln gleich, um das betreffende Quartier, und er begann und schloß den Tag mit Seufzen. Wenn seine Frau mit dem triftigen Trostgrunde ins Feld rückte, daß ja noch nie eine Wohnung in ihrem Hause leer geblieben sei, so grub der Doktor regelmäßig einen alten General aus, der inzwischen, nach der seitdem verflossenen Zeit zu schließen, längst zum Feldmarschall oder unter die himmlischen Heerscharen avancirt sein mußte, und dessen Quartier einst ein volles Vierteljahr unvermiethet gestanden hatte.
Zeigte sich dann ein präsumtiver Miether, so begann ein neues Stadium in dem Zustande des Doktors. Er hatte für nichts anderes Sinn und Gedanken, als für die Chance, er sang mit dem französischen Grenadier „was schiert mich Weib, was schiert mich Kind?“ und war für alle häuslichen Vorkommnisse taub und blind.
Heute nun war, gleich einem Sonnenblick, in sein umdüstertes Gemüth ein Brief gefallen, in dem ein der Familie bekannter Baron von Rabeneck um die Erlaubniß bat, am Nachmittag zu erscheinen und die annoncirte Wohnung in Augenschein zu nehmen.
Der Baron galt zwar für einen etwas langweiligen und unsäglich neugierigen Herrn — aber in der Noth ist man nicht wählerisch — der Baron wollte miethen, und der Hausherr sah seinem Eintreffen seit drei Uhr mit fieberhafter Spannung entgegen.
Die Familie — Käthe, die Älteste, ausgenommen, die, wie wir wissen, bei Fräulein Sabine war, saß um den Kaffeetisch. Eine stattliche Reihe von schulpflichtigen Kindern — zwar nicht so viel, als unser schwäbischer Freund besaß, der auf eine Anfrage nach dem Befinden der Seinen antworten konnte: „ich danke, die „Meischte“ sind wohl“ — aber immerhin genug, um zu Zeiten recht angenehmen Spektakel zu machen.
Die Hausfrau dirigirte mit Wort und Blick die stillbewegte Gruppe, die zur Eile angetrieben wurde, um beim Erscheinen des Miethers nicht den Eindruck der Räume abzuschwächen. Jetzt klingelte es.
„Kinder, schnell — trinkt aus, das ist er!“ rief der Vater, und ließ sich in der Eile zu der unmännlichen Handlung des Umgießens aus der Ober- in die Untertasse für seinen jüngsten Sohn verleiten — doch zu spät! Die Thür ging auf — aber nicht der Baron erschien, sondern das heiter lächelnde Angesicht der Frau Majorin Scharff. Die Kinder gingen trotzdem auf einen Wink der Mutter hinaus. —
Frau Scharff bewohnte mit ihrem Gatten, einem Major a. D., die Beletage. Dieser Gatte und ihr Sohn waren ziemlich die beiden einzigen Gegenstände, welche sich die Frau Majorin nicht geborgt hatte, sondern rechtmäßig besaß. Man kann es ihr daher nicht übel nehmen, wenn sie mit besonderem Stolz auf diese beiden blickte. Eine gute, ganz gescheidte Frau von stets heiterem Temperament, hatte sie nur die Manie, alles zu verlegen, zu verlieren, und sich mit einer wahrhaft genialen Unverdrossenheit durch Entlehnen von dem, was ihr momentan fehlte, aus der Verlegenheit zu ziehen.
Ihr Mann wußte entweder nichts davon — oder er wollte nichts davon wissen, was ziemlich auf eins herauskommt. Er hatte es zu seiner Vorgesetzten und seinem eigenen größten Erstaunen bis zum Major gebracht und war dann erschöpft ins Privatleben zurückgesunken. Seine Geisteskräfte, die ohnehin nie üppig wucherten, hatten sich seitdem auf Whist konzentrirt, und keine Gemüthsbewegung, kein Familienereigniß freudiger oder trauriger Natur war bisher im Stande gewesen, ihn derart zu erregen, daß er nicht, so wie der erste Sturm vorüber war, die Seinigen gefragt hätte: „machen wir heute keine Partie?“
Ja es ging die dumpfe Sage, daß er an dem Abend, wo sein einziger Sohn das Licht der Welt erblickte, zwei Stunden darauf einen Whisttisch herbeigeschoben und seiner Schwiegermutter zur Erholung eine Partie Whist vorgeschlagen habe.
So lange seine Bequemlichkeit und sein Whist ihm ungestört blieben, ließ er den Dingen ihren Lauf, und seine Frau mochte die Wirthschaftsutensilien aus allen benachbarten Familien rekrutiren — ihn focht es nicht an.
Sein Sohn, der inzwischen als sehr begabter und tüchtiger Offizier die beste Carriere machte, hatte für ihn erst Interesse gewonnen, als er den Dritten beim Whist abzugeben vermochte, was den jungen Mann nicht hinderte, seinen Vater sehr zu lieben, und mit großer Ehrerbietung an beiden Eltern zu hängen. Dieser Sohn, das Glück und der Stolz der Mutter, wurde, wie wir von Käthe gehört haben, erwartet, und die Frau Majorin hatte bereits eine Bettstelle mit Betten, einen Teppich, einen Waschtisch und zwei Leuchter von der Doktorin Lang entlehnt, und kam soeben, um zu fragen, ob ein überzähliger Flügel reiner Gardinen vakant wäre, da sie das Gastzimmer sonst soweit in Ordnung habe.
Die gutmüthige Doktorin versprach, danach zu sehen, und lud ihre Hausgenossin zum Sitzen ein. Doch diese lehnte ab.
„Nein, nein,“ sagte sie eilfertig, „o ich habe noch sehr viel zu thun — denn, liebste Lang, ich komme mit einer großen Bitte — trinken Sie nicht heute Abend mit uns Thee? Keine Gesellschaft — nur etwa zwölf bis fünfzehn Personen — bitte, schlagen Sie es mir nicht ab!“
„Wir kommen herzlich gern,“ sagte die Doktorin, „wenn mein Mann nichts dagegen hat.“
Der Doktor war herausgegangen, um die Straße herunter zu spähen, ob der Miether sich nicht zeigte. —
„Ach, was sollte er dagegen haben!“ sagte Frau Scharff, „heut muß er kommen — ich habe eine kleine Überraschung vor! Aber liebe Lang — eine Bitte! Meine Pauline ist so ungewandt — können Sie mir Ihre Köchin auf heute Abend leihen? Wir haben nur zwei Gerichte, und sie ist so prächtig flink — das weiß ich! Im Hause geht das ja sehr gut!“
„Ja, ja, das will ich thun, Frau Majorin,“ sagte Frau Lang lächelnd, „kann ich sonst mit etwas dienen?“
„Nun ja — wenn Sie mir Ihre große Bratenschüssel und zwei Dutzend Mittelteller und Ihre Gabeln, fünfzehn Weingläser und die silberne Zuckerdose leihen wollten, so wäre ich Ihnen sehr dankbar! Ach, und Beste — die beiden großen Lampen — aber lassen Sie sie bald füllen; meine Leute verstehen sich so schlecht darauf! Das ist alles — denn die Kompottschüsselchen und die Bowlengläser habe ich noch oben. Aber richtig — Sie haben wohl nicht ein Pfund Speck zu Hause? meine Pauline hat es heut früh mitzubringen vergessen! Wir haben Rehrücken und sie soll ihn noch spicken.“
„Ich werde sogleich nachsehen,“ erwiderte Frau Lang, und griff in die Tasche — die Schlüssel fehlten! Bei dieser Gelegenheit schickte sie zu Fräulein Sabine, um Käthe holen zu lassen, die auch bald erschien und von der Majorin aufs zärtlichste begrüßt wurde.
„Mein liebes Käthchen — nein, wie reizend steht Ihnen die neue Frisur! Wie haben Sie sich bei Ihrer Freundin amüsirt? Ich bitte eben bei Mamachen vor, ob Sie uns heute Abend nicht besuchen wollen — ich habe eine kleine Ueberraschung in petto! Nicht wahr, Sie kommen doch? Ich schrieb noch neulich an meinen Sohn: „eine Gesellschaft ohne Käthchen ist mir gar nicht denkbar — sie ist so belebend!“
Käthe, die bis zu diesem letzten Satz sehr freundlich ausgesehen hatte, machte eine ungeduldige Bewegung und zog die Hand fort.
„Nun muß ich aber gehen, liebe Frau Doktorin,“ sagte die Majorin eilfertig, „also Ihre Anna bringt nachher alles mit herauf, nicht wahr?“
Damit ging sie, und die Doktorin blieb mit Käthe allein. Sie legte ihrer Tochter die Hände auf die Schultern und sah ihr forschend ins Gesicht. „Käthe, warum bist du nur wieder so unfreundlich gegen die gute Majorin?“
„Weil sie mich nicht mit ihrem langweiligen Sohn in Frieden läßt!“ erwiderte Käthe unartig.
Die Doktorin schüttelte den Kopf.
„So laß sie doch — für die Pläne der Mutter kann der Sohn nichts — und außerdem — Käthe, wäre es denn nicht sehr hübsch, wenn etwas daraus würde? Eine andere Neigung hast du nicht“ —
Käthe mußte wohl an der Tischdecke gezupft haben, denn der Schlüsselkorb fiel zur Erde, und sie mußte die Schlüssel aufheben, wozu sie eine ganze Weile brauchte und sehr roth wieder zum Vorschein kam — vom Bücken jedenfalls!
„Und der junge Scharff soll ein vortrefflicher, höchst gescheidter Mann sein,“ fuhr die Mutter fort, „thu mir wenigstens den Gefallen, dich nicht von vornherein gegen ihn einzunehmen! Seine Briefe haben dir ja immer so gut gefallen!“
Käthe schwieg hartnäckig.
„Da klingelt es,“ unterbrach sich die Mutter, „hier, Käthe, ich habe mir alles notirt, was die Majorin sich zu heute Abend leihen will — gieb es einmal heraus!“
Käthe nahm mit einem ironischen „weiter nichts?“ das Verzeichniß in Empfang, und ging hinaus, eben, als der Vater zur andern Thür hereintrat.
„Er kommt wieder nicht!“ sagte er resignirt, „ich werde jetzt ausgehen! Hausbesitzer sein ist ein Vergnügen.“
„Ja, ja, er kommt,“ beschwichtigte seine Frau, „eben klingelt es — da ist er schon!“
Richtig — so verhielt es sich! Herr Baron von Rabeneck erschien mit einer tadellosen Verbeugung auf der Schwelle. Er war ein mittelgroßer, schlanker Mann, mit sehr vorsichtig frisirtem, dunkelblondem Scheitel, mit kurzsichtigen Augen, die er stets etwas einkniff, mit einem parfümirten Taschentuch, und einem kornblumenblauen Schlips.
„Ganz ergebensten guten Tag, meine Herrschaften,“ sagte er eintretend, „Sie sind beim Kaffee? lassen Sie sich nicht stören! Trinken Sie immer hier Kaffee?“
„Ja,“ sagte der Hausherr etwas kurz. Seine Frau, der die Fragepassion des Barons, und die kurze Geduld ihres Mannes schon bekannt war, wollte mit einer Gegenfrage dazwischen kommen, aber der Baron ließ sich nicht so leicht beirren. „Ich trinke auch Kaffee,“ fuhr er fort, „sehr gesundes Getränk? Was? Trinken Sie auch Kaffee, Frau Doktorin?“
„Ja,“ sagte der Doktor gereizt, „meine Frau trinkt Kaffee — meine Tochter auch, meine ganze Familie trinkt Kaffee!“
Die Hausfrau mischte sich ins Gespräch. „Sie wollten unser leeres Quartier sehen, Herr Baron?“
„Ja,“ erwiderte der Neuangekommene behaglich, „ich sah heute bei meinem Morgenspaziergang, den ich immer durch diese Straße mache — hübsche Straße, was? — daß hier ein Miethszettel hängt — wollte doch mal nachfragen. Erster Stock, was?“
„Nein — zweiter Stock — vier Zimmer mit Balkon,“ gab der Doktor zurück.
„Oh — charmant — vier Zimmer? Balkon? Ganz mein Fall! Alles Vorderzimmer? Küche? Gesund? Hoch? Still?“
„Wie wäre es,“ schlug die Hausfrau vor, „wenn Sie mit mir einmal hinaufgingen, Herr Baron, und die Wohnung selbst in Augenschein nähmen? Ich hole mir nur ein Tuch, und bin gleich wieder da!“
„Bitte, bitte,“ erwiderte der Baron verbindlich, und ging Käthe entgegen, die eben wieder hereintrat, und am Fenster mit einer Arbeit Platz nahm.
Sie lud den Gast durch eine schweigende Handbewegung ein, sich auch niederzulassen. Käthe war sehr wortkarg, wenn ihr jemand nicht gefiel.
Der Baron in seiner Frageseligkeit empfand die Pause schmerzlich, und wandte sich an das junge Mädchen.
„Sie sticken, mein Fräulein? Weiß?“
Käthe hielt ihm ihre Arbeit hin.
„Ja, Herr Baron! Interessiren Sie sich für dergleichen?“
Der Baron hustete zierlich.
„Ich interessire mich für alles, mein Fräulein! Schon meine selige Mama sagte immer: Chlodwig, du interessirst dich für alles! Ich heiße nämlich Chlodwig! Hübscher Name, was? Der fünfte Chlodwig in unserer Familie — mein Papa hieß auch Chlodwig! Wie heißt Ihr Papa?“
„Friedrich,“ erwiderte Käthe, die mit Mühe ein Lächeln unterdrückte.
„Friedrich — so so — und Ihre Frau Mama?“
„Fragen Sie sie selbst,“ sagte der Doktor ungeduldig, „da kommt sie.“
Als die Hausfrau mit dem Baron verschwunden war, sagte der Doktor zu Käthe: „wenn dieser Fragekasten die Wohnung miethet, zünde ich das Haus an allen vier Ecken an. Der fragt einen todt.“
Käthe lachte. „Laß ihn, Papa! Du brauchst ja nicht mit ihm umzugehen. Vielleicht spielt er Whist, da kann er sich mit Scharffs befreunden, die er ohnehin schon kennt. Weißt du denn, daß sie heute eine Gesellschaft geben?“
„So?“ brummte der Doktor, „was haben sie sich denn schon geborgt?“
„Vorläufig unsere Teller, unsere Lampen, unsere Köchin und unsere Familie,“ erwiderte Käthe spöttisch, „wir werden uns also wohl recht heimisch fühlen.“ —
Der Baron und die Doktorin kamen nach geraumer Zeit wieder, und der erstere war entzückt von dem Quartier.
„Wenn es Ihnen recht ist, Herr Doktor,“ sagte er, „so können wir gleich Kontrakt machen — liebe schnelle Entschlüsse — Sie auch, — was?“
„Gewiß!“ sagte der Doktor höflich — die Aussicht, einen Miether zu bekommen, goß Öl auf die Wogen seines Zornes. Die beiden Herren nahmen an einem Seitentischchen Platz, um über den Kontrakt einig zu werden.
Kaum hatte der Doktor den ersten Paragraphen vorgelesen, als die Thüre aufging und eine Dame erschien. Sie war nicht mehr ganz jung, aber auch durchaus nicht alt — so hübsch in der Mitte. Ganz jung waren ihre Toilette, ihre Haartracht und ihr Wesen! sie flog wie eine Elfe ins Zimmer und umarmte Käthe mit kindlichem Ungestüm.
Das war Fräulein Leontine von Faldern, die mit ihrer Großmama, der verwittweten Generalin, die Hälfte des zweiten Stockes im Hause bewohnte. Der Baron hatte sie kaum erblickt, als er aufstand und auf sie zutrat.
Der Doktor, im Ausfertigen seines Miethskontraktes unterbrochen, kreuzte die Arme, lehnte sich in seinen Stuhl zurück und sagte düster: „nett!“
„Mein gnädiges Fräulein,“ begann der Baron, „ich bin entzückt, Sie zu begrüßen! Wie ist Ihnen die Stumme von Portici bekommen?“
„O ausgezeichnet!“ erwiderte Leontine, „es war eine allerliebste Aufführung! Ich war mit Schraffenaus da — Will ist jetzt bei ihnen zum Besuch — Sie wissen ja — Will Schraffenau, der bei den zweiten Kürassieren stand! Will kann zu amüsant sein, nicht?“
„O ja, meine Gnädigste,“ erwiderte der Baron, „aber nichts gegen Lu! Sie erinnern sich doch? Lu Schraffenau, der die zweite Sandrowsky — Peppi Sandrowsky — zur Frau hat? Sie kennen sie doch? Graziös, was?“
„Na!“ brummte der Doktor vor sich hin, „bis die beiden jetzt den Grafenkalender durchgearbeitet haben, kann mein Miethskontrakt schwarz werden!“
„Denken Sie nur, meine Gnädigste, ich bin im Begriff, Ihr Hausgenosse zu werden! Charmant, was?“
„Ach, wie reizend! Das muß ich Großmama erzählen!“ rief Leontine entzückt.
„Ja, dann lassen Sie aber den Herrn Baron erst hier zu Ende kommen,“ sagte der Doktor, und schob sein Tischchen in die andere Ecke des Zimmers — dort konnte er hoffen, ungestört zu bleiben, „bitte, Herr Baron! — der Miether verpflichtet sich“ —
Während die beiden sich wieder in den Kontrakt vertieften, plauderten die Mädchen in der Fensternische.
„Käthchen, ich komme nur, um Sie etwas zu fragen — ist heute großer Zauber bei Scharffs? Ich dachte schon, der Sohn wäre gekommen, den ich von früher her kenne — wissen Sie, er war Adjutant bei meinem Vetter Storrwitz, und meine Cousine neckte mich immer entsetzlich mit ihm — ist er gekommen?“
„Nein, er wird erst erwartet,“ erwiderte Käthe, „ich weiß auch nicht, warum sie heut plötzlich eine Fête geben.“
„Nun ja — aber die Frage ist, was zieht man an? Rabeneck ist auch da, ich habe die Scharff gefragt.“
Die Beiden erörterten die Toilettenfrage und Leontine hüpfte endlich ab.
Inzwischen wurde es so dunkel, daß der Doktor zu seinem Miethskontrakte nach der Lampe rief. Das Mädchen erschien, brachte aber nur einen Armleuchter mit einem Licht.
„Die Lampe!“ donnerte der Hausherr.
„Verzeihen Sie, Herr Doktor — unsere Lampen sind alle oben beim Herrn Major — die Kinder arbeiten auch bei Licht.“
„Darauf machen Sie sich gefaßt,“ sagte der Doktor, kochend vor Wuth, „wenn Sie hier ins Haus ziehen, wird Ihnen von Majors alles abgeborgt, was Sie haben und nicht haben!“
„Aber Papa!“ rief Käthe vorwurfsvoll und verlegen.
„Ich bitte Sie,“ rief der Baron ängstlich, „das ist ja sehr unangenehm! Alles verborgen? Muß man das?“
„Das frage ich mich schon seit zwei Jahren!“ grollte der Doktor, „denn so lange wohnen sie hier, und was sie sich alles borgen, spottet jeder Beschreibung. Ich wollte nur, sie ließen einmal auf einen halben Tag um mich bitten, da wollte ich es ihnen schon abgewöhnen! Aber weiter: „die Wäsche muß in dem dazu bestimmten Waschhaus“ —
„Eine Empfehlung von der Frau Majorin, und ob sie die silbernen Armleuchter bekommen kann?“ sagte das Dienstmädchen und griff bereits nach dem fraglichen Gegenstand.
„Sie sind wohl verrückt!“ schrie der Hausherr in verzeihlichem Ingrimm, „sollen wir hier im Dunkeln sitzen?“
„Mein Gott, ist es denn schon so spät!“ sagte der Baron, und sah nach der Uhr, „wahrhaftig — halb sieben! Pardon, Herr Doktor, aber ich muß an meine Toilette gehen — wir sehen uns ja wohl heute Abend beim Herrn Major? Ich komme dann morgen in aller Frühe, und wir beenden das Miethsgeschäft, was? Wann stehen Sie auf? Um sieben? Acht? Neun?“
Der gänzlich resignirte Doktor pfiff statt aller Antwort einen Walzer — das Symptom des letzten Verzweiflungsstadiums, als er seinen Gast zur Thür geleitete.
„Nun borgen sie sich auch schon die Miether!“ sagte er vor sich hin, als er hinausging.
Käthe blieb allein. Die Dunkelheit, die sanft und leise zum Fenster hinein schlich, kam ihr eben recht. Sie dachte so still vor sich hin — die Phantasie ist ein Nachtfalter, der seine Schwingen am liebsten in der Dämmerstunde ausbreitet. Warum war ihr noch nie so bange vor der Zukunft gewesen als heut — warum noch nie der Gedanke an die von den Ihrigen so sehnlichst gewünschte Heirath mit dem Hauptmann Scharff so schrecklich erschienen? Ach, die Träume von den kommenden Tagen hatten seit ihrer Reise eine bestimmte Gestalt angenommen — zum ersten Mal! Käthes Herz war bisher ein unbeschriebenes Blatt — noch nie hatte eine Begegnung ihre Einbildungskraft, viel weniger ihr Gefühl zu erregen vermocht — aber es war ihr auch noch nie jemand mit so liebenswürdiger Ironie, mit so gutmüthig überlegenem Ernst entgegen getreten, als der Fremde, dem sie sich doch wie ein unartiges Kind gezeigt! Sein festes, kluges Gesicht mit dem humoristischen Lächeln, seine tiefe, freundliche Stimme gaben ihr das Gefühl einer Sicherheit und Zuversicht, wie sie es nie zuvor gekannt hatte. Doch was half das alles! sie kannte seinen Namen nicht — er nicht den ihren — sie würden sich wahrscheinlich nie wiedersehen! Und mit einem tiefen Seufzer stand sie auf, und ging in ihr Zimmer, um sich anzukleiden.
Inzwischen herrschte bei der Majorsfamilie schon einige Aufregung. Die Frau des Hauses wanderte in den menschenleeren Räumen umher, die bereits im festlichen Lichterglanz erstrahlten, rückte hier und da an den Stühlen und stand dann wieder überlegend still, ob noch etwas fehlte, wonach man zu Doktors schicken könnte.
Da öffnete sich die Thür und ein großer, blonder Mann trat ins Zimmer.
Die Majorin wandte sich um.
„Nun, Mamachen,“ sagte der Eintretende freundlich, „du hast noch zu thun? Ich hoffte eben auf eine gemüthliche halbe Stunde mit dir, ehe die Gäste kommen.“
„Ich bin fertig“, sagte die Mutter, und trat vor den Stuhl, in den sich ihr Sohn niederließ. Sie legte ihm die Hände auf beide Schultern und sah ihm zärtlich ins Gesicht.
„Mein alter Junge — wie du wieder verbrannt bist!“
„Im Winter, Mama? Nein, das ist wohl meine natürliche Farbe, du mußt dich schon daran gewöhnen.“
„Und du warst ein so weißes Kind!“ sagte die Mutter lächelnd. „Jetzt sage mir aber einmal, Kurt — ist es dir eigentlich recht, daß ich heut Abend unsere Hausgenossen eingeladen habe? Du machtest mir bei der Ankündigung ein so besonderes Gesicht.“
„Nun, offen gesagt, wäre ich eben so gern mit Euch allein gewesen, Mutterchen — aber wir sind ja, so Gott will, noch viele Abende zusammen. Wer kommt denn heut?“
„Also,“ begann die Majorin, „da ist erstens die Generalin Faldern mit ihrer Enkeltochter Leontine —“
„Was?“ unterbrach der Hauptmann lebhaft, „Tine Faldern ist hier?“
„Kennst du sie?“
„Wie sollte ich nicht! — Als ich bei Storrwitz Adjutant war, hielt sie sich ja einen ganzen Winter dort auf! Sie hieß damals immer die Tochter des Regiments, weil sie so genau in der Rangliste Bescheid wußte. Uebrigens ein hübsches, amüsantes Mädchen — es ist mir ganz lieb, sie einmal zu treffen, wir haben eine Menge gemeinsamer Beziehungen.“
Die Majorin sah etwas mißvergnügt aus, sagte aber nichts.
„Dann,“ fuhr sie fort, „von Hausgenossen heißt das, kommt noch unser Wirth — der Doktor Lang mit Frau und Tochter —“
„Ach — die berühmte Käthe! Ich kenne dich, Mama! Hätte ich mir’s nicht denken können, daß du wieder einen Heirathsplan wie einen Lasso bereit hältst, um ihn mir Unglücklichen über den Kopf zu werfen? Aber gieb dir keine Mühe, Mama — es wird nichts!“
„Sei doch nicht so absprechend,“ bat die Mutter, „du hast Käthe noch gar nicht gesehen — ich sage dir, sie ist allerliebst! Hübsch, sehr gut erzogen und sehr gescheidt — sie würde ausgezeichnet für dich passen!“
„Kann sein, Mama! aber ich will dir etwas sagen — ich werde wohl überhaupt nicht heirathen. Sieh,“ fuhr er lebhaft fort, als die Mutter eine Bewegung des Unmuths machte, „ich bin — nenne es phantastisch, unpraktisch, kurz, was du willst — aber ich bin entschlossen, mich nur zu binden, wenn ich ein Mädchen finde, von der ich sage: ‚Die oder keine!‘ Und solche Dinge kommen vor! — Ich sage dir, sie kommen vor! Lache mich nicht aus, Mutter — aber ich habe ein Mädchen gesehen, das mir gefällt, und wenn ich die wiedersehe, und sie will mich — dann sollst du am längsten auf eine Schwiegertochter gewartet haben. Frage mich aber nicht weiter — ich bin auf der Suche — das laß dir genug sein. Und verschone mich mit deiner Käthe — ich mag sie nicht!“
„Guten Abend, Frau Majorin,“ sagte in diesem Augenblick die Generalin Faldern, die in taubengrauer Seide ins Zimmer rauschte, von der rosafarbenen Leontine gefolgt. „Sie waren so freundlich, uns zu erlauben — ah, das ist wohl Ihr Herr Sohn?“
„Ja, er ist gestern angekommen,“ sagte die glückstrahlende Mutter, ihn den Damen vorstellend, „er hat mich überrascht! Es ist doch einzig von ihm; aber er war von jeher ein so guter Junge!“
Wenn diese öffentliche Liebeserklärung dem Hauptmann peinlich war, so ließ er es durch keine Miene merken — er lächelte sehr freundlich und wandte sich an Fräulein Leontine, die ihm als altem Bekannten vergnügt die Hand hinstreckte.
„Herr Hauptmann — das ist aber eine Ueberraschung, die Ihrer Frau Mutter vollständig gelungen ist! Allerliebst, das muß wahr sein! Und nun erzählen Sie mir von W.... — was machen die dritten Husaren? Und wo stehen jetzt die Vierundzwanziger? Hat Trotha wirklich einen so großen Pas gemacht, und muß Schulten den Abschied nehmen? Ach, es waren doch schöne Zeiten?“
„Ihre Theilnahme für meine Kameraden rührt mich aufs tiefste, mein gnädigstes Fräulein,“ erwiderte der Hauptmann ernsthaft, „ich kann Sie versichern, daß die dritten Husaren sich sehr wohl befinden, und daß die Vierundzwanziger sich ohne Ausnahme Ihnen durch mich zu Füßen gelegt hätten, wenn sie hätten ahnen können, daß ich so glücklich sein würde, Sie zu sehen.“
„Ach, Sie spotten wieder,“ schmollte Leontine, „aber ohne Scherz — erzählen Sie mir ein bischen! Hat mein Vetter Storrwitz sich ein neues Pferd gekauft? Der Braune von damals war doch ein süßes Thier — er ist mir noch manchmal im Traume erschienen!“