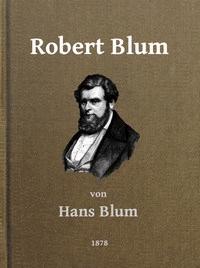
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 865
Ähnliche
The Project Gutenberg eBook, Robert Blum, by Hans Blum
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.
Title: Robert Blum
Ein Zeit- und Charakterbild für das deutsche Volk
Author: Hans Blum
Release Date: December 13, 2014 [eBook #47659]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ROBERT BLUM***
E-text prepared by Odessa Paige Turner, Norbert Müller, and the Online Distributed Proofreading Team (http://www.pgdp.net) from page images generously made available by the Google Books Library Project (http://books.google.com)
Note:
Images of the original pages are available through the Google Books Library Project. See
http://www.google.com/books?id=i6YBAAAAYAAJ
Druck von F A Brockhaus in Leipzig
Robert Blum.Ein Zeit- und Charakterbild für das deutsche Volk
von
Hans Blum.
Mit einem Portrait in Stahlstich und dem Facsimile des letzten Briefes Robert Blum’s.
Leipzig,
Verlag von Ernst Keil.
1878.
Seinem lieben Vetter
Christian Wahl
in Chicago (Illinois, Nordamerika)
in freundschaftlicher Gesinnung
zugeeignet
vom
Verfasser.
Vorrede.
Mein lieber Vetter und Freund!
Der Sohn hat es unternommen, des Vaters Leben zu schreiben. —
Unter allen Umständen ein großes Wagniß, doppelt schwierig im vorliegenden Falle, wo es sich handelt um die Darstellung von Ereignissen, die der Verfasser selbst gar nicht oder nur als Kind erlebte, und um die Zeichnung einer politischen Richtung und Bewegung, welcher der Verfasser keineswegs vollkommen sympathisch gegenübersteht. So war denn das einfache Verhältniß, in welchem der Biograph zu seinem Helden stehen soll, das Verhältniß reiner Uebereinstimmung oder Gegnerschaft, von Anfang an nicht vorhanden. Die Gefahr lag nahe, daß entweder die Pietät des Sohnes auf Kosten historischer Wahrheit und Treue oder die Parteimeinung unserer Tage auf Kosten der vollen Pietät und Gerechtigkeit gegen den edeln Todten in dem Widerstreit dieser beiden Anschauungen siegen werde.
Daß ich das offen ausspreche, mag ein Beweis dafür sein, daß ich nicht blos die Gefahr erkannt habe, die dem Gelingen eines seit achtzehn Jahren beharrlich und freudig verfolgten Planes entgegenstand, sondern daß ich auch Alles aufgeboten habe, um diese Gefahr zu überwinden.
Das erste Erforderniß zur Erreichung meines Ziels schien mir zu sein die volle Herrschaft über den Stoff. Nur dadurch war ein unbefangenes Urtheil zu gewinnen. So wie ich daran ging, den Stoff zu sammeln, zeigte sich, daß diese Sammlung wohl kaum jemals abgeschlossen werden könne. Jedes Jahr — um nicht kürzere Zeiträume zu nennen — hat uns seit 1848 werthvollere Bereicherungen unseres Wissens und Urtheils über die vierzig Jahre geboten, in denen Robert Blum lebte, namentlich über das Jahr der deutschen Revolution selbst. Damit war mein Unternehmen von Anfang an auf die bescheidenen Grenzen des Versuchs einer Lösung angewiesen. Mehr will es auch nicht bieten, da es nun hinaustritt in die Welt. Mögen Andere, Bessere, sich dazu angeregt fühlen, diesen Versuch weiter zu führen. Ich selbst werde fortfahren zu sammeln und zu sichten und werde die Resultate dieser fortgesetzten Arbeit, wenn die deutsche Nation diesem Versuche ihre Gunst leiht, in einer anderen Auflage niederlegen.
Ihrer Art nach zerfallen meine Quellen in drei Klassen: in Jedem zugängliche gedruckte Schriften und Blätter, in schriftliche und mündliche Mittheilungen von Zeitgenossen Robert Blum’s über denselben an mich und Andere; endlich in handschriftliche Aufzeichnungen Robert Blum’s selbst, die sich theils in seinem Nachlasse vorfanden, theils von den Besitzern mir überlassen wurden. Allen, die mir bei der Sammlung irgend einer dieser Quellengattungen behülflich waren, sage ich hierdurch öffentlich meinen herzlichsten Dank. Leider ist Mancher darunter, der längst die Augen für immer geschlossen hat und meinen Dank nicht mehr vernehmen kann. Das gilt z. B. von Johann Jacoby, Ludwig Simon, Prof. Wuttke und vor Allem von jenem Manne, der sich wenige Wochen vor seinem Ende noch dazu entschloß, dieses Buch zu verlegen, von Ernst Keil.
Am 9. November 1878 ist ein Menschenalter erfüllt, seitdem Robert Blum auf der Brigittenau verblutete. Dieser Zeitabschnitt schien den vorläufigen Abschluß und die Veröffentlichung dieser Arbeit zu rechtfertigen. Aber auch innere Gründe drängten dazu, nicht länger mit der Ausgabe dieser Blätter zu zögern. Es schien hohe Zeit, jenes falsche und unsaubere Bild Robert Blum’s, zu welchem Herr Alexander Frhr. v. Helfert die Grundlinien scheinbar aus dem ehrwürdigen Schrein österreichischer Privat- und Staatsarchive zusammengetragen hatte, und das seit etwa acht Jahren fast unberichtigt geblieben war, geschichtlich treu zu zeichnen. Außerdem erschien der Versuch, das Leben und Wirken jenes Mannes, welcher die treueste Fürsorge für den „vierten“ Stand mit einer gut-deutschen Gesinnung vereinigte — das Leben und Wirken Robert Blum’s darzustellen besonders geboten in einer Zeit, in welcher ein vaterlandsloses Demagogenthum den rohen Klassenhaß predigte und die Verhöhnung und Zerstörung der deutschen Vaterlandsliebe als die Grundbedingung der wahren Freiheit pries. Die Wahrheit über Robert Blum mußte bald gesagt werden, da dieselbe Partei mit der ihr eigenen Virtuosität der Lüge diesen Mann seit Jahren in ihren unsauberen Blättern als einen ihrer socialistischen Parteiheiligen pries. Noch ehe dieses Buch vor die Welt tritt, ist allerdings auch die Fortsetzung dieser Lästerung Robert Blum’s unterbrochen worden durch das Sozialistengesetz, welches dem frechsten Mißbrauch der Preßfreiheit das verdiente Ziel setzt; und damit ist scheinbar einer der Gründe weggefallen, die mich zur Vollendung meiner Arbeit antrieben. Aber gerade zu der Aufgabe, welche das Sozialistengesetz verfolgt: eine Wandlung der ethischen und nationalen Gesinnung jener Kreise anzubahnen, die von dem zersetzenden Gifte der Socialdemokratie angefressen sind, kann dieses Lebens- und Charakterbild wohl ein Scherflein beitragen. Denn es zeigt einen Mann, der sich aus dem tiefsten socialen Elend aus eigener Kraft emporgearbeitet zu dem höchsten Ehrensitz seines Volkes und der sein Leben einsetzte um die höchsten Güter der Nation. Vor solcher Größe tritt die ganze Erbärmlichkeit der socialistischen Heilslehre und die Kleinheit ihrer Apostel besonders grell zu Tage.
Ob es mir gelungen ist, dem theuren Manne und seiner Zeit gerecht zu werden, darüber steht mir kein Urtheil zu. Aber auch wenn man mir das rundweg bestreiten sollte, so wird mein Buch ein Verdienst immer behalten, das freilich mein Verdienst nicht ist: zum ersten Male ist hier der Werdegang dieses merkwürdigen Mannes fast ausschließlich an seinen eigenen Worten dargestellt, seine Weltanschauung und Parteimeinung an der Hand aller eigenhändigen Aufzeichnungen Robert Blum’s, die nur irgend in seinem Nachlasse, im Gewahrsam seiner Gattin, seiner Schwester, vieler seiner Freunde und in Folge öffentlicher Aufforderung zu benützen waren, dargelegt worden.
Wenn ich Dir, lieber Vetter Christian, dieses Lebensbild widme, so wählte ich Dich als einen Typus der besten Deutschen des fernen Westens der Vereinigten Staaten; jener Deutschen, welche nicht mit vorgefaßten unabänderlichen Meinungen und nicht mit ärgerlichem Besserwissen die Zustände und die geschichtliche Entwickelung ihrer alten Heimath betrachten, sondern mit demselben nüchternen, kritischen, aber auch ideal-patriotischen Blick, mit dem sie inmitten des großen Lebens der Union selbstthätig stehen. Das treue Andenken dieser Deutsch-Amerikaner an Robert Blum ist mir von größtem Werthe und ihnen wollte ich durch meine Widmung an Dich einen Dankesgruß über den Ocean rufen.
In treuer Freundschaft
Inhaltsverzeichniß.
1. Kindheit.
Einer langen Einleitung bedarf das Unternehmen, das Leben Robert Blum’s zu schreiben, nicht.[1] Obwohl beinahe dreißig Jahre seit seinem Tode verflossen sind und Deutschland seither in allen seinen öffentlichen Verhältnissen sich von Grund aus verwandelt hat, ist Robert Blum dennoch bei der großen Mehrzahl des deutschen Volkes unvergessen. Viele seiner Mitstreiter und Gegner aus der ersten deutschen Nationalversammlung haben ihn überlebt und seither hervorragenden und rühmlichen Antheil an der politischen Arbeit des deutschen Volkes genommen: Präsident Simson, Biedermann, Grumbrecht, Löwe, Schaffrath, Ruge &c. Aber dennoch kann sich kaum Einer von ihnen mit der Popularität des todten Robert Blum messen. Mit rührendster Beharrlichkeit und Zähigkeit hängt das deutsche Volk an dem Andenken dieses Todten. Zeugniß dafür bietet die Thatsache, daß noch heute das Bildniß dieses Mannes nicht nur in Sachsen, dem Hauptschauplatz seines Manneswirkens, in so vielen Häusern und Hütten getroffen wird; auch hoch oben im baierischen und badischen Gebirge, wo Robert Blum nie gewesen, hat Verfasser dieses noch Jahrzehnte nach Blum’s Tode dessen Bildniß in Wirtschaften und Privathäusern getroffen. Von dem Stuhl Robert Blum’s in der Paulskirche zu Frankfurt war zuletzt kaum ein Spahn mehr übrig. Jeder Besucher des einstigen Sitzungssaales des ersten deutschen Parlaments nahm sich, soweit der Vorrath reichte, einen Splitter dieses Sessels zum Andenken mit.
Der Grund der unverwelklichen Liebe und Verehrung, die das Volk an diesen Namen heftet, ist einfach genug. Robert Blum hat in seiner Kindheit und Jugend die Leiden der Armuth gekostet, wie selten ein Anderer. Er hat schon als ganz junger Mensch lange schmerzliche Blicke gethan in die tiefsten Tiefen leiblichen und geistigen menschlichen Elends. Ihm ist der herbste Schmerz nicht erspart geblieben, der eine reichbegabte, wissensdurstige Natur erfüllen kann: der Schmerz aus Armuth dem Lernen, jeder höheren Bildung entsagen, mit einfacher Handarbeit sein Brod verdienen zu müssen. Robert Blum ist mit eigener Kraft aus diesem ihm von einem harten Schicksal vorgezeichneten, scheinbar unübersteiglichen Lebenskreise immer freier und größer herausgewachsen. Er hat begonnen, mit unvergleichlicher Ausdauer an seiner eigenen geistigen Fortbildung, seiner Befreiung aus den Banden der Armuth und Unbildung zu arbeiten. Er hat mit jedem Schritte, der ihn unabhängiger stellte und seine Gesichtspunkte erweiterte, auch weitere Ziele in’s Auge gefaßt. Von den Interessen seiner Person, seiner freien Seele, seiner Familie, seines Standes, seiner Stadt, seiner Religionsgenossen, ist er vorgeschritten zu dem Streben, die heiligsten und wichtigsten Angelegenheiten seines ganzen Volkes zu vertreten. Die Leiden und Kümmernisse wie die berechtigten Forderungen des Arbeiters haben niemals einen beredteren und uneigennützigeren Anwalt gefunden, als Robert Blum.
In wunderbarem Maße war ihm die Macht der Rede gegeben: niemals hat ein Mann so wie er verstanden, aufgeregte Massen zu beschwichtigen, als wären Tausende seines Sinnes, als geböte ein milder Vater dem ungeberdigen Kinde. Und dieses reiche, kraftvolle Leben, dessen letzter Theil, mit Aufopferung und großherziger Verleugnung aller eigenen Interessen, nur seinem Volke gewidmet war, hat Robert Blum gekrönt durch seinen in der Blüthe der Jahre muthig erlittenen Tod. Dieser Tod vor Allem macht ihn noch der Gegenwart theuer. Denn Robert Blum ist nicht erschossen worden wegen irgend einer persönlichen Handlung, welche auch nur den Vorwand eines Todesurtheils gegen ihn gerechtfertigt hätte. Vielmehr geben die heute bekannten Acten seines sehr kurzen Processes volle Gewißheit darüber, daß jener Schrei der Entrüstung vollkommen berechtigt war, der bei der Nachricht von seiner Hinrichtung Deutschland durchzitterte von den Gestaden der Nordsee bis zum schwäbischen Meere, und der vom grünen Tische des Gesammtministeriums in Dresden mit derselben Naturgewalt ertönte, wie von den Tribünen des deutschen Parlaments zu Frankfurt und in zahllosen Volksversammlungen: daß in Robert Blum nicht die Person, sondern der Vertreter des deutschen Volkes, die Unverletzlichkeit des deutschen Reichstagsabgeordneten habe gemordet werden sollen; daß mit einem Worte die siegreiche österreichische Reaction in dieser Tödtung symbolisch zeigen wollte, daß sie Alles was seit dem März des großen Jahres 1848 geschehen, nicht anerkenne und nun die Stunde gekommen erachte, um Deutschland wieder das Joch des alten österreichischen Bundestages auf den Nacken zu legen. So gilt denn Robert Blum noch heute mit Recht als eines der edelsten Opfer, welche Deutschland jemals seiner nationalen Freiheit und Einheit gebracht hat.
Auch die Geschichte der Familie, aus der dieser bedeutende Mann hervorging, ist schnell erzählt. Auf eine lange Ahnenreihe konnte Robert Blum nicht zurückblicken. Das Wenige, was hierüber bekannt ist, muß berichtet werden, da es für die Kindheit und Jugend Robert Blum’s von Wichtigkeit wurde.
Aus dem Dorfe Frechen, zwei Stunden von Köln, siedelte der Faßbindermeister Johann Blum und dessen Frau um die Mitte des 18. Jahrhunderts nach Köln über. Von sieben Söhnen übernahm der älteste, Robert Blum, das Geschäft des Vaters und wohnte als fleißiger Meister auf dem Fischmarkte in Köln. Er hatte drei Kinder: Engelbert, Heinrich und Agnes. Der im Jahre 1780 geborene älteste Sohn Engelbert war zu schwächlich, um sich dem Geschäfte des Vaters widmen zu können; namentlich hatte er eine schwache Brust und taugte daher für schwere Arbeit nicht. Auch hätten die ziemlich wohlhabenden und streng katholischen Eltern gern gesehen, wenn ihr ältester Sohn Theologie studirt hätte und „geistlich“ geworden wäre. Er besuchte daher das Kölner Gymnasium und hatte fünf Classen desselben absolvirt, als Untersuchungen und Verfolgungen gegen die Schüler stattfanden, die verdächtig waren, sich den verruchten Lehren ketzerischer Freigeister zugewendet zu haben[2]. Engelbert Blum war in dieser Hinsicht bei den frommen Vätern sehr schlecht angeschrieben. Er hatte für die Verbreitung der ketzerischen Irrlehren Propaganda gemacht und wurde von nun an streng bedroht und scharf beobachtet, sodaß ihm die Studien ernstlich verleidet wurden. Er schwankte, ob er freiwillig abgehen, sich wegschicken lassen oder heucheln solle und war — wohl hauptsächlich mit Rücksicht auf die kirchliche Treue und die für ihn getroffene Berufswahl der Eltern — über seinen Entschluß noch nicht im Reinen, als die Franzosen in Köln einzogen, der Staatsherrlichkeit des Krummstabes daselbst ein Ende bereiteten und das Gymnasium schlossen.
Engelbert verzichtete nun definitiv auf seine Ausbildung zum Theologen und versuchte abermals sich zum Faßbinder auszubilden, um das väterliche Geschäft zu übernehmen. Aber auch diesmal zeigte sich, daß ihm hierzu die nöthige Körperkraft mangle. Das nährende Gewerbe des Vaters ergriff der jüngere Sohn Heinrich, ein stämmiger Bursche, mit Kraft und Umsicht. Er ist in hohem Alter wohlhabend gestorben. Die Tochter, Agnes Blum, hat ein Zufall, wie wir sehen werden, zur Lehrerin gemacht; sie stand als solche viele Jahre der Elementar-Pfarr-Mädchenschule der Maria-Himmelfahrt-Pfarre vor. Ihr werden wir später noch begegnen. Der halbstudirte, zu dem Gewerbe seines Vaters zu schwächliche Engelbert Blum aber hatte seine liebe Noth, sich sein tägliches Brod zu verdienen. Er suchte nach Beschäftigungen, die seinen Kenntnissen entsprachen, doch ohne Erfolg, und mußte endlich für kargen Lohn eine Schreiberstelle an einem Kölner Lagerhause annehmen, die er nach einiger Zeit mit der Aufseherstelle in einer Stecknadelfabrik vertauschte. Das tagelange Sitzen am Schreibtisch war jedoch seiner schwachen Brust kaum nachtheiliger gewesen, als die verdorbene Luft, die er in seinem neuen Beruf den ganzen Tag athmen mußte. Denn in engem Raume mußte er hier mit einer großen Anzahl arbeitender Kinder aus den niedrigsten Ständen sich aufhalten. Für Ventilation war so wenig gesorgt, wie für Reinlichkeit der armen Kinder. Schulzwang und Verbot der Kinderarbeit in den Fabriken waren noch unbekannte Dinge. Kinder im zartesten Alter wurden von ihren Eltern schon als Erwerbsquelle ausgebeutet.
Als Engelbert nach dem Schiffbruche seiner theologischen Hoffnungen zum zweiten Male den Versuch gemacht hatte, Küfer zu werden, hatte er ein junges Mädchen kennen gelernt, das mit sechszehn Jahren nach Köln gekommen war, bei verschiedenen Herrschaften gedient hatte und in den Jahren 1804 und 1805 bei einer wohlhabenden Faßbinderfamilie Wolff, die mit Blums verwandt war und in deren Nachbarschaft wohnte, in Diensten stand. Dieses Mädchen hieß Maria Katharina Brabender. Sie war über ihren Stand gebildet, etwas romantisch veranlagt, aber voll tüchtigen Selbstgefühls. Die jungen Leute liebten sich, und trotz des heftigsten Sträubens, der Eltern Engelbert’s wie der Familie Wolff — weshalb die letztere sich sträubte, ist etwas räthselhaft — heiratheten sich die jungen Leute am 25. November 1806. Sie wohnten in den ersten Jahren im Hause der Eltern Engelbert’s in der zweiten Etage des sehr schmalen Hauses Fischmarkt Nr. 1490 und erfreuten sich trotz ihrer Armuth des freundlichsten Familienlebens. Der junge Ehemann verdiente freilich nur achtzig Pfennige (einen Franken) den Tag. Die junge Frau aber nähte für die Leute, und da sie geschickt und fleißig, gut und gefällig war, so war sie überall gern gelitten, und es fehlte ihr nie an Arbeit.
Hier im Hause seiner Großeltern, wurde am 10. November 1807 dem jungen Paare der erste Sohn, Robert Blum, geboren. Nichts charakterisirt wohl so sehr die damalige Lage des Vaterlandes, dessen kraftvoller Streiter der Neugeborene später werden sollte, als die Thatsache, daß der Geburtsschein dieses deutschen Kindes in der französischen Stadt Köln französisch ausgestellt wurde. Er lautet (Nr. 1421 vom Jahre 1807): „Acte de naissance de Robert Blum, né le dix novembre entre huit et neuf heures du matin, fils d’Engelbert Blum, tonnelier, et de Catharine Brabender, époux, demeurant rue Fischmarkt No. 1490.“
Das Kind war der Abgott der ganzen Familie. Vergessen war der Groll über die Heirath Engelbert’s. Der Großvater und Taufpathe Robert’s, der damals schon kränkelte, fühlte sich in dem Enkelchen wieder verjüngt und glücklich und wünschte sich nun noch ein langes Leben, das ihm indessen nicht beschieden sein sollte, denn im Jahre 1810 starb er. Der kleine Robert wuchs indeß herrlich heran; ungemein früh lernte er sprechen. In zartester Jugend entwickelte er außergewöhnliche Anlagen. Mit drei Jahren bekam er die Masern, an denen er so heftig erkrankte, daß man ihn bereits verloren gab. Von dieser Krankheit behielt er schlimme Augen und wurde schließlich blind, neun Monate lang: Alles versuchten die Eltern, um ihm das Augenlicht wiederzugeben. Zuletzt riefen sie die Hülfe eines Dr. Bracht an, der ihnen als Augenarzt gerühmt worden war und der den Kleinen mit der größten Sorgfalt behandelte. Immer sprach er den Eltern Muth und Hoffnung ein und bestellte endlich eines Tages die ganze Familie auf den kommenden Morgen zusammen. Der Arzt erschien pünktlich, nahm den kleinen Robert auf den Schooß, spielte mit ihm, erzählte ihm und schwenkte dazwischen, wie spielend ein weißes Tuch hin und her. Zur unaussprechlichen Freude der Seinen griff Robert nach dem Tuche und gab so den ersten Beweis wiedererlangter Sehkraft. Doch blieben seine Augen immer schwach, eine Schwäche, die ihm auf seiner Lebensbahn recht hinderlich ward; um so höher steht jener eiserne Fleiß und Muth, mit welchem später der Mann, ohne Schonung seiner schwachen Augen, in durchwachten Nächten den Lücken seiner Bildung abzuhelfen bemüht war.
Das gute Gedächtniß, welches Robert sehr frühzeitig bekundete, veranlaßte seinen Vater, ihm das Meßdienen, das Knaben in lateinischer Sprache verrichten, zu lehren. Bald konnte Robert, kaum vier Jahre alt, die ganze lateinische Messe auswendig. Sein Vater zeigte ihm nun auch in der Nähe eines Altars, an dem gerade Messe gelesen wurde, was die Knaben dabei zu beobachten hätten. Und als Robert sich auch das eingeprägt, ließ der Vater ihn, unter Beihülfe eines größeren Knaben, am Altar mit dienen, und Robert sagte sein auswendig gelerntes Latein so schön und deutlich her, daß der Geistliche, ein gutmüthiger alter Herr, den Vater bat, ihm doch das liebe Kind täglich zum Meßdienen zu senden; den kleinen Robert aber beschenkte der freundliche alte Herr häufig mit Bildern, Büchern, Bonbons &c. Von dieser Zeit an ging der Kleine täglich in die Messe, bis er später wirklicher Meßdiener wurde.
Aber auch irdischere Künste brachte der Vater seinem Kinde bei: er lehrte ihm Lesen, Schreiben und Rechnen in sehr frühen Jahren. Sicher ist, daß Robert zu der Zeit, als sein Vater im letzten Viertel des Jahres 1814 am Ende seiner Kräfte in seiner aufreibenden Thätigkeit angelangt war und für immer auf’s Krankenlager geworfen wurde, also mit sieben Jahren, bereits in allen diesen Künsten ganz tüchtig Bescheid wußte. Nach neunmonatlicher Krankheit am 24. Juni 1815, starb Engelbert Blum. Er hinterließ eine Wittwe mit drei Kindern, Robert, Johannes und Gretchen, von denen Robert beim Tode des Vaters noch nicht acht Jahre zählte.
Die schlichten Aufzeichnungen, die mir vorliegen, über das Elend der Armuth, das die lange Krankheit und der Tod des Ernährers über die Familie brachte, und das Verhalten dieses jungen Knaben seiner Mutter und seinen Geschwistern gegenüber, als er in so zartem Alter Waise geworden war, gehören zu dem Rührendsten und Ergreifendsten, was man lesen kann, und lassen namentlich die ganze Verlogenheit der socialistischen Declamationen erkennen, wenn diese heutzutage danach trachten, die vergleichsweise beneidenswerthe Ueppigkeit einer heutigen Arbeiterfamilie, bei den jetzigen Löhnen, Lebensbedürfnissen und Lebensgewohnheiten auch der ärmsten Classen, als den Gipfel des Elends und der Würdelosigkeit zu bezeichnen.
Robert erkannte mit seinem klaren Verstande, seiner herzlichen Liebe für Mutter und Geschwister viel schärfer als sonst Kinder in seinen Jahren, wieviel mit dem Vater für die arme Familie verloren war. Aber statt seiner Mutter Schmerz durch die Offenbarung seiner frühreifen Erkenntniß zu vergrößern, suchte er seine Mutter zu trösten durch die treuherzige Versicherung, er sei schon groß und stark und werde deshalb fleißig mit ihr arbeiten; nur solle sie nicht mehr weinen, sonst werde sie auch noch krank. Er that aber mehr. Er ließ die scheinbar prahlerischen Worte zur That werden. Die Mutter gewann mit ihrer Nadel den ganzen Unterhalt der Familie — kümmerlich genug. Damit sie keine Minute versäume, holte Robert die Arbeit von den Kunden und trug das Fertige wieder fort. Er rathschlagte ernstlich mit der Mutter darüber, was jeweilig zuerst beschafft werden müsse, ganz wie ein ordentlicher Finanzminister, und holte das Nöthige herbei. Er unterhielt und ermahnte die jüngeren Geschwister, damit die Mutter ja beim Nähen bleiben konnte. Er blieb auf, wenn die Jüngeren im Bette waren, und strickte für die Geschwister und für sich selbst, weil die Mutter darauf keine Zeit verwenden konnte. Er verrichtete freudig und geschickt aus freien Stücken die meisten Hausarbeiten. Und als sein Bruder Johannes zu kränkeln anfing, pflegte ihn Robert mit rührender Geduld und Ausdauer.
Aber so traurig es der armen Familie ergangen war seit der Erkrankung und dem Tode des Familienhauptes, so sollte doch nun eine noch viel traurigere Zeit über sie kommen. Bisher hatte es wenigstens am Besten nicht gefehlt: an dem Frieden des Hauses. Die Ehegatten hatten sich aus Liebe geheirathet und sich herzlich geliebt, bis der Tod Engelbert’s sie trennte. Das Verhältniß zwischen Eltern und Kindern war das beste gewesen. In der Liebe, dem Gedeihen und dem Gehorsam ihrer Kinder sah auch die arme Wittwe einen unermeßlichen Schatz. Aber dieser Schatz wurde ihr mehr und mehr auch zu großer Sorge, namentlich als Johannes’ Krankheit sich verlängerte und als böses väterliches Erbtheil sich ankündigte. Da glaubte die arme Frau, sie werde doch auf die Dauer ihren Kindern das Brod nicht allein mit ihrer eigenen Kraft verdienen können, und nahm den Antrag an, den der Schiffer Kaspar Georg Schilder ihr machte, seine Frau zu werden.
Schilder hatte einen etwas stürmischen Lebenslauf hinter sich. Er war zuerst Schmuggler gewesen, ein Beruf, der die Betheiligten nicht immer mit den Spitzen der Gesellschaft zusammenführen soll. Dann, vor acht Jahren, war er als Soldat mit Napoleon nach Spanien gezogen und dort bis jetzt verblieben, ohne auch hier unablässig an der Spitze der Civilisation zu marschiren. Nun war er eben aus dem Kriege zurückgekehrt und hatte zwar ein hübsches Stück Geld, aber auch eine kleine Schwäche mitgebracht, welche geeignet war, einer zu großen Ansammlung von Ersparnissen mit der größten Aussicht auf Erfolg energisch entgegenzutreten, nämlich eine liebevolle Anhänglichkeit an alkoholhaltige Flüssigkeiten. Es ist begreiflich, daß diese mit dem Charakter eines alten Troupiers sonst keineswegs unvereinbare Leidenschaft nicht an Liebenswürdigkeit gewann, als der spanische Krieger, der dort gewöhnt gewesen war, die ältesten, feurigsten Klosterweine im Namen des einen und untheilbaren französischen Kaiserreiches à discrétion durch die rächende Gurgel zu gießen, sich, nach seinem geliebten Heimathlande zurückgekehrt, gezwungen sah, für weit saurere oder gemeinere Getränke sein gutes Geld Zug um Zug hinzugeben. Sehr bald konnten sich die besten Freunde Schilder’s der Erkenntniß nicht länger verschließen, daß der einstige Bändiger Hesperiens nicht blos dem Trunke, sondern sogar einem bösen Trunke ergeben sei.
Ob nun die arme Frau, die diesem Manne ihr Jawort gab, seine Schwäche weniger bemerkt hat, ob sie hoffte, ihn in dieser Hinsicht zu bessern, oder sich angezogen fühlte durch die wirklich guten Eigenschaften Schilder’s — denn er war kerngesund, gutmüthig, grundehrlich, treu und fleißig — sicher ist, daß sie vor Allem einen Ernährer ihrer Kinder in ihm zu heirathen meinte. Aber sie sah sich schwer getäuscht. Auch in nüchternen Stunden zeigte sich der neue Gatte argwöhnisch, eifersüchtig, jähzornig und nur zu geneigt, bösen Einflüsterungen ein williges Ohr zu leihen, mit denen seine Mutter und Schwestern ihn reichlich versorgten. Bedauert und aufgehetzt von seiner Familie, trug er dieser das verdiente Geld zu und gab murrend von dem Reste Weniges in den Haushalt seiner Frau. Während diese also schon wenige Monate nach Eingehung der neuen Ehe erkannte, daß sie nur den lieben Frieden ihres Heims geopfert habe, ohne irgend eine Erleichterung in ihrer vielen und schweren Arbeit zu gewinnen, im Gegentheile nach wie vor für ihre Kinder allein sorgen müsse, und ihre Verbindung mit Schilder tief bereute, brachte dieser eines Tages ganz plötzlich und unerwartet, zum größten Schrecken und Staunen seiner Frau, seine Mutter und drei Schwestern dauernd in’s Haus. Das häusliche Elend, welches dadurch für Robert, dessen Geschwister und vor Allem für dessen Mutter geschaffen wurde, war grenzenlos. Die neuen Ankömmlinge waren völlig ungebildete, rohe und zanksüchtige Menschen, die unter einander und mit Schilder’s Frau und Stiefkindern unaufhörlich haderten und stritten. Den Mann gegen die Frau aufzuhetzen, schien ihnen Lebensbedürfniß. Robert stand mit blutendem Herzen in dieser heillosen Wirthschaft. Das Leiden der Mutter erdrückte ihn fast. Inniger als je schloß sich Robert’s Herz an Mutter und Schwester. Stolz und ohne jede Heuchelei von Liebe, die er nicht empfand, trat er den neuen Tanten gegenüber. Mit Stichelreden und rohen Mißhandlungen wurde ihm von der Sippschaft vergolten. Unwirsch und gereizt durch das stete häusliche Gezänk, ward Schilder immer verdrießlicher und liebloser; zuletzt mißhandelte er im Trunke sein treues Weib, zum Lohne für ihre unendliche Anstrengung und Arbeit. Mehrere Monate dauerte dieses unselige Verhältniß — bis endlich Robert’s Mutter mit dem Muthe der Verzweiflung ihrem Manne die Wahl stellte: mit ihr ohne die Seinen, oder mit den Seinen ohne sie und ihre Kinder zu leben. Dieser Energie der Frau beugte sich der im Grunde gutmüthige Mann, indem er sie dauernd von seinen Angehörigen befreite.
Elend blieb auch so genug noch übrig. Johannes starb im ersten Jahre der neuen Ehe an der Schwindsucht, bis an’s Ende von Robert treu gepflegt und nach Kräften erheitert. Der lange Zwist, Verdruß und Kummer hatten tief am Herzen der Mutter genagt. Viermal nach einander hat sie nach Eingehung der neuen Ehe zu früh geboren. Fortdauernde Kränklichkeit und Entkräftung waren die Folgen. Gicht und Lähmung traten schon jetzt bei ihr ein, um sie niemals mehr zu verlassen.
Mit besonderer Liebe wandte sich Robert nach dem Tode seines Bruders dem Schwesterchen zu. Er war der Schutzgeist ihrer Kindheit und Jugend; er unterrichtete sie, spielte mit ihr, darbte sich oft einen guten Bissen ab, um ihr eine Freude zu machen, und hatte er Kleinigkeiten an Geld, so wurden sie zu einem Spielzeug, einer Leckerei &c. für die Kleine. War Gretchen einmal unartig, so brauchte er nur zu sagen: „Lieb’ Gretchen, thue das nicht mehr!“ und das Verbotene wurde keinesfalls wieder gethan. Bei schönem Wetter führte er, so oft er Zeit fand, sein Schwesterchen nach dem fast dreiviertel Stunden entfernten Friedhof, an das Grab ihres Vaters, das durch ein einfaches schwarzes Holzkreuz bezeichnet war, in dem sich hinter Glas ein Todtenzettel des Vaters befand. Hier hielt er Gretchen an zu beten und erzählte ihr jedesmal, wie gut der Vater und wie glücklich sie alle bei seinen Lebzeiten gewesen. Bei einem solchen Besuche auf dem Friedhofe bemerkte Robert Nachbarn, die sich zugleich mit den beiden Kindern von dort entfernten und in einen Wagen stiegen, um nach Hause zu fahren. Er trat an die gutmüthigen Leute heran und sagte, daß Gretchen so müde und außerdem noch nie in einem Wagen gefahren sei. Sie würden ihr wohl ein Plätzchen einräumen und ihr einmal diese Freude machen. Die Leute — eine Faßbinder-Familie Namens Merzenig — meinten, es sei auch für ihn noch ein Plätzchen übrig. Er aber war durchaus nicht zum Einsteigen zu bewegen, sondern eilte, so schnell er konnte, voraus, um das Schwesterchen in Empfang zu nehmen, brachte sie eilig nach Hause und erzählte der Mutter glückselig, wie es ihm gelungen sei, Gretchen in einem Wagen fahren zu lassen.
Ein anderes Mal sahen die Kinder, gleichfalls auf einem ihrer Gänge nach dem Friedhofe, am Wege einen Judenknaben, der ein Murmelthierchen zeigte und dafür Pfennige einsammelte. Um ihn hatte sich eine Schaar Buben zusammengerottet, die den Knaben verhöhnten, schimpften und mit Stöcken nach ihm und selbst nach dem Thierchen schlugen. Robert trat, voller Entrüstung über dieses Gebahren, auf die theilweise viel größeren Knaben zu und redete sie mit seiner lauten Stimme also an: „Schämt Ihr Euch denn gar nicht, den armen Jungen und selbst das unschuldige Viehchen zu mißhandeln? Das Kind ist arm und hat gewiß zu Hause noch kleinere Geschwister, die auf seine Pfennige mit Hunger warten. Braucht Eure Stöcke zu was Anderem und gebt dem Knaben was!“ und damit gab er dem Kinde einen halben Stüber (etwa zwei Pfennig), den ihm die Mutter zum Ankauf einiger Brezeln mitgegeben hatte. Unterdessen hatten sich auch mehrere Erwachsene um den Judenknaben und Robert versammelt und riefen: „Der Knabe hat Recht. Gebt dem armen Kinde was und mißhandelt es nicht!“ und der arme kleine Jude wurde reichlich beschenkt. Ein Herr aber sagte zu Robert: „Das hast Du gut gemacht, mein Junge. Sage Deinen Eltern, sie sollen Dich Pastor werden lassen! Predigen kannst Du schon jetzt.“
Mißhandlungen Seiten seines Stiefvaters hat Robert, obwohl das vielfach behauptet und auch in einigen biographischen Arbeiten über Robert Blum zu lesen ist, nie erfahren. Die Mutter hielt ihre Kinder so streng und folgsam, auch ihr selbst gegenüber, daß der Vater, auch in seinen reizbarsten Augenblicken, nie Veranlassung fand, gegen die Kinder auszufallen.
Die größte Hingebung und Aufopferung für die Seinen bewies Robert aber in den schweren Hungerjahren 1816 und 1817. Schilder verdiente damals täglich vierzig Stüber, anderthalb Mark. Die Familie brauchte aber jeden Tag sieben Pfund Brod, und diese kosteten achtundvierzig Stüber. Also nicht einmal zum täglichen Brode reichte der Verdienst des Vaters. Der tägliche Brodverbrauch der Familie mußte um die Hälfte reducirt werden. Und dieses theure Brod war zudem noch so selten, daß Robert im Winter schon um fünf Uhr Morgens, bei grimmiger Kälte und schlecht bekleidet, an den Bäckerladen gehen mußte, um nach langem Warten und Kämpfen das kloßähnliche, heiße, kaum genießbare Gebäck zu erhalten. Nicht selten wurde es ihm von Stärkeren entrissen. Denn Noth kennt kein Gebot. Bald aber war auch dieses Brod nicht mehr zu erschwingen, und die Familie mußte sich durch ein Gebäck aus Hafer und allen möglichen anderen halb oder ganz ungenießbaren Dingen vor dem Hungertode zu schützen suchen. Es gab Leute genug, die Robert deutlich zu verstehen gaben, er solle sich auf’s Betteln legen. Aber dagegen bäumte sich der ganze Stolz seiner edlen Natur. Er hungerte, aber er bettelte nicht. Als dagegen die Noth zu Weihnachten 1816 auf’s Höchste gestiegen war und das frohe Fest herannahte, freudlos und gramvoll wie die anderen Tage, da leuchtete ein anderer Gedanke in dem Haupte des gesunden Buben auf. Er eilte zu einem alten, wohlhabenden, geizigen Großonkel, einem der sieben Söhne des Johann Blum, mit dem wir die Genealogie des Hauses eröffneten, erschien hier mit rothgefrorenen Backen und blitzenden Augen und begann ungefragt dem biedern Onkel mit der ganzen überzeugenden Kraft, der echten Gottesgabe der Rede, die er in sich trug, die Drangsal und Noth der Seinen ergreifend zu schildern. Der alte Geizhals that, was er seit Langem nicht gethan: er vergoß einige Zähren des Mitleids. Er that aber noch ein Uebriges, was Robert sehr viel werthvoller war: er beschenkte Robert mit einem Sack Erbsen und Kartoffeln, einem Stück geräucherten Fleisches und sechs Stübern. Außer sich vor Freude, keuchend unter der schweren Bürde, flog der Knabe athemlos die Straßen entlang, seiner Wohnung zu. Da stolperte er, stürzte hin, Erbsen und Kartoffeln rollten über das Pflaster; doch Robert las sie bis auf die letzte zusammen und trat mit den völlig unerwarteten reichen Gaben unter die Seinen, mit Jubel und hoher Festfreude aller Herzen erfüllend.
Keinen Stachel und keinen Schatten von Verbitterung hat diese überaus trübe Kindheit, welcher ebenso peinvolle Lehrjahre folgten, in Robert’s Herzen zurückgelassen. Er hat daraus nur eine eiserne Charakterstärke und Willenskraft gewonnen, eine Aufopferungsfähigkeit, die keine Grenzen kannte, wenn das Gebot der Liebe sie ihm zur Pflicht machte.
2. Schule und Kirche.
Vieles von dem, was erzählt wurde und noch zu berichten sein wird, ist nur dann für möglich zu halten, wenn man versucht, in die damaligen öffentlichen und wirthschaftlichen Zustände sich einzuleben. Hier können selbstverständlich nur Andeutungen gegeben werden.
Jenes großartige Gesetz, welches die gesammte preußische Monarchie, einschließlich der neuerworbenen Rheinprovinz in ein einziges Zollgebiet verwandelte, die zahlreichen Binnenzölle aufhob, welche bis dahin innerhalb der einzelnen Landestheile bestanden, und damit die Grundlage zum künftigen deutschen Zollverein legte, ist erst 1818 erlassen worden. Seine Segnungen kamen mithin den Armen Köln’s in den Hungerjahren 1816 und 1817 noch nicht zu Gute. Während der Hungerjahre stand der Preis eines Scheffels Weizen am Rhein um sechs Mark fünfundneunzig Pfennig, also beinahe sieben Mark höher als gleichzeitig in Posen[3], so kolossal waren damals die Verkehrshindernisse. In den fünfziger Jahren war der höchste Preisunterschied innerhalb Preußens eine Mark sieben Pfennig. Kein Wunder, wenn man bedenkt, daß Preußen, der Staat, der in den Befreiungskriegen gegen Napoleon das Größte gethan für ganz Europa, um sechshundert Geviertmeilen kleiner aus dem siegreichen Kampfe hervorging, als er vordem gewesen, und obendrein in der denkbar ungünstigsten Gestaltung seines Gebietes, zerrissen in zwei weit entlegene Massen. Der Bevölkerungszuwachs von 5½ Millionen, den die Monarchie 1815 gewann, vertheilte sich auf ein Gewirr von Ländertrümmern, vor Kurzem zu mehr als hundert deutschen Kleinstaaten gehörig, zerstreut von der Prosna bis zur Maas. In den altpreußischen Landestheilen allein galten nach dem Frieden siebenundsechszig verschiedene Zolltarife, nahezu 3000 Waarenklassen umfassend. Dazu kamen die besonderen Zollsysteme der neuerworbenen Sächsischen und Schwedischen (Neuvorpommern) Landestheile, die Zollanarchie am Rhein, wo man die verhaßten Douanen und droits réunis der Franzosen einfach gestürzt hatte, ohne einstweilen Neues an ihre Stelle zu setzen. Wer billig denkt, und namentlich Sinn besitzt für jenes Zartgefühl, mit welchem die Preußische Staatskunst von jeher das historisch Gewordene und Gegebene pietätvoll würdigte, wird begreiflich finden, daß nicht vor dem Jahre 1818 die Schöpfung eines einheitlichen Zollgebietes in Preußen verwirklicht werden konnte.
Die neue preußische Rheinprovinz besonders litt außerdem hart unter der schlechten Verkehrsverbindung mit den östlichen Provinzen der Monarchie und vor Allem unter der Concurrenz mit England. Denn mit Aufhebung der von Napoleon drakonisch gegen England durchgeführten Continentalsperre wurden die seit Jahren aufgespeicherten englischen Waaren massenhaft auf den Continent geworfen. In dem einzigen Jahre 1818 hat England für 129 Millionen Gulden Waaren nach Deutschland ausgeführt. England bedurfte damals kolossaler Baarmittel, weil es in den Jahren 1816–19 die Englische Bank zur Wiederaufnahme der Baarzahlungen durch Parlamentsbeschlüsse nöthigte und das Gold demgemäß wieder zum allgemeinen Tauschmittel machte. Dieser Bedarf wurde durch vermehrte Waarenausfuhr gedeckt. Der einzige Vortheil der deutschen Industrie gegenüber der englischen, der billige Arbeitslohn, ging während der späteren Hungerjahre 1816 und 17 vollständig verloren. Am schwersten litt das Rheinland unter allen preußischen Provinzen; denn kaum waren hier unter dem napoleonischen Mercantilsystem Fabriken aufgeblüht, so verloren sie nun mit der veränderten Gebietsabgrenzung des Friedens plötzlich ihre Absatzquellen nach Frankreich, Holland, Italien, den Niederlanden; sie waren durch die Provinzialzölle der altpreußischen Landestheile vom Osten Deutschlands abgeschlossen und schutzlos der übermächtigen Concurrenz Englands preisgegeben. Die schwere Krisis, die wir jetzt durchleben, erscheint als eine Kleinigkeit gegenüber diesem wirthschaftlichen Elend.
Unter allen Städten des Rheins war nun aber wieder Köln vielleicht am härtesten durch die Franzosenzeit und die veränderte Staatsangehörigkeit heimgesucht worden. Schon mit dem Eindringen der als Retter aus aller Noth begrüßten Jacobiner war das städtische Eigenthum Nationalgut geworden, der beste und wohlhabendste Theil der Bürger geflohen, die Aufhebung der Klöster und mancher milden Stiftung beschlossen. Nach Beendigung der Fremdherrschaft konnten nur noch wenige alte Convente und klösterliche Institute Zeugniß ablegen von der Art, wie im alten Köln die Noth gelindert, die Krankenpflege betrieben worden war. Auch wurde Köln unter der neuen Regierung wichtiger Institute und Behörden beraubt, die ihm wohl gebührt hätten. Die Universität ward nach Bonn, das Oberpräsidium nach Coblenz, die Malerakademie nach Düsseldorf, das Polytechnikum nach Aachen verlegt. Erst später verstand die betriebsame Stadt, sich trotz der Ungunst der Verhältnisse zum Mittelpunkt des rheinischen Großhandels zu machen.
Damit dürfte zur Genüge erklärt sein, wie das Elend der Hungerjahre sich zwei Jahre lang in der großen Stadt behaupten, wie Robert Blum auf seinem ferneren Lebenswege so gut wie gar keine unterstützende Aufmerksamkeit von Seiten der Vaterstadt finden konnte.
Wir sahen, daß der junge Robert schon mit dem siebenten Jahr lesen, schreiben und rechnen konnte. Er hatte sich bis zum zehnten Jahr in diesen und allen sonstigen Künsten, die in seiner Pfarrschule gelehrt wurden, so weit vervollkommnet, daß er anfing, manchem Lehrer als unbequemer „Ueberflieger“ zu gelten, das heißt als ein Bursche, dem Alles zu leicht wird, dem nichts mehr gelehrt werden kann.
In diesem Stadium seiner Bildung bethätigte seine Tante Agnes Blum (wie wir sahen, die einzige Tochter seines Großvaters Robert) die volle Staatskunst der Frauen, indem sie nach dem alten machiavellistischen Grundsatz den gefährlich-oppositionellen Denker in das Ministerium ihres Lehramtes berief und ihm zunächst das Portefeuille der Mathematik verlieh — mit zehn Jahren!
Das ging so zu. Die gute Tante Agnes hatte sich niemals träumen lassen, Lehrerin zu werden. Sie war vielmehr Jahre lang blos Pflegerin einer alten Dame gewesen, welche in dem Gebäude der Elementarschule der St. Maria-Himmelfahrts- oder Jesuiten-Pfarre wohnte. Als diese Dame das Zeitliche gesegnet hatte, wurde Agnes die Universalerbin der Verstorbenen und als solche sehr wohlhabend. Sie übernahm nun gleiche Samariterdienste bei der Lehrerin der genannten Schule, wohnte ihrem Unterrichte vielfach bei, vertrat sie in der Schule, als die Lehrerin kränker und kränker wurde, und erhielt — wahrscheinlich zu ihrem eigenen nicht geringen Schrecken — die Lehrerinstelle der hochehrwürdigen Jesuiten-Pfarr-Elementarschule angetragen, als die Lehrerin die Augen für immer geschlossen hatte. Freilich tobte damals noch nicht der Culturkampf. Auch der Schulzwang und die Schulordnung hatten die Pforten der Hölle noch nicht überschritten. Jeder konnte nach seiner Façon Lesen, Schreiben und Rechnen lehren. Jeder, der zahlen konnte, schickte seine Kinder wohin ihm beliebte. Wer nicht zahlen konnte, schickte sie — in die Stecknadelfabrik zum Verdienen. So war’s unter dem menschenfreundlichen Krummstab gewesen. So war’s auch noch Anno 1817. Das Geld, welches für die Schulstunden zu entrichten war, gehörte der „Lehrperson“. Dieser letztere Gesichtspunkt scheint für Tante Agnes entscheidend gewesen zu sein, als sie sich entschloß, ohne jegliche ausreichende Vorbildung zum Amte einer Elementarlehrerin, dem an sie ergangenen Rufe Folge zu leisten. Immerhin blieb ja doch der große Trost, daß in der Hauptsache, in der Religion, die armen Kinder von der Pfarrgeistlichkeit direct unterrichtet wurden. Nur in einem Punkte konnte sich ihr zartes Gewissen mit dem übernommenen Amte nicht abfinden: im Einmaleins, in den vier Species, vollends im Bruchrechnen, der Regeldetrie &c. Diesen Geheimnissen gegenüber war sie völlig rathlos. Um so besser, daß der kleine Neffe Robert so ausgezeichnet darin bewandert war. Er wurde also als Rechenlehrer bei Tante Agnes angestellt.
Die Einkünfte, die er für diese Thätigkeit genoß, waren verhältnißmäßig bedeutend. Denn Tante Blum überzeugte ihre Schülerinnen natürlich mit Leichtigkeit, daß die wunderbare Kunst des Rechnens nicht für den gewöhnlichen Unterrichtspreis mit verabreicht werden könne, daß vielmehr zur Aneignung dieser ungewöhnlichen Kenntnisse Privatstunden nothwendig seien. Selbstverständlich konnten auch nur die reiferen Schülerinnen an dieser Sahne des Unterrichts der Pfarrschule naschen. Der Preis von einem Stüber (vier bis fünf Pfennig) für zwei Rechenstunden in der Woche erschien als eine Kleinigkeit gegenüber der Errungenschaft dieses Wissens, welches — die Lehrerin selbst nicht besaß. Für Robert aber, der an vier Tagen der Woche Nachmittags von vier bis fünf Uhr zwei Classen der Tante unterrichtete, waren diese Kupfermünzen gerade ausreichend, um seiner guten Mutter die Ausgabe für einen Communionanzug zu ersparen. Denn Tante Agnes sammelte ihm die Einnahmen seines Rechenunterrichtes auf das Genaueste. Sie gab ihm aber außerdem durch eine bei ihrer Genauigkeit wahrhaft splendide Naturalleistung schamhaft zu verstehen, aus welcher Verlegenheit er sie durch seinen Rechenunterricht erlöste: sie verabreichte ihm nämlich, wenn er um vier Uhr aus seiner Schule zum Unterricht in die ihrige kam, eine ganze Tasse Kaffee und ein Brödchen. Die Tasse Kaffee mußte er nun schon als unübertragbare persönliche Rechtswohlthat für sich selbst hinnehmen. Aber das Brödchen allein zu genießen, ging über seine brüderlichen Begriffe. Sein Schwesterchen besuchte ja dieselbe Schule als Schülerin, in der er lehrte. So oft es ging, suchte er ihr das kleine Gebäck zuzustecken. War sie im Garten, auf dem Spielplatz, im Schulzimmer, so scheute er keinen Vorwurf, um seinem Liebling den hohen Genuß frischen Weißbrods zuzuwenden.
Der schmutzige Geiz dieser Tante und die Kränkungen, die sie Robert und seinem Schwesterchen durch Zurücksetzung der Kinder hinter die reichere Verwandtschaft zufügte, haben in Robert’s Herz früh die schmerzlichsten Eindrücke hinterlassen. Höchst charakteristisch für ihn ist ein in diese Zeit fallender kleiner Vorfall, der in der Familie noch heute als die „Geschichte von den Hobelspänen“ streng wahrheitsgetreu erzählt wird. Schwester Gretchen hatte mit etwa sechs Jahren — man staune nicht über die fanatische Menschenquälerei, welche die fromme Geistlichkeit zu Wege brachte! — aus Christoph Schmidt’s biblischer Geschichte ein unendlich langes, in kleinen lateinischen Lettern gedrucktes Stück „Jesu letzte leidensvolle Nacht“ auswendig lernen müssen, und was noch wunderbarer ist — das „Stück“ auch fehlerlos ihrem armen Gedächtniß eingeprägt und am Sonntag in der Kirche heruntergesagt. Diese Quälerei zur größeren Ehre Gottes war speciell in dem jungfräulichen Haupte der Schultante Agnes Blum ausgeheckt worden und sie war keineswegs gewillt, blos in der Kirche mit ihrer Wundernichte Staat zu machen. Sie gab unmittelbar danach auch eine Kaffeevisite, zu welcher selbstverständlich der Herr Pfarrer, ihr Bruder Heinrich Blum, der kräftige Böttcher mit Frau, und einem Gretchen Blum beinahe gleichalterigen Töchterchen u. A. eingeladen waren. Als das Gespräch zufällig auf die Wundernichte gelenkt war, wurde diese aus ihrer Schule heruntergeholt und mußte Jesu leidensvollste Nacht noch einmal ohne Murren zum Kaffee hersagen — den Andere tranken. Den Blick hoffnungsvoll auf den Teller mit „Hobelspänen“ — einem geringelten Butterteiggebäck — gerichtet, sagte das Kind „sein Sprüchel und forcht sich nit“ und so ging denn auch diese „leidensvollste Nacht“ rasch und anstandslos vorüber. „Ach wie schön!“ „Das ist viel für ein so kleines Kind!“ „Brav Gretchen, das hast Du gut gemacht!“ rief es in der Runde. Das Auge des geplagten Kindes haftete gespannter als je auf den Hobelspänen. Da greift denn auch einer der Herren nach dem Teller mit dem Gebäck — und schüttet fast dessen ganzen Inhalt der Cousine des kleinen Gretchen zu. Die brave Tante Agnes aber sagt zu dem Staatskind: „Gretchen, Du kannst nun wieder in die Schule gehen.“ Sie mußte die Aufforderung mehrmals, dringlicher wiederholen.
Darüber waren mehrere Jahre vergangen. Die Mutter nähte nach wie vor für die Leute und sandte eines Tages ihre kleine Tochter ein fertiges Kleid auszutragen und sechzehn Stüber Arbeitslohn dafür zu verlangen. (Dreizehn Stüber machten fünfzig Pfennig). Das Kind verlangte und erhielt siebzehn Stüber, und lief spornstreichs zum Hofconditor Maus — ich vermuthe beinahe, daß er zeitlebens wenig für den Hof conditort hat — und verlangte hier in der höchsten Aufregung für einen Stüber Hobelspäne. Der „Herr“ am Ladentisch fragte ängstlich, ob das Kind die Hobelspäne essen wolle — sie sah offenbar so aus, als ob sie damit zu jedem anderen Verbrechen fähig gewesen wäre — und als das Kind diese Absicht entschieden bejahte und als glaubhaften Beweggrund hinzufügte, daß sie ein andermal habe zusehen müssen, ohne welche zu kriegen, machte er ihr für den einen Stüber eine ganze Düte voll.
Aber das Verhängniß schreitet schnell. Die Empfängerin des Kleides beschwert sich bei Robert’s Mutter, daß sie soviel habe bezahlen müssen, und die Mutter stellt die Tochter zur Rede. Sprachlos vor Angst blickt Gretchen die Mutter an und vermag kein Wort herauszubringen. Robert ist zugegen und sagt: „Aber liebe Mutter, wie soll Gretchen nach so langer Zeit noch wissen, was Du ihr damals bestellt und was sie erhalten hat?“ Die Mutter stand von weiterem Forschen ab. Sowie aber Robert ausgehen mußte, sagte er: „Ich möchte Gretchen gerne mitnehmen.“ Er schlug einen ungewöhnlichen Weg mit ihr ein. In einer stillen Straße bleibt er stehen, sieht sie eindringlich an und fragt: „Gretchen, warum hast Du der Frau einen Stüber mehr abverlangt, als die Mutter gesagt?“ Sie erzählte ihm nun die ganze Geschichte. Da ballte er die Hände und knirschte mit den Zähnen. Die Schwester bat ihn, es der Mutter zu sagen, damit sie ihre Strafe bekomme. „Sei ruhig,“ erwiderte er stirnrunzelnd, „ich werde es der Mutter nicht sagen. Aber warum hast Du mir damals nichts gesagt, als man Dich zusehen ließ?“ „Dann hättest Du geweint,“ sagte Gretchen schluchzend. „Jetzt bin ich groß und weine nicht mehr,“ entgegnete Robert. „Du aber sollst mir versprechen und es nie vergessen, daß Du Dich stets an mich wenden willst, wenn Dir etwas fehlt, wenn Du Dir etwas wünschest, wenn Dir bange ist.“ Er hat redlich Wort gehalten.
Jener Fall mit den Hobelspänen war natürlich nicht der einzige, bei welchem die Tante die armen Kinder zurücksetzte. Als Robert eines Tages trübselig zu Hause saß, äußerte er seiner Mutter den Wunsch, ein wenig zur Tante zu gehen. Er ging, kam aber bald zurück mit der Nachricht, daß er nicht vorgelassen worden sei, weil die Tante Besuch habe. Neugierig, den Besuch zu sehen, hatte er durch das Glasfenster der Besuchsstube geschaut und den Onkel Heinrich nebst Frau bei der Tante sitzen sehen. Tief gekränkt, faßte er seinen Schmerz in die für einen so jungen Knaben höchst überraschende Wendung zusammen: „Die Schwester meines Vaters konnte mich nicht empfangen, weil sie den Bruder meines Vaters zum Besuch da hatte.“
So war das elfte Jahr seines Lebens herangekommen, in welchem Robert zum ersten Male das heilige Abendmahl empfing. Wohl der Einzige unter den gleichalterigen Genossen, hatte Robert die Festkleidung, die er am Altar des Herrn trug, sich selbst redlich verdient. Aber auch der kindlich tiefe Glaube an das Wunder des Gnadenmahls des Heilandes mochte vielleicht keinem seiner Gefährten so rein und kräftig innewohnen, wie ihm. Diesen schon seit seinem vierten Jahr durch täglichen Messebesuch und Messedienst bethätigten Glauben bezeugte Robert nun auf’s Neue, indem er seine Eltern nach der Communion bat, ihm zu gestatten, daß er in der St. Martinskirche (seiner Pfarrkirche) in die Reihe der Meßdiener eintreten dürfe. Da mit diesem Amte kleine Einnahmen verbunden waren, die Robert seiner Mutter zuzuwenden hoffte, und außerdem das Recht, die Pfarrschule der Kirche zu besuchen, so gaben die Eltern mit Freuden ihre Zustimmung.
Robert wurde also Meßdiener. Da dieser Dienst die Knaben nur in frühen Morgenstunden und an Sonn- und Feiertagen beschäftigte, so hinderte er nicht am Schulbesuch. Aber aus diesem Dienst, der Alles in sich zu vereinigen schien, was Robert glücklich machte, erwuchsen dem Knaben zum ersten Male in seinem jungen Leben seelische Leiden, die ihn mit tiefem Schmerz erfüllten und in ihrem Verlaufe den festen, treuen Kinderglauben Robert’s zerstörend ergriffen und vernichteten. Den ersten Anlaß hierzu bot folgender Vorgang. Die jungen Meßdiener verweilten in der Kirche schon ehe sie den Gläubigen geöffnet wurde und noch nachdem sie von den Kirchenbesuchern verlassen war. Die Jungen — mindestens aber Robert — beobachteten genau das Benehmen der Geistlichkeit in diesen Momenten, wenn diese unter sich zu sein glaubte. Klagend und weinend berichtete Robert der Mutter: „Er habe die traurige Bemerkung gemacht, daß die stets mit dem Heiligen beschäftigten Leute nicht frömmer als die Anderen seien, ja noch viel weniger fromm. Es falle Keinem derselben ein, vor dem Hochaltar das





























